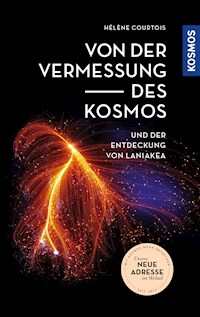
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Als die Astrophysikerin Hélène Courtois mit ihrem Team begann, eine Karte des gesamten Universums zu erstellen, ahnte sie nicht, dass sie die neue Adresse unserer Erde finden würde: in einem gigantischen Haufen aus Millionen kleinen und 100.000 großen Galaxien. Die Forscher*innen nannten diesen Super-Galaxienhaufen Laniakea, das ist hawaiianisch für "unermesslicher Himmel". Hélène Courtois berichtet mitreißend über ihren langen Weg zur Entdeckung von Laniakea und vermittelt dabei komplexe Zusammenhänge auf leicht verständliche Weise. Eine spannende Reise von den ersten Schritten zur Vermessung des Weltalls bis hin zu neuesten spektakulären Entdeckungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Inhalt
Vorwort
Prolog
Unsere neue kosmische Adresse
Sie befinden sich hier
Was macht ein Kosmograf?
Die tagtägliche Grundlagenforschung
Der Himmel als Relief: die dritte Dimension
Erste Entfernungsmessungen
Die große Debatte
Die Leuchtkraft, der Schlüssel zur Entfernungsmessung
Meine ersten Schritte ins Unbekannte
Ich spinne meinen Kokon
Die Jagd auf den Großen Attraktor
Das Universum in Bewegung
Alles orten, was sich bewegt
Der Weltraum dehnt sich aus
Die Pekuliargeschwindigkeit einer Galaxie bestimmen
Die Bewegung unserer Milchstraße im Universum
Die sieben Samurai
Die Gravitation betritt die Bühne
Eintauchen in das südliche Universum
Rückkehr auf die Erde
In der Sackgasse
Mit neuen Augen betrachtet
Alles beschleunigt sich!
Die Eroberung des Westens
Spiralgalaxien in Bewegung
Schönheitswettbewerb: Miss Spirale
Die Vorteile unseres Berufs
Etwas Neues auch im Osten
Sich seiner Fehler bewusst sein
Unsere ersten „modernen“ Karten
Kosmische Ströme
Das große Weltall-Puzzle
Alles wird größer!
Unter der Zauberhand des Wiener-Filters
Sprechen wir ein wenig über Technik
Daniels Welten
Der Countdown läuft
Die Einzugsgebiete
Sehr kleine Bewegungen
A supercluster is born
Jenseits von Laniakea
Virtuelle Universen
Berliner Ballade
Ich möchte noch mehr!
Auf dem Weg zu einem homogenen Universum?
Eine Geschichte ohne Ende
Epilog
Anhang
Videos und Links zum Buch
Weitere Videos und Links
Bücher
Forschungsartikel
Extragalaktische Datenbanken
Danksagung
Impressum
VORWORT
Was macht ein Kosmograf? Er oder sie ist ein Geograf des Universums. So definiert sich Hélène Courtois – darüber hinaus mit einer zeitlichen Dimension. Denn in der Astronomie bedeutet weit reisen, die Zeit zurückdrehen. Schnallen Sie sich an, wir erforschen in diesem Buch unsere unmittelbare Umgebung, die eine Milliarde Lichtjahre weit in den Kosmos hinausreicht!
Hunderttausende Galaxien, die uns im Universum umgeben, sind nicht gleichmäßig verteilt. Im Gegenteil, sie ballen sich zu dichten Haufen zusammen, getrennt durch große, leere Zwischenräume und miteinander verbunden durch kosmische Filamente aus Galaxien, die eine Art Spinnennetz erzeugen. Auf Bildern können wir dieses Galaxiennetz als zweidimensionale Projektion an den Himmel erkennen. Aber wie erfahren wir etwas über die Entfernung – die dritte Dimension, die Tiefe?
In dieser packenden Forschungsstory von Hélène Courtois kommt keine Langeweile auf. Wir begleiten die Autorin auf ihren Reisen durch die ganze Welt, um an verschiedenen Teleskopen zu arbeiten. Zunächst sind es optische Teleskope, später Radioteleskope. Die zahlreichen Beobachtungskampagnen erfordern Teamarbeit und den Zusammenschluss mehrerer Astronomen weltweit. Die Gruppe um Hélène Courtois „surft auf den kosmischen Strömen“ und beobachtet unter Ausnutzung aller verfügbaren Zeitzonen Nacht und Tag. Mit entsprechend wenig Schlaf konnte sie im Jahr 2009 auf diese Weise 480 Beobachtungsnächte durchführen!
Ein entscheidender Schritt bei ihrer Arbeit ist im Anschluss die Rekonstruktion der dreidimensionalen Geografie unseres lokalen Universums. Man benötigt intelligente Software, um die verschiedenen Störeinflüsse bei der Beobachtung zu minimieren sowie das Fehlen von Daten in bestimmten Regionen auszugleichen. Unbekannte Geschwindigkeiten lassen sich rekonstruieren wie fehlende Teile bei einem antiken Fresko. Die gesuchten Daten werden mit Algorithmen geschätzt, die auf Modellen und Simulationen der geheimnisvollen Dunklen Materie basieren. Dabei nutzt man die Methode der größten Wahrscheinlichkeiten und arbeitet mit sogenannten Wiener-Filtern, die zur Rauschunterdrückung entwickelt wurden.
Das Ergebnis dieser immensen Arbeit ist die Entschlüsselung der Geografie – oder eben der Kosmografie – unseres lokalen Universums mit seinen Materieeinzugsgebieten und damit auch die Entdeckung unseres Supergalaxienhaufens Laniakea. Erstaunlicherweise befinden wir uns am Rand dieser großräumigen Struktur, ganz nah an einer „großen Leere“, dem sogenannten Local Void. Hat man nun schließlich den von vielen Forschern gejagten „Großen Attraktor“ gefunden? Wir lassen die Spannung bestehen, damit es der Leser oder die Leserin selbst herausfinden kann.
Um diese 20-jährige Forschungsarbeit ranken sich zahlreiche Anekdoten. Exkurse über das tägliche Leben der Astronomen und Forscher lassen die Erzählung sehr lebendig und menschlich werden. Forschung ist kein langer, ruhiger Fluss! Es gibt Misserfolge, aus denen man viel lernen kann, wenn man nicht aufgibt. Bei kosmologischen Beobachtungen sind heutzutage zunehmend riesige Forschungsgruppen beteiligt, und die Karriere von Hélène Courtois ist ein perfektes Beispiel für diese Entwicklung. Bestanden ihre Arbeitsgruppen anfangs aus weniger als zehn Personen, gehört sie inzwischen großen Kollaborationen an bis hin zu einem Konsortium, das die Mission des Weltraumteleskops Euclid vorbereitet und das aus über 1000 Personen besteht! Dieses Buch ist eine Hommage an die Arbeit im Team und die Zusammenarbeit in internationalen Kollaborationen, in denen Kompetenzen gemeinschaftlich eingesetzt werden, um sich zu ergänzen.
In gesonderten Kästen werden einige Begriffe und Konzepte erläutert. So verliert man nicht den Faden der Geschichte, es bleiben aber auch keine unklaren Punkte zurück. Die Einschübe können durchaus unabhängig gelesen werden. Hélène Courtois offenbart ihr ganzes pädagogisches Talent bei der detaillierten Beschreibung der verschiedenen Entfernungsindikatoren, der Ausdehnung des Universums, der Vorstellung der Dunklen Materie und der Dunklen Energie, der kosmischen Hintergrundstrahlung und ihrer Anisotropien oder bei einer kurzen Geschichte der Welt …
Françoise Combes
Astrophysikerin
Französische Akademie der Wissenschaften
PROLOG
Unsere Galaxie – die Milchstraße – und ihre Nachbarinnen rasen mit einer gigantischen Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde durch das Universum. Diese Beobachtung war seit Beginn der 1960er-Jahre bekannt, ohne dass es den Astrophysikern gelungen wäre, den Grund dafür vollständig zu erklären. In den 1990er-Jahren schlug eine amerikanische Forschungsgruppe vor, dass diese Bewegungen durch eine enorme Masse hervorgerufen werden könnten – den „Großen Attraktor“ –, der sich unglücklicherweise in einer schwer zu beobachtenden Region befindet.
Nun fügt es sich, dass zu den großen Spezialitäten der französischen Stadt Lyon, in der ich arbeite, neben der Gastronomie auch die Astronomie gehört. Unsere Suche nach dem Großen Attraktor führte meine Gruppe und mich zur Entdeckung des „Superhaufens“ von Galaxien, in dem wir leben und den wir „Laniakea“ genannt haben.
In diesem Buch möchte ich Sie an der Geschichte dieser bedeutenden Entdeckung teilhaben lassen. Dazu versuche ich, ein möglichst einfaches und klares Bild des Universums und seiner physikalischen Gesetze zu zeichnen. Absichtlich vermeide ich mathematische Formeln (außer Zehnerpotenzen), auch auf die Gefahr hin, dass die Erläuterungen damit etwas an Genauigkeit einbüßen. Wichtig ist mir aber vor allem, den gesamten wissenschaftlichen Prozess zu beschreiben, an dem wir Forscher täglich arbeiten.
Im Laufe meines Berichts erläutere ich die Analyse- und Visualisierungsmethoden, mit denen wir Karten erstellen, auf denen sich nach und nach die großräumigen Strukturen des Universums wie Filamente, Superhaufen und Leerräume abzeichnen. Nach einiger Zeit werden Sie sich an Ihre neue extragalaktische – das heißt, außerhalb unserer eigenen Milchstraße gelegene – Umgebung gewöhnt haben, die wir Kosmologen als „lokal“ bezeichnen, die sich aber in alle Richtungen mehr als eine Milliarde Lichtjahre um uns herum erstreckt. Ich beschreibe in diesem Buch auch unsere aktuellsten Funde seit der Entdeckung von Laniakea: das kosmische Geschwindigkeitsnetz sowie die beiden Materieabstoßungszentren „Dipole Repeller“ und „Kalter Fleck“. Abschließen werde ich mit einem Überblick über die Auswirkungen dieser Entdeckungen auf unser aktuelles Wissen. Tatsächlich ermöglicht es unsere Forschung, verschiedene Entstehungsprozesse von Galaxien besser zu verstehen, und legt den Grundstein für weitergehende Untersuchungen mit zukünftigen Multi-Antennen-Teleskopen auf der Erde oder im Weltraum.
Mein Bericht erweist mehreren Forschern Ehre – Männern und Frauen verschiedener Nationalitäten –, die in der einen oder anderen Weise an unseren Entdeckungen beteiligt waren. Ich porträtiere auch einige außergewöhnliche Astrophysikerinnen – namentlich Henrietta Leavitt, Sandra Faber, Wendy Freedman, Vera Rubin und Renée Kraan-Korteweg –, um einmal ein anderes Bild der Astronomie zu zeichnen. Ich hätte noch viele andere nennen können. Wir werden sehen, dass Entdeckungen nicht mit der Herkunft oder dem Geschlecht verbunden sind, sondern mit der individuellen Zielstrebigkeit und der Arbeit im Team.
Aber nun genug der Vorrede: Machen Sie es sich in Ihrem Sessel bequem und begeben Sie sich mit mir auf eine Reise durch Raum und Zeit. Begleiten Sie mich auf meine Beobachtungskampagnen – anfangs als junge Studentin in den australischen Busch, später hoch über hawaiianische Palmen sowie in eine immense Zone der Funkstille im Osten der USA.
KAPITEL 1
UNSERE NEUE KOSMISCHE ADRESSE
Beginnen möchte ich meine Erzählung mit der Schilderung des wissenschaftlichen Fortschritts, der es den Kosmologen ermöglicht hat, Galaxien im Raum zu verorten und die ersten dreidimensionalen Karten des lokalen Universums zu erstellen.
SIE BEFINDEN SICH HIER
Seit dem 4. September 2014 haben wir offiziell eine neue kosmische Adresse! An diesem Tag ist in der renommierten englischen Wissenschaftszeitschrift Nature unser Artikel erschienen, mit dem wir die Entdeckung von Laniakea bekannt gegeben haben. Der Superhaufen Laniakea ist die größte bisher bekannte Galaxienstruktur, der wir angehören. Sein Name stammt aus dem Hawaiianischen und bedeutet „unermesslicher Himmelshorizont“. Tatsächlich sind seine Ausmaße gigantisch und kaum zu erfassen: Er hat einen Durchmesser von rund 500 Millionen Lichtjahren – das bedeutet, dass das Licht zum Durchqueren von einem Ende zum anderen 500 Millionen Jahre benötigt. Der Superhaufen enthält ungefähr hunderttausend große Galaxien wie unsere Milchstraße, zudem noch eine Million kleinere. Das sind insgesamt etwa hundert Millionen Milliarden Sonnen.
Zur Entdeckung von Laniakea habe ich aktiv beigetragen, und diese Geschichte möchte ich Ihnen nun erzählen.
Kleines Lexikon der Kosmologie
Für Kosmologen sind die grundlegenden Himmelsobjekte Galaxien. Eine Galaxie (das Wort stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „milchiger Kreis“) enthält Sterne, Gas, Staub und unsichtbare Materie, die man als „Dunkle Materie“ bezeichnet. Zusammengehalten wird dies alles durch die Gravitation. Galaxien werden nach ihrer Form und Größe klassifiziert, so unterscheidet man spiralförmige, elliptische, linsenförmige und irreguläre Galaxien sowie Zwerg- und Riesengalaxien. Unsere eigene Galaxie, die auch Milchstraße oder Galaxis genannt wird, ist verhältnismäßig groß: Sie enthält einige hundert Milliarden Sterne. Es handelt sich um eine Spiralgalaxie, sie hat die Form einer flachen Scheibe mit einer zentralen Verdickung. Die Sonne befindet sich in den Außenbezirken eines ihrer Spiralarme, dem sogenannten Orion-Arm.
Eine Galaxie wird von Sternen bevölkert. Ein Stern ist eine „einfache“ Gaskugel, die aufgrund von Kernfusionsreaktionen in ihrem Inneren extrem heiß ist. Die Temperatur eines Sterns hängt von seiner Masse ab: Die massereichsten Sterne sind am heißesten und leben am kürzesten. Unsere Sonne ist ein Stern mittlerer Größe. Viele Sterne werden von Planeten umkreist – kleinen Himmelskörpern, die nicht heiß genug sind, um eigenes Licht auszusenden, da sie nicht genügend Masse haben. Acht Planeten umrunden die Sonne, darunter auch die Erde. Um einige Planeten drehen sich noch kleinere Begleiter wie der Mond, der einzige natürliche Satellit der Erde.
Abb. 1.1: Einige Galaxientypen (Katalogbezeichnung der Galaxie in Klammern).© oben links und oben rechts: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA), unten: ESO
Unter dem Einfluss der Gravitation schließen sich die Galaxien im Universum zu Gruppen zusammen. Wir befinden uns in der „Lokalen Gruppe“, zu der nur drei große Galaxien gehören, darunter die Milchstraße. Die Gruppe enthält außerdem über 50 Zwerggalaxien. Manchmal können sich auch deutlich mehr Galaxien zusammenfinden, sie bilden dann sogenannte Haufen. Unsere Lokale Gruppe wird vom Virgo-Haufen angezogen, der mehr als tausend Galaxien umfasst. Die Haufen sind entlang einer netzartigen Struktur von Filamenten angeordnet, die wiederum Superhaufen wie Laniakea bilden.
Abb. 1.2: Vom Sonnensystem zum beobachtbaren Universum: Hier sind wir!© oben links: NASA/JPL, oben rechts: ESO, unten links: Springel et al. (2005)/Max-Planck-Institut für Astrophysik, unten rechts: Hélène Courtois und Benjamin Le Talour
WAS MACHT EIN KOSMOGRAF?
Die Kosmologie ist ein großes Teilgebiet der Astronomie, dessen Ziel es ist, die Struktur und die Entwicklung des Universums seit dem Urknall zu erforschen. Dazu identifizieren die Kosmologen die im aktuellen Universum vorhandenen Strukturen und untersuchen, wie diese Objekte miteinander wechselwirken. So können sie die Bildung dieser komplexen Körper seit der Epoche nachvollziehen, in der das Universum sehr jung und die Materie sehr viel homogener verteilt war. Kosmologen sind sozusagen gleichzeitig Geografen und Historiker des Universums. Sie können sehr unterschiedliche Spezialgebiete haben: von der reinen Theorie bis hin zum Experiment. Unter all diesen Spezialgebieten ist meines die „Kosmografie“, das heißt, ich erstelle Karten unseres Universums. Genauer gesagt arbeite ich daran, die Positionen und Bewegungen von Galaxien in unserer „Nachbarschaft“ zu bestimmen – einer Region, die wir im Komologen-Jargon das lokale Universum nennen. Nachbarschaft ist hierfür natürlich ein seltsames Wort, denn sie reicht bis in einige hundert Millionen Lichtjahre Entfernung von unserer Erde! Das Licht, das wir bei der Beobachtung dieser lokalen Galaxien wahrnehmen, hat diese zu einer Zeit verlassen, als auf der Erde noch Dinosaurier lebten, oder sogar noch früher. Trotzdem verwenden wir das Adjektiv „lokal“ aus gutem Grund, denn selbst unsere größten Karten stellen nicht mehr als ein Millionstel des beobachtbaren Universums dar.
Wenn ich Schulklassen der Mittel- oder Oberstufe besuche und mein Fachgebiet erkläre, fragen mich die Jugendlichen nie, „warum“ wir das Universum kartografieren, sondern immer nur „wie“. Dabei sind die Antworten auf beide Fragen wichtig, so sehr die Antwort auf das „Warum“ auch offensichtlich erscheint: Wir benötigen eine Karte, um zu wissen, wo wir uns befinden! Ist es nicht essenziell, zu wissen, wo man ist, und sei es auch nur, um zu wissen, wo die Reise hingeht? Und ebenfalls, um zu wissen, wo man herkommt – also auch teilweise eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wer wir sind? Die Frage nach dem „Wie“ ist sehr viel komplizierter zu beantworten und wirft gleich neue Fragen auf. Wie arbeiten Astrophysiker heute? Klemmen sie ihr Auge noch hinters Teleskop, wie es als Erster Galileo Galilei vor 400 Jahren getan hat? Muss man alle Berge der Welt bereisen, um an modernen Observatorien neue Beobachtungsdaten zu sammeln, die nach ihrer Analyse Modellen gegenübergestellt werden und es dann vielleicht erlauben, die Grenzen unseres Wissens zu verschieben? Und worin besteht eigentlich meine Aufgabe als Professorin an der Universität: Muss ich tagsüber unterrichten und nachts beobachten? Ich beschreibe den Schülern daher meinen Alltag, in dem die Informationstechnologie eine sehr wichtige Rolle spielt, unter anderem, um Daten zu gewinnen und zu verarbeiten. Bei der Antwort auf das „Wie“ erkläre ich auch die Methoden, die ich anwende: die Auswahl der Region am Himmelsgewölbe – einer zweidimensionalen, konkaven Fläche –, auf die ich ein Teleskop richte, dann das Abschätzen der Entfernung der mich interessierenden Galaxie, um in die dritte Dimension vorzudringen. Wie ich danach mithilfe verschiedener Tricks ihre Geschwindigkeit ableite, um schließlich diese neuartigen Bewegungskarten des umgebenden Weltraums zu erstellen, die man „dynamische“ Karten nennt. Und die Schüler geben dann oft überrascht zu: „So habe ich mir Ihren Beruf überhaupt nicht vorgestellt!“
DIE TAGTÄGLICHE GRUNDLAGENFORSCHUNG
Ich bin den Jugendlichen dankbar dafür, dass sie mich danach fragen, „wie“ man das Universum kartografiert, Erwachsene möchten von mir aber häufiger eine Begründung des „Warum“ hören. Diese Frage ist pragmatischer und am Ende dadurch motiviert, dass sie es sind, die die öffentliche Forschung finanzieren. Wir alle sind Mäzene dieser Aktivität, deren Auswirkung auf unser tägliches Leben wir nicht genau beziffern können. Dennoch stammt ein Großteil der Dinge, die wir benutzen, aus der Forschung – der angewandten oder der grundlegenden. Sie können das Ergebnis eines Technologietransfers sein, der mit der Entdeckung eines neuen physikalischen Phänomens verbunden ist. Die Glühbirne zum Beispiel ist entwickelt worden, nachdem man die Phänomene rund um den elektrischen Strom und die damit einhergehenden Energieverluste verstanden hatte. Alltagsobjekte können aber auch aus der Erfindung und Herstellung neuartiger Hilfsmittel resultieren, die ein Grundlagenforscher braucht. Beispielsweise ist die Glaskeramik-Technologie, die die Backofentüren in unseren Küchen kalt hält, direkt zurückzuführen auf die Forschung, die zur Konstruktion von sehr großen Spiegelteleskopen betrieben wurde. Tatsächlich benötigt man für Spiegel mit mehreren Metern Durchmesser rund hundert Tonnen geschmolzenes Siliziumdioxid. Dieser ungefähr ein Meter dicke Block muss anschließend abgekühlt werden können, ohne dass der Temperaturunterschied zwischen Boden und Oberfläche zu Fehlern im Glas führt. Die enorme thermische Stabilität, die hierzu erforderlich ist, hat zur Entwicklung neuartiger Glaskeramiken geführt. Und diese Teleskoptechnologie findet sich heute auch in unseren Küchen, damit sich niemand mehr an Ofentüren die Finger verbrennt.
Grundlagenforschung ist über diese technologischen Auswirkungen hinaus notwendig, weil sie das grundlegende menschliche Bedürfnis stillt, neues Wissen zu erwerben. Ursprünglich musste der Mensch Karten erstellen, um zu jeder Jahreszeit Nahrungsquellen zu finden. Heute, lange Zeit nach diesem durch den Überlebensinstinkt gesteuerten Nomadentum, setzen wir unsere Erkundungen fort, um unseren Reichtum und unser Wissen zu mehren. Die Verbesserung und Erweiterung von Karten ist ein Beispiel unter vielen anderen für das, was die Grundlagenforschung der Gesellschaft zurückgeben kann. Denn die wissenschaftliche Erkenntnis ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur. Durch ihre Arbeit tragen die Forscher zum Allgemeinwissen bei, durch das Ignoranz und Gewalt bekämpft werden. Forscher sind eigentlich „Finder“. Oft sage ich zu den Klassen, in die ich komme, dass wir Entdecker sind. Diese Definition deckt sich gut mit der Realität meines Berufes: Entdecker gehen furchtlos voran ins Unbekannte. Sie lieben alles, was sie noch nicht wissen. Formlose Materie oder nicht greifbare Energie werden in geordnetes Wissen transformiert und direkt dem Rest der Gesellschaft übermittelt. Und sobald ihre Mission erfüllt ist, brechen sie wieder auf zu neuen Abenteuern!
Das Licht als Welle
Wie Wasserwogen oder der Schall zeigt das Licht alle Eigenschaften einer Welle: Es kann zum Beispiel reflektiert, gebrochen oder gebeugt werden. Diese Eigenschaften nutzen die Astronomen, um das Licht mit ihren Teleskopen zu sammeln. Je nach Wellenlänge, also dem Abstand zweier Wellenberge, kann das Licht alle Regenbogenfarben annehmen. Blauviolettes Licht zum Beispiel hat eine Wellenlänge von 4 × 10-7 m, sie ist halb so groß wie die von rotem Licht, das 8 × 10-7 m misst. Bei anderen Wellenlängen kann das Licht sogar unsichtbar für das menschliche Auge sein. Infrarotes Licht, Mikrowellen und Radiowellen haben größere Wellenlängen als Rot, während ultraviolettes Licht, Röntgenstrahlen und Gammastrahlen kürzere Wellenlängen als Violett aufweisen. Alle diese Wellen, sichtbar oder unsichtbar für das Auge, bilden das elektromagnetische Spektrum. Um das Lichtspektrum eines Himmelsobjekts zu erhalten, montieren die Astronomen einen Spektrografen an ihr Teleskop. Spektrografen bestehen in erster Linie aus Prismen oder Beugungsgittern. Diese Instrumente zerlegen das Licht, das vom Objekt ausgesendet wurde, in seine verschiedenen Farben. Unabhängig von der Farbe bewegen sich alle elektromagnetischen Wellen von Gammastrahlen bis Radiowellen mit der gleichen Geschwindigkeit durch das Vakuum. Diese Geschwindigkeit ist so hoch, dass nichts anderes schneller durchs Universum rast: In einer Sekunde durchläuft das Licht rund 300.000 km.
Abb. 1.3: Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen.© Rachid Maraï/Dunod
Die Erdatmosphäre absorbiert nicht alle elektromagnetischen Wellen gleichermaßen. Sichtbares Licht, das die Astronomen als optischen Bereich bezeichnen, lässt sie passieren – glücklicherweise, denn sonst würden wir nicht viel sehen. Die Atmosphäre ist außerdem für einen Teil der Radiowellen durchlässig, und zwar für solche, deren Wellenlängen ungefähr im Bereich zwischen 1 mm und 10 m liegen. Diese beiden Wellentypen, optische und Radiowellen, können mit terrestrischen Teleskopen empfangen werden. Alle anderen elektromagnetischen Wellen (Röntgen-, Ultraviolett-, Infrarotstrahlung …) werden von der Atmosphäre absorbiert, ihre Messung erfordert daher Teleskope im Weltraum.
DER HIMMEL ALS RELIEF: DIE DRITTE DIMENSION
Sicher haben Sie sich schon einmal als Amateurkartograf des Universums betätigt, als Sie in einer warmen Sommernacht, die Augen zum sternenübersäten Himmel gerichtet, Ihrer Begleitung erklären wollten, wo sich ein bestimmtes, interessantes Himmelsobjekt befindet. Die Schwierigkeit besteht darin, Ihren Gesprächspartner zu diesem einen schönen Stern zu leiten, der ein kleiner, leuchtender Punkt unter Hunderten anderen ist, die an diesem Abend mit bloßem Auge sichtbar sind. Die Magie des Moments kann dann schnell in einen Strom konfuser Erklärungen münden. Vielleicht hat es Ihnen dann Leid getan, kein versierter Astronom zu sein, der den Namen der Himmelsregion nennen könnte, zu der „Ihr“ Stern gehört. Zahlreichen anderen Menschen vor Ihnen ist es sicherlich ebenso ergangen, und sie haben eingesehen, dass es sinnvoll ist, das Himmelsgewölbe in einfach zu identifizierende Regionen zu unterteilen: die Sternbilder. Das Himmelsgewölbe ist die Hälfte einer Kugel mit unbestimmtem Radius, in deren Mittelpunkt die Erde steht und auf der alle leuchtenden Objekte des Universums befestigt zu sein scheinen. Die Sternbilder bestehen aus Gruppen von Sternen, die einander am Himmelsgewölbe nahestehen und die willkürlich miteinander zu anschaulichen Formen verknüpft wurden. Übrigens sind die Sternbilder in verschiedenen Zivilisationen durchaus unterschiedlich. Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat die Himmelssphäre jedoch in 88 offizielle Sternbilder eingeteilt, so dass jeder Himmelspunkt exakt einem Bild zugeordnet werden kann. Für noch genauere Angaben überziehen die professionellen Astronomen die Himmelssphäre mit einem imaginären Gitternetz, das sich aus großen Kreisen ergibt. Das sind einerseits Kreise, die durch die beiden Himmelspole laufen, und andererseits Kreise parallel zum Äquator – exakt wie das Gitternetz der Längen- und Breitenkreise auf der Kugeloberfläche unserer Erde. So können die Wissenschaftler jeden Punkt auf diesem Gitternetz durch seine Koordinaten lokalisieren. In diesem sogenannten äquatorialen Koordinatensystem ist die Position eines Gestirns jeweils durch zwei Winkel festgelegt: seine Deklination, die der geografischen Breite eines Punktes auf der Erde entspricht, und seine Rektaszension, entsprechend der geografischen Länge.
Abb. 1.4: Ansichten des Sternbilds Orion, am Himmelsgewölbe und in 3D.© Rachid Maraï/Dunod





























