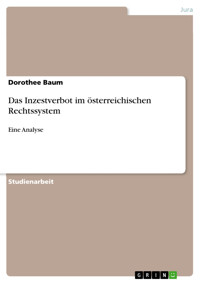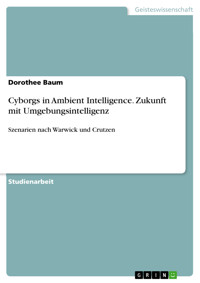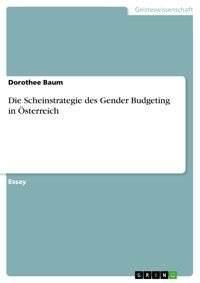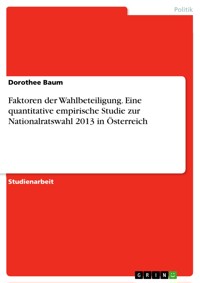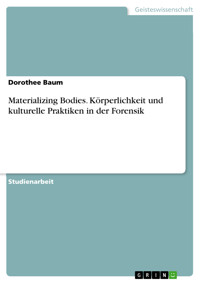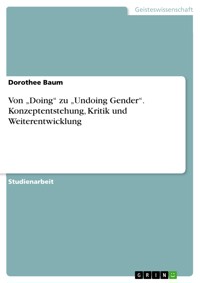
Von „Doing“ zu „Undoing Gender“. Konzeptentstehung, Kritik und Weiterentwicklung E-Book
Dorothee Baum
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Sozialwissenschaften allgemein, Note: 1, , Sprache: Deutsch, Abstract: Dieser Beitrag befasst sich mit der Entstehung des Konzeptes „doing gender“, seiner Kritik dran und seiner Weiterentwicklung. An erster Stelle wird das auf Candace West und Don H. Zimmerman und mit ihnen auf die Transsexuellenstudien von Suzanne Kessler und Wendy McKenna und insb. jene von Harold Garfinkel zurückgehende Konzept des „doing gender“ erläutert. Fortgesetzt wird mit der Weiterentwicklung dieses Konzeptes bei West und Sarah Fenstermaker (doing difference) und bei Judith Lorber (Genderparadoxien). Im Anschluss wird die Kritik am Konzept des „doing gender“ zusammengefasst, drauf aufbauend werden drei prominente Gegenkonzepte erläutert: das „undoing gender“ bei Francine M. Deutsch und bei Stefan Hirschauer sowie das „degendering“ bei Judith Lorber. Abschließend wird dem ethnomethodologischen Konzept des „doing gender“ von West und Zimmerman der diskurstheoretischer Ansatz Judith Butlers („gender performance“) gegenübergestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
INHALTSVERZEICHNIS
I) Einleitung
II) Das Konzept des Doing Gender: West/Zimmerman
III) Ausgangspunkt: Transsexuellen-Studien
IV) Sex, Sex-Category und Gender
V) Fortbildung des Konzeptes des Doing Gender
A. Doing Difference: Festermaker/West
B. Genderparadoxien: Lorber
VI) Kritik am Konzept des Doing Gender
A. Soziale Veränderung vs. Omnirelevanz von Gender
B. Verselbstständigung des Konzeptes des Doing Gender
C. Omnipräsenz und differenzielle Relevanz: Gildemeister
VII) Undoing Gender und Degendering
A. Undoing Gender bei Deutsch [Deutsch 2007]
B. Degendering bei Lorber [Lorber 2000, 2005]
C. Undoing Gender bei Hirschauer [Hirschauer 1994]
VIII) Performing Gender: Butler
IX) Schlusswort
Literaturverzeichnis
I) Einleitung
Dieser Beitrag befasst sich mit der Entstehung des Konzeptes „doing gender“, seiner Kritik dran und seiner Weiterentwicklung. An erster Stelle wird das auf Candace West und Don H. Zimmerman und mit ihnen auf die Transsexuellenstudien von Suzanne Kessler und Wendy McKenna und insb. jene von Harold Garfinkel zurückgehende Konzept des „doing gender“ erläutert. Fortgesetzt wird mit der Weiterentwicklung dieses Konzeptes bei West und Sarah Fenstermaker (doing difference) und bei Judith Lorber (Genderparadoxien). Im Anschluss wird die Kritik am Konzept des „doing gender“ zusammengefasst, drauf aufbauend werden drei prominente Gegenkonzepte erläutert: das „undoing gender“ bei Francine M. Deutsch und bei Stefan Hirschauer sowie das „degendering“ bei Judith Lorber. Abschließend wird dem ethnomethodologischen Konzept des „doing gender“ von West und Zimmerman der diskurstheoretischer Ansatz Judith Butlers („gender performance“) gegenübergestellt.
II) Das Konzept des Doing Gender: West/Zimmerman
Das ethnomethodologische Konzept des „doing gender“ geht auf den gleichnamigen Beitrag von Candace West und Don H. Zimmerman im Journal Gender & Society im Jahre 1987 [West/Zimmerman 1987] zurück. Es bedurfte allerdings zehn Jahre, um die Drucklegung dieses bereits 1977 verfassten Beitrages zu erwirken [vgl. West/Zimmerman 2009: 112], ein Beitrag der aus heutiger Sicht die Theoriebildung wesentlich beeinflusst hat.
„Doing gender“ versteht Geschlecht als erworbene Eigenschaft, als fortlaufenden Herstellungsprozess, der gender methodisch reproduziert und in alltägliche Interaktionen eingebettet in nahezu jeder menschlichen Aktivität stattfinden kann. West und Zimmerman transformierten somit den zugewiesenen (gender-)Status in einen ausgeführten (gender-)Status und verschoben Weiblichkeit und Männlichkeit als vorgegebene, essentielle Eigenschaft eines Individuums hin zu einer in einem Beziehungsgefüge beständig herzustellenden interaktionalen sozialen Eigenschaft: „Doing gender means creating differences between girls and boys and women and men, differences that are not natural, essential, or biological. Once the differences have been constructed, they are used to reinforce the ‘essentialness’ of gender.“ [West/Zimmerman 1987: 137].[1] Dem ethnomethodologischen Ansatz folgend handelt es sich bei der Geschlechterdifferenz somit um eine kollektiv hergestellte soziale Wirklichkeit, die ständig reproduziert werden muss und nicht etwa mit Feststellung des Geburtsgeschlechtes oder dem (frühkindlichen) Sozialisationsprozess abgeschlossen ist.
III) Ausgangspunkt: Transsexuellen-Studien
Ausgangspunkt für West und Zimmerman waren die Transsexuellen-Studien von Suzanne Kessler und Wendy McKenna [Kessler/McKenna 1978] und insb. jene zum Fall „Agnes“ von Harold Garfinkel [Garfinkel 1967]. Diese Studien zeigen deutlich, dass weibliches bzw. männliches Verhalten erst auf sozialer Ebene erlernt werden muss, um nach außen hin stimmig und glaubwürdig zu wirken und akzeptiert zu werden. Sie verdeutlichen aber auch die Durchdrungenheit des Alltages vom sexuellen Status, der einen invarianten aber nicht wahrgenommenen Hintergrund des täglichen Lebens bildet [Garfinkel 1967: 118] und selbst Transsexuelle an die Vorstellung einer biologisch begründeten Natur der Zweigeschlechtlichkeit bindet.
In Hinblick auf Agnes, einer/s als männlich erzogenen Transsexuellen, die/der sich 1958 einer operativen Geschlechtsangleichung an eine Frau unterzog und deren/dessen Weg Garfinkel vor und nach dieser Operation einige Zeit verfolgte und analysierte, heben West und Zimmerman drei an Agnes gestellte Herausforderungen besonders hervor:
(1) die Überzeugungsarbeit gegenüber Ärzten und Psychiatern, eine „wirkliche“ Frau zu sein,
(2) sich selbst als Frau zu präsentieren und in der Gesellschaft als Frau aufzutreten und
(3) das Geheimnis, einen Penis zu besitzen (bzw. besessen zu haben und nun eine künstliche Vagina zu besitzen), zu bewahren.