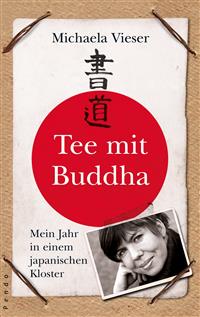Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
ABTRITTANBIETER
ALLESSCHLUCKER
AMEISLER
AMME
BÄNKELSÄNGER
FISCHBEINREISSER
FULLONE/URINWÄSCHER
KAFFEERIECHER
KAMMERTÜRKE, HOFMOHR, INSELINDIANER
Kammertürken
Hofmohren
Inselindianer
KÖHLER
LICHTPUTZER
LITHOGRAPH
LUMPENSAMMLER
MÄRBELPICKER
PATERNOSTERMACHER/ BERNSTEINDREHER
QUACKSALBER
ROHRPOSTBEAMTIN
ROSSTÄUSCHER
SANDMANN
SCHARFRICHTER
SESSELTRÄGER
SILHOUETTENSCHNEIDER
WANDERPREDIGER
ZEIDLER
Danksagung
ANMERKUNGEN
LITERATUR
REGISTER
BILDNACHWEIS
Copyright
MICHAELA VIESER
Periit pars maxima – der größte Teil geht verloren
IRMELA SCHAUTZ
Für Salome und Christian, die Quicklebendigen
VORWORT
Wie der Titel dieses Buches unschwer erkennen lässt, haben die hier versammelten Berufe eines gemeinsam: Sie gehören einer anderen Zeit an. Es gibt sie heute nicht mehr, zumindest in unserer mitteleuropäischen Lebenswelt nicht. Wer genau hinschaut, wird den Lumpensammler, den Waldbienenzüchter oder den Scharfrichter dennoch wiederfinden und das, leider, nicht nur in den Entwicklungsländern.
Berufe, wie der des Kaffeeriechers, verschwanden plötzlich aus dem Alltag ihrer Zeitgenossen, und niemand hat dies bedauert, außer vielleicht die Kaffeeriecher selbst. Der Grund für ihr Verschwinden waren neue Zolleinfuhrgesetze. Einfach eine Verordnung von oben. Bei anderen Berufen dauerte es eine Weile, bis sich kaum mehr jemand an sie erinnerte. Die niederösterreichischen Ameisler zum Beispiel hielten sich erstaunlich lange, bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Die Quacksalber dagegen keimten wie die Krankheiten, die sie vertrieben, immer wieder auf, und ob sie wirklich nur in vergangenen Zeiten zu finden waren und heute nicht mehr, könnte man durchaus in Frage stellen.
In diesem Buch wird von Berufen erzählt, deren Geschichte sich zurückverfolgen lässt bis zu den alten Griechen, manchmal sogar noch weiter, durch Bildzeugnisse von den Ägyptern und von noch früheren Kulturen. Sie existierten bei den Germanen, und sie begleiteten die Menschen bis in die Neuzeit hinein. Die Köhler gehören dazu, die ein Produkt herstellten, das den Aufbau der menschlichen Zivilisation prägte wie kaum ein anderes Erzeugnis. Doch auch die Zeit der Köhler ist vorbei. Längst ist der Wald zu wertvoll geworden, als dass man ihn für die Gewinnung von Holzkohle verbrennen wollte.
Viele der Berufe, die in diesem Buch zusammengetragen wurden, hielten sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Danach veränderte sich die Gesellschaft so radikal, dass es auch bei Berufen und in der Arbeitswelt einer Zäsur gleichkam. Manche Berufe mussten sich neu erfinden, andere verschwanden durch Erfindungen, wie die Lithographen beispielsweise. Sie hatten zu ihrer Blütezeit einen wahren Paradigmenwechsel im Umgang mit Bildern herbeigeführt, dass deren Allgegenwart uns heute als selbstverständlich erscheint. Mit Bildern ließ sich so viel Geld verdienen, dass noch bessere Methoden entwickelt wurden, um sie zu reproduzieren. Die Lithographie ist ein Kunstdruckverfahren geworden, industriell wird sie nicht mehr angewendet.
Die Silhouettenschneider, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg durch die Vergnügungsviertel zogen und blitzschnell Scherenschnitte zauberten, wurden durch Polaroids ersetzt, und selbst die Polaroids sind weitgehend verschwunden. Mit der Digitalkamera im Handy fangen sich Erinnerungsschnipsel so viel schneller und bequemer ein.
Und beim Fischbeinreißer war es die Mode, die ihn um seinen Beruf brachte.
Am längsten überlebte die Rohrpostbeamtin, die das Kommunikationssystem der Metropolen mit Rohrpostbriefen fütterte. Als 1984 die letzte Büchse ins Pariser Netz geworfen wurde, ging auch diese Ära zu Ende. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass bis vor wenigen Jahrzehnten die Städte mit einem unterirdischen System von Rohren durchzogen waren, in denen Briefe hin – und herflitzten.
Arbeit war und ist in erster Linie Broterwerb. Für sich selbst, für die Familie, die oft den Haupterwerbstätigen dabei unterstützte. Bei den Bänkelsängern hörte es sich schöner an, wenn auch Kinderstimmen mit vortrugen. Bei den Sandmännern führte die Kinderarbeit dazu, dass kaum eines ihrer Kinder alt wurde. Eine Ausbildung aber, eine Spezialisierung, hatten die wenigsten. Von Sicherheit ganz zu schweigen.
Dass Arbeit auch Spaß machen kann – dieses Glück war Menschen in den wenigsten Berufen vergönnt. Dennoch erfüllte es viele mit Stolz, sich selbst am Leben erhalten zu können und sich nicht als Bettler durchschlagen zu müssen. Die Lumpensammler beispielsweise sangen davon ein Lied. Nur wenige der in diesem Buch zum Leben erweckten Berufe gehörten einer Zunft an, einem Netzwerk von Menschen, die täglich mit den gleichen Problemen konfrontiert waren und die sich zusammenschlossen, um vor Gesetzgeber und Auftraggebern als Einheit auftreten zu können.
Berufe öffnen ein Fenster in die Lebenswelt der damaligen Zeit. Es ging mir beim Schreiben nicht darum, akribisch genau festzuhalten, was genau welcher Beruf zu tun hatte, wie die Handgriffe aussahen und welche Werkzeuge dafür verwendet wurden. Viel wichtiger war mir, warum es diese Berufe gab. Was brachte Menschen dazu, diese Tätigkeit auszuüben? Bei den Abtrittanbietern war es ganz klar: Die Städte waren zu verschmutzt. Es musste sich jemand der Notdurft der Menschen annehmen.
Wie global auch früher schon gehandelt wurde, lässt sich nicht nur am Beispiel der Märbelpicker verdeutlichen; sie klopften in Thüringen Murmeln, die in den Seeschlachten eingesetzt wurden. So mancher Pirat wird geflucht haben über diese vertrackten Murmeln. Dass thüringische Märbel die Häuserwände von Kolonialstädten schmückten, fand ich genauso wichtig wie die Gründe, warum die Thüringer überhaupt auf die Idee kamen, Murmeln zu produzieren. Irmela Schautz und ich haben zwei Jahre lang Augen und Ohren offen gehalten auf der Suche nach ausgestorbenen Berufen. Manchmal stießen wir in Romanen auf Nebenfiguren, die uns genauer hinschauen ließen, manchmal erzählten wir Freunden von unserem Interesse und erhielten spannende Hinweise. Wenn wir uns auf einen Beruf geeinigt hatten, zogen wir los in die Bibliotheken und gruben dort manchen Schatz aus. Fantastisch war zum Beispiel ein Buch von 1737 über Sänften. So saßen wir andächtig im Raritätenlesesaal der Berliner Staatsbibliothek über diesem Werk, das ein Mann vor über dreihundert Jahren verfasst hatte und das uns durch seine Liebe zum Detail, seinen Wunsch, alles Wissen zusammentragen zu wollen, in seinen Bann zog. Der Autor hatte damals schon über Sänften in aller Welt berichtet, alle Gesetze zu Sänften aufgeschrieben und sich selbst Gedanken gemacht, wie die perfekte Sänfte aussehen könnte. Und weil er daraus ein Buch machte, können wir ihm heute in seine Welt folgen.
Zu anderen Berufen, wie zum Beispiel zum Sandmann, fanden wir weder in Bibliotheken noch im Internet Anknüpfungspunkte. Da der Beruf uns aber faszinierte, ließen wir nicht locker. Wir schauten uns eine geologische Karte von Deutschland an und fanden heraus, in welchen Gegenden der Sandstein vorkam. Dann telefonierten wir mit den Ortsämtern: Gibt es bei Ihnen nicht Heimatforscher, die dazu etwas geschrieben haben? Es gab sie. Ihre Artikel sind jedoch selten katalogisiert. Bereitwillig schickte man uns Kopien. Selbst mein Großvater konnte sich noch an die Sandmänner erinnern; er sang mir das Lied vor, mit dem sie den Stubensand anpriesen. Nach über neunzig Jahren war es ihm so genau im Gedächtnis, dass er selbst die Melodie noch kannte. Während ich Bücher immer wieder nach Zitaten durchsuchte, denn O-Töne vermitteln am besten ein Gefühl für eine bestimmte Zeit, wälzte Irmela Schautz für ihre Illustrationen Bücher über Kostüme, alte Stiche und Zeichnungen, um nicht nur möglichst genau abzubilden, was heute nicht mehr existiert, sondern auch, um den Charakter eines bestimmten Berufs wiederzugeben.
Jetzt bleibt nur noch, Ihnen genauso viel Spaß beim Lesen zu wünschen, wie wir beim Recherchieren, Schreiben und Illustrieren hatten.
Für Anregungen zu weiteren verschwundenen Berufen bin ich dankbar. Informationen bitte an
[email protected]MICHAELA VIESER
Berlin, im Juli 2010
ABTRITTANBIETER
Männlicher oder weiblicher Anbieter einer öffentlichen Toilette, zum Beispiel auf Messen oder Märkten, bevor es öffentliche Toilettenanlagen gab
KENNZEICHEN: langer Mantel, zwei Eimer, starker Geruch
AKTIVE ZEIT: Mitte des 18. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts
Am 9. Oktober 1694 schrieb Lieselotte von der Pfalz, Herzogin von Orléans, aus Fontainebleau:
»Sie sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen zu können, wann sie wollen, scheißen sie also nach Belieben. Wir sind hier nicht in derselben Lage, hier bin ich verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum Abend aufzuheben; es gibt nämlich keinen Leibstuhl in den Häusern an der Waldseite. Ich habe das Pech, eines davon zu bewohnen und darum den Kummer, hinausgehen zu müssen, wenn ich scheißen will, das ärgert mich, weil ich bequem scheißen möchte, und ich scheiße nicht bequem, wenn sich mein Arsch nicht hinsetzen kann.«1
Die Briefe der Herzogin mögen aus der heutigen Sicht zwar ordinär klingen, für ihre Zeitgenossen waren sie nur ehrlich. Friedrich Schiller lobte die Autorin sogar, da sie die Wahrheit so hüllenlos darstellte. Sein dichterisches Schamgefühl wurde dabei nicht verletzt. Praktisch wie auch sprachlich durfte man, wie wir selbst von Goethe wissen, furzen, rülpsen und scheißen. Heute verlässt man dazu besser den Raum und spricht nur im Wandschrank davon.
Viel frappierender an dieser Passage aus der Korrespondenz der Herzogin ist aber, dass sie vermuten lässt, es habe in Fontainebleau keine Toilette gegeben. Und tatsächlich: Selbst das Prachtschloss Versailles blieb von solchen Gemächern verschont. Man saß stattdessen, falls vorhanden, auf edel verzierten Nachtstühlen, die die Dienerschaft untertänigst entleerte, oder erleichterte sich in Ecken und an Tapisserien. Im gesamten 17. Jahrhundert nahm auch in den besseren Kreisen niemand Anstoß an diesen Gewohnheiten. Sogar Audienzen wurden abgehalten, bei denen man gemeinsam auf dem Nachtstuhl saß und sich nach Lust und Laune dem verbalen oder analen Geschäft hingab.
Beim einfachen Volk zählten Parkidyllen, enge Gassen, Flussufer und dunkle Ecken zu den beliebteren Orten, um sich zu erleichtern. Casanova berichtet:
»Wir setzten unseren Spaziergang fort, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben und sprachen von Literatur und allerlei Gebräuchen. Plötzlich bemerkte ich in der Nähe von Buckingham-House zu meiner Linken im Gebüsch fünf oder sechs Personen, die ein dringendes Bedürfnis verrichteten und dabei den vorübergehenden den Hintern zukehrten.«2
In einem Schulbuch von 1568 findet sich eine Passage, die man heute in einem Witzbuch vermuten würde, weil der Schüler die Aufforderung des Lehrers zu wörtlich beantwortet:
Der Lehrer fragt einen Schüler: »Erzähle mir in genauer Reihenfolge, was du vom Aufstehen bis zum Frühstück gemacht hast. Hört gut zu, Jungen, damit ihr lernt, diesen Schüler nachzuahmen.« »Ich bin aufgewacht, bin aus dem Bett gestiegen, habe Hemd, Strümpfe und Schuhe angezogen, meinen Gürtel umgeschnallt, an der Hofmauer Urin gelassen, habe aus dem Eimer frisches Wasser genommen, Hände und Gesicht gewaschen und am Tuch abgetrocknet.«3 Der Junge hatte nicht nur an eine Wand gepinkelt, er erzählte auch noch allen Ernstes seiner Klasse davon. Warum? Es war damals selbstverständlich.
Toiletten in Häusern – das hatten Ägypter und Römer vor der Zeitenwende, nicht aber die Londoner, Berliner oder Pariser der industriellen oder politischen Revolution. »Fortschritt«, so wurde eine Satire aus dem Satiremagazin »Kladderadatsch« von 1852 betitelt, herrsche alltäglich zur Mittagszeit in den Straßen Bremens, wenn nämlich alle Nachttöpfe der Stadt vor den Häusern standen, bereit von einem Fahrdienst abgeholt zu werden. Den Fortschritt erkenne man an den wegeilenden Bürgern.
Der Gestank muss bestialisch gewesen sein.
Im alten Rom soll es 144 öffentliche Latrinen und 116 Pissstände an der Stadtmauer gegeben haben. Ein Spruch, der in einer solchen römischen Prachtlatrine gefunden wurde, lautet: »Cacator cave malum! Aut si contempseris, habeas Jovem iratum! – Hüte dich, auf die Straße zu kacken! Sonst wird dich Jupiters Zorn treffen!«4
Die Kultur der öffentlichen Pissoirs ging zusammen mit den Römern unter. Es kam das Mittelalter, es kam die Neuzeit. Die Sitten verrohten. Die Städte wuchsen, das Gedränge wurde dichter, Krankheiten kursierten: Es galt etwas zu unternehmen. Aller kondensierte Lavendelduft Südfrankreichs, in Flakons an Gürteln, ins Haar gesprüht, mit Fächern gewedelt und auf Kissen verteilt, half nicht gegen die bestialischen Gerüche, die durch die überfüllten Städte waberten. Die Menschen flüchteten und fluchten zwischen Pesthauch und Blütenduft. Es galt, etwas zu unternehmen.
Anhänger eines besonders schlauen Gedankengangs im 18. Jahrhundert empfahlen, die mangelnde Hygiene durch eine relativ einfache Maßnahme auszugleichen: Die Atmosphäre, so glaubte man, würde durch Erschütterungen von Glocken oder Geschützen desinfiziert. Die Unruhe, die hierbei erzeugt werde, reinige die Luft von allem Übel. Selbst Sümpfe, so riet ein gewisser Monsieur Baumes, könne man verminen, um sie von ihren krankheitsfördernden Dämpfen zu säubern. Kirchen, die wegen des Leichengestanks der in den Kellern verwesenden Körper nicht mehr messefähig waren, wurden mit Schießpulver in die Luft gejagt. Das Ende des stillen Örtchens?
Zeitgleich krempelten in Bayreuth die Amtsinhaber ihre Hemdsärmel hoch und verfassten 1797 die erste Behördliche Verordnung zur Einhaltung der öffentlichen Reinlichkeit:
»Soll sich hinfür niemand unterfangen, weder bei Tag noch Nacht,an öffentlichen Plätzen, an Häusern, in den Hausplätzen hinter den Hausthüren sich seiner Unreinlichkeit zu entledigen und werden Eltern erinnert, ihre Kinder vor solchen ekelhaften Unsauberkeiten ernstlich abzuhalten, widrigenfalls sie selbst dafür zur Strafe gezogen werden.«5
Bild 1
Ein knappes halbes Jahrhundert später war man in Berlin soweit: Die ersten beiden Pissoirs der Stadt wurden errichtet.
Es war auch durchaus an der Zeit. Wegen der veränderten Lebensumstände spielte sich das Leben viel mehr in der Öffentlichkeit ab als zuvor. Seit spätestens Ende des 16. Jahrhunderts bedeutete Reichtum nicht mehr nur Besitz. Wirtschaftliche Stärke manifestierte sich vor allem in Warenhandel und Finanzverkehr. Es galt sich zu bewegen, mental wie physisch. Und wie der kleine Bauer täglich zum Markt fuhr oder der große Entscheidungsträger sich in den Clubs zum Diskutieren traf: Man war unterwegs. Von früh bis spät.
Was sollte man tun, wenn man mal musste? Wer reich war, konnte sich eine Kutsche anhalten, sich einmal ums Karree fahren lassen und danach erleichtert weitergehen. Alles schon vorgekommen! 1781 schrieb der Franzose Louis Sebastian Mercier: »Man hat öffentliche Bedürfnisanstalten errichtet, in denen jedes Individuum seine Notdurft für zwei Pfennige verrichten kann. Aber findet man Zeit, den Unternehmer aufzusuchen, wenn man sich im Faubourg St.-Germain befindet und die Gedärme von Schwäche befallen fühlt? … Die Orte die die Aufschrift tragen: ›Es ist bei Körperstrafe verboten, hier seine Bedürfnisse zu verrichten‹ sind gerade die, in denen sich die meistbeschäftigten Leute zusammenfinden. Es bedarf nur eines Beispiels, um dreißig Nachahmer zu finden.«6
Wo die öffentlichen Toiletten fehlten, half ein sogenannter Abtrittanbieter: ein mobiler Toilettendienst, der von Männern und Frauen angeboten wurde. Die Abtrittanbieter hielten sich vor allem auf Märkten und Handelsschauen auf, wie die Messe in Frankfurt, und luden mit lauter Stimme dazu ein, sich auf einem ihrer Eimer niederzulassen. Wer sich erleichtern wollte, wurde mit einem langen Ledermantel umwickelt, aus dem nur noch der Kopf schaute, und konnte so in der Öffentlichkeit das tun, was heute privat verrichtet wird. Der Thüringer Johann Christoph Sachse berichtet in seinen Erinnerungen, wie er in Hamburg von einer Frau angesprochen wurde: »Will gi wat maken?«, und als er sehen wollte, was er da machen solle: »Eh ich mich’s versah schlug sie ihren Mantel um mich, unter welchem sie einen Eimer verborgen hatte, dessen Duft mir seine Anwendung verriet.« Er ergriff die Flucht, die Umstehenden lachten.7
Auch in Edinburgh soll es dieses Dienstleistungsangebot gegeben haben, dort mit dem Spruch: »Who wants me for a bawbee?« Bawbee war die Bezeichnung für die gängige Münzwährung. In Wien dagegen gab es K.K. privilegierte Retiraden8, also kaiserlich begünstigte Rückzugsorte: Gemeint waren damit kleine hölzerne, fassähnliche Gefäße, auf Marktplätzen aufgestellt, die von tüchtigen Frauen betrieben wurden. Hier waren die Abtrittanbieterinnen bis Mitte des 19. Jahrhunderts groß im Geschäft. Offensichtlich störte es niemanden, dabei beobachtet zu werden, solange die privaten Körperteile verdeckt waren. Bei den öffentlichen Pissoirs in Paris, den Vestibülen, konnte man noch lange Zeit sehen, wer sich darin aufhielt. Lediglich die Körpermitte wurde verdeckt.
Die ersten öffentlichen Toiletten Deutschlands waren aus Gusseisen konstruiert. Somit konnten sie leicht an wechselnden Orten aufgebaut werden, falls sich die Anwohner – was oft vorkam – über sie beschwerten. 1876 standen sechsundfünfzig solcher Konstruktionen in Berlin, und es wurden immer mehr: Das Café Achteck, das Café Wellblech, der Madai-Tempel oder der Pinkelwinkel gehörten fortan zum europäischen Stadtbild. Endlich wieder Sitten wie im alten Rom. Dort war man mal wieder schlauer gewesen und hatte das Gesundheitssystem durchschaut: »Amice fugit te proverbium. Bene caca et irruma medicos. – Freund, du vergisst das Sprichwort: Kacke gut und scheiß auf die Ärzte.«
ILLUSTRATION: Abtrittanbieterin, die einem feinen Herrn ihren Dienst anbietet. Er nimmt erleichtert an.
Hintergrund: Berliner Stadtplan, Kupferstich 1789.
ALLESSCHLUCKER
Meist Männer, die als Attraktion auf Jahrmärkten und im Zirkus auftraten, Ungewöhnliches schluckten und oft auch wieder ausspien
ERKENNUNGSZEICHEN: äußerliche keine; innerliche unbekannt
AKTIVE ZEIT: in Europa vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
Anno 1788: Gerade hatten zwei Franzosen es geschafft, mit einem Ballon in die Luft zu steigen, da faszinierte eine andere Art, die Natur zu überlisten, die Menschen: »Der einzigartige Steinfresser, der wirklich einzige auf der Welt, der Steine isst und schluckt und sie dann in seinem Bauch klingen lässt, als wären sie in der Hosentasche. Unser außergewöhnlicher Steinfresser leidet unter keinen Unbequemlichkeiten, und das, obwohl er sich von einer Speise ernährt, die für jeden anderen sonst ein vollkommen ungenießbares Mahl darstellen würde. Die verehrten Damen und Herren aus dem Publikum werden gebeten, Zünd – oder Kieselsteine mit zur Vorstellung zu bringen.«9
So kündigte ein Programmzettel einen namentlich unbekannten, als Steinfresser aber berühmten Mann als Attraktion an. Er nahm Steine in den Mund, zermalmte sie oder schluckte sie ganz hinunter. Seine Kinnbacken dienten ihm als Kauwerkzeug, sein Magen dankte ihm die fettfreie Nahrung. Er trat in verschiedenen Etablissements in London auf, später auch in New York. Wie bei fast jeder Varieténummer umgab auch diesen Steinfresser eine sonderbare Geschichte: Er sei, so wurde erzählt, als einziger Überlebender eines Schiffbruchs auf eine kleine Insel vor Norwegen gespült worden und habe sich dort dreizehn Jahre lang nur von Steinen ernährt. Nun, da er wieder zurück auf dem Festland sei, halte er sich weiterhin an seine Diät.
Es dauerte nicht lange, da hatte der Steinfresser eine Menge Nachahmer.
Ein gewisser Siderophagus »verzehrte Eisen in jeder Form: Nägel, Nadeln, Draht und Nussknacker eingeschlossen. Die Zuschauer werden aufgefordert, einen Bund mit Schlüsseln, einen Bolzen oder einen Schürhaken mitzubringen, was er alles so essen wird, als seien es Ingwerkekse.«10
Und selbst Siderophagus hatte Nachahmer – nicht alle überlebten die Folgen ihres Plagiats.
Des Siderophagus Frau wiederum, Sarah Salamander, spezialisierte sich auf aqua fortis, Salpetersäure, die sie hinunterspülte »wie Dünnbier«. Andere würgten Uhren hinunter und ließen sie aus ihrem Bauch heraus ticken. Später kamen Glühbirnen hinzu, die aus dem Innern des armen Schluckers heraus leuchteten. Scheren, Schwerter, Regenschirme, kleine Gefäße – die menschliche Fantasie kennt im Grotesken keine Grenzen. Ein Allesschlucker namens Tarrare wurde von Napoleons Offizieren als Spion eingesetzt: Er verschluckte ein Kistchen mit geheimen Botschaften, das er – unerkannt beim Verbündeten angelangt – über seinen Hinterausgang hervorholte. Da er leider mit einem einzigartigen Magen, nicht aber mit Intelligenz gesegnet war, wurde der Versuch nicht wiederholt.
Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Berufsgruppe, die zu den Allesschluckern gehört, die man aber besser als »Vielfresser« bezeichnen sollte. Bereits Vospicius gibt Auskunft darüber, dass am Hofe des römischen Kaisers Aurelius ein Bauer eingeladen war, der ein Ferkel, ein Schaf und danach ein Wildschwein verzehrte. 1511 hatte Kaiser Maximilian einen ähnlich hungrigen Bauern geladen, der vor dem Hofstaat ein rohes Kalb zerfleischte. Als der Bauer sich dann auf den Kadaver eines Schafs stürzte, war das genug der monotonen Unterhaltung, und die Vorführung wurde abgebrochen.11 Dabei hatte dieser Vielfresser noch Glück: Am dänischen Hof lebte ein Schauspieler, der über den Appetit und Leibesumfang von zehn Männern verfügte. Als der König vernahm, dass der Schauspieler aber nicht besser spielen konnte als die anderen Schauspieler, wurde er zum Tode verurteilt: Er stelle als »Vertilger der Nahrung ein öffentliches Ärgernis dar«.12
Im 17. und 18. Jahrhundert traten Vielfresser gehäuft auf Jahrmärkten und in Spelunken in England auf; es musste aber ein Franzose kommen, um ihnen das Handwerk richtig zu zeigen und es zirkustauglich zu machen: Dufour, der seit 1783 europaweit, auch in Berlin, seine Nummer darbot. Als echter französischer Feinschmecker hatte sich dieser Vielfresser eine interessante Menüfolge einfallen lassen, die Stein-, Alles – und Eisenfresser wie Langweiler aussehen ließ:
»Das Mahl begann mit der Suppe – Nattern in schwimmendem Öl. Auf jeder Seite stand eine Obstplatte, die eine enthielt Disteln und Kletten, die andere rauchende Säure. Oft waren Beilagen aus Schildkröten, Ratten, Fledermäusen und Maulwürfen mit glimmender Holzkohle garniert. Anstatt des Fischgangs verspeiste er ein Gericht aus Schlange in kochendem Teer und Pech. Seinen Braten bildete ein Waldkauz in einer Soße aus glühendem Schwefelkies. Der Salat erwies sich als Spinnennetze, die voll mit Knallfröschen waren, eine Platte mit Schmetterlingsflügeln und Würmern, dazu ein Gericht von Kröten, die von Fliegen, Grillen, Heuschrecken, Küchenschaben, Spinnen und Raupen umgeben waren. Er spülte das alles mit brennendem Branntwein hinunter, und zum Nachtisch aß er vier große Kerzen, die auf dem Tisch standen, die seitlichen Hängelampen samt ihrem Inhalt und schließlich die große Mittellampe mit Öl, Docht und allem Drum und Dran. Deshalb versank der Raum in Dunkelheit, aus der nur Dufours Gesicht in einem Gewirr züngelnder Flammen hervorglänzte.«13
Dufour markiert den Übergang des Allesschluckers vom einfachen Schausteller und Freak zum Profi. Er kombinierte seine Gabe, alles schlucken zu können, mit Spezialeffekten und Humor. Die Zirkus -Ikone Paula Busch berichtet in ihren 1957 erschienenen Memoiren »Das Spiel meines Lebens« von einer Zirkusnummer, die als »das lebende Aquarium« bekannt wurde. Einer der wichtigsten Darsteller war ein gewisser Herr Max Wilton. »Die Aufführung war mit starken Effekten gewürzt, genauso wie das Plakat, auf dem sich Wilton als Frackkavalier zeigte. Sein Frackhemd leuchtete wie die Scheibe eines Aquariums, hinter der sich Herrn Wiltons Inneres offenbarte: Zwischen den Rippen des Gentleman spielten wie zwischen Korallenriffen muntre Fische, tummelten sich Molche und züngelten Miniaturseeschlangen.«14
Bild 2
Das war natürlich etwas übertrieben, deutete aber an, was genau Herr Wilton auf der Bühne zeigte: Er fischte sich lebende Fische und Amphibien aus einem kleinen Becken und schluckte sie hinunter. Danach trank er mehrere Liter Wasser, wartete eine Weile und ließ die Fische in seinem Bauch schwimmen. Er rauchte genüsslich eine Zigarette, ließ weitere Zeit verstreichen, holte dann ein Tier nach dem anderen wieder heraus und spie zum krönenden Abschluss das Wasser als Fontäne ins Publikum. Ein Kollege von ihm, Mac Norton, auch Allesschlucker beim Zirkus Busch, schloss seinen Akt mit den Worten: »All alive and still kicking.« Und als er im Alter von siebenundsiebzig Jahren starb, war er stolz darauf, dass nie ein Tier bei seinen Tricks gestorben war.
Aus ästhetischen und humanitären Gründen ist das Allesschlucken heute keine Zirkusattraktion mehr. Während in den zwanziger und dreißiger Jahren kein Allesschlucker im Zirkus oder bei Vaudeville Shows fehlen durfte, sind heute einzig die Schwertschlucker noch auf der Bühne anzutreffen.
ILLUSTRATION: Der Allesschlucker Mac Norton, auch bekannt als das menschliche Aquarium, mit Kostproben seiner Kunst. Das Motiv ist angelehnt an ein französisches Originalplakat, das mit folgender Aufschrift versehen ist:
»Mac Norton
The Aquarium Man
I say I am an extraordinary scientific phenomenon like the quadruped mammal with four stomachs (the cow).
I drink a punch bowl of water containing 220 liters in 2 hours 30 100 glasses of beer in 10 minutes.
I eat 208 loaves of dry bread of 1 pound each in 48 hours.
I swallow fishes, turtles, frogs, water snakes alive by the dozens.
I keep them not more than 2 hours in my stomach, just as Jonah in the whale, then I return them alive, even more alive than ever in their respective aquariums.«
Hintergrund: Illustration aus »Meyers Konversationslexikon«, Darstellung der Eingeweide des Menschen, Chromlithographie.
AMEISLER
Person, meist männlich, die Ameisenpuppen sammelte, sie trocknete und sie als Vogelfutter oder Medizin verkaufte
ERKENNUNGSZEICHEN: bäuerliche Tracht, Strümpfe weit hochgezogen, um Ameisenbisse zu vermeiden
AKTIVE ZEIT: in Mitteleuropa bis in die zwanziger Jahre, in Niederösterreich sogar bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts
Das Gewicht aller Menschen auf der Erde ist heute größer als das aller Ameisen. Bis vor Kurzem war es umgekehrt; da wogen die Ameisen mehr. Es wäre jetzt einfach, die Schuld auf die Ameisler zu schieben. Dieser etwas drollig klingende Name bezeichnete eine Berufsgruppe, die vor allem in Niederösterreich, aber auch in anderen mitteleuropäischen Regionen in den heimischen Wäldern Ameisenhaufen »ernteten«. Ameisler waren auf der Suche nach Ameisenpuppen, die als Vogelfutter angeboten wurden und mit denen sich guter Gewinn erzielen ließ.
Es ist wohl wahr, dass der Beruf des Ameislers spätestens in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts von den Forstbehörden verboten wurde, da er in die Ameisenbestände eingriff und das andere Gewicht, nämlich das ökologische Gleichgewicht, belastete. Aber die Aktivität des gemeinen Ameislers war nichts im Vergleich zur Bevölkerungsexplosion der Spezies Mensch, der er angehörte und die mit ihren geschätzten 6,9 Milliarden Bewohnern seit wenigen Jahrzehnten vermutlich mehr wiegen, als die geschätzten 10 bis 100 Billiarden Ameisen15 dieses Planeten.
1886 schrieb der österreichische Heimatdichter Peter Rosegger über den Ameisler:
»Da kannst du im Walde einem sonderbaren Mann begegnen. Seinem zerfahrenen Gewand nach könnte es ein Bettelmann sein, er trägt auch einen großen Sack auf dem Rücken; aber über diesem Bündel und an all’ seinen Gliedern… laufen in aller Hast zahllose Ameisen auf und nieder, hin und her.«16
Präziser wird das Buch »Das deutsche Land – geografische Charakterbilder aus den Alpen, dem Deutschen Reich und Deutsch-Österreich« 17 von 1892. Hier findet sich eine weitere Stelle über den Homo Ameisler:
»Der Ameisler ist eine Charakterfigur im Gebirge. Er durchstreift die Wälder, in denen die schwarze Ameise Abfälle von Nadelholz und Pflanzenteilen in solchen Mengen zusammenträgt, dass diese Haufen eine Höhe mitunter von einem Meter erreichen. In ihnen birgt das Tier seine Puppen, die sogenannten Ameiseneier. Diese sucht der Ameisler auf, und seine feine Ausbeute ist in manchen Sommern so beträchtlich, dass die Händler aus Wien sie ihm mit 200 Gulden bezahlen.«18
Wann genau der Ameisler die Bühne der Weltgeschichte betrat, ist unklar. Da er die Ameisenpuppen, die fälschlicherweise oft als Eier bezeichnet werden, als Vogelfutter anbot, muss er mit der Mode der Käfigvogelhaltung aufgekommen sein. Es gibt Werke, die über den babylonischen Vogelfang berichten; doch landeten die Vögel damals noch im Kochtopf und nicht im Vogelbauer. Danach taucht der Käfigvogel erst wieder in Beschreibungen und Gemälden der Renaissance auf. 1444 berichtete ein Italiener von einem Besuch in Wien:
»Der Bürger Häuser sind hoch und geräumig … die Vögel singen in den Stuben.«19
Und sehr viel später, als Mozart mit seinem Vogelhändler Papageno eine unvergessliche Figur kreierte, muss die Stubenvogelhaltung auf ihrem Höhepunkt gewesen sein:
»Die Wiener, besonders die Frauenzimmer, sind außerordentliche Liebhaber von Singvögeln … In allen Fenstern hängen schöne Käfige mit Nachtigallen, Kanarienvögeln, Gimpeln, Amseln, Lerchen und anderen Singvögeln«, wie ein Zeitgenosse Mozarts schreibt.20
Die Familie Mozart selbst besaß Kanarienvögel, Meisen, Rotkehlchen und Grasmücken. Und ja, in einer Rechnung aus dem Hause Mozart tauchen auch die Ameisenpuppen auf.21