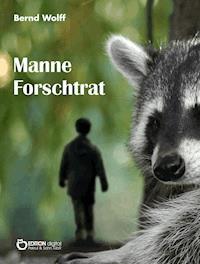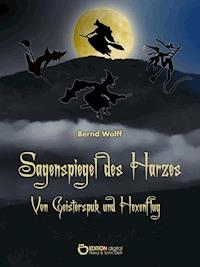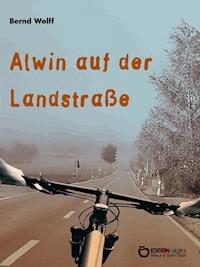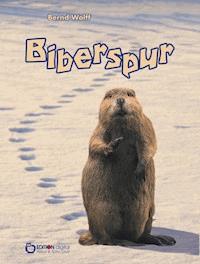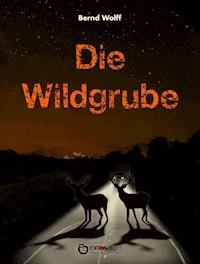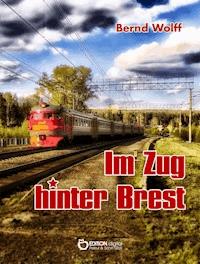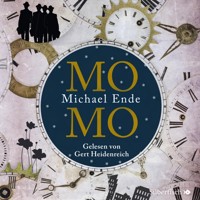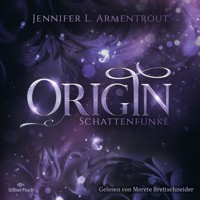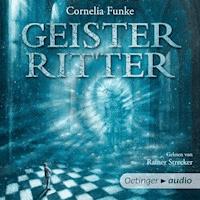5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Romanik, das sind für uns zerfallende Burgen, Klosterruinen mit idyllischen Kreuzgängen, massige Dome und wuchtige Wehrkirchen. Das sind merkwürdig starre Plastiken, kaum Bilder, kostbare handgeschriebene Bücher in den Museen. Romanik, das ist tausend Jahre her. Auch damals lebten Menschen, arbeiteten, liebten und hassten und veränderten die Welt. Wir erfahren von Landleuten und Bergknappen, Köhlern, Erzgießern, von Salzsiedern und Zeidlern, von Fürsten und Kaisern, und eine versunkene Zeit wird lebendig. LESEPROBE: Vinz bekam plötzlich Sehnsucht nach der Bauernarbeit, als er das Gerät sah. Er hatte das Land gesehen, es war fruchtbares Schwemmland, das man allerdings wegen der häufigen Überschwemmungen in den Niederungen fast ausschließlich als Rinderweide oder Grasland nutzte. Die Unstrut floss hier träge, in vielfachen Windungen, ihre Ufer waren mit Erlen und Weiden und allerlei Gesträuch gesäumt. Graureiher fischten dort ebenso wie der Otter, Biber errichteten Knüppeldämme quer durch und stauten das Wasser, dass es schwoll (in dem Namen steckt die Wurzel strut, was soviel wie schwellen, strotzen, strudeln bedeutet), in den krautigen Uferzonen voll Gilb- und Blutweiderich, Zaunrübe und Igelkolben, Wassernuss und Froschlöffel lebten Frösche und Schlangen, nisteten Bart- und Beutelmeisen, Blaukehlchen, Eisvögel. Wiedehopf und Steinkauz brüteten in den Höhlungen der Bäume, und auf den kahlen Kalkfelsen des Wendelsteins hatte eine Kolonie des Waldrapps ihre liederlichen Nester. Um diese Zeit allerdings waren die merkwürdigen storchenähnlichen Vögel mit dem metallisch schillernden schwarzen Gefieder und dem säbelförmigen Schnabel, dem glatten roten Kopf schon längst in ferne Länder gezogen. Obwohl es eine unvorstellbar reiche Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten gab, der Fluss von Fischen, Krebsen und Wasserinsekten wimmelte, von den Höhenzügen düstere Wälder herüberrauschten, trug doch die Gegend unverkennbar das Gepräge von Menschenhand. Die Wiesen im Überschwemmungsbereich waren sorgfältig gepflegt; wurden sie beweidet, so war es die Aufgabe der Frauen und Kinder, von den Kühen stehengelassene Horste von Disteln und Nesseln zu reuten und zu ebnen, dass sich keine Blüten bildeten, desgleichen mussten Maulwurfshaufen gebreitet und die zerstampften Bereiche der Tränken geharkt und aufgeschüttet werden. Wurden sie gemäht, benutzten die Bauern eine zweigriffige Sense mit langem, über die Schulter reichendem Baum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Bernd Wolff
Von Klöstern und Burgen
Ein Kulturbild aus der Zeit der Romanik
ISBN 978-3-95655-045-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1986 bei Der Kinderbuchverlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Detlev Komarek
Die Schwarz-Weiß-Abbildungen sind spätere Nachzeichnungen der farbigen Bilderhandschrift »Hortus deliciarum der Herrad von Landsperg«, um 1175-1185
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Vorbemerkung
Kirchen mit wuchtigen Türmen,
Schwärme unruhiger Dohlen,
Rundbogenfenster, verstohlen
spähend ins Land unter Stürmen,
die ließen von Klöstern Ruinen,
von wehrhaften Burgen nur Mauern
und Wälle und Gräben dauern
im Kampf zwischen Herrschen und Dienen.
Und auf den morschen Zinnen grünen Birken,
als könnte mitten im Vergehen
des Menschen Frohsinn weiterwirken ...
Das meiste von damals hat die Zeit getilgt: Wälder sind gewichen, Burgen gebrochen, Türme fielen in Trümmer, Klöster klaffen zerstört, Buden brannten, Grabsteine stürzten. Was blieb von den Menschen, die damals lebten? Weniges von ihrem Werk. Und wir.
Damals - das ist die Zeit der Romanik. Spätere Jahrhunderte haben diese Bezeichnung dafür gefunden, als man zu sortieren begann, was welcher Epoche zuzuordnen sei.
Heute stehen wir manchmal mitten in den lauten Städten still und betrachten eine Kirche mit massigen grauen Mauern und entdecken vielleicht ein in den Stein geschlagenes Gesicht oder eine Tierfigur, einen Adler, einen Löwen. Da werden wir nachdenklich.
Oder wir steigen ganz früh, eh noch der lärmige Besucherandrang einsetzt, im jungen Maiengrün zur Wartburg hinauf, atmen tief die taufrische Luft, freuen uns auf das Betreten von Pallas und Turm, und plötzlich geht es uns durch den Sinn, wie es wohl damals gewesen sein mag, als noch Ritter diesen Berg hinaufreisten. Buchen wird es gegeben haben und Grün und Finkengeschmetter, wie aber waren die Menschen, unsere Vorfahren? Was dachten, was fühlten, was taten sie? Wie verbrachten sie ihren Tag? Wie gingen sie miteinander um?
Der mächtigste Mann im Reich war der Kaiser
Der Kaiser
Ihm brachte man Geschenke, um sein Wohlwollen zu erringen, von ihm empfing man Macht und Besitz als Lehen, aber ihn bekämpfte man auch. Das Reich war groß, und Gegner gab es nicht nur an den Grenzen.
Unentwegt war der Kaiser mit seinem Gefolge unterwegs im Lande, um Streitigkeiten zu schlichten, Huldigungen zu empfangen, Recht zu sprechen, selber nach dem Rechten zu sehen, sich des Gehorsams seiner Untergebenen zu versichern.
Der Kaiser hatte dazusein. Wo er nicht war, da waren seine Stellvertreter oder seine Gegner. So reiste er von Speyer nach Merseburg, von Magdeburg nach Bamberg, von Regensburg nach Goslar, er reiste nach Oberitalien in die Lombardei, nach Ferrara und Sutri und Ravenna und Turin.
Kaiser wurde ein deutscher König dann, wenn er vom Papst in Rom feierlich dazu gekrönt wurde. Zeitweilig setzten die deutschen Herrscher die Päpste, die ihnen zu Willen waren, selber ein.
Das Land war damals noch zu großen Teilen von Wäldern bedeckt, die besonders in den Gebirgen dicht und undurchdringlich wucherten. Flüsse zerfaserten sich in zahlreiche Nebenarme, Sümpfe überzogen die Niederungen. Trotz Heeres- und Handelsstraßen war das Reisen beschwerlich.
Um sich erholen zu können, um Ehrungen und Treuegelöbnisse der Lehnsleute des umliegenden Gebiets zu empfangen, um regieren zu können, hatten die Kaiser und Könige überall im Lande Pfalzen, Königsburgen, errichtet, in denen sie sich jeweils Tage, Wochen, ja sogar Monate aufhielten.
Ein Rüdemann reist durch das Land
Der Kaiser reist durch das Land
Er ist Laienbruder aus dem Kloster St. Hubertus in den Ardennen und hat den Auftrag seines Abtes auszuführen, dem Kaiser eine Koppel der berühmten Hubertusleithunde als Geschenk zu überbringen.
Der Abt seines Klosters hat ihn ausgesucht, weil er einen wachen Verstand hat, sich schnell zurechtfindet, weil er jung und kräftig und weil er ein Hundenarr ist.
Im Kloster hatte er die Aufgabe, die Zucht zu überwachen und die Tiere abzuführen, was bedeutet: abzurichten.
Der Hubertusleithund ist klein und schwarz, kurzhaarig, er stammt von der alten Keltenbracke ab, hat lange Behänge (Ohren), der Schwanz ist nicht kupiert. Er hat die Aufgabe, das Großwild aufzuspüren, also Hirsch oder Schwein, er hat eine hervorragende Nase, mit der er selbst kalte, ältere Fährten halten kann, ist ausdauernd und arbeitet, ohne Laut zu geben. Er ist ein Jagdhund, der das Wild bestätigt. Zum Hetzen werden Windhunde eingesetzt. Alle Tiere der Klostermeute wurden mit einem Brandsiegel, dem Hubertusschlüssel, auf der Stirn gekennzeichnet. Bei der Art Jagd, die von Kaiser, Fürsten und hohen Würdenträgern betrieben wird, sind sie von unschätzbarem Wert. Es ist ein kostbares Geschenk, für das Vinz die Verantwortung trägt.
Der heilige Hubertus war vor der Zeit Kaiser Karls des Großen Bischof in Lüttich gewesen. Man sagte ihm nach, dass er ein leidenschaftlicher Jäger gewesen sei, der selbst an Fest- und Feiertagen dem Wild nachstellte. Eines Tages sei ihm ein Hirsch mit einem Kreuz zwischen dem Geweih erschienen und habe ihn zu Einkehr und Buße bewegt. So wurde er zum Schutzpatron der Jäger.
Das Kloster St. Hubertus befindet sich nur drei Tagesmärsche südlich von Lüttich. Zu Ehren seines berühmten Namenspatrons hat es sich der Zucht der berühmten Hubertusleithunde verschrieben.
Ein Kloster war damals geistiges und verwaltungsmäßiges Zentrum eines Gebietes, es sorgte nicht nur für die Verbreitung und Ausübung der kirchlichen Lehre, es förderte auch Handwerk und Wissenschaften, erhob Abgaben, vertrat das Recht.
Zu den Klöstern gehörten sowohl Mönche und Priester als auch Laienbrüder, die in den verschiedensten Gewerken tätig waren, und bewaffnete Klosterknechte. Von hier aus verbreiteten sich Neuerungen in der Bodenbearbeitung, der Viehzucht, die Erkundung, Förderung und Nutzung der Bodenschätze, die Kenntnis der »Sieben Freien Künste des Marcianus Mineus Felix Capella«. Dazu gehörte die über allen stehende Philosophie, die Ethik, Physik und Logik umfasste, ferner die Sprachfächer Grammatica, Rhetorica, Dialektica, ferner Musica, Arithmetica, Geometria, auch Astronomia. Die Kaiser erkannten die Bedeutung dieser Bildungszentren für ihr Reich. Sie förderten und fürchteten gleichzeitig die Kirche und ihren riesigen Klosterbesitz.
Der Rüdemann ist schon wochenlang unterwegs. Zuerst gelangte er über das menschenleere und an Mooren reiche Hohe Venn und durch die karge Eifel nach Köln, von dort nach Worms, von da nach Bamberg. Mit einem Treck Bergleute aus dem Fichtelgebirge, die in den Harz wollten, erreichte er Erfurt, zog weiter ins Unstruttal. Aber überall, wohin er kam, hatte der Kaiser den Ort schon wieder verlassen, musste er sich aufmachen und ihm nachreisen.
Er ist jung, der Rüdemann Vinz, er hat noch nie eine so weite Reise unternommen, und ihm ist eingeschärft worden, dem Kaiser die Hunde tadellos abgerichtet und mit glänzendem Fell, also im Bestzustand, zu überbringern
Aber nach so langen Wochen erscheinen sie verwildert und ruppig, er selbst ist, trotz des Geleitbriefes, der ihm Türen und Tore öffnet, am Ende seiner Kräfte. Er muss dringend einige Tage rasten.
Auf seiner Fahrt führt er fast kein Gepäck bei sich. Angetan ist er mit der Klostertracht, einer Kutte aus grobem Sackleinen, mit einem hänfenen Strick gegürtet. Darunter zu Schutz und Sicherheit während der Fahrt einen leichten Federkoller. Er trägt eine eng anliegende wollene Hose und halbhohe Schlupfschuhe aus Rindsleder. Bewaffnet ist er lediglich mit einem zwei Meter langen, derben Knüppel, den er zum Wandern benutzt und mit dem er sich hervorragend zu verteidigen versteht, außerdem hat er ein knapp ellenlanges feststehendes Messer bei sich, mit dem er den Hunden die Nahrung zerteilt. Die trägt er in einem Sack, in dem sich außerdem Wegzehrung für ihn selbst befindet und eine zusammengerollte feinere Kutte, in der er vor den Kaiser treten soll.
Die Hunde führt er an Lederriemen, unterschiedlich gestaffelt; mit einer leichten und sehr langen Hundepeitsche sorgt er für Ordnung im Gespann.
Er ist auf seiner Reise darauf angewiesen, von Klöstern oder Königshöfen aufgenommen und versorgt zu werden. Der Geleitbrief, den ihm der Abt des Klosters St. Hubertus in den Ardennen mitgegeben hat, ist sein wichtigster Ausweis.
Die Reise ist beschwerlich. In menschenleeren Tälern, in Waldgebirgen kam es häufig genug vor, dass er keine Herberge fand und unter freiem Himmel übernachten musste, dass ihm das Hundefutter ausging und er selbst auf Beeren und Wurzeln angewiesen war.
Bischof
Bei einem Köhler
Mönch
Bei einem Köhler musste er in finsteren Wäldern eine ganze Woche zubringen, weil einer der Hunde sich verletzt hatte und die Wunde erst ausgeheilt werden musste. Er half dem schwarzen Mann bei der Arbeit.
Der Köhler errichtete einen Tannenmeiler, dazu wurden die Holzscheite sorgfältig senkrecht um Mittelstangen geschichtet, zu zwei bis drei Stücken übereinander, nach außen zu immer schräger gestellt, um ein Zusammenstürzen zu verhindern.
Vinz half beim Bedecken mit grüner Tannenhecke, mit altem Laub, Torfmoos, Farnkraut, in die der Köhler immer wieder mit dem Stiel der Stechschaufel Zuglöcher bohrte, zum Schluss wurde das Ganze mit Ofenleimerde und Grassoden handbreit beworfen. Diese Arbeit war besonders gewissenhaft auszuführen, denn es kam bei nachlässigem Vorgehen vor, dass sich ein Meiler »schüttete«, sich entzündete und mit lautem Knall barst, es kam vor, dass er »durcheimerte«, wenn das Feuer die Oberfläche erreichte, oder auch, dass er »blindkohlte«, völlig zu Asche zerfiel, wenn nicht ausreichend Räume für den Luftzug geschaffen waren.
Zum Schluss drehte der Köhler den Richtstock heraus und setzte den Meiler mit der Steckrute in Brand. Das war eine an der Spitze gespaltene Zündstange, in die man Harz, Birkenrinde, Zunder gekeilt hatte. Wenn es anfing zu qualmen, wurde die Steckrute herausgezogen und das Zündloch verstopft.
Ein kohlender Meiler musste Tag und Nacht beobachtet werden. Es kam vor, dass er sich setzte, dann musste er, was besonders gefährlich war, durch die geöffnete Haube nachgefüllt und mit dem Wahrhammer zugekeilt werden. Um hinaufzugelangen, benutzte der Köhler eine kurze Leiter, die an den Meiler gelegt wurde.
Er selbst lebte allein in seiner zeltartig aus schwachen Stangenhölzern errichteten und mit Grasplacken bedeckten Hütte, der Kote; sein Gehilfe, der Kohlenjunge, war mit einem zweirädrigen Kastenwagen, der von einem struppigen kleinen Pferdchen gezogen wurde, unterwegs, um die Kohlen an die Hüttenleute abzuliefern.
War es notwendig, Hilfe zu holen oder eine Nachricht zu übermitteln, so schlug der Kohlenbrenner auf ein hohl gelagertes Bohlenbrett, die Hillebille; der Klang trug bis zur nächsten Kohlenstätte, dem Hai (von Hauung).
Der Köhler hatte den verletzten Hund mit Kohlensaft, einem ablaufenden Destillationsprodukt aus dem gärenden Meiler, behandelt. Er wusste darüber hinaus eine Menge Heilmittel und Heilkräuter zu finden und zu handhaben, der Wald war voll davon. Ringsum flimmerte das Hai von Weidenröschen oder Feuerkraut, in den halbschattigen Beständen wucherte die Tollkirsche; Bilsenkraut, Fingerhut, Holunder, Wacholder und alle Wiesenkräuter von Arnika bis Salbei und Zinnkraut wurden gesammelt und verwertet.