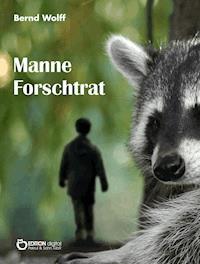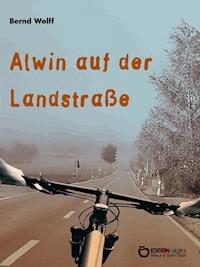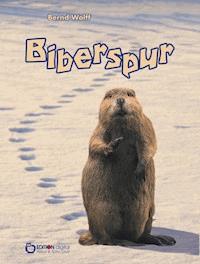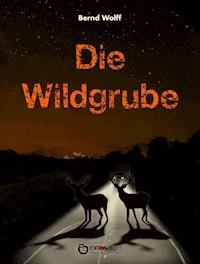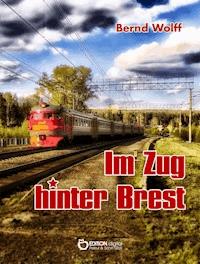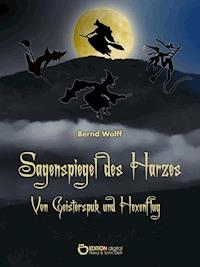
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Teufelsmauer, Roßtrappe, Hübichenstein, Brocken – so vielfältig wie die Landschaft des Harzgebirges sind seine Sagen, in denen sich Denken und Hoffen, Freude und Schrecken, Leid und Zuversicht widerspiegeln. Dieses Sagenbuch, in dem Bernd Wolff die alten Begebenheiten auf eigene poetische Weise und mit der nötigen Portion hintergründigen Humors nacherzählt, hilft dem Leser über das Vergnügen am Text hinaus, die mündlichen Überlieferungen in ihrem historischen Zusammenhang zu begreifen. Dazu werden auch mitunter schriftliche Quellen herangezogen. Deshalb sind die Sagen nicht wie üblich nach Ortschaften, sondern nach Themenkreisen geordnet. Hüttenkobolde und Zwerge, Götter und Riesen, Hexen und der in diesen Bergen besonders präsente Teufel, Bergleute, Schatzsucher, Reiche, Arme und Geprellte sowie gruselige Nachtgeister bevölkern die Seiten. Jedes der übergeordneten Kapitel wird eingeleitet durch ein Zitat aus Goethes «Faust», das zeigt, wie dieses Nationalepos unserem Gebirge besonders verbunden ist. So stellt sich unschwer die Verbindung von Volksdichtung und klassischer deutscher Literatur her, die beide aus einem Born geschöpft sind. Da bei der Liqidation der Druckerei die Druckunterlegen verloren gingen, war es bisher nicht möglich, dieses begehrte Sagenbuch von 1997 wieder aufzulegen. EDITION digital legt hiermit zur Freude der Leser die E-Book-Fassung vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Bernd Wolff
Sagenspiegel des Harzes
Von Geisterspuk und Hexenflug
ISBN 978-3-86394-187-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1997 bei Jüttners Verlagsbuchhandlung Wernigerode
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Detlev Komarek
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Von Geisterspuk und Hexenflug
Wie Wasser in den Vertiefungen der Wege, so sammelten sich im Harz die Sagen vor allem nach überstandener Unbill - fast hätte man Schaden genommen, woran lag es? Fast wäre einem das Gold über den Weg gerollt - warum nur passierte es nicht, wo man Furcht und Beschwörungen auf sich genommen hatte? Den Nachbarn hatte es getroffen - womit hat er sein Glück verwirkt? Im Harz war das Leben besonders hart, lagen die Siedlungen weit auseinander, Wälder voller Geheimnisse, in denen noch der Königsbann galt. Besonders verwegene Kerle hausten im Schutz der Schluchten: Vogelfreie, denen kein Gesetz heilig war, Räuber und Wegelagerer, Wilddiebe auf der Fährte des königlichen Hirsches, Finkenhanse mit Netz und Leimrute, Erzscharrer mit Schlegel und Kratze, Heiden, die dem alten Glauben anhingen. Wehe dem, der ohne sicheres Geleit die alten Pfade zog, die Heerstraßen, die Königswege durch Wildnis und Furten! Wehe, wenn er an eine Räuberburg kam statt zur einsamen Klause und Zelle, wenn er ins Elend geriet!
Auf der Höhe orgelt der Sturm. Unten zur Harzkante hin lauscht alles atemlos, aneinander gefasst; droben bricht in wilder Wut das Wetter über kahle Kuppen her, faucht durch Wipfel, reißt Äste zu Boden, stürzt Stämme um, poltert Steine steile Hänge hinab. Am nächsten Morgen schimmern alle Berge weiß, als habe sich die Schleppe eines weiten Mantels darüber verfangen.
Nach solchen Nächten wusste man zu sagen, der Wilde Jäger sei über den Harz getobt, Wotan, der Wütende, in all dem Fauchen und Donnern habe man Stimmen vernommen, Hetzlaute, Jiffen, Tutursels Ruf. Im weißen Umhang, im roten Umhang, wenn blutend die Sonne aufging, sei er dahergefegt, dem im rasenden Gewölk sich verbergenden Gold-Eber hinternach, auf Sleipnir, dem achtfüßigen Schimmel Schleifer, der alle Kuppen rundschleift. Frau Holle, auch Harke, in seinem Gefolge, Hüterin des Totenreiches, wehe, wer ihr ins Angesicht schaut! Sie wird ihm zeigen, was eine Harke ist. Zur Wintersonnwend, in zwölf hilligen Nächten, braust die Wilde Jagd daher; wer es wagt, ihr zu trotzen, wird überrannt, mit stinkender Pferdelende beworfen, ein Jahr lang anhaftend, dass man aussätzig ist und gemieden. Furcht vor Naturgewalten, lebendig in dunklen Stuben voller Qualm. Der rauschige Eber der Dezembernächtem, das Pferdeopfer auf hoher Klippe kehren in heimlich weitergeflüsterten Sagen wieder. Blut dampfte in der ovalen Vertiefung der Rosstrappe und taute das Eis an den Rändern, im Osten stieg Ostara, die Strahlende, über Berghänge und übersprang den Abgrund, ihre Lichtkrone erhellte die Tiefe, wo Schmelzwässer kochten und brodelten. Der dunkle Winterschlag schlug als Graupelwetter und Hagelwolke zu Grund und verwandelte sich in den schwarzen Hund. In den Sagen mischten sich Bruchstücke verwehter Mythen mit der neuen Lehre, noch entzündete man Jahr für Jahr Osterfeuer auf den Höhen, noch ging man schweigend Osterwasser, das heilige wiedererweckte wiedererweckende Lebenswasser, zu schöpfen. Wer schweigt, hört auf die Stimmen der Bäche.
Doch der Brocken - wer war schon auf dem Brocken? Ganz Verwegene, die sich bis in die Nähe vorkämpften, fanden Bäume mit verdrehten Ästen und zottigen Flechtenbärten, fanden hin gepolterte Granitblöcke, als hätten Riesen damit gewürfelt, gerieten in tückisches Moor oder waren unversehens von Schwaden ziehender Nebelhexen umgeben, die einen kichernd in die Irre führten, und wen es besonders schlimm traf, den glotzte mit gesenkten Hörnern und rotunterlaufenen Lichtern ein Auerochs aus dem Dickicht an, ein Ur, ein Herr Urian. Aber die klaren Granitgrusbäche glitzerten und glimmerten wie Gold, in den Moorlöchern stand rostig schillernd die Lache, die Eisen verhieß; immer wieder galt es die Angst zu überwinden, stets lockte das Abenteuer.
In den Tälern dagegen wuchsen Ortschaften - die Enge der Gassen, in denen man sich kannte und doch nicht kannte, Geflüstertes und Weitergeflüstertes: droben auf den Schlössern, fern vorm Tor, nachts auf dem Markt... Unerklärliches, jemand war mit dickem Kopf gestorben, wer hatte wen umgebracht, dort und dort ging es nachts um. Fremde tauchten auf, verständigten sich mit geheimen Zeichen, wer ihnen nachschlich, kam nach Jahren verändert aus ferner Gegend wieder. Die Reichtümer der Tiefen zerrten an einem, das Dunkel des Bergwerks, in dem die Unschlittfunzel nur ein paar Schritte reichte, was war dahinter? Abends, in den flackernden Räumen beisammen. Sagen. Weitersagen. Sagen.
Von Hüttenkobolden und Zwergen
„Da trippelt ein die kleine Schar, Sie hält nicht gern sich Paar und Paar; Im moosigen Kleid mit Lämplein hell Bewegt sich's durcheinander schnell, Wo jedes für sich selber schafft, Wie Leucht-Ameisen wimmelhaft..."
Goethe: Faust II
Über das Vorhandensein von Zwergen
In alten Zeiten, als das Berühren eines Buckligen noch Glück brachte, fanden sich allenthalben Zwerge im Harz. Abseits von den Menschen lebten sie ihr stilles Leben in Höhlungen und Löchern und ließen sich nur im Notfall blicken. Wer auf gutem Fuß mit den Hausgeistern stand und ihnen abends oder zu Feiertagen Milch und Brot vor die Tür stellte, dem gaben sie sich auch zu erkennen, borstig wie Igel, mit aufmerksamen Mardergesichtern, rotpelzigen Fuchsmützen, grämlich-breiten Dachsnasen. Mit klugen, urweisen Augen wie Steinkäuze oder Uhus. Dem wühlten sie mitunter Schätze zutage, Katzengold und Bachedelsteine, Tongeschirr aus verschütteten Tagen, Steigbügel oder Sporen, uralte, grünspanige Münzen. Sie kannten sich in der Erde aus und nutzten die feinsten Spalten und Gänge, wo große Bergleute hoffnungslos stecken geblieben wären. Desgleichen kannten sie alle Heil- und Zauberkräuter. Und sie verstanden die Kunst, sich von einem Augenblick auf den anderen unsichtbar zu machen, so dass man die Augen rieb und nicht wusste, hatte man sie nun erblickt oder nicht.
Sie hielten sich fern von menschlichen Siedlungen, doch in erreichbarer Nähe; sie lebten an Flussläufen und dort, wo Erze zu vermuten waren; im Ausgraben, Schmelzen und Schmieden blieben sie unübertroffene Meister. Sie waren so breit wie hoch, gedrungene, kurzhalsige, kurzbeinige Gesellen, die sich auf geheime Zeichen und Künste verstanden und die Nacht zum Freund hatten. Sie trugen zipflige Ohrenmützen wie die Bergknappen, Lederschürzen und unterm Knie gebundene Hosen mit Hinterleder, so konnten sie nirgends hängen bleiben. Man wüsste nichts von ihnen, wenn sie sich nicht immer wieder zu den Menschen hingezogen fühlten, denen sie halfen und deren Hilfe sie brauchten, mit denen sie auch zuweilen ihren Schabernack trieben und die sie bestahlen, was letztlich zum Zerwürfnis führte.
Der Keller im Heidelberg bei Helsungen
Die feste Stadt Blankenburg, geschützt durch einen mächtigen stachligen Mauerring und bewacht von einer Burg hoch droben auf dem blanken Stein, bezog ihr Baumaterial aus dem Heidelberg, über den wie ein schartiger Hahnekamm die Teufelsmauer hinlief, die sich hinstreckte bis zu den Dorfstellen Timmenrode und Helsungen und später, hinter Thale, noch einmal auftauchte. Dort am Heidelberg, in der Gegend des heutigen „Fuchsbaues" und der Gewittergrotte, entdeckte man eines Tages einen Keller, in dem, nach der Anzahl der Stühlchen und Bettchen gerechnet, zwölf Männerchen leben mussten, die aber verschwunden blieben, nur ein dunkler Gang gähnte noch im Hintergrund. Da man sich selbst nicht hineinwagte, der Durchschlupf für einen Menschen auch viel zu niedrig war, setzte man eine Ente hinein und lauschte, bis sich ihr klägliches Naken in der Finsternis verlor. Wie wunderte man sich aber, als man dieselbe Ente zwei Tage später auf dem Schlossteich wieder fand, auf dem sie, sich immer und immer wieder putzend, umherschwamm. So musste es also einen Gang unter der Teufelsmauer entlang, unter dem Hirschtor hinweg und auch in der Tiefe des Herzogsgartens unter dem Vogelherd hinauf in die Nähe des Schlossteiches geben, durch den die Kerlchen vielleicht das im Großen Schloss stiebitzte Geschirr hinabgeschafft hatten, einen Gang von immerhin sechstausend Fuß Länge, was etwa zwei Kilometern entspricht. Besonders der immer wieder des Diebstahls bezichtigten Dienerschaft war daran gelegen, dass die Sache aufgeklärt würde, doch war der Keller bereits den Steinhauern zum Opfer gefallen, und die zwölf Männchen blieben unsichtbar.
Das wüste Dorf bei Blankenburg
Ebenso erzählte man, vor allem den Kindern, dass seit ihrer Vertreibung aus Thale eine Menge Zwerge in den wüsten Dörfern auf dem Platenberg, unmittelbar vor der Felsenburg Regenstein, zugange wären, so dass es nicht ratsam sei, in der Gegend zu spielen. Denn dass Zwerge es auf Menschenkinder abgesehen hätten, das kannte man zur Genüge, das betraf vor allem die zwergenhaft kleinen Neugeborenen. Das Pack tat sich vor allem an den Feldern der Bauern gütlich, und am Morgen fanden sich massenhaft zerwühlte Breiten, Gänge die kreuz und die quer, ausgepahlte Hülsen und geknickte Ähren, so dass man nicht umhin konnte, mit Fallen und Peitschen und nächtlichem Lärm die Bande zu vertreiben. Noch lange Zeit später aber pflügte man dort Tonscherben von Tellern und Krügen hoch, die sich die Zwerge aus den Stadthäusern zusammengestohlen hatten, denn dass die Bürger ihren zerbrochenen Unrat heimlich an die Waldkante verbrächten, war schließlich undenkbar.
Zipfelmützen im Kloster Michaelstein
Zwerge beobachtete man dann noch etliche Male am Kloster Michaelstein, den Goldbach hinauf in der Senke zwischen den Bergen, wo man ihre Kapuzen hinter den Mauern entlangziehen sah und Spatenklirren vernahm, doch auch dort waren sie schließlich verschwunden, und das Kloster verfiel, wurde zur Papiermühle, zum Vorwerk.
Zwergenspuren an der Bode
Besonders zahlreich fand sich das Zwergenvolk am Bodefluss, an dessen Ufern sich mancherlei Ausspülungen, Höhlen und unterirdische Gänge auftaten, die oftmals direkt zu Erzen und Edelsteinen hinführten. So ein Fluss lebte für sich, schmeichelte und tobte, werkte und zerstörte, sprach beständig vor sich hin mit mancherlei Stimmen, flüsternd und donnernd. Zuweilen passierte es, dass hier der zottige Petz stand und nach Forellen und Lachsen griff, nicht mehr der riesige Höhlenbär von ehedem, doch wohl sein kleiner braunblonder Vetter. An den Ufern, auf den Kiesbänken fanden sich seltsame Spuren, die es sonst nirgends gab, und manch Angeschwemmtes, auch zerbeultes Zinngeschirr oder Schüsseln zum Goldwaschen, hing in den Zweigen. Auch konnte es passieren, dass es einem unversehens die Beine wegschlug und die Flut einen hinabtrug, und erst, wenn man um Hilfe bat und schrie und Gaben versprach, gelang es, eine krumme Wurzel - wie eine verdorrte Hand geformt - zu fassen und sich pudelnass herauszuziehen. Dann wieherte oder kicherte es höhnisch irgendwo im Gebüsch, im Wald, und man wusste Bescheid, dachte sich seinen Teil. Und schließlich, hinter dem Kästental, wurde die Bode so wild, so reißend, die Uferhänge ragten so schroff und steil, dass niemand sich durch die Talenge getraute, auch und schon gar nicht auf der Rolle Floßholz, die auf den Schmelzwasserwogen hinabritt und unten arg zerschunden wieder auftauchte. Aber man war ja nicht auf den Kopf gefallen und hatte Augen, zu sehen, und man sah untrüglich die Zeichen und Kerben, die Zwergmänner und Nickel dem Stamm geschlagen hatten.
Das Zwergenweiblein im Kreuztal bei Rübeland
Auch hier, an den Bodeschlingen, gaben sich die Quarge, wie man sie auch nannte, dadurch zu erkennen, dass sie zu den Menschen kamen, um Teller und Tassen für ihre Zwergenfeste zu erbitteln. So erging es einst einer armen Familie im Kreuztal bei Rübeland unter der Klippe des Krocksteins, deren einzige Tochter totsterbenskrank an der Pestilenz darniederlag. Zu denen trat eine Zwergenfrau ins Haus, knurzlig wie eine Wurzel, dick wie ein Baumstumpf. Sie wolle sich nur ein paar Teller und Löffel für eine Gastlichkeit ausborgen. Wie sie aber erfuhr, dass eine Pestkranke im Hause sei, tröstete sie voll Mitgefühl, es werde sich alles zum Besten wenden. Der Hausherr, während er ihr die schwere Last aufhuckte, tätschelte ihr den Rücken; er wollte ihr für den guten Zuspruch danken, doch er hatte keine Hoffnung für sein Kind. Als die Gnomin am nächsten Tag das geliehene Geschirr zurückbrachte, fand sich in einem Näpfchen etwas Zwergenspeise. Die solle man der Kranken einlöffeln. Kaum dass die den ersten Bissen geschluckt hatte, kam wieder Glanz in ihre Augen, und kurz darauf erhob sie sich wie neu geboren, wie aus einer Larvenhaut geschlüpft. So wurde sie aus Dankbarkeit der Familie und dem Liebsten wiedergegeben.
Das Zwergenloch bei Elbingerode
Ein Stück flussauf, im Mühlental von Elbingerode, wo der Rohrbach der Bode zurauschte, hausten seit jeher Zwerge in den warmen, löchrigen Kalkwänden, im Zwergenloche oberhalb der Mühle, die am Wasser geschäftig rumpelte. Mühlen waren dazumal verrufene Orte, mancherlei lichtscheues Gesindel fand sich außerhalb der geschlossenen Ortschaften ein, manch verbotene Ware ging von Hand zu Hand. Einmal sollte dort eine Hochzeit stattfinden, so groß und prächtig, dass das Geschirr im Hause nicht reichte. So ging man zu den Zwergen und lieh sich etwas von ihnen. Doch damit gaben sich die Brautleute in ihre Hand: nicht nur, dass ratzbatz die Speisen von den Tellern verschwanden, ohne dass einer der Gäste sah wohin, es wurde auch das Neugeborene vertauscht und ein hässlicher Wechselbalg in die Wiege gelegt, so unartig und ungehorsam, dass es unmöglich das eigene Kind sein konnte. Hatten die Zwerge nun ihre Teller zurückbekommen oder nicht, hatte man ihnen mit Speisen gedankt oder nicht, sie trieben es immer ärger: Mal hatten sie wie die Katzen ins Mehl geschissen, mal die Mahlgänge verstellt oder Steine hineingeworfen, so dass man den Zwergenkönig Echwaldus und seine Sippe gern loswerden wollte. Zwischen den Mühlen stand früher ein Stein mit drei Kreuzen, dort sollten die Zwerge der Kindesmutter ihren echten Säugling geraubt haben, den man später im Mühlgraben fand. Endlich gab jemand den Rat, eine Handvoll Kümmel in den Brotteig zu streuen, da war der Spuk zu Ende. Denn Kümmel wirkte auf die Zwerge wie das Weihwasser auf den Teufel. Das Zwergenloch aber wurde später, als man mit Maschinen dem Kalkgebirge zuleibe rückte, einfach mit abgebaut, und an seiner Stelle türmen sich heute triste Halden von bröckligem, Unterkorn genannten Kalkschotter. Auch die Mühle steht nicht mehr, und durch das Mühlental brausen auf der B 6 täglich und nächtlich Hunderte von Fahrzeugen, darunter pausenlos Schwerlaster, die das Gebirge davontragen, schlimmer als stiebitzende und Schabernack treibende Gnome.
Das Schwarzmännchen von Rothehütte
Ein junger Bursche, den sein täglicher Arbeitsweg von Elbingerode über die Höchte nach Rothehütte an der Bode führte, einem Ortsteil des heutigen Königshütte, widerfuhr es, dass ihn abends im Dämmerlicht ein Männchen mit einem schweren Stocke, der aussah wie brünniertes (brünniert: gebräunt) Eisen, ansprach und ihn bat, doch für einen Augenblick den Stock zu halten. Doch er traute dem Braten nicht und weigerte sich, worauf der Kleine verzagt sprach, dann müsse er's in sieben Jahren noch einmal versuchen. Die Zeit ging hin, der Junge war bei den Soldaten und kehrte dann in seinen früheren Beruf und an seine frühere Arbeitsstelle zurück, da stand ihm plötzlich wieder der Zwerg im Weg und bat ihn flehentlich, er möge ihm doch um Himmelswillen den Stab abnehmen, es solle sein Schade nicht sein, sonst müsse er noch fünfhundert Jahre umgehen. Niemand war weit und breit zu sehen, der Mond schien so fahl, und dem Burschen standen die Haare zu Berge. Er lief und lief, und wenn er keuchend innehalten wollte, hörte er das schwarze Männchen dichtauf hinter sich, so stürzte er in seiner Not in die Bergschenke, zitternd, als habe er den Leibhaftigen gesehen. Der Kleine aber fuhr hinter ihm durch die Tür, setzte sich ihm gegenüber und beschwor ihn, doch niemand außer ihm konnte ihn erkennen. Schließlich schlug es von der Kirche her zwölf, der Kleine fuhr hoch und knallte im Hinausgehen derartig mit der Tür, dass die Fenster erklirrten. Da erzählte der Bursche den anderen stockend sein Erlebnis und musste sich noch deren Schelte anhören, dass er sein Glück verscherzt habe. Sie liefen hinaus und suchten und riefen und fanden doch nichts als jagende schwarze Wolken vor dem Mond und das Jammern der Eulen.
Hüttenkobolde in Sorge
An der Warmen Bode, dem rechten Zulauf von Braunlage her, entstanden neue Hütten im Vogtsfeld und in Sorge. Da fanden sich denn auch bald die Hüttenmännchen ein wie Bilche (Bilch: Siebenschläfer) auf dem Dachboden oder Ratten im Stall und trieben allerlei Kurzweil, saßen auf der Eisenwaage, turnten auf der Hammerwelle, schauten an der Schöpfstelle aus dem Wasser, kletterten im Gebälk. Eine Frau erzählte, wie sie Birnen mit Klump machen und den Teig zum Aufgehen ins Warme bringen wollte, da hüpfte und wippte eines der Ziege auf dem Rücken wie ein winziger grauer Reitersmann, sie habe sich so verjagt, (sich verjagen: sich erschrecken, zusammenfahren) dass sie vor Schreck den Hefeteig fallenließ. Und zur Winterzeit, besonders am Weihnachtsabend, gingen plötzlich in der Schmiede die Blasebälge; ein alter Mann, der austreten wollte und das Rumpeln vernahm, konnte sich wie gebannt die ganze Geisterstunde über nicht vom Fleck rühren und war nachher blaugefroren wie ein Eiszapfen.
Unfälle durch Zwerge
Auch Unfälle lastete man den Kobolden an. So wusste man zu sagen, dass einer, der mit der Schürstange, die man Spett nennt, nach dem Männchen geschlagen habe, daraufhin selber ins Feuer gefallen sei, und man fand von ihm nur noch die angekokelten Beinstümpfe vor. Ein anderer, der Kohlen ins Maß füllen wollte, vernahm, wie es unten quiekte: „Et kucket!" („Es guckt!") Der Kohlenmesser schaute hinein, sah nichts und sprach verwundert: „Et kucket nich!" („Es guckt nicht!") Wieder schallte es: „Kucket!" („Guckt!") „Ek kann nischt seihn", („Ich kann nichts sehen) erwiderte der Mann, „sticke doch en O'e ut!" (stich doch ein Auge aus!") Da sprang ihm etwas heiß wie Kohlenglut ins Gesicht, so dass er selbst ein Auge verlor.
Die Geister aber sorgten auch für den Gedeih der Hütte. Als man ihnen aus Dankbarkeit rote Kleidung hinlegte, war das der Grund, dass sie fortziehen mussten, und mit den Hütten ging es bergab.
Die Huckepolte von Braunlage
Noch höher in den Bergen, in und um Braunlage, wo es nicht geheuer war, erschienen die Zwerge gern als Huckepolte, als Irrlichter. Sie lockten den Wanderer ins Moor, in dem er elend versinken musste, sie zeigten aber auch durch ihr flackerndes Umherspringen verborgene Schätze an, deshalb folgten ihnen immer wieder Verwegene zu ihrem Glück oder Unglück.
Hüttenmännchen in Rübeland
In Rübeland, wo die Menschen seit alters her an der Bode Hochöfen und Schmiedehämmer betrieben, erschienen die Zwerge gern als Hüttenkobolde wie rotglühende Feuerklumpen, die durch den düsteren Raum rollten und graulich anzusehen waren, dass man glaubte, die Hütte ginge in Flammen auf. Andererseits machten sie sich gern selbst mit Blasbalg und Amboss zu schaffen, und wenn es nachts in den Gebäuden rumpelte und werkelte, so wusste man, dass anderntags Bestellung käme und die Not ein Ende hätte. Die Zwerge arbeiteten immer nur dann, wenn die Hüttenleute Feierabend hatten, als fürchteten sie, dass man sich über ihre dicken Köpfe lustig machen könnte. Wie die Marder polterten sie im Gebälk der Hütten umher, wenn nur noch ein bisschen Glut gloste. Dann konnte es auch mal passieren, dass die Stangen von Stabeisen durcheinander gerollt waren oder die Zangen vom Wandbrett gefallen. Aber für gewöhnlich zeigte sich, dass eine Arbeit, die man sich für den nächsten Tag vorgenommen, schon aufs trefflichste erledigt war und man sich nur noch halb so sehr plagen musste, wenn ein Kobold in der Hütte hauste. Einmal wollte man sich für geleistete Dienste gefällig erweisen und legte einen feinen grauen Rock hin wie ein Säuglingskittelchen und ein paar winzige handgenähte Lederschuhchen, aber da vernahm man in der dunkelsten Ecke ein Schluchzen und Schniefen und hörte betroffen heraus, dass die Schuhe ja nun der Laufpass seien und man sich woandershin wenden müsse.
Warnung durch die grauen Männchen
Einmal, so sagt man, warnten die grauen Hüttenmännchen von Altenbrak die Schmiedeknechte auch, den neuen Bau nicht so dicht an das Wasser zu verlegen, doch die überschlauen Hüttenleute, die Blasebälge und Schlaghämmer gern von der Wasserkraft betreiben lassen wollten, lachten nur und spotteten, und das nächste Bodehochwasser brach und schwemmte alles hinweg, bis nach Treseburg und sogar bis hinab nach Thale.
Der Kräuterzwerg unter der Linde im Bodetal
Nie war man sicher vor Zwergen, weil sie so klein waren. Ging man allein durch den Wald, kicherte es hinter einem wie Spechtgewieher. Drehte man sich um, sah man nur eine Höhlung unter Wurzel, Stein oder im offenen Stamm, und die Farnpflanzen zitterten noch. Nur wenige erblickten die faltigen, erdbraunen Gesichter mit Augen, klug und goldgetüpfelt wie bei Kröten, mit Barten wie Moos und Flechtenkram, noch weniger die Hände mit runzligen Alraun-Wurzelfingern, kaum jemand die Füße wie Entenbein und Krähenzeh, die sich unter weiten Gewändern verbargen oder in großmächtigen Siebenmeilenstiefeln und nur auf feuchten Kiesbänken sichtbar wurden.
Wer sich von Thale aus das schroffe Bodetal emporwagte, durch das damals noch kein befestigter Wanderweg führte, vielmehr nur ein halsbrecherischer Felspfad, der gelangte schließlich, wenn er nicht abgestürzt war, an den kochenden schäumenden gischtenden strudelnden Bodekessel, donnernd wie tausend Pferdehufe. Dort unter der Linde im Gewände des Bodetals wohnte ein Zwerg wie ein Eremit; ging man zu dem bei Nacht und rief um Heilung, so fand man zwölf Stunden später mancherlei Kräutersträuße auf dem Stein, Nachtviole und Blauen Lattich, Berglauch und Springkraut, Rauen Alant und Hirschzunge, und immer half der Absud gegen die Gebresten. Erst mit dem Absprengen eines Teils des Kessels, um dem Floßholz den Durchgang zu erleichtern, verschwand auch der hilfreiche Geselle aus dem Tal.
Wasser- und Nickelmänner an der Bode
Schlimmer war es mit den Nickelmännern im unteren Bodetal, die breite, schnurrbärtige Gesichter hatten wie die Fischotter und die den Fischern an die Reusen gingen. Auch sagte man, sie könnten den Wasserstand der Bode regulieren. Wenn man ihnen nicht ein Huhn, einen Hund oder Kater zum Opfer brächte, so hieß es, ertränke zu Pfingsten ein Kind an der Obermühle. Draußen im weidenbestandenen Vorland sah man sie zuweilen tagsüber wie die Biber in der Sonne liegen und sich den Pelz wärmen, und manchmal saßen da auch Nixen und kämmten sich die Haare. Sie waren zwar mit den Landzwergen verwandt, hielten sich aber abseits und gingen nicht wie diese nachts in Scharen auf die Erbsenfelder, um die Schoten zu plündern, holten auch keinen Sauerteig aus den Mollen, gaben nicht von ihrem Geschirr. Aber es war mit ihnen nicht geheuer, weil sie jeden, der ihrem Reich zu nahe kam, Schaden zufügen und ihn ins Wasser zerren wollten. Auch brachten sie die verheerenden Bodehochwasser im Vorland, unter denen vor allem die alte Stadt Quedlinburg arg zu leiden hatte.
Fredecke vom Quedlinburger Münzenberg
In Quedlinburg auf dem Münzenberg gegenüber dem Schloss pflegte man sich Geschirr bei den Zwergen aus der Zwergkuhle zu borgen, wenn Kindtaufe war, dafür bekamen diese etwas von der Speise. Eines Tages rief es hinter einem Manne her: „Gödecke, Gödecke, sejj' mal forr Fredecken, sien Kind wolle starwen!" („Gödecke, Gödecke, sag mal zu Fredecke=Friedrich, sein Kind wolle sterben!") Er erschrak sich, lief heim und erzählte alles seiner Frau, da ertönte wieder die Stimme: „ Vorrfluchter Gödecke, warum hewwe jie kein Solt in Surdeich 'edan!"(„Verfluchter Gödecke, warum habt Ihr kein Salz in den Sauerteig getan!")
Die Frau nahm rasch eine Handvoll Salz und streute sie vor die Haustür, damit das Zwergenkind von Fredecke wieder gesund würde, das von dem Brot gegessen hatte, doch die Zwerge kamen nicht wieder, und die Leute mussten fortan zusehen, woher sie ihre Teller bekamen.
Die Höhle an der Voigtstiegklippe bei Wernigerode
So wie am Flusslauf der Bode, so lebten die Zwerge auch im Tal des Zillierbaches, der durch das lang gestreckte Mühlental auf Wernigerode zuläuft. Am Voigtstiegberg, unter der Voigtstiegklippe, gab es eine Höhle, zu der die Leute kamen und Geschirr erbaten, das sie auch erhielten, alles vom feinsten, so dass die Speisen gleich noch mal so gut schmeckten. Das gefiel ihnen so sehr, dass sie das Zurückbringen vergaßen. Als sie es jedoch anderntags aus dem Schrank nehmen wollten, war es verschwunden, und das Essen in den alten Töpfen brannte ihnen an.
Zwerglöcher im Tiergarten
Im Tiergarten, an der Försterei Christianental, fanden sich geheimnisvolle Löcher, in denen Zwerge wohnen sollten. Kamen Kinder in die Nähe, so wurden sie hineingelockt, und die Zwerge nahmen ihnen alle ihre Speise weg, dafür aber lehrten sie sie kluge Sprüche, das Wetter zu erkennen, gaben ihnen Steine, Zapfen und andere Geschenke und ließen sie heil wieder frei.
Kinderfänger am Salzberg
Schlimmer war es mit den Zwergen am Salzberge, die in ihre vollgelaufenen Löcher alles einheimsten, was ihnen greifbar war, selbst kleine Kinder, deshalb durften die dort nicht hingehen.
Michaelsteiner Zwerge unterwegs zur Theobaldikapelle
Mancher behauptete, er habe die Zwerge vom Kloster Michaelstein kommen sehen, wie sie an der Harzkante lang bis nach Benzingerode marschiert seien, dann durch den Heiligen Grund zum Hundsrücken hinauf und andererseits an den sieben Bornen hinab über den Kirchstieg, durch den Tiergarten an den Zwerglöchern vorbei bis hin zur Theobaldikirche, allwo sie ihren Gottesdienst abhielten, ehe sie, einer hinter dem anderen, mit ihren Grubenlichtern wieder zurücktrippelten, gut und gerne fünfzehn Kilometer die eine Strecke.
Vom Fischzug im Zwölfmorgental
Ehe sie aber vollends verschwunden waren, begab sich folgendes: Im Zwölfmorgental gab es ehdem drei Teiche, aus denen sich die Ritter fleißig ihre Fischmahlzeiten holten. Als aber einer dieser Ritter in einem Prozess sechshundert Taler verloren hatte, borgte er sich diese von den Zwergen in der Heidemühle, die dafür am Fischrechte teilhaben wollten. Da ließen die Knappen, just als der beste Zwergfischzug im Gange war, das Wasser in den Teichen ab und schlugen mit langen Angeln über das Wasser, bis sie einem der Zwerge die Nebelkappe vom Kopfe rissen, den nahmen sie gefangen. Von daher rührt die Feindschaft zwischen Rittern und Zwergen.
Der Nickelmann im Teichdammteich
Die Ritter hatten auch ein festes Haus am Teichdamm, und weil ihnen die Zwerge, die im Wasser wohnten, so viele Mücken auf den Hals schickten, nannte man es auch die Schnakenburg. Hier war das Wasser, das von der Flutrenne kam, angestaut, um die Diekmohle, das „schiefe Haus", zu betreiben. Die Ritter verbreiteten aber die Geschichte, dass die Zwerge all ihr Diebesgut unter Wasser verbrachten und verwiesen dabei auf mancherlei Dinge, die man aus dem Schlick gezogen hatte, sogar zerbrochene Kinderwagen darunter. Sie hätten beobachtet, dass die Kurzen mit ihrer Rute aufs Wasser schlugen, da teilte sich das und ließ sie hinein und schloss sich wieder. Ein Nickelmann, hieß es, habe sich ein Wernigeröder Mädchen in seine Unterwasserhöhle geraubt, und jedes Mal, wenn es ein Kind bekam, holte er die Hebamme und führte sie mit verbundenen Augen in die Tiefe, sechsmal. Als die Wöchnerin aber dann hinauf und sich einsegnen lassen wollte, sah man sie alt, grau und verquollen im Kirchstuhl ihrer Familie sitzen, und niemand traute sich in ihre Nähe. Nachher war an der Stelle, wo sie gesessen, ein nasser Fleck, der blieb, bis man die Zwerge vertrieben hatte.
Trultram von der Heidemühle
Die Heidemühle war die unterste Mühle an diesem Mühlbach, im Heideviertel der Lohgerber und Sattler kurz vor dem Austritt des Wassers unter der Stadtmauer hindurch. Man nannte diese Stelle das Klare Loch, obwohl es alles andere als klar war, darin lebte die große Wappenforelle. Dort in der Finsternis des alten Mühlengebälks, zwischen den rumpelnden Wellen und Mahlsteinen, hinter den staubigen Getreidesäcken, bei den armen Leuten auf der Heide, den Dienern und Dirnen, fühlten sich die Zwerge geborgen. Und genau dort stellten ihnen die Leute von der Harburg nach. Sie schickten einen Knappen namens Prutzam, das feine Silbergeschirr zu holen, weil der Sohn des Ritters Hochzeit halten wollte. Der Zwergenhauptmann Trultram wusste wohl, dass die Burgleute das nicht nötig hatten, doch er war gutherzig und wollte die Hilfe nicht verweigern. Das wurde ihm übel gedankt, denn das Geschirr kam verbeult und besudelt zurück, als habe man damit die Jauchegrube ausgeschöpft, und zu dem Hohn kam hinzu, dass die Knechte der Burg den Zwergen auflauerten, als diese heimkehrten, und Trultram, sowie er seine Kappe ablegte, gefangen nahmen. Die übrigen verschwanden durch eine Falltür in einem verborgenen Gang, doch die Knechte verstopften das Klare Loch, so dass das Wasser zurückstaute und in die Mühle stieg, und das war voll von Unrat, Lohbrühe und Gossenspülicht der ganzen Stadt. Schließlich mussten die kleinen Kerle prustend auftauchen, und man schaffte sie auf drei Karren davon, in den Kerker der Harburg, wo niemand sie mehr sah. So wurde Wernigerode seine stillen und geschickten Helfer los. Die Harburg aber, die die Erzwege nach Ilsenburg kontrolliert hatte, wurde aufgegeben und verfiel, mit ihr der Erzhandel.
Das Hickemännchen in der Wernigeröder Neustadt
Einmal noch, lange Zeit später, ließ sich so etwas wie ein Kobold in Wernigerode sehen, das war das Hickemännchen der alten Krehlschen aus der Johannisstraße. Das kam, als die Frau nach dem Felde gegangen war, um Kräuter zu suchen, da gab es auf einmal einen Spektakel in der stillen Straße der Wernigeröder Neustadt, als ob Feuer ausgebrochen wäre. Die Leute riefen sich gegenseitig zu: „Kohmet her, de ohlen I'schen öhre Hickemänneken is hier in da lote." („Kommt her, der alten Ütsche ihr Hüpfmännchen ist hier in der Gosse.") Ische oder Ütsche war aber der Beiname der Alten, die allein lebte und die niemand leiden mochte, Ütsche ist eine Erdkröte. Das Wesen hüpfte die Gosse rauf und runter, alles schmiss mit Steinen auf das Tier, manche schlugen mit Knüppeln drauf, und quaken tat das beinahe wie ein Frosch, aber so hell wie ein kleines Kind: „Näack, näack!" Es war nicht größer als ein Kaninchen, sah aber aus wie eine Ütsche, bloß der Kopf war dicker, und runde Ohren hatte das Biest, und es huckte, als ob man ihm die Beine zusammenhielte. Sie trieben es pudelnass im Abfluss die Neustadt runter und wieder rauf, wie es aber an die Johannisstraße kam, versuchte es dort wieder hinzukommen. Da kam die alte Krehl und hatte eine Tragekiepe voll Kraut auf dem Rücken, die warf sie vor die Tür und sprang hinzu, nahm ihr Hickemännchen auf den Arm und sagte: „Ach, mien armet Diereken, wat het denn da vorrfluchten Minschen mit dek emaket? Da mößte de Düwel daforr halen!" („Ach, mein armes Tierchen, was haben denn die verfluchten Menschen mit dir gemacht? Die müsste der Teufel dafür holen!") Und streichelte ihm das Fell und trug es ins Haus, dann holte sie ihre Tracht mit dem Kraut auch rein und schloss die Haustür fest zu, aber jeder wusste nun, was die alte Krehl, die man auch wegen ihres Schreiens die alte Gröhlsche nannte, für ein fremdartiges Haustier hatte, nämlich einen echten Huckeduster aus Afrika.
Die Ilsenburger Zwergenhochzeit
Noch saß das Zwergenvolk im Harz fest, in der Altenburg Heimburg, in Derenburg, Silstedt, in Stapelburg, Dardesheim, überall vernahm man die gleichen Geschichten von gegenseitiger Hilfe und mancherlei Bosheit.