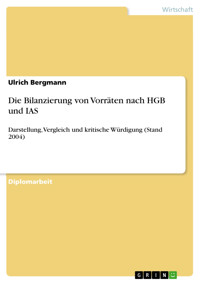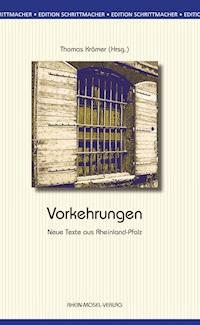
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Edtion Schrittmacher
- Sprache: Deutsch
Die Anthologie 'Vorkehrungen' versucht nicht einen repräsentativen Querschnitt durch die rheinland-pfälzische Literaturlandschaft zu legen. Sie bietet eine subjektive Auswahl von einundzwanzig Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ausschließlich Prosa, eine Auswahl, die mehrere Generationen vereint, alle im Lande lebend, schreibend, und die einem roten Faden folgt. Thomas Krämer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Printausgabe gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur Rheinland-Pfalz
Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Marcel Diel, Sigfrid Gauch, Arne Houben, Thomas Krämer.
© 2004 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGZell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-760-2 Umschlag: Arne Houben
Thomas Krämer (Herausgeber)
Vorkehrungen
Neue Texte aus Rheinland-Pfalz
Edition Schrittmacher Band 1
RHEIN-MOSEL-VERLAG
InhaltWie sich leben
Heinz G. Hahs, Wie sich lebenWolfgang Hermann Körner, Das VersehenDietmar Gaumann, KatzengrabInge Reitz-Sbresny, Steine im KopfPeer Leonard Galle, AnnaJörg Matheis, Vater lächelt
Vom Ende der Kunst
Irina Wittmer, Vom Ende der KunstKlaus Dieter Regenbrecht, Kuno Kunstmann kochtPeer Leonard Galle, Nihilisten auf ProbePetra Urban, FahrradtourWalter Schenker, Urban Zacharias WickWendel Schäfer, Das Lied der Amsel
Der trübe Gast
Armin Peter Faust, Der trübe GastMonika Böss, Zitronen im SchneeErnst Heimes, Reise in Europas nahe Ferne (Ausschnitt)Wolfgang Hermann Körner, Die EmigrantinClara Herborn, Die WanderungSarah Alina Grosz, AlsChrista Estenfeld, Paramatta
Textur der Zeit
Clara Herborn, Textur der ZeitMonika Böss, Im ›Geschwollenen Herz‹Ulrich Bergmann, TinaSarah Alina Grosz, Die Krücken sind im Schrank, Julien .Klaus Wiegerling, Deutsche StimmenChrista Estenfeld, Die klingenden Reime des Narren …Wendel Schäfer, Wandelbarkeit der Dinge
Vorkehrungen
Dietmar Gaumann, VorkehrungenVerena Mahlow, Blue SteelUlrich Bergmann, RamschNorbert Scheuer, ArmbrustHeinz G. Hahs, BettlägerigkeitenWendel Schäfer, Von der Schönheit des Menschen
Ein Wort zum Schluss – zum AnfangBiobibliografien der Autoren
Wie sich leben
Heinz G. Hahs
Wie sich leben
Nachdem er seine Bratkartoffeln rasch und ohne Appetit gegessen hatte, schien er, statt seinem Ruhebedürfnis nachzugeben, in die Innenstadt hinunterzugehen. In den Straßen stand heller Nachmittag. Trotzdem sah es so aus, als hätten die Kaufhäuser und Läden geschlossen; die Auslagen in den Schaufenstern gaben sich unbeteiligt. Die Leute schlenderten umher, wie für einen Sonntagsausflug gekleidet, für einen Familienbesuch, einen Stadtrundgang. Es fuhren keine Autos, so daß die Straßen, obwohl auf den Fahrbahnen Fußgänger liefen, leer wirkten. Immer wieder blieben Leute stehen und schauten an den Häuserfronten hoch, als führte in einem der oberen Fenster jemand ein Puppenspiel vor. Der Himmel war flachblau und schied sein flunkerndes Gold ab. Die Sonne wärmte, zum ersten Mal in diesem Jahr. Doch er hatte das Gefühl, er friere.
Die Leute starrten ihn wie einen Eindringling an. Sie wichen ihm nicht aus. Nur durch Zufall blieben sie von den Kehrmaschinen unbehelligt, die jetzt auch durch die Seitenstraße in Kolonnen die Rinnsteine entlanggekrochen kamen. Dabei war noch lange nicht Abend.
Plötzlich vernahm er den gigantisch dahinwabernden, dissonanten Harmoniumakkord hoch über den Dächern, mit diesem Jaulton dazwischen, der wie eine Übelkeit durch den Leib fährt und wie ein Müllgestank. Die braun getönte Glasscheibe war wieder vor ihm, die große Backofentür in der Mauer. Das Feuer barst in die Höhe und zermalmte den Sarg. Die Gasflammen tosten, daß die Luft im Andachtsraum der Ohnmacht wich. Der Sog ging durch ihn hindurch wie durch ein Rohr. Erst später, erst als er den plombierten Behälter in seinen Händen spürte, dämmerte ihm, daß die Musik vom Band gekommen sein mußte, wie aus einem Versteck heraus.
Das Entsetzen begann von neuem. Sie hätten dich nicht verbrennen dürfen, sie hätten dir deine Gestalt lassen sollen, das letzte Stück Würde. Ich stünde am Grab zu deinen Füßen und schaute zu dir hin, wie du unter Blumen liegst und unter der Erde, ich blickte dir ins Gesicht und redete mit dir von den Kindern, die wir miteinander gehabt hätten, nennte dir den Wochentag und erzählte von den Jahreszeiten und vom Alleinsein, dann legte ich einen Euphorbienzweig vor dich hin, im Weggehen drehte ich mich noch einmal um: Bis morgen, Liebes. Die Erinnerung an dich in die Steinumrandung gefaßt, dein Bild in Lebensgröße. Doch sie haben dich zu Umrißlosigkeit verbrannt.
Straße um Straße streunte er weiter durch die City. Er war darauf gefaßt, in irgend eine der unbekannten Geistergegenden zu geraten. An dem Trödelladen hinter dem Dom ging er vorbei. Auf das Scheppern der Türglocke hin wäre der Alte herangeschlurft gekommen und hätte ihn durch die vielen schmalen Stockwerke geführt, um die Mumienstandbilder herum und hinter den Vorhängen aus Staubweben vorbei, durch das Labyrinth von Dämmerung und grauen Zeiten.
Er ging weiter. Fast täglich war er durch diese Straßen gegangen, doch die Hausfassaden verweigerten alle Vertrautheit. Es suchte Hausnummern ab, ob von ihnen Aufschlüsse zu erhalten seien. Vielleicht auch würde sich aus den Namen auf den Klingelschildern eine Bedeutung ergeben, ein Hinweis.
Das Schreibwarengeschäft hätte er nicht am Marktplatz vermutet. In ein seidengefüttertes Etui gebettet, lag, wie auf einem Katafalk, der Füllfederhalter. Er erkannte ihn sofort wieder, er war ein Geschenk von ihr. Mit dem sollst du mir viele schöne Geburtstagsbriefe schreiben, viele Seiten schön mit Tinte geschrieben, in großzügiger, blauer Tintenschrift. Du weißt, ich habe oft Geburtstag, mindestens zweimal die Woche. Und du kannst von Glück sagen, wenn nicht allzu oft Sonntag ist, denn da habe ich gleich zweimal Geburtstag. Von mir aus könnte jeden Tag Sonntag sein, weil ich nicht genug Geburtstagsbriefe von dir kriegen kann.
Er ging weiter, Straße um Straße, auf der Fahrbahn, es war seine Stadt. Stetig und wie aus einer Düse gepreßt blies der Wind ihn an, so daß er, um atmen zu können, den Schal vor die Nase hielt. An den Haussockeln klebten zittrige Papierfetzen. Der Wind, als gäbe es ihn nicht, ließ die Passanten unberührt. Oder als gäbe es die Leute nicht, mit ihren tadellosen Perücken und mit den im verzögerten Rhythmus des Schreitens wippenden Reifröcken und den Fracken, deren schlenkernde Schöße bis zum Boden reichten. Die Leute nahmen ihn nicht wahr. Manchmal blieben sie in einer wie wartenden Haltung stehen und ließen ihn, ohne ihn eigentlich zu bemerken, vorbeigehen. Bisweilen standen sie in Gruppen zusammen und schauten an den Hauswänden hoch. Die Sonne blakte. Die Sonne ist schwarz zu denken oder als blinkendes Narrengold. Die Kehrmaschinen waren mehr geworden und schoben sich geräuschlos von allen Seiten auf ihn zu. Wenn er auf die Bürgersteige auswich, krochen sie auf die Bürgersteige. Er preßte, um sie zu vertreiben, die Augenlider aufeinander, doch jedesmal kamen sie sofort wieder aus ihren Löchern hervor.
Durch die vergitterten Kellerluken und durch die Schaufensterscheiben starrten sie ihn an, mit offenen Mündern, Frauen ohne Kopfhaar und Männer mit blutigen Lücken im Gebiß. Eure Gesichter stehen in einem ausgestorbenen Dialekt. Eure Gesichter sind eine Ausdünstung. Er legte den Kopf in den Nacken, schloß die Augen. Dort oben das dröhnende Harmonium, weinerlich verstimmt. Er ging durch seine Stadt. Fühlte sich hohl. In ihm war ein Geruch nach Altmetall.
In diesem Augenblick hallte es wie aus einem übermächtigen Lautsprecher herab. Wer immer es versäumt, die Wärme von der Zeit abzukoppeln, mag sich auf das Moos verlassen. Denn das Schweigen ist aus den Regalen genommen, und die Gebete der Fürchtigen werden eingestampft. Und wer seine Tangenten verspielt, daß er an den Krokodilen spare, der wird es kalt haben in seiner Scheuer.
Er versuchte das Gehörte zu verstehen. Um es zu verstehen, muß ich die Wörter behalten. Um die Wörter, damit ich das Gehörte verstehe, zu behalten, muß ich sie in einem fort wiederholen, indem ich gehe und gehe und die Wörter, damit ich sie, um das Gehörte zu verstehen, behalte, in einem fort wiederhole. Wer nämlich versäumt wenn jemand versäumt ich gehe ich gehe wer immer wiederholt wer geht wenn wer immer die Wörter versäumt jemand geht wenn immer die Wörter versäumt jemand geht wenn immer die Wörter zu gehen versäumt die Wörter ...
Ihm fiel auf, daß er längst in die Außenbezirke geraten war, auf flaches Gelände mit Fabrikhallen und fensterlosen Gebäudeklötzen. Keine Menschen, keine Autos. Als wäre Feierabend schon vorbei. Der Himmel, ein Loch, verschluckte Schritte.
Erst jetzt merkte er, daß er die Gärtnerstraße hinauflief. Da oben wohnte er, rechts gleich um die Ecke. Und er sah dich, wie du vor ihm hergingst. Er erschrak, daß ihm das Herz stolperte. Du konntest es nicht sein. Aber er sah dich. Sah dich in dem Kleid aus langen, luftig fließenden Schleiern. Sie ist die Tänzerin mit den beiden sommerlichen Vornamen, und jeder für sich macht sie schweben. Sie geht da vor mir wie die Schwester von Audrey Hepburn in einem Schwarzweißfilm. Lieben Sie mich, hatte die Frau gesagt, ich werde Sie gewähren lassen. Vielleicht wird sich eine Schüchterheit einstellen zwischen Ihnen und mir. Sterben Sie in mich hinein.
Du drehtest dich nicht um. Bleib stehn, warte, um‘s Himmels willen, warte. Es war, als hätte jemand seiner Stimme den Ton abgestellt. Und obwohl er jetzt aus Leibeskräften schrie. Warte. Dein Haar wehte, wie silbriger Tang in der Strömung weht. Er fing an zu rennen, mit steinsteifen Beinen bergan. Du fingst an, dich in Dunst aufzulösen. Er blieb stehen, daß du in der Ferne wieder Umrisse bekämest. Von neuem lief er hinter dir her. Warte. Bleib stehn, bitte. Die Straße wurde nur länger und stummer.
Er sah, wie du in einem Hauseingang verschwandest, erschrak. Rannte mit zähen Schritten. Doch da war kein Einlaß, den er all die Jahre übersehen hätte, in der Mauer der Harthschen Gewürzmühle gab es kein Türchen. Er blieb stehen. Du warst wieder da, weit oberhalb. Wie ein Kind liefst du, klein, barfuß, mit traumträgen Schritten. Bleib doch stehen. Einmal dreh dich zu mir um. Ihm fiel ein, daß er gar nicht wußte, wie deine Füße aussahen. Ich weiß gar nicht, wie deine Füße aussehen. In dem Brief nachher würde er es dir schreiben, in übermütig breiter Tintenschirft. Weißt du übrigens, daß ich noch nie deine Füße gesehen habe? Sofort wußte er wieder, daß es keine Briefe mehr zu schreiben gab. Dabei sah er dich. Jetzt eben gelangtest du an die Straßenecke, wo du rechts abbiegen mußt zu dem Haus, wo er wohnt. Ein Feuerschwall fuhr durch ihn hindurch, das kannte er aus Träumen. Ohne den Schritt zu verzögern, bist du geradeaus gegangen. Ohne einen Blick in seine Straße zu werfen. Den Kopf nicht bewegen – warum – bleib stehn. Um‘s Himmels willen.
Nein ich werde weiterleben und zwar pünktlich und anstandslos ich werde nicht zusammenbrechen mich nicht zuschandensaufen Tag für Tag ich werde mich jeden Morgen während das Teewasser sprudelt rasieren und zwar scharf Einkaufzettel werde ich schreiben die Rechnungen (Er trägt keinen Namen, der ihn trüge.) begleichen aber fristgerecht täglich werde ich mich rasieren und über die Zoten von Herrn Kuhle wo auch immer und ordnungsgemäß lachen die Wohnung wird auch wenn ich daheim bin leer sein bleiben wird in mir der (Er hätte bei dir sein sollen, als du starbst.) Sog zuverlässig der Blasebalgakkord und um den Kopf pünktlich diese. Fieselige Übelkeit.
Wolfgang Hermann Körner
Das Versehen
Anfang Dezember machte sich David bei milden Temperaturen – sonst hätte er die Mühe gescheut – ins nahe Luxemburg zu Botticelli auf, der laut Feuilleton einen ständigen Dialog mit dem Zeitgeist geführt, sich daher oft in der Rolle des Neinsagers wiedergefunden und darüberhinaus den Mut aufgebracht habe, den Humanismus als eine Utopie nur zu träumen, was offenbar als Tugend angesehen wurde. Als zartestes Werk der gesamten Ausstellung erwies sich das Profilbildnis einer rotblond gefärbten Schönheit (»aus« – wie ein Schildchen am unteren Rahmen unfreiwillig und dennoch meisterhaft lasziv verriet – »New Yorker Privatbesitz«) mit liebevoll nachgezogenen Konturen und reizvoll verwilderten Kopftuchfalten, die eine so frappierende Ähnlichkeit mit Susanne aufwies, daß ihm schwach wurde und er sich setzen mußte. Im Katalog blätternd nahm er zur Kenntnis, daß besagtes Werk in der Frage der Eigenhändigkeit heftig umstritten sei, ja, höchstwahrscheinlich habe ein Ateliergeselle nicht nur den Entwurf skizziert, sondern bei der Ausführung maßgeblich mitgewirkt, so wie man es auch von der Flucht nach Ägypten aus dem Musée Jacquemart-Andrée vermute. Eine verläßlichere Information war nicht zu finden (und eine irritierendere nicht zu denken), weshalb sich David sofort wieder die Frage der Wahrhaftigkeit und des Sinns zufälliger Koinzidenzen stellte. Länger als eine Viertelstunde verbrachte er – als lebende, dennoch seltsam erstarrte Skulptur selbst schon zum Objekt der Besucherneugier geworden – beschämt und von Phobien heimgesucht, die ihm den Schweiß ins Gesicht schwemmten, auf seinem Hocker. Die Sorge um Susanne kam dazu: Natürlich versuchte sie, so gut es ging, sich zu verstellen, aber nach der Pensionierung hatte sich ihr Gesundheitszustand weiter verschlechtert, Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit hatten immer mehr nachgelassen, kompliziertere Kausalzusammenhänge herzustellen, brachte sie in große Bedrängnis – während ihr Eigensinn wuchs. Die ägyptische Torheit war ihr nicht auszureden gewesen. In welche Fallen würde sie tappen?
Im Bahnhof der Stadt Luxemburg kaufte David für die Rückfahrt im Bummelzug die jüngste Ausgabe der »Zeit« und vertiefte sich aufatmend in die Lektüre. An jeder Station stiegen zahlreiche Fahrgäste zu, vor allem lärmende und rücksichtslos drängelnde Jugendliche. Demnach mußte in Trier irgendein banales Ereignis, vielleicht ein Pop-Konzert oder ein Eishockey-Spiel, stattfinden, das sie in Scharen anlockte. Zunehmend wurde David zwischen ihnen eingepfercht, so daß er die Ellenbogen eng anlegen, seine Zeitung kleinfalten und immer näher vors Gesicht rücken mußte. Ein gefährlicher Computer-Wurm, las er (und stellte sich unter dem Schädling eine Art Reblaus oder den schönen, gelbgestreiften Kartoffelkäfer vor), sei seit Tagen schon im weltweiten Datennetz unterwegs und werde in Kürze einen Angriff auf große Internet-Server starten, nach Einschätzung von Experten sei dies der sich am schnellsten verbreitende Virus aller Zeiten. Zudem sei eine DOS-Attacke gegen die Websites von SCO in Vorbereitung, Begriffe, mit denen er nichts anfangen konnte, die aber selbstverständlich zum Jargon der jugendlichen Meute gehörten (deren Wortschatz sonst nur noch Sprachrudimente wie geil, mega, super und Scheiß verzeichnete). Werteverlust und Unfug wurden allerdings auch noch auf andere Weise dokumentiert. In einer Frankfurter Kunsthalle entfalteten, verriet ihm das sich seriös dünkende Blatt, die großformatigen, rot-weiß-karierten Schmierflächen (eine war abgebildet) eines simplen amerikanischen Anstreichers eine im doppelten Sinn byzantinische Wirkung. Und an anderer Stelle: Eine zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung mache sich daran, die Sprache so lange zu reglementieren, bis der Zauberberg auf Bild-Niveau herunterversaut sei. Weitere Studien erlaubten ihm die Zeitläufte nicht, denn das raschelnde Papier hatte das diffizile Kleinklima des Waggons offenbar empfindlich gestört: Die »Zeit« wurde ihm – das ist das Rätselhafte an der Dekadenz – aus den Händen gerissen und mit Turnschuhen, unförmigen Boliden, in denen ausgeprägte Klumpfüße zu stecken schienen, am Boden zerfetzt. Schließlich nötigte eine Handvoll Teenager ihn unter orgiastischem Gejohle mit Püffen und anzüglichen Stößen, seinen Platz zu räumen, wonach es zu einer wollüstigen Keilerei zwischen kreischenden androgynen Schimpansen mit Baseballmützen um den freigewordenen Sitz kam –
Am Hauptbahnhof in Trier hatte er seinen Golf geparkt, und nachdem er eingestiegen war und die Wagentür hinter sich zugeschlagen hatte und endlich allein saß (im Bistro hatte er schnell noch drei Wodka gekippt), überfiel ihn ein Weinkrampf. Dann richtete er sich wieder auf, verstellte den Rückspiegel ein wenig, so daß er sich in die Augen blicken konnte. Sie fragten und antworteten. Wie groß sind Wut und Schreck, hat mich die versuchte Demütigung wirklich getroffen? Ach – ist das noch relevant? Wo der Eingang zum Yucca Mountain doch nur einhundertsechzig Kilometer nordöstlich von Las Vegas entfernt liegt. Letzte Woche hat sich ein einundzwanzigjähriges Au-pair-Mädchen aus Rumänien wegen der Grausamkeit seiner deutschen Gasteltern mit dem Seil einer Kinderschaukel im Dorf erhängt. Geschminktes Obst verzehren wir, aromatisiertes Fleisch, industrielle Massenwaren ersetzen die natürlichen Lebensmittel. Angesehene Wissenschaftler aus allen Erdteilen betreiben einen Schwarzmarkt für Nuklearwaffen. Der Yucca Mountain, für die Indianer noch ein heiliger Berg, dient der Regierung in Washington dazu, radioaktiven Abfall loszuwerden. Immer leutseliger las er sich in die Erzählungen seines Gesichts ein. Dann fuhr er beflügelt los: Seine Überzeugung, daß diese Welt der Wahnsinnssysteme kaum noch etwas anderes als primitive Unholde hervorbringe – der moderne Erdenbürger agiere wahrscheinlich mit kälterer Seele, als der Neandertaler es tat, das Prädikat »Mensch« habe er wohl für immer verspielt – wurde täglich aufs schönste bestätigt. Und das ließ nur einen vernünftigen Schluß zu –
Hinter Schweich war ihm auf freier Landstraße schwindlig geworden, es war ihm noch gelungen, auf einen Parkplatz einzubiegen, aber dann verlor er das Gespür für die Pedale und wußte nicht mehr, was er zu tun hatte, so daß der Wagen über die Grasnarbe (ein Schlag, ein Knacken) hinausschoß und weiterhoppelte, bis der Motor abgewürgt war. David kroch aus seinem Wagen und versuchte benommen, sich zu orientieren. Er befand sich auf einem brachliegenden Acker, der Golf hatte bei seiner spektakulären Landung die Krume umgepflügt und klaffende Reifenspuren hinterlassen. War dies nicht ein willkommener Anlaß zur Heiterkeit? Man müßte, dachte er, seine Verblüffung über die Unerträglichkeit des Seins so elegant formulieren, daß man allein durch die Worte geheilt werden könnte. Er breitete die Arme aus und blickte zur Sonne hoch. Die alberne Andachtspose half ihm hier keinen Deut weiter. Er hätte sich niemals an Steuer setzen dürfen, hoffentlich benachrichtigte keiner die Polizei: Einige Autos hatten angehalten, die Insassen, am Straßenrand aufgereiht, glotzten herüber; der Fahrer eines Traktors stapfte entschlossen heran. Susanne hatte sich glücklicherweise geweigert, ihr Mobiltelefon mit nach Ägypten zu nehmen, obwohl dort, wie sie wußten, inzwischen in fast jeder Galabeya eins steckte. So konnte er mit dem kleinen Zaubergerät wenigstens seine Autowerkstätte anrufen. Bevor der Abschleppwagen eintraf, hatten die Beamten des – von dem Bauern alarmierten – Streifenwagens seinen Führerschein eingezogen. Außerdem war die Vorderachse gebrochen –
Lange nach Einbruch der Dunkelheit raffte er sich noch einmal auf und wanderte durchs stille und nachtdüstere Dorf. Um auf kürzestem Weg zum Hof des Händlers zu gelangen, mußte er die Hauptstraße verlassen und zwischen Gemüsegärtchen hindurch einen unbeleuchteten, ansteigenden Pfad benutzen. Oben (die Beine waren ihm unendlich schwer geworden) warf er einen einsamen Blick durch die Stäbe des verschlossenen Tors auf den im Mondlicht glitzernden Golf – und jetzt erst wurde ihm bewußt, was es bedeutete, Susannes Auto zu Schrott zu fahren, in der Erregung das Wrack für fünfhundert Euro zu verscheuern und nun mit leeren Händen dazustehen. Er schien sich auszustrecken und an die Erinnerungen klammern zu wollen: Wie oft hatten sie die Sitzlehnen in rasendem Eifer heruntergekurbelt, damit eine passable Liegefläche entstand! Ach, er korrigierte sich gleich wieder: Insgesamt vielleicht nur drei Mal, und immer war die Situation durch die Plumpheit seines Gebarens nach wenigen Augenblicken verpfuscht. Und nun, dachte er und begab sich mit steifen Knien auf den Heimweg, sieht die Wirklichkeit noch einmal ganz anders aus –
Dietmar Gaumann
Katzengrab
Die Katze lag auf dem Fußboden und war in einen verschnürten Müllsack gepackt. Er stieß mit dem Fuß dagegen, als er sich über die Spüle beugte und ein Glas unter dem verkrusteten Geschirr hervorzog. Ihr Körper fühlte sich hart an. Sie lag seit vorgestern dort und roch bereits. Es war Hochsommer und schon jetzt, am Morgen, wälzte sich die schwere, träge Hitze durch das geöffnete Küchenfenster.
Im Kühlschrank fand er einen Rest Milch gegen den Durst, im Brotkorb eine Aspirin gegen die Kopfschmerzen. Er setzte sich in Shorts an den Küchentisch, auf dem sich die Reste der letzten Tage angesammelt hatten – benutzte Gläser und Kaffeebecher, ein Stapel Zeitungsbeilagen und zwei Bananenschalen, die braun verfärbt waren. Er schob die Sachen zur Seite, um sein Glas abzustellen.
Während er wartete, dass die Wirkung der Tablette einsetze, blätterte er in einem Katalog, der unter dem Brotkorb geklemmt hatte. Einige Seiten darin waren markiert. Sie hatte, wie sie es immer machte, einfach die oberen Ecken eingeknickt. Auf den markierten Seiten waren bunte Frotteesachen abgedruckt. Auf der Titelseite sah er, dass der Katalog bereits abgelaufen war.
Im Haus war es noch ruhig. Die Wohnungen unter ihnen wurden von jungen Familien bewohnt, die offenbar noch schliefen. Er wäre gerne noch einmal ins Bett gegangen, doch bei dieser Hitze war an Schlaf nicht zu denken.
Er begann die geknickten Ecken der Katalogseiten gerade zu streichen. Als er damit fertig war, schob er den Katalog wieder unter den Brotkorb.
Später kam sie in die Küche. Ihr T-Shirt, das sie zum Schlafen trug, war verknautscht und hing schlaff um ihren mageren Körper. Sie setzte sich auf einen der Stühle, stellte ihre Fußballen auf die Kante, so dass die Knie fast ihre Brust berührten. Während sie ihren Kaffee in kleinen Schlucken trank, sagte sie nichts. Sie steckte sich eine Zigarette an und blies den Rauch in seine Richtung. Er starrte auf ihre Zehen, deren Nägel sie vor ein paar Wochen schwarz lackiert hatte. Er fand, dass das hässlich aussah.
Das war der Stand der Dinge seit zwei Tagen. Sie saßen da, redeten aneinander vorbei, schwiegen. Warteten darauf, dass der andere einen Zug machte.
»Irgendwas muss mit der Katze geschehen«, sagte er schließlich.
»Wenn du meinst.« Sie fuhr sich mit einer Hand durch ihr dunkles, kinnlanges Haar, ohne es dadurch wirklich zu ordnen. Er hasste diesen Satz. Er wusste, was nun folgen würde. Ihr Streit begann von neuem.
Sie bestand darauf, die Katze im Park zu begraben. Er sagte ihr, dass dies nicht ginge, die Stadt habe es untersagt. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Sie sagte, manche (und damit meinte sie ihn) werfen ihre Tiere einfach in den Müll. Er schüttelte den Kopf und sagte, das stimmt nicht. So kam die Sache nie zu einem Ende. Schließlich zündete sie sich eine neue Zigarette an und schweig wieder, wie zuvor. Sie sah dem Rauch nach, der sich langsam durch die stickige Luft bewegte. Er goss sich einen weiteren Schluck Milch in sein Glas. In den Nachbarwohnungen war es immer noch still. Niemand hörte Radio oder schlug die Tür, um einkaufen zu gehen. Sie sind alle aus der Stadt geflüchtet, dachte er, vor der Hitze. Auch von der Straße drang kein Geräusch hinauf.
Die Katze hatte zwischen ihnen auf dem Bett gelegen, zusammengekrümmt, den Kopf zur Seite gelegt. Sie hatten sie zwischen sich genommen. Zum Laufen war sie bereits zu schwach.
Lili, den Namen hatte sie nach einigem Hin und Her vorgeschlagen, war nie zu einer richtigen Katze ausgewachsen. Im Tierheim hatte man ihnen erzählt, die Mutter sei kurz nach der Geburt überfahren worden und Lili deshalb nicht lange genug mit Milch versorgt worden. Tatsächlich nuckelte sie in den ersten Wochen an den Falten ihrer T-Shirts herum, wenn sie sie auf den Arm nahmen. Jeder, der zu Besuch kam, fand sie niedlich, denn sie wirkte auch später immer ein wenig zerbrechlich.
Dann hatte sie aufgehört zu fressen. Sie zog sich zurück, unter die Kommode oder auf den Kleiderschrank im Flur, dorthin wo sie ungestört war. Als das mehrere Tage so ging, hatte er auf sie eingeredet, die Katze zum Tierarzt zu bringen. Sie schüttelte den Kopf.
Schließlich taten sie es doch. Im Wagen hielt sie den Korb auf ihrem Schoß, während die Katze den Kopf gegen die Gittertür presste. Der Arzt wollte die Katze einschläfern. Ihm war klar, dass sie sich nie darauf einlassen würde. Als sie wieder nach Hause fuhren, meinte er in ihrem Gesicht so etwas wie Genugtuung zu sehen. Sie hatte es von Anfang an gewusst. Ärzte sind Schlächter, sagte sie bitter.
Der Sterben der Katze geschah fast beiläufig. Ein kurzes spastisches Zucken, als stünde die Matratze unter Strom, weißer Speichel, der aus dem Mund auf das Laken tropfte. Sie wechselte im Schlafzimmer die Bettwäsche, während er in der Küche den Kadaver in eine Plastiktüte wickelte.
Er hatte gewusst, als sie am Morgen blass und übermüdet in die Küche gekommen war, dass er endlich nachgeben musste. Sie nickte fast abwesend, als er nun seinen Widerstand aufgab. Er hatte mehr von ihr erwartet, ein Zeichen der Dankbarkeit. Wahrscheinlich hatte sie geahnt, dass er nachgeben würde. Man erreichte immer einen Punkt, an dem einer schließlich nachgeben musste. Dieses Mal war er dran.
Sie betraten den Park durch ein schmales, schwarzes Gittertor. Dieser Teil des Geländes lag abseits, ein heimlicher Platz für Paare, die einen Nachmittag im Schatten der schwer herabhängenden Baumkronen verbringen wollten. Weiter unten, den Hügel hinab, lagen ein Ententeich und ein Kinderspielplatz, von dem leises Stimmengewirr herüberdrang. Die braune, ausgedorrte Wiese vor ihnen war menschenleer.
Sie ging zielstrebig auf einen der Ahornbäume zu, die entlang der grau verputzten Parkmauer gepflanzt waren. Er nahm den Rucksack ab und wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Das T-Shirt klebte an seinem Rücken, seine Schulter war von der Last wundgescheuert. Aus der Öffnung des Rucksacks ragte ein Stück des blauen Plastiks hervor.
Sie beachtete ihn nicht. Sie strich um den Baum herum, ging in die Hocke, wühlte mit den Händen in der Erde, stand auf, ging weiter und begann ihre Runde von vorn. Was sie tat, kam ihm sinnlos vor. Sie mussten ein Loch graben, die Katze dort hineinlegen, das Loch wieder zuschaufeln, das war alles. Er band den Rucksack auf und legte die eingewickelte Katze auf den Rasen. Schließlich deutete sie auf einen Fleck zwischen zwei aus der Erde tretenden Wurzeln. Er kniete sich dorthin und begann zu graben.
Die Erde war trocken und die Kehrschaufel, die er im Keller gefunden hatte, völlig unbrauchbar. Der Dreck rieselte von der Schaufel herunter, bevor er ihn zur Seite schaffen konnte. Wurzelwerk versperrte den Weg in die Erde. Das Loch wurde nicht tiefer. Sie stand daneben, schaute zu, wie er sich abmühte. Schweiß brannte ihm in den Augenwinkeln. Er versuchte mit der Schaufel, das Wurzelwerk zu durchtrennen – ohne Erfolg. Er grub weiter. Schließlich brach der Holzgriff der Schaufel. Sie nahm keine Notiz davon, sie hatte sich abgewandt, sah den Hügel hinab, dorthin wo die Kinder auf den Rutschen vor Vergnügen quietschten. Er versuchte es mit den Händen. Scharrte einen kläglichen Haufen Erde zur Seite. Der Dreck setzte sich unter seine Fingernägel. Das Erdreich war heiß und hart und trocken.
Er beugte sich über die Spüle und wusch sich den Dreck von den Fingern. Er hörte, wie sie ins Bad ging. Die Katze lag verschnürt auf dem Boden vor der Spüle. In die Falten des Plastiks hatte sich Erde gesetzt. Sonst war alles wie vorher.
Sie hatte nichts gesagt. Er wusste, dass sie ihm vorwarf, dass er die Katze nicht vergraben hatte. Er hatte es versucht, doch das zählte nicht. Sie hatte ihn um etwas gebeten und er hatte es nicht getan.
Wie in der Nacht, als sie die Katze im Hof hatte schreien hören. »Es ist alles in Ordnung«, hatte er halb benommen gesagt, als sie ihn bat, nachzusehen und war liegen geblieben. Die Katze hatte weiter geschrien, wie ein Baby. Jetzt wusste er, das war der Anfang vom Ende gewesen.
Inge Reitz-Sbresny
Steine im Kopf
Ich bin zehn Minuten vor sieben aufgewacht. Ich gehe an das Fenster, kontrolliere den Himmel, das Thermometer, ob dieselben Leute unten auf der Straße gehen wie jeden Tag: Zügig, schnell, weil sie zu einem Anfang müssen. Keine Spaziergänger, die trödeln. Es trödeln nur die, die ihre Hunde ausführen müssen, die immer ihre Hunde und die Bäume im Blick haben und das kleine Stück Erde, aus dem die Bäume herauswachsen. Es sind immer dieselben Hunde, dieselben ›Frauchen‹. Sie gehen gemütlich, sie trödeln. Sie kennen sich. Und ich kenne sie auch. Die Hunde bellen nicht. Früher, kann ich mich erinnern, haben sie ab und zu noch gebellt. Jetzt haben sie in der Stadt Hunde, die nicht mehr bellen. Aber es ist gut, daß sie Hunde haben. Da haben sie einen Anlaß. Wer keinen Hund hat, der hat keinen Anlaß, geht morgens nicht auf die Straße, wenn die Geschäfte und Büros noch geschlossen sind.
Ich bin noch im Morgenrock, in dem älteren. Den besseren habe ich in dem Extra-Koffer für das Krankenhaus. Das Krankenhaus kommt immer plötzlich. Da bleibt keine Zeit mehr, zu waschen, zu bügeln oder gar neu einzukaufen. Es ist immer gut, wenn man mit dem Krankenhaus rechnet. Ich hab das plötzliche Krankenhaus immer im Hinterkopf.
Ich halte meine Kaffeetasse in der einen Hand. Ich muß auch manchmal umrühren. Den Kaffee und das Müsli. Ich muß trinken und essen. Aber ich muß auch gucken.
Wie ein langer Wurm schlängelt sich der Aufriß durch die Straße. Nein, nicht wie ein Wurm. Der würde unhörbar kriechen. Der Aufriß dröhnt. Arme zittern, die Helme der Männer wackeln. Manchmal ein greller Pfiff. Dann drängelt sich ein Lastwagen neben und zwischen die Bäume und bleibt am Aufriß stehen. Er wird mit ausgehobener Erde vollgeschauftelt und dann weggefahren. Oder er bleibt mehrere Stunden stehen, manchmal auf einen ganzen Tag, und die Menschen auf dem Trottoir und zwischen den Bäumen tänzeln um ihn herum. Sie sehen es auch ein, daß er da stundenlang im Weg stehen muß. Wegen der Eventualität.
Ich kann vom Fenster aus nicht sehen, ob der Lastwagenfahrer in seinem Führerhaus sitzt und schläft oder nur wartet, weil ich manchmal vom Fenster weg muß, wenn es bei mir eine Unterbrechung gibt. Da ruft eine Nachbarin an und sagt, daß sie mal ein paar warme Worte wechseln muß mit mir wegen der Abwechslung. Denn bei jedem Hammerschlag, der in der Wohnung über ihr falle, zucke sie zusammen. Dort machen sie aus zwei Zimmerchen ein größeres. Tendenz sei doch heute Großräumigkeit. Ich kann sie gut verstehen, denn sie ist noch sensibler als ich.
Der Fahrer sitzt immernoch im Lastwagen. Sonst tut er nichts. Er fährt nicht weg, steigt nicht aus. Wenn das so weiter geht, sitzt er noch stundenlang da drin in seinem Führerhaus und tut nichts. Manchmal fliegt eine Zigarettenkippe heraus. Ich könnte nicht stundenlang in einem Lastwagen sitzen und nichts tun. Jetzt vergleiche ich mich schon wieder mit anderen Leuten. Das sei falsch, sagt man mir, sich zu vergleichen. Jeder Mensch sei anders. Aber ich muß doch Maßstäbe setzen. Die lasse ich mir nicht nehmen.
Ich stehe immer noch am Fenster. Ich kann doch nicht weggehen, wo sich ständig etwas ereignen könnte. Dann wäre ich nicht dabei gewesen, und ich könnte auch nicht sagen, ich sei dabei gewesen. Und aussagen könnte ich auch nichts, wo es doch immer so auf Zeugen ankommt.
An dem einen Baum liegt ein ganzer Haufen Steine. Eckige Pflastersteine. Sicher Basalt. Aber ich bin nicht sicher, ob es Basalt ist. Ich bin kein Pflasterer oder Pflasterin. Die Steine sind schwarz bis dunkelgrau. Es sind solche, wie sie oft an der Straße liegen, wenn die Straßen nicht asphaltiert sind. Das ist ein schöner Steinhaufen. Ich muss immer wieder hinsehen. Ein schönes Grau. Und so viele. Wenn es regnet oder sie noch feucht sind von der Nacht, sind sie fast schwarz.
Ich gehe vom Fenster weg. Ich habe noch anderes zu tun. Wenn mich jemand beobachten würde, vielleicht vom Fenster gegenüber in dem großen Haus, würde der sich bestimmt fragen, was ich so lange am Fenster stehe. Aber es geht niemanden etwas an, daß ich so fasziniert bin von den grauen Steinen.
Der Mann sitzt immer noch in seinem Lastwagen. Sonst tut er nichts. Er wartet. Ob er sich merkwürdig vorkommt, daß er in so einem Führerhaus sitzen muß, um nichts zu tun. Bestimmt wartet er auf einen Auftrag. Inzwischen guckt er vor sich hin, wirft einen Zigarettenstummel aus dem Fenster. Er könnte den Auftrag bekommen, den Wagen wegzufahren, dann, wenn die anderen Männer, die den Graben ausheben, ihm zurufen, daß er jetzt wegfahren könne, weil er voll ist, der Lastwagen. Er käme bald wieder leer zurück, um wieder zu warten.
Ich habe noch immer die Pflastersteine im Kopf. Schöne Steine. Grau. Ein schönes Grau. Jetzt nieselt es, und sie fangen an zu glänzen.
Ich bin auf der Straße, habe Besorgungen gemacht. Ganz nah geh ich an den Steinhaufen heran. Mit dem Fuß trete ich gegen einen der Steine. Er bleibt fest liegen, bewegt sich nicht. Auch die anderen liegen fest. Ich fange an, sie in meine Gedanken mit einzubeziehen. Ich stelle sie mir in einem Garten vor. Zwischen den Beeten könnten hier und da welche liegen. Oder als Begrenzungsteine. Zwischen kleinen Gänseblümchen vor dem Übergang zum Efeu. Ein Garten. Wie nötig sind da Steine, solche soliden Basaltsteine, wo die Schieferplatten aufhören, wo ein Weg entlangführt. Als Begrenzung.
Ich denke nach. Unten im Keller fällt die schwere Feuerschutztür immer schnell hinter mir zu. Sie teilt die Treppe und den Vorkeller von den übrigen Kellern. Ein dazwischen liegender Stein könnte sie bremsen, und man könnte in Ruhe mit Eimern und Taschen hindurchgehen.
Immer wieder fallen mir die Steine in meine Gedanken. Aber ich lasse sie gleich wieder fallen und lasse sie liegen. Am Tag ist es zu hell. Aber neben der Haustür wächst ein dichter Busch. Wacholder. Groß und üppig ist er, so daß man in ihm etwas verstecken könnte. Bei Dunkelheit wollte ich meinen Anschlag durchführen. Ich nannte es meinen ›Anschlag‹.