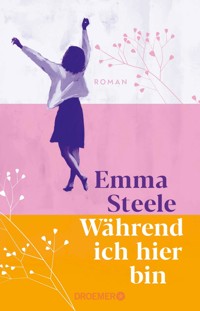
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eindringlich, dramatisch und mit besonderen Twists: Ein außergewöhnlicher Liebesroman, der Fragen stellt, die zutiefst berühren. Stell dir vor, eine Herz-Transplantation schenkt dir ein neues Leben – aber es ist nicht dein eigenes … »Während ich hier bin« ist ein besonderer Liebesroman, der Fragen nach unserer Verantwortung anderen und uns selbst gegenüber stellt. Stell dir vor, eine Herztransplantation schenkt dir ein neues Leben – aber es ist nicht dein eigenes … Seit ihrer Kindheit wartet die 30-jährige Maggie auf ein Spenderherz. Doch als das Wunder endlich geschieht, kann sie ihr Leben noch immer nicht genießen. Zu groß ist ihre Angst, wieder krank zu werden und ihren Eltern und ihrer Schwester noch mehr Leid zuzumuten. Tatsächlich beginnt ihr Körper nach einer Weile, das neue Herz abzustoßen. Maggie muss wieder ins Krankenhaus und erleidet einen Herzstillstand. Am nächsten Morgen erwacht sie in einer Wohnung, die sie nicht kennt – in einem Körper, der nicht ihrer ist! Nach dem ersten Schrecken stellt Maggie fest, dass sie das Leben einer gesunden, fröhlichen Frau namens Emily lebt. Sie lernt ihren Nachbarn Adam kennen und verbringt immer mehr Zeit mit ihm. Zum ersten Mal ist Maggie wirklich glücklich. Bis sie etwas über Emily erfährt, das alles verändert … Dramatisch, tragisch und spannend – ein gefühlvoller Roman, der ganz nebenbei Fragen der Moral und Verantwortung stellt Mit ihrem zweiten Liebesroman nach »Die Sekunde zwischen dir und mir« ist der schottischen Autorin Emma Steele wieder eine ganz besondere Geschichte gelungen. Leser*innen von Jojo Moyes oder Clare Empson werden Maggie sofort ins Herz schließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Emma Steele
Während ich hier bin
Roman
Aus dem Englischen von Nadine Alexander und Christina Kuhlmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit ihrer Kindheit wartet die 30-jährige Maggie auf ein Spenderherz. Doch als das Wunder endlich geschieht, kann sie ihr Leben noch immer nicht genießen. Zu groß ist ihre Angst, wieder krank zu werden und ihrer Familie noch mehr Leid zuzumuten. Tatsächlich beginnt ihr Körper, das neue Herz abzustoßen. Maggie erleidet einen Herzstillstand – und erwacht in einer Wohnung, die sie nicht kennt, in einem Körper, der nicht ihrer ist! Nach dem ersten Schreck stellt sie fest, dass sie das Leben einer gesunden, fröhlichen Frau namens Emily lebt. Sie lernt ihren Nachbarn Adam kennen und verbringt immer mehr Zeit mit ihm. Zum ersten Mal ist Maggie wirklich glücklich. Bis sie etwas über Emily erfährt, das alles verändert …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
Prolog
Lieber Empfänger,
ich schreibe Ihnen diesen Brief erfüllt von tiefer Trauer, aber auch ein wenig Hoffnung. Ein Brief, von dem ich nie gedacht hätte, ihn einmal schreiben zu müssen. Keine Mutter sollte je dazu gezwungen sein.
Meine Tochter, mein Leben – mein Herz – ist an einem heiteren, sonnigen Tag im Juli vollkommen unerwartet von uns gegangen. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Sie war gerade einmal dreißig und hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, all die wunderschönen Momente.
Das vergangene Jahr war entsetzlicher, als ich es mir je hätte vorstellen können, und es fällt uns noch immer schwer, nach vorn zu schauen – ohne sie. Wir können einfach nicht fassen, dass sie nicht mehr lebt, dass sie diese Welt für immer verlassen hat.
Meine Stella liebte es zu träumen, sprudelte über vor Ideen und mochte es bunt. Zugleich war sie überaus klug und zielstrebig und erfolgreich in allem – im Studium, im Sport und in der Musik –, und das bereits als Kind. Außerdem war sie herzensgut. Ich weiß noch, wie sie eine streunende Katze mit nach Hause brachte, als sie etwa zwölf war. Wenn sie nicht gerade in der Schule war, hat sie sich rund um die Uhr um sie gekümmert, bis wir es unterbanden und das Tier weggaben. Sie nannte sie Polly. Als sie klein war, nannte sie alles Polly. Sie hätte bestimmt gerne eine kleine Schwester gehabt, auf die sie hätte aufpassen können – mit der sie über alles hätte reden können, und es tut mir leid, dass wir ihr diesen Wunsch nie erfüllt haben.
Aber sie hatte viele Freunde. Wer sie kannte, mochte sie, die Leute fühlten sich einfach zu ihr hingezogen. Und sie liebte es, sich mit Menschen zu umgeben, mit anderen auszugehen und Partys zu feiern. Allerdings hatte sie nicht oft Gelegenheit dazu – ich fürchte, wir waren einfach zu streng mit ihr. Und das ist nicht das Einzige, was ich bedaure, aber das interessiert Sie sicher alles nicht. Allerdings habe ich schon unzählige Anläufe genommen, diesen Brief zu schreiben, und ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, noch einmal von vorn zu beginnen.
Ich würde Ihnen gerne noch so vieles über sie erzählen, doch jedes Mal, wenn ich den Stift ansetze, werde ich auf schmerzliche Weise daran erinnert, dass sie nicht mehr da ist.
Allerdings habe ich noch eine Sache auf dem Herzen, also lesen Sie bitte weiter, wenn es Ihnen möglich ist.
Nach der Schule ging meine Tochter auf eine hervorragende Universität, bekam anschließend einen Job in einer renommierten Firma und arbeitete sich schnell an die Spitze. Sie übertraf all unsere Hoffnungen und Träume.
Doch dann erkannte ich sie eines Tages nicht mehr wieder. Sie hatte sich auf eine Weise verändert, die ich bis heute nicht verstehe. Denn um ehrlich zu sein, habe ich sie ein halbes Jahr vor ihrem Tod zum letzten Mal gesehen. Wir hatten eine heftige Auseinandersetzung wegen einiger Entscheidungen, die sie getroffen hatte, und danach packte sie ihre Sachen und zog in den Norden, in eine winzige Wohnung über einer Bäckerei. Als ich schließlich zu ihr gefahren bin, um sie zu überzeugen, nach Hause zu kommen, haben wir uns erneut gestritten. Ich war zu stur, um ihr zuzuhören, und habe Dinge zu ihr gesagt, die ich bis in alle Ewigkeit bereuen werde.
Auch jetzt noch träume ich jede Nacht von ihr, nur um irgendwann aufzuwachen und festzustellen, dass sie nicht da ist und auch nie zurückkommen wird, mein süßes kleines Mädchen.
Mein Ein und Alles.
Wenn ich doch nur mehr wüsste über die Zeit, bevor sie uns für immer verließ, darüber, was sie gemacht hat, und über die Menschen, denen sie begegnet ist. Ich wünschte, ich könnte diese letzten, fehlenden Teile zu einem Bild zusammenfügen – dem Lebensbild meines einzigen Kindes. Doch am meisten sehne ich mich danach, meine Stella ein letztes Mal in die Arme zu schließen und ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe – dass sie mir alles bedeutet hat und dass sich daran auch nie etwas ändern wird.
Seit ich von ihrem Tod erfuhr, habe ich so manche dunkle Stunde durchlebt, und es gab Momente, da habe ich mich gefragt, ob mein Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Und das habe ich mich mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gefragt.
Doch nach allem, was ich getan habe, verdiene ich es nicht besser.
Aber kürzlich ist mir ein Gedanke gekommen, der mir wieder ein wenig Hoffnung geschenkt hat: Vielleicht lebt sie ja weiter – in den Organen, die sie gespendet hat, den Menschen, deren Leben sie gerettet hat.
Vor allem aber in ihrem Herzen, dem Herzen, das jetzt in Ihrer Brust schlägt. Denn meine Stella hatte ein unglaublich großes Herz, weit größer, als Sie es sich vorstellen können. Und deshalb wollte ich Ihnen von ihr erzählen, damit Sie verstehen, wie außergewöhnlich ihr Herz ist und Sie sie in sich weiterleben lassen.
Würden Sie das für mich tun?
Meine Stella weiterleben lassen?
Kapitel 1
Die späte Vormittagssonne scheint durch das Blätterdach und zeichnet ein filigranes Muster auf den Kiesweg vor mir, doch ich nehme seine Schönheit kaum wahr. Meine Gedanken kehren immer wieder zu dem Brief zurück, der in meiner Hosentasche steckt.
Der mich wie ein Stich ins Herz getroffen hat.
»Alles in Ordnung?«, erkundigt sich Jess, die neben mir hergeht. Ich werfe einen Blick zu ihr hinüber, sehe ihr dunkelblondes Haar und die Sonnenbrille in ihrem Gesicht. In ihrer Hand hüpfen drei gelbe Luftballons auf und ab, die sie zur Feier des Tages mitgebracht hat.
»Klar, alles bestens«, erwidere ich fröhlich, während ich an den Moment vor einer Woche zurückdenke, als die Post ankam.
Aber heute werde ich mich nicht damit beschäftigen.
Stattdessen widme ich meine Aufmerksamkeit ganz meinen vierjährigen Neffen, die im Partnerlook – beigefarbene Shorts und weiße T-Shirts – mit wehenden roten Haaren vor uns herflitzen. Überall stehen imposante alte Bäume, durch die sich geheime Pfade schlängeln und auf kleine, versteckte, grasbewachsene Lichtungen führen.
Während ich den beiden zusehe, muss ich daran denken, wie meine Schwestern und ich als Kinder hier im Botanischen Garten gespielt haben. Cat übernahm stets lautstark die Führung, und ich befolgte brav jede ihrer Anweisungen, obwohl ich nur neun Monate jünger war als sie. Jess, die drei Jahre jünger war als ich, lief in einigem Abstand hinter uns her und bemühte sich verzweifelt, mitzuhalten.
»Hunter, Sebs, lauft nicht so weit vor!«, ruft Jess neben mir. »Graham, sieh zu, dass du die beiden nicht aus den Augen verlierst.«
Gehorsam nimmt mein Schwager, in seinen Baumwollshorts und dem blauen Hemd, im Laufschritt die Verfolgung auf, während seine Föhnfrisur in der Brise flattert. Er knurrt, und die Jungs stieben quietschend vor Vergnügen im Zickzackkurs davon, um seinen ausgestreckten Klauen zu entkommen.
Dicht hinter uns höre ich meine Eltern lachen und kann mir selbst ein Grinsen nicht verkneifen.
Dann treten wir unter dem dichten Blätterdach ins helle Licht hervor. Sobald ich die Sonne auf dem Gesicht spüre, setze ich mir den Sonnenhut mit der breiten Krempe auf. Am Horizont erstreckt sich die majestätische Skyline von Edinburgh, von Arthur’s Seat mit seiner markanten Felswand zur Linken bis hin zum Edinburgh Castle zur Rechten. Auf der anderen Seite thront hinter einem grünen Saum ein Sandsteinhaus im georgianischen Stil, das Herz des Botanischen Gartens. Kinder schlagen in der Julisonne Rad, während die Eltern mit Kaffeebechern in der Hand durch den Park flanieren. Die warme Luft riecht nach Kiefern und Gras, und von den Sträuchern in der Ferne dringt der Duft von Rhododendron herüber.
»Und«, frage ich betont beiläufig, während wir den Weg entlangschlendern, »hast du dir die silbernen Turnschuhe geholt, die du so klasse fandest?«
Jess lächelt schuldbewusst. »Tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Sie passen einfach perfekt zu all meinen Sachen.«
Ich muss lachen und deute auf meine Füße. »Und ob sie das tun, deshalb hab ich sie mir ja zuerst ausgesucht.«
Sie grinst, und ich puffe ihr verspielt in die Seite.
Dann fragt sie in ebenso beiläufigem Tonfall: »Und, wie fühlst du dich an deinem großen Tag? Bist du aufgeregt?«
Ich werfe einen Blick auf die Ballons, die in meiner Lieblingsfarbe leuchten. »Aber klar doch«, erwidere ich munter, doch im gleichen Moment zieht sich mein Magen schmerzhaft zusammen.
Denn genau heute vor einem Jahr habe ich ein neues Herz bekommen. Wegen eines fortschreitenden, genetisch bedingten Herzfehlers.
»Was viel wichtiger ist«, wechsele ich das Thema und schiebe das beklemmende Gefühl beiseite, »bist du dennschon aufgeregt wegen deines großen Abenteuers?«
Jess schweigt einen Moment, ihr Gesichtsausdruck hinter der Sonnenbrille verborgen.
»Ja, schon«, antwortet sie schließlich. »Aber ich würde mich noch wesentlich mehr freuen, wenn ich wüsste, dass du uns besuchen kommst. Du könntest uns helfen, uns einzugewöhnen, und dir bei der Gelegenheit auch gleich die Sehenswürdigkeiten anschauen.«
»Komm schon, Jess, du weißt genau, dass ich noch nicht reisen kann. Vielleicht im nächsten Jahr.« Ich bemühe mich nach Kräften, zuversichtlich zu klingen.
Jess runzelt die Stirn auf eine Weise, die mir nur zu gut vertraut ist. Die Enttäuschung ist ihr deutlich anzumerken, und mich überkommt ein schlechtes Gewissen.
Sie zieht in zwei Wochen mit ihrer Familie nach Amsterdam, um dort als Lehrerin zu arbeiten, und natürlich möchte ich sie dort besuchen. Nichts lieber als das. Jess ist schließlich meine Schwester – und seit einiger Zeit auch meine beste Freundin. Ich würde überhaupt liebend gern verreisen, egal wohin, nachdem es für mich bisher so gut wie unmöglich war. Aber ich darf mich nicht überanstrengen, das wäre einfach zu gefährlich.
Und das weiß keiner besser als Jess.
»Bist du denn gar nicht neugierig auf das Haus, das du für uns gefunden hast?«, drängt sie weiter. »Es ist übrigens fantastisch. Hast du gesehen, wie viel Platz die Jungs haben?«
Ich erhasche einen Blick auf die beiden und ihren Dad in dem kleinen Gehölz vor uns und muss lachen. Hunter springt von einem Baum, auf den er mit Sicherheit nicht hätte klettern sollen. »Ob du’s glaubst oder nicht, an meine Neffen habe ich ganz besonders gedacht.«
Jess atmet hörbar aus und meidet meinen Blick, und mich beschleicht – wie so oft in letzter Zeit – das Gefühl, dass sie mir etwas vorenthält. Anfangs dachte ich, es läge einfach nur am Umzug, aber inzwischen bekomme ich immer mehr den Eindruck, dass sie sich von mir abkapselt. Dabei stehen wir uns eigentlich sehr nahe – wir streiten uns manchmal, ja, aber das kommt schließlich in den besten Familien vor.
Natürlich ist es mit ihr nicht das Gleiche wie mit Cat, wir beenden nicht die Sätze der jeweils anderen oder rufen uns exakt zur gleichen Zeit an. Cat musste ich nur ansehen, um zu wissen, dass sie dringend eine Tüte M&M’s brauchte – die mit Erdnüssen, ihre Lieblingssorte. Und sie spürte instinktiv, wenn mir mal wieder alles zu viel wurde und ich nur noch meinen Kopf in ihrem Schoß vergraben wollte. Aber auch Jess und ich haben ein sehr enges Verhältnis. Kein Wunder, nach allem, was passiert ist.
Wir biegen in den Weg ein, der an der Wiese entlangführt. Das Gras glitzert in der Sonne. Vor uns liegt ein steiler Hang, und ich halte einen Moment inne.
Dann mache ich mich an den Aufstieg, doch im gleichen Augenblick erscheint ein Bild von Cat vor meinem inneren Auge, mein Atem beschleunigt sich, und mein Herz pocht heftig in meiner Brust. Abrupt bleibe ich stehen.
»Alles in Ordnung?«, erkundigt sich Jess. Sie ergreift meinen Arm und sieht mich entschlossen an. »Na los, komm, zusammen schaffen wir das.«
»Ach was«, erwidere ich und schenke ihr ein Lächeln, »ich geh einfach außenrum.«
Ein Hauch von Sorge huscht über ihr Gesicht, und ich ärgere mich selbst darüber, wie erbärmlich ich klinge. Aber ich will einfach kein Risiko eingehen.
Nicht heute.
Auf dem Kies hinter uns knirschen Schritte, und als ich mich umdrehe, sehe ich Mum auf uns zurennen.
Mist.
»Was ist denn los? Geht’s dir gut?« Mum klingt angespannt und ist außer Atem. Mit einem Mal wird mir klar, wie es ausgesehen haben muss, als ich so abrupt stehen geblieben bin.
»Alles bestens, wirklich«, versichere ich hastig und mache mich auf den Weg zurück den Hügel hinab. »Ich gehe nur lieber außenrum.«
»Dann ist es ja gut«, sagt Mum erleichtert und atmet tief durch. »Ich komme mit.« Sie dreht sich um und ruft: »Ian, es geht ihr gut!«
Der Picknickkorb und die Stühle liegen hinter Dad auf dem Weg, dort, wo er sie fallen lassen hat. Er nickt, aber auch auf seinem Gesicht erkenne ich deutlich die Anspannung und den Angstschweiß, bevor er kehrtmacht, um die Sachen wieder einzusammeln.
Ziemlich ernüchtert mache ich mich in Begleitung von Mum und Jess auf den weiten Weg um den Hügel herum. Wir laufen über die Wiese, vorbei an Picknickdecken und Leuten, die ein Sonnenbad nehmen, bis Mum unweigerlich an einer schattigen Stelle stehen bleibt. Mein Immunsystem erlaubt es mir zurzeit nicht, mich längere Zeit der direkten Sonne auszusetzen.
»Hier ist doch ein guter Platz«, erklärt sie. Ihre Stimme klingt eine Spur besorgter als sonst, und sie tut mir leid – schließlich ist unser Ausflug auch für sie etwas Besonderes, und sie sollte ihn genießen.
Sie trägt extra den großen Strohhut und ihr Lieblingskleid mit den Mohnblumen. Sie hatte es sich vor ein paar Jahren für den Urlaub gekauft, der, wie es nicht anders zu erwarten war, abgesagt werden musste.
»Wenn alles so weit okay ist, geh ich mal kurz meine Sprösslinge einsammeln«, verkündet Jess und eilt den Hügel wieder hinunter. Ich sehe ihr sehnsüchtig nach. Natürlich bin ich es gewohnt, allein in der Obhut meiner Eltern zurückzubleiben – schließlich lebe ich immer noch zu Hause –, aber ich würde nur zu gern für einen Moment mit ihr tauschen.
Dad kümmert sich wie immer um die Logistik, breitet die Decke mit dem Schottenmuster aus und stellt für die »ältere Generation« zwei Liegestühle auf, während Mum und ich den Picknickkorb auspacken. Die Sandwiches entlocken mir ein Mmh und die Snacks von Marks & Spencer – Salami und Käse, große Oliven und samtiger Hummus – ein Oh, wie lecker, doch dann holt Mum noch eine Tupperdose aus dem Korb und reicht sie mir.
»Danke«, sage ich lächelnd. Durch das weiße Plastik kann ich schemenhaft meine Vollkornsandwiches erkennen, und bei ihrem Anblick entfährt mir ein wehmütiger Seufzer.
Plop.
Ich sehe auf. Dad hält eine offene Champagnerflasche in der Hand, aus der die Flüssigkeit schäumend heraussprudelt und über den Rand läuft. Mir wird warm ums Herz, als ich ihn da in seinem karierten Lieblingshemd stehen sehe. Sein weißes Haar sieht im Licht der Sonne nahezu durchscheinend aus, aber das breite, alberne Grinsen in seinem Gesicht lässt ihn um Jahre jünger erscheinen.
»Hier, für dich, Kleine«, sagt er und hält mir ein Glas hin. Als ich seinen alten Kosenamen für mich höre, muss ich lächeln. Doch eh ich michs versehe, steht Mum schon da. »Was soll denn das, Ian?«, fragt sie vorwurfsvoll und nimmt ihm das Glas aus der Hand. »Warum hast du das Zeug überhaupt mitgebracht?«
Die Enttäuschung ist Dad deutlich anzusehen, und er tut mir leid. Schließlich wollte er mir bloß eine Freude machen.
»Es ist doch nur ein winziger Schluck«, versuche ich Mum zu beschwichtigen, aber sie hört mir gar nicht zu.
»Siehst du? Das Glas ist doch nur halb voll«, pflichtet Dad mir bei.
Eine unheilvolle Stille breitet sich zwischen uns dreien aus, und ich will gerade etwas sagen, um die Lage zu entschärfen, als ich ein junges Paar über die Wiese auf uns zuschlendern sehe. Etwas an der Gestalt des Mannes kommt mir bekannt vor. In Shorts und T-Shirt, die Sonnenbrille im Gesicht, wirkt er betont lässig, aber sein kräftiges Kinn und den dunklen Haarschopf würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Mir rutscht das Herz in die Hose.
Nick.
Kapitel 2
Ich brauche eine Weile, um zu verarbeiten, wen ich da sehe. Hastig will ich mich abwenden, damit er mich nicht entdeckt, aber es ist schon zu spät.
Wir müssen da jetzt durch, ob wir wollen oder nicht, und ich spüre Panik in mir aufsteigen.
Je näher er kommt, desto besser kann ich erkennen, wer ihn begleitet – eine junge Frau, nicht weniger attraktiv als er, mit langen, goldblonden Haaren und schlanken, gebräunten Beinen, die aus ihren Jeansshorts hervorschauen. Er flüstert ihr etwas zu, und sie schaut neugierig lächelnd zu mir herüber. Ich würde mich am liebsten irgendwo verkriechen.
Hastig stehe ich auf, als mir bewusst wird, wie blass ich aussehen muss in meinem weiten, dunklen Kleid, die roten Haare zurückgebunden. Erst als sie uns fast erreicht haben, fallen mir die Rundung ihres Bauches unter dem figurbetonten Trägertop und der glitzernde Ring an ihrer linken Hand auf. Ich schlucke.
»Maggie«, sagt Nick und bleibt vor mir stehen. Er schiebt sich die Sonnenbrille aus dem Gesicht und nimmt mich mit diesen funkelnden blauen Augen, die mich immer so fasziniert haben, ins Visier. »Dachte ich mir doch, dass du das bist. Wie geht es dir?«
»Danke, gut«, erwidere ich prompt, während mein Herz rast und ich mich wundere, dass ich vor lauter Nervosität überhaupt ein Wort herausbringe. »Ach, was sage ich, hervorragend. Wir sind hier, um meinen … etwas zu feiern.« Ich möchte doch lieber nicht ins Detail gehen.
»Wie schön«, sagt er und wendet sich seiner Begleiterin zu. »Das ist übrigens Sophie.«
»Hi, Sophie«, begrüße ich sie eine Spur zu überschwänglich.
»Nett, dich kennenzulernen, Maggie«, erwidert sie aufrichtig, was alles nur noch schlimmer macht. Ich werfe einen verstohlenen Blick auf die Armreifen, die sie trägt, und die ausgetretenen Flipflops an ihren Füßen.
»Nick«, ertönt eine Stimme hinter mir, und ich würde am liebsten im Boden versinken, als Mum lächelnd neben mir auftaucht. »Du bist es tatsächlich.«
»Hallo, Sue. Wie geht es dir?«, erkundigt er sich. »Perfektes Wetter für ein Picknick.«
»Nicht wahr? Einfach herrlich«, sprudelt Mum sofort los. »Aber wie geht es dir denn? Wohin hat es dich verschlagen?«
»Nach Genf. Wir sind dort in die Skibranche eingestiegen, haben unseren eigenen Betrieb.« Sophie und er schauen sich glücklich an. »Wir sind auf Besuch bei meinen Eltern hier, solange wir noch können.« Er deutet auf Sophies Bauch, und ich lächle und sage automatisch Herzlichen Glückwunsch, während meine Brust sich schmerzhaft zusammenzieht. Warum müssen wir uns ausgerechnet heute über den Weg laufen? Während ich schön brav mit meinen Eltern beim Picknick sitze.
»Das klingt wirklich wunderbar«, sagt Mum freudestrahlend.
»Und was ist mit dir, Maggie?«, fragt Nick. Er schielt auf die Picknickdecke hinter mir, wo Dad in der Kühlbox herumkramt. »Wohnst du noch … hier?«
»Jupp, im guten alten Edinburgh, wo sonst?«, erwidere ich, wobei mein Versuch, heiter zu klingen, kläglich scheitert.
»Und sie arbeitet auch noch bei derselben Agentur«, verkündet Mum fröhlich, aber es klingt wie Hohn in meinen Ohren, und meine Augen füllen sich mit Tränen.
Nick scheint nicht im Mindesten überrascht zu sein. »Sollte es dich jemals in die Alpen verschlagen …« Er spricht nicht weiter, und so etwas wie Bedauern huscht über seine Züge. »Wie auch immer, es war wirklich schön, dich wiederzusehen.«
»Fand ich auch«, erwidere ich, und dann schlendern die beiden über den Rasen davon.
Sobald sie verschwunden sind, wendet Mum sich mir zu. Sie wirkt bedrückt. »Solche Treffen tun immer ein bisschen weh. Er war halt schon eine super Partie … aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr letztlich miteinander glücklich geworden wärt.«
»Mum.« Resigniert schlage ich die Hände vors Gesicht und wünschte erneut, ich könnte im Erdboden versinken.
»Wieso? Was ist denn?«, fragt sie, doch mir fehlen die Worte.
Kurz darauf erscheint Jess neben uns. »Gerade rechtzeitig zum Anstoßen«, witzelt sie, bevor ihr Blick zwischen Mum und mir hin- und herwandert. »Ist was passiert?«
Es folgt angespanntes Schweigen. Wortlos zieht Mum los, um Jess ein Glas Champagner zu holen. Und bevor ich etwas sagen kann, kommen Hunter und Sebs angestürmt. Vermutlich veranstalten sie ein Wettrennen um die blaue Tasse. Was der eine will, will der andere auch.
Genauso wie bei Cat und mir damals. Ihr wäre sicher etwas eingefallen, um die Situation zu entschärfen, irgendetwas Lustiges, worüber wir noch den ganzen Tag gelacht hätten.
Mein Gott, wie ich sie vermisse.
Als sich mein Herzschlag langsam wieder beruhigt, lassen wir uns alle mit einem gefüllten Glas nieder – Mineralwasser für Mum und mich, Limonade für die Jungs und für die anderen den eingeschmuggelten Schampus. Die traumatische Begegnung mit meinem Ex ist vergessen – von allen außer mir.
»Jetzt ist es aber höchste Zeit, dass wir endlich unser Glas auf unsere liebe Maggie erheben«, sagt Dad schließlich. »Und haben wir uns nicht den perfekten Platz dafür ausgesucht? Ich weiß noch genau, wie ihr drei kleinen Racker hier herumgetobt seid.« Er sieht mich mit feuchten Augen an. »Alles Gute zum ersten Herz-Geburtstag, Maggie.«
Jess drückt meine Hand, und ich atme tief ein.
»Alles Gute zum Herz-Geburtstag«, stimmt auch Graham mit ein, der sich gemütlich auf der Decke ausgestreckt hat. Er erhebt sein Glas.
Und dann wiederholen sie alle gemeinsam: »Alles Gute zum Herz-Geburtstag!«
Jess lächelt mir mit zitternden Lippen zu, als wollte sie sagen: Du hast es geschafft.
Doch ich denke nur: Cat aber nicht.
Und das ist einzig und allein meine Schuld.
Kapitel 3
Einige Zeit später, als die anderen satt und zufrieden sind, lasse ich mich ein Stück entfernt auf einer Bank nieder, um die Jungs im Auge zu behalten, die in der Nähe spielen. Allerdings bin ich seit der Begegnung mit Nick eher damit beschäftigt, auf meinem Handy hin und her zu scrollen. Ich habe mich überwunden, mir endlich seine Website anzusehen – all die Bilder von den unzähligen Reisen, die er unternommen hat, seit wir uns getrennt haben, Aufnahmen von ihm und Sophie aus der Zeit, als sie sich kennenlernten: die beiden wandernd im Dschungel und faulenzend am Strand, ihre filmreife Hochzeit – auf Bali, wenn ich mich nicht täusche. In diesem Moment wünsche ich mir, ich hätte mir damals nicht so feierlich geschworen, die Website nie wieder aufzurufen. Wäre ich ein bisschen besser vorbereitet gewesen, hätte mich unser Zusammentreffen nicht so aus der Bahn geworfen. Dabei war es reiner Selbstschutz.
Anders ging es einfach nicht.
Das Wiedersehen mit Nick ruft auch Erinnerungen an die Zeit hervor, als ich noch ins Büro gegangen bin. Jetzt tue ich das natürlich nicht mehr, das Infektionsrisiko ist bei Weitem zu groß und der tägliche Weg hin und zurück viel zu anstrengend. Allerdings arbeite ich so viel wie möglich von zu Hause aus. Und Reiseplaner zu sein ist gar nicht so übel; zumindest virtuell bin ich bereits durch die weiten Flure des Rijksmuseums gewandert und entlang der glitzernden Grachten in Amsterdam; ich bin in Neuseeland aus Flugzeugen gesprungen und über Schluchten gesegelt; habe den Mont Blanc gesehen und die Dawn Wall erklommen. Auch die Kollegen sind nett, selbst wenn sie nie lange bleiben. So ist das eben in der Reisebranche – alle ziehen weiter, alle bis auf mich. Ich verdiene auch nicht schlecht, wobei ich ja sowieso nicht viel unternehme. Ich kann mich also nicht beklagen. Nicht wirklich.
Trotzdem wüsste ich nur zu gern, wie es sich anfühlen würde, einer meiner Kunden zu sein. Zu beschließen, irgendwohin zu fahren, und es dann auch tatsächlich zu tun – auf einer türkisfarbenen Welle zu surfen oder in einen kristallklaren See zu springen, einen sonnenüberfluteten Berg zu besteigen oder in einem Heißluftballon davonzusegeln. All diese Dinge selbst zu erleben und nicht bloß auf dem Bildschirm zu sehen.
Und plötzlich frage ich mich, wie es wohl wäre, wenn ich jetzt mit Nick in Genf lebte.
Dann fällt mir der Brief wieder ein. Ich fühle nach, ob er noch da ist, als ich mich daran erinnere, dass ich ihn vorhin zur Sicherheit in meine Tasche gesteckt habe. Ich wusste natürlich, dass ich ihn erhalten würde – der Donor Family Care Service, der die Familien von Organspendern betreut, hatte mich darüber in Kenntnis gesetzt. Man hatte mir versichert, dass alles vollkommen anonym abliefe und ich nicht dazu verpflichtet sei, den Brief zu öffnen.
Dabei habe ich ihn inzwischen so oft gelesen, dass ich ihn schon fast auswendig kann.
Lieber Empfänger, lautet die Anrede.
Natürlich hatte ich selbst auch schon überlegt, die Familie meines Spenders anzuschreiben. Und nicht nur das, ich habe tatsächlich unzählige Versuche gestartet, einen Dankesbrief oder eine E-Mail zu verfassen. Immerhin haben diese Menschen mir ein unglaublich wertvolles Geschenk gemacht und unfassbar großes Leid erfahren, genauso wie wir.
Aber …
Ich weiß einfach nicht, was ich ihnen schreiben soll. In mir schlägt das Herz eines Menschen, den sie über alles geliebt haben. Was können sie schon von mir hören wollen? Ich kann einfach nicht umhin, mich schuldig zu fühlen, weil ich vom Tod eines anderen Menschen profitiere, weil ich wollte, dass er stirbt. Denn genau so ist es doch, oder etwa nicht? Als ich von einem Spenderherzen träumte, sehnte ich mich gleichzeitig danach, dass ein anderes Leben endet. Aber als ich mit den Ärzten darüber sprach, sagten sie, so dürfe ich nicht denken; dass die Person, deren Herz jetzt mir gehört, sowieso gestorben wäre und das Ganze nicht in meiner Macht läge.
Offenbar ist das Einzige, was mir bleibt, das Beste aus meinem Geschenk zu machen – sie weiterleben zu lassen, so wie Stellas Mutter es sich gewünscht hat.
Und tue ich das nicht, indem ich gesund bleibe und dieses Herz mit allen Mitteln schütze?
Graham kommt zu mir herüber, in der Hand ein weiteres Glas Schampus, das Jess ihm heimlich nachgefüllt haben muss, und ich setze ein Lächeln auf.
Trotz seiner ständigen Sticheleien ist er inzwischen wie ein Bruder für mich. Ich kenne ihn schon fast mein ganzes Leben lang, und er liebt Jess über alles, und damit ist er in meinen Augen ein Held.
»Und, hast du den Tag gut überstanden?«, fragt er.
»Es war ein mit Hummus garnierter Traum, Graham«, antworte ich und lege mein Handy neben mich auf die Bank. »Nur die Jungs tun mir ein bisschen leid, ist ja nicht gerade besonders aufregend für sie.«
»Hauptsache, du bist da, mehr brauchen die beiden nicht zum Glück, genau wie ihre Mutter. Sie haben sich also prächtig amüsiert«, versichert mir Graham.
»Vielleicht bekommt ihr ja noch die Gelegenheit für ein kleines Abenteuer, bevor ihr aufbrecht. Ihr könntet doch zum Cottage hochfahren. Mum und Dad haben es diesen Monat nicht vermietet.«
»Würdest du mitkommen?«
Ich zögere einen Moment.
»Ich halte euch doch nur auf«, entgegne ich, bemüht, unbeschwert zu klingen.
Als ich zu ihm aufschaue, sieht er mich geradezu verärgert an. »Hör auf, dir ständig Gedanken um die Bedürfnisse anderer zu machen, und tu einfach mal, was du willst. Das würde uns allen guttun.«
Einen Augenblick lang weiß ich nicht, was ich sagen soll, auf diesen Tonfall war ich nicht gefasst. Ich bin auch nicht sicher, was er damit meint – das würde uns allen guttun? Er kann schon sehr direkt werden, wenn er etwas getrunken hat, doch obwohl er bereits Teil der Familie war, als es passierte, kann er einfach nicht verstehen, was es bedeutet, an allem schuld zu sein.
Verantwortlich zu sein für so viel Leid.
Seitdem bin ich noch nicht wieder im Cottage gewesen – ich kann einfach nicht.
»Wenigstens werden die Jungs nachher gut schlafen«, bemerke ich in dem Versuch, die Unterhaltung auf ein anderes Thema zu lenken.
»Na, das hoffe ich doch«, erwidert er lachend, »schließlich rennen sie schon seit Stunden durch die Gegend.«
»Du kannst dich ja später mit Jess nach Hause schleichen, dann könnt ihr noch ein Glas Wein zusammen trinken«, schlage ich vor. »Die Kinder können doch bei Mum und Dad übernachten.«
Mich plagt ein wenig das schlechte Gewissen, dass ich noch zu Hause wohne und das Esszimmer mit Beschlag belege. Doch so elend, wie es mir vor der Transplantation ging, konnte ich nicht mehr ständig die Treppe hoch- und runtersteigen, und es ist sicherlich angebracht, weiterhin jedes Risiko zu vermeiden.
Manchmal stelle ich mir vor, wie meine eigenen vier Wände aussehen würden oder besser gesagt: mein eigenes Leben. Vielleicht hätte ich eine Blockhütte an einem abgelegenen Ort in den Bergen und würde mir meinen Lebensunterhalt als Yogalehrerin verdienen; oder ich würde in einem Wohnmobil um die Welt reisen und einen Blog darüber schreiben oder in einem Penthouse in der Stadt wohnen, mit einem aufregenden Job, der mich in jeden erdenklichen Winkel der Welt führen würde. Ich würde jeden Abend essen gehen und mich einmal um den Globus futtern. Außerdem würde ich nach Herzenslust daten und alles tun, worauf ich Lust habe, in der Gewissheit, dass jeder Tag etwas Neues bringt. Aber von einem solchen Leben kann ich nur träumen. Was, wenn mir etwas zustoßen und ich krank werden würde? Das könnte ich den anderen nicht antun – nicht noch einmal.
»Das klingt echt gut«, sagt Graham seufzend. »Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir wahrscheinlich doch nicht umziehen.«
Ich sehe ihn entgeistert an.
Er scheint mir den Schock deutlich anzumerken, denn er wird kreidebleich.
»Scheiße … Ich dachte, Jess hätte dir vorhin davon erzählt«, murmelt er und weicht meinem Blick aus.
»Was redest du da, Graham? Warum um alles in der Welt solltet ihr hierbleiben?«, frage ich fassungslos.
Und weshalb hatte Jess nichts davon erwähnt?
Er setzt zu einer Antwort an, als mir plötzlich auffällt, dass meine Schwester nirgendwo zu sehen ist.
Mich beschleicht ein seltsames Gefühl.
»Bin gleich wieder da«, sage ich, stehe auf und gehe über den Rasen. Ich schlängele mich zwischen spielenden Kindern und lächelnden Erwachsenen hindurch, bis ich unseren Picknickplatz sehen kann. Mum und Dad sind irgendwohin verschwunden, aber Jess ist noch da. Sie starrt auf etwas Weißes in ihrer Hand.
Der Brief.
Als ich mich nähere, schaut sie auf. »Was zum Teufel ist das, Maggie?«
»Was soll das denn, bitte schön? Warum kramst du in meinen Sachen herum?«
»Ich krame nicht in deinen Sachen herum, Maggie. Er lag mitten auf der Decke, wo ihn jeder sehen konnte.«
Mist, er muss mir aus der Tasche gefallen sein.
»Warum hast du uns denn nichts davon erzählt? Nach allem, was wir gemeinsam durchgestanden haben.«
Eine Welle der Frustration überkommt mich. »Weil ich ihn erst vor einer Woche bekommen habe. Ich muss das erst mal selbst verdauen.«
Ihre Augen weiten sich. »Hast du denn gelesen, was da steht?«
»Klar hab ich das.«
»Und stimmst du dem zu?« Sie hält mir den Brief unter die Nase.
»Natürlich«, gebe ich zurück, wenn auch ein bisschen kleinlauter als zuvor.
Jess reißt die Arme hoch. »Und warum machst du das alles dann nicht?«
»Was alles?«
»Na, einfach alles, Maggie. Du hast ein neues Herz. Du bist endlich gesund. Warum machst du nicht das Beste daraus?«
»Als ob dir das nicht klar wäre. Du weißt ganz genau, dass ich nichts von dem tun kann, was ich gerne möchte«, gifte ich zurück.
Jess starrt mich an, als hätte ich etwas total Verrücktes gesagt.
»Warum denn nicht? Als Cat noch da war, hast du es doch auch gemacht, und …«
»Und hast du etwa vergessen, was passiert ist?«, falle ich ihr ins Wort.
Stille breitet sich in der warmen Luft zwischen uns aus, und mir ist klar, dass wir beide die gleichen Bilder vor Augen haben.
Das Krankenhaus, tränenüberströmte Gesichter.
Abgrundtiefe Verzweiflung.
»Maggie«, sagt Jess schließlich, und ihre Stimme klingt jetzt sanfter, »Cat ist gestorben, und das war entsetzlich, für uns alle. Aber willst du dich deswegen für immer zu Hause verkriechen?«
Ich will sie gerade daran erinnern, dass mein neues Herz nur siebzig Prozent Pumpleistung hat, dass ich auch in Zukunft bei Weitem nicht so belastbar bin wie andere Leute, wenn ich nicht plötzlich tot umfallen will, nicht die Ursache sein will für noch mehr Trauer und Verzweiflung, als sie weiterspricht.
»Dieses Herz war dazu gedacht, dir eine zweite Chance zu geben, Maggie. Ach, was sage ich, es sollte dir überhaupt erst die Chance geben, dein Leben zu genießen. Und du machst absolut nichts daraus.«
Ihre Worte sind wie ein Schlag in die Magengrube.
»Absolut nichts? Immerhin bin ich heute hier, oder etwa nicht?«, frage ich schnippisch.
»Na super – ein paar Stunden Picknick im Park, bevor du mit Mum und Dad wieder nach Hause zurückfährst, wo es noch gegrilltes Hähnchen gibt.«
So langsam steigt mir die Galle hoch.
»Und was bitte soll ich deiner Meinung nach tun? Mich volllaufen lassen und auf Berge klettern? Verstehst du denn nicht, was die Ärzte sagen? Ich muss den Rest meines Lebens aufpassen, wenn ich nicht riskieren will, dass etwas schiefgeht.«
»Natürlich schlage ich nicht vor, dass du Berge erklimmst, Gott bewahre. Aber was ist mit dem Kunststudium? Und du musst doch auch mal Spaß haben und dich mit Freunden treffen. Dich verlieben. Ich weiß übrigens, dass Nick vorhin hier war.«
Ich schließe für einen Moment die Augen. Die Erinnerung tut immer noch weh.
»Erzähl du mir nichts von Liebe, Jess. Du wirst nie verstehen, was ich nach Cats Tod durchgemacht habe.«
Ich bedaure meine Worte, noch ehe sie verklungen sind.
»Willst damit etwa sagen, ihre eigene Schwester weiß nicht, wie du dich gefühlt hast?«, fragt Jess mit seltsam gefasster Stimme. »Aber klar, zwischen euch bestand ja immer eine ganz besondere Verbindung. Hab ich nicht recht?«
»Jess, es tut mir leid. Das meinte ich doch gar nicht«, versichere ich hastig.
»Sondern?«
Mir fehlen die Worte – wie soll ich ihr klarmachen, dass ein Teil von mir mit Cat gestorben ist.
Als ich nicht antworte, reißt Jess frustriert die Arme in die Höhe. »Mein Gott, Maggie, wie soll ich dir helfen, wenn du nicht mit mir sprichst?«
»Das sagt die Richtige. Du hast schließlich auch nichts davon erwähnt, dass du womöglich doch nicht nach Amsterdam gehst«, platze ich heraus, bevor ich mich eines Besseren besinnen kann.
Jess steht stumm da. Ihr Blick spricht Bände.
»Ich hatte Graham gebeten, dir noch nichts zu sagen, tut mir echt leid. Aber … es ist einfach –«
»Einfach was?«
Sie schweigt, und meine Augen beginnen zu brennen, sodass ich sie für einen Moment schließen muss.
Als ich sie wieder öffne, sage ich: »Du brauchst dir um mich keine Sorgen mehr zu machen, Jess. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit dieses Herz gesund bleibt, damit ihr alle so leben könnt, wie ihr es euch wünscht, und ich auch.«
»Das nennst du leben, Maggie?« Jess schreit jetzt geradezu.
Mir stockt der Atem, als würde mir jemand die Kehle zuschnüren. Aber sie redet einfach weiter.
»Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob du das Herz überhaupt verdient hast.« Ihre Augen funkeln gefährlich.
Ihre Worte treffen mich wie ein Schlag ins Gesicht, und ich erstarre.
»Ich mache jetzt einen Spaziergang«, ist alles, was ich erwidern kann, und noch ehe sie ein weiteres Wort hervorbringen kann, mache ich auf dem Absatz kehrt und verschwinde über die Wiese.
Als ich den Pfad zurücklaufe, den wir gekommen sind, meine ich, Mum von irgendwoher meinen Namen rufen zu hören. Aber die Worte dringen nur undeutlich zu mir herüber und verlieren sich in der Septemberluft.
Mir rauscht das Blut in den Ohren.
So schnell, wie ich es eben wage, eile ich den Kiesweg unter den Bäumen entlang in einen weniger belebten Teil des Parks. Meine Füße finden den Weg wie von selbst, noch bevor ich mir überlegt habe, wo ich eigentlich hinwill.
Schließlich erreiche ich die Wegkreuzung, wo die Platanen und die Eschen einladend in der Sommerbrise rascheln. Ich bleibe stehen.
Bis hierhin und nicht weiter.
Und in diesem Augenblick wird mir klar, dass es immer so sein wird.
Denn ich hatte recht – ich werde niemals das Leben führen, das ich mir so sehnlich wünsche. Ich habe es versucht, und jetzt ist meine Schwester tot.
Und dann musste noch eine wundervolle Frau namens Stella sterben, damit ich leben kann.
Ich werde mein neues Herz unter keinen Umständen aufs Spiel setzen.
Als ich mich umdrehe, um zurückzugehen, spüre ich plötzlich ein heftiges Ziehen in der Brust, das gleich darauf meinen ganzen Körper zu zerreißen scheint. Ich sinke zu Boden.
Mit einem leisen Geräusch schlägt mein Kopf auf dem Kies auf.
Schmerz überwältigt mich.
Ich versuche krampfhaft, etwas zu sagen, etwas zu rufen, damit mich irgendjemand hört, aber aus meiner Kehle dringt kein Laut.
Ich starre in den endlosen, blauen Himmel hinauf, wo ein einsamer, gelber Luftballon langsam in die Höhe steigt, und bekomme keine Luft mehr.
Kapitel 4
Licht.
Weicher Stoff an meiner Wange.
Ich öffne die Augen nicht sofort. Als ich mich umdrehe, steigt mir der Duft von Jasmin in die Nase; ein Waschpulver, das mir nicht vertraut ist.
Seltsam.
Es riecht weder nach zu Hause noch nach Krankenhaus.
Krankenhaus.
Ich bin auf dem Weg im Park zusammengebrochen.
Ich reiße die Augen auf, und mein Herz beginnt zu rasen. Panisch sehe ich mich um und stelle fest, dass ich in einem unbekannten Schlafzimmer bin. Es ist klein und hell, das große Fenster hochgeschoben, um frische Luft hereinzulassen. Vor der Scheibe hängt ein Traumfänger, dessen perlenbesetzte Quasten in der Brise flattern. Darunter steht ein alter Schreibtisch.
Wo bin ich bloß?
Ich lege eine Hand an die Brust. Sie hebt und senkt sich. Mein Herz überschlägt sich fast. Verdammt, warum bin ich nicht im Krankenhaus? Oder zumindest zu Hause?
Denk nach, Maggie.
Hat mich vielleicht ein Spaziergänger im Botanischen Garten gefunden? Womöglich hat er mich mit zu sich nach Hause genommen und dann einen Krankenwagen gerufen.
Aber der müsste schon längst da sein.
So lange dauert das doch nicht.
Am besten Ruhe bewahren und erst mal hierbleiben. Wie spät ist es eigentlich?
Auf dem weißen Nachttisch neben mir steht ein Radiowecker. Eines dieser modernen Teile, auf denen man vorn Uhrzeit und Datum ablesen kann. Ich bin offenbar noch nicht wieder ganz bei mir, denn die Anzeige in der Ecke des Displays ergibt absolut keinen Sinn. Da steht, es sei der 26. Juli, aber das ist erst morgen.
Noch dazu liegt das Datum zwei Jahre zurück.
Ich blinzele verwirrt und sehe dann auf die Zeit – elf Uhr morgens.
Mist!
Anscheinend habe ich die ganze Nacht hier verbracht. Mum ist bestimmt außer sich vor Sorge.
»Hallo?«, rufe ich verzweifelt. Merkwürdig – meine Stimme klingt einen halben Ton tiefer, weicher, und außerdem spreche ich mit einem anderen Akzent – als käme ich aus Südengland oder so. Ich fasse mir an die Kehle.
Meine Güte, was ist denn mit mir los?
Mit zitternden Händen schlage ich die geblümte Bettdecke zurück und stelle fest, dass ich den Schlafanzug einer Fremden trage – einen blauen Seidenpyjama mit kleinen Glühwürmchen drauf.
Aber weshalb hat man mich umgezogen? Was geht hier eigentlich vor?
Ob man mich betäubt hat? Um Gottes willen. Aber jemand, der so etwas tut, hätte sich doch nicht die Mühe gemacht, mir extra einen edlen Schlafanzug anzuziehen. Unmöglich.
Ich setze mich auf, schwinge die Beine aus dem Bett und stelle meine Füße auf den kühlen Holzfußboden. Ich rechne damit, dass jeden Moment der stechende Schmerz zurückkommt und mein Körper seinen Dienst versagt, aber nichts passiert – Gott sei Dank.
»Hallo?«, versuche ich es noch einmal. Verdammt, wo bin ich hier bloß?
Ich drehe mich um und schaue aus dem Fenster. Auf der anderen Straßenseite befinden sich altmodische Mietshäuser, wie sie für Edinburgh typisch sind. Allerdings habe ich den Eindruck, in einem ganz anderen Stadtteil gelandet zu sein.
Das ergibt alles absolut keinen Sinn.
Schließlich verlasse ich das Zimmer und gelange in einen weiß getünchten Flur. An seinem Ende scheint ein kleines Wohnzimmer zu liegen, und ich wanke unsicher darauf zu.
Auf der rechten Seite liegt eine Eingangstür, daneben hängen einige Mäntel und Jacken. Ich bin also in einer Wohnung. Ich taumele weiter, wobei ich mich mit den Händen an den leicht unebenen Wänden abstütze. So müssen sich Betrunkene fühlen, denke ich – ich selbst habe kaum Erfahrung damit.
Im Wohnzimmer angekommen, lasse ich meinen Blick über das kleine, durchgesessene Sofa und den abgenutzten Holzfußboden schweifen. Eine Reihe unterschiedlicher Farbtöpfe steht vor einer der weißen Wände, als hätte sich jemand noch nicht entschieden, welche Farbe die richtige ist, und das große Erkerfenster an der gegenüberliegenden Seite taucht einen alten, runden Esstisch in schimmerndes Licht. Und obwohl ein laues Lüftchen von draußen hereinweht, wo sich ein sonniger Sommerhimmel über den Horizont erstreckt, verspüre ich ein nervöses Kribbeln.
Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu.
Tief durchatmen, Maggie.
Eine Seite des Wohnzimmers beherbergt eine kleine Küchenecke, auf die ich jetzt zusteuere. Es herrscht ein ziemliches Durcheinander, Schraubgläser mit Nudeln und Gewürzen sind überall verteilt; ein Karton mit Bratpfannen steht auf dem Boden, als wäre jemand vor Kurzem erst eingezogen. Als ich einen Blick zurück in den Wohnbereich werfe, fällt mir eine Karte auf dem Kaminsims auf. Ich gehe hinüber und nehme sie in die Hand, offensichtlich eine Einladung. Unter einem streng wirkenden Briefkopf prangen in goldenen Lettern die Worte Toby und Fran.
Für Emily, lautet die Anrede, und darunter stehen Details zu einer Hochzeit im nächsten Jahr, irgendwo in London. Das bedeutet dann wohl, dass hier eine Emily wohnt. Aber wer ist sie? Und wo ist sie hin? Warum hat sie mich hier allein gelassen?
Im Moment weiß ich nur eines mit Gewissheit – ich muss unbedingt ins Krankenhaus.
Und mich gründlich untersuchen lassen. Ich gehe zurück zur Garderobe im Flur. Hoffentlich sind meine Sachen hier.
Als ich mich durch gelbe Regenjacken und bunte Mäntel wühle, stößt meine Hand plötzlich an etwas Kaltes, Hartes. Ich ziehe die Jacken auseinander und blicke in einen Spiegel.
Mein Gegenüber starrt mich an.
Ich schlucke.
Die Welt scheint stillzustehen.
Kapitel 5
Als ich klein war, habe ich auf dem Speicher ein kleines Fenster entdeckt, in dem ich mich spiegeln konnte. In meiner Vorstellung allerdings blickte ich in das Gesicht eines anderen Mädchens, das jenseits der Scheibe saß und spielte, in einem Spiegelhaus, auf einem Spiegelspeicher. Es hieß Tina, und nach meiner Diagnose ging ich manchmal allein dort oben hinauf und wünschte mir sehnsüchtig, für einen einzigen Tag dieses Kind zu sein, in einem gesunden Körper zu stecken und aufregende Abenteuer zu erleben. Dann müsste ich nicht ständig über Krankenhaustermine und Operationen nachdenken oder mich schlecht fühlen, weil alle anderen meinetwegen traurig waren.
Als ich jetzt in den Spiegel vor mir schaue, frage ich mich, ob meine Fantasie mit mir durchgegangen ist und ich so auf die andere Seite des Glases gelangt bin. Denn mir gegenüber steht eine Fremde – eine Frau mit langen, dunklen Haaren und sonnengebräunter, schimmernder Haut. Sie hat geschwungene Lippen, eine kleine Sommersprosse über einer ihrer elegant gebogenen Brauen und unglaublich lange Wimpern. Allein die Augenfarbe haben wir gemeinsam, ein warmes Haselnussbraun.
Also muss ich doch im Krankenhaus sein.
Das ist die einzige logische Erklärung für das, was hier vor sich geht: Ich bin im Botanischen Garten zusammengebrochen, jemand hat einen Krankenwagen gerufen, und jetzt liege ich in einem künstlichen Koma.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als auszuharren, bis es vorbei ist.
Bis ich wieder aufwache.
Noch immer benommen, aber etwas ruhiger, nehme ich die Wohnung in meinem Traum genauer in Augenschein. Es ist kaum zu glauben, wie real sich alles anfühlt, das helle Sonnenlicht, das am Traumfänger vorbei ins Schlafzimmer scheint, und der angenehme Geruch nach Zitrusfrüchten, der die Luft durchzieht. Es duftet nach Zitronen und Rosen. Neugierig werfe ich einen Blick in die alte Holzkommode. Farbenfrohe Kleidung stapelt sich in den Schubladen – rosafarbene Trägertops und gelbe T-Shirts, leuchtend blaue Leggings und zerrissene Jeansshorts. Als Nächstes nehme ich mir den Kleiderschrank vor, wo ich eine ebenso große Anzahl an knallbunten, figurbetonten Kleidern vorfinde – ich würde mich niemals trauen, so etwas Grelles anzuziehen. Auf dem Schrankboden stehen und liegen eine ganze Reihe von Turnschuhen, Stiefeln und Taschen.
Mit einem Mal überkommt mich ein ebenfalls sehr reales Hungergefühl. Ich mache mich auf den Weg in die Küche und öffne einen Schrank, in dem ich eine Tüte Tortilla-Chips entdecke. Schon komisch, selbst im Traum zögere ich, bevor ich zugreife. Klar, normalerweise darf ich keine Chips essen, aber ich träume ja nur, da ist es doch Blödsinn, sich wegen möglicher Folgen Gedanken zu machen. Kurz entschlossen hole ich die Tüte aus dem Schrank und stopfe die Chips gierig in mich hinein.
Mein Gott, sind die gut. Sie schmecken nach Salz, Käse und sind unglaublich knusprig – einfach himmlisch.
Mit der Chipstüte in der Hand öffne ich als Nächstes den Kühlschrank. Kurioserweise spüre ich die Kälte auf meiner Haut, als würde das alles hier wirklich geschehen.
Zu meiner großen Freude stoße ich auf eine riesige Flasche Cola, eine halb volle Flasche Prosecco und eine Schüssel mit einem Rest Ramen, zumindest sieht es aus wie das japanische Gericht. Geradezu berauscht nehme ich alles heraus, während ich inständig hoffe, erst aufzuwachen, wenn ich den Inhalt des Kühlschranks restlos vertilgt habe. Ich kippe durstig einen Schluck Cola hinunter, dann nehme ich eine Gabel aus der Schublade und löse den Deckel von der Plastikschüssel. Ein unglaublich verführerischer Duft steigt mir in die Nase – eine Mischung aus Knoblauch, Chili und Schweinefleisch. Der Stoff, aus dem die Träume sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Stehen schlinge ich den Inhalt der Schüssel so gierig hinunter, dass ich mir die Suppe auf den Glühwürmchen-Schlafanzug kleckere.
Sollte ich mich vielleicht umziehen?
Die Kleider.
Aufgeregt eile ich zurück ins Schlafzimmer, drehe kurz darauf wieder um und hole den Prosecco aus der Küche.
Als ich schließlich vor dem Kleiderschrank stehe, genehmige ich mir einen kleinen Schluck der sprudelnden Flüssigkeit direkt aus der Flasche und spüre, wie sich ihre Wirkung auf äußerst realistische Weise in meinem Körper entfaltet.
Dann lasse ich eine Hand sanft über die Sachen im Schrank wandern, einen rosa Pullover und einen türkisfarbenen Rock, ein gelbes Sommerkleid, das im Luftzug flattert, der durch das Fenster hereindringt. Schließlich bleibt mein Blick an einem luftigen, von roten, blauen und grünen Tupfen übersäten Kleid hängen, das aussieht wie die Flügel eines Schmetterlings. Es hat einen tiefen V-Ausschnitt und einen weiten, wallenden Rock. Mit einem dumpfen Geräusch stelle ich den Prosecco auf den Boden, ziehe den Schlafanzug aus und lasse mir das Kleid über die bloßen Schultern fallen. Als ich mich in dem großen Spiegel in der Ecke betrachte, geht mir durch den Kopf, wie hübsch ich aussehe oder, besser gesagt, mein Traumkörper, hier in dieser Wohnung, in der ich allem Anschein nach ganz allein lebe. Zugegeben, es ist nicht gerade das Penthouse in der Stadt oder die Hütte am See, von der ich immer geträumt habe. Diese kleine Wohnung hier in Edinburgh ist eher wie eine leere Leinwand, die darauf wartet, von mir gefüllt zu werden. Vielleicht bin ich ja genau deswegen hier?
»Die Farbtöpfe«, wispere ich und laufe, erneut von Aufregung gepackt, wieder zurück ins Wohnzimmer. Der Raum ist in dunstiges Morgenlicht getaucht, und für einen Augenblick stelle ich mir vor, wie es wäre, jeden Tag hier aufzuwachen, ganz für mich eine Tasse Kaffee zu trinken – oder auch fünf – und anschließend zu tun, was immer mir in den Sinn kommt.
Ich gehe zu den Farbtöpfen hinüber und knie mich hin, um mir einen Überblick über das Angebot zu verschaffen. Entzückt stelle ich fest, dass es nur leuchtende, lebendige Farben sind, Sonnengelb und Aquamarin, Fuchsia und Clementinen-Orange. Natürlich hatte Mum nichts dagegen, dass ich mir das Esszimmer nach meinen Wünschen einrichtete, aber es war halt nur ein kleiner Teil des elterlichen Zuhauses, nichts, was einen in Begeisterungsstürme ausbrechen lässt.
Als Erstes öffne ich den Topf mit dem Aquamarin, tauche einen der Pinsel in die kräftige Farbe und male in einer einzigen, schwungvollen Bewegung einen leuchtenden Streifen an die Wand. Die Farbe hebt sich schillernd vor dem weißen Hintergrund ab, und ich kann noch immer nicht fassen, wie real alles erscheint.
Ich wiederhole das Ganze mit der nächsten Farbe, dann noch eine, tauche den Pinsel hinein und streiche damit über die sterile weiße Fläche. Im Handumdrehen ist die gesamte Wand mit Streifen und Wirbeln, Kreisen, Punkten und Regenbogen bedeckt, ein einziges, knallbuntes Chaos.
Ich bin von oben bis unten mit Farbe bekleckert und gleichzeitig von überschwänglicher Freude erfüllt.
Und ich bin noch lange nicht fertig.
Denn schließlich stecke ich nicht mehr in meinem zerbrechlichen Körper, die Sonne strahlt, und ich verspüre das überwältigende Bedürfnis, mich frei wie der Wind draußen auszutoben. Ich trinke einen letzten Schluck Prosecco, Schwindel steigt mir in den Kopf, dann mache ich mich auf zur Wohnungstür, wo ich die Ansammlung von Schuhen genauer unter die Lupe nehme – Flipflops, Gummistiefel in Regenbogenfarben, Wanderschuhe. Ich entscheide mich für ein Paar neongelbe Turnschuhe, und im nächsten Moment stehe ich draußen auf dem Treppenabsatz, allem Anschein nach in einem alten Mietshaus, was passt, da ich mir immer vorgestellt habe, in einem solchen Gebäude zu wohnen. Offenbar bin ich im obersten Stockwerk, gegenüber liegt eine weitere Wohnung mit einer frisch gestrichenen, weißen Tür, vor der ein Paar große, schlammbedeckte Turnschuhe steht. Das Treppenhaus ist kühl und nur schwach erhellt, das einzige Licht fällt durch ein trübes Oberlicht herein, und ein Blick in den Schacht zwischen den Treppengeländern lässt mich erahnen, dass sich unter mir noch drei weitere Etagen befinden.
Und dann sause ich zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppen hinunter, so schnell, dass ich das Gefühl habe, gleich abzuheben. Unten angekommen, spüre ich mein Herz energisch pumpen, ein unglaubliches Gefühl. Ich öffne die Eingangstür. Vor mir liegt eine belebte Straße mitten in Edinburgh – mehrstöckige Wohnhäuser, Geschäfte, Autos –, die der strahlende Sonnenschein in helles Licht taucht. Ich bleibe auf der Schwelle stehen und versuche, mir darüber klar zu werden, was hier gerade passiert.
Es fühlt sich alles so verdammt real an.
Meine Träume ergeben sonst nie so viel Sinn. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte, als ich die Haustür öffnete, aber gewiss nicht etwas so … Wirklichkeitsgetreues.
Mit einem Mal unsicher geworden trotte ich los, die Straße hinunter, während hinter mir die Eingangstür mit einem Rums ins Schloss fällt.
Wie bereits vermutet, befinde ich mich auf der anderen Seite der Stadt, in Tollcross, wie es aussieht. Ich war ab und zu in dem kleinen Laden für Künstlerbedarf in der Nähe, und manchmal habe ich mir einen grünen Tee im Victor Hugo in den Meadows, einem Park gleich um die Ecke, gegönnt. Allerdings bin ich seit meiner OP nicht mehr hier gewesen. Was nicht weiter verwunderlich ist, da ich seitdem eigentlich so gut wie nirgendwo mehr hingegangen bin.
Rechts von mir ragen hohe Bäume über grünen Wiesen auf und wiegen sich im Wind. Wie von selbst gehe ich auf sie zu. Wenigstes ein Ort, den ich kenne. Wie nicht anders zu erwarten herrscht viel Betrieb hier draußen, und ich spüre Panik in mir aufsteigen. Als ich endlich in den Meadows angekommen bin, fallen mir die seltsamen Blicke auf, die Spaziergänger mir zuwerfen, bis mir bewusst wird, dass ich noch immer von Kopf bis Fuß mit Farbe bekleckert bin.
Wegen des Sektes, den ich vorhin getrunken habe, bin ich leicht beschwipst und etwas wackelig auf den Beinen, sodass ich mich schließlich ins Gras setze, unsicher, wie es weitergehen soll. Ich strecke mich der Länge nach auf den weichen Halmen aus und starre in das endlose Blau über mir. Vom Geräusch spielender Kinder und dem gleichmäßigen Brummen der Rasenmäher eingelullt, fallen mir irgendwann die Augen zu.
Kühle Luft streicht mir über das Gesicht, und der Geruch nach Bäumen umgibt mich, als ich einige Zeit später wieder erwache. Ich bin noch immer in den Meadows, aber das Licht hat sich verändert. Der Himmel ist nicht mehr blau, sondern rosa. Die Kinder sind größtenteils verschwunden.
Ich hieve mich hoch und stelle fest, dass ich über und über mit Grashalmen bedeckt bin. Verrückt, wie unglaublich real auch dieses Detail ist. Dazu kommt, dass ich im Traum aufgewacht bin. Mein Herz beginnt laut zu pochen, und die ausgelassene Stimmung, die mich anfangs noch erfüllte, ist wie weggeblasen.
Das Ganze ist einfach unheimlich.
Während ich durch den Park zurückgehe, flattert mir das mit Farbflecken übersäte Kleid um die Beine, und das Gefühl, nicht ich selbst zu sein, wird immer überwältigender. Als ich an einem geschlossenen Café vorbeikomme, bleibe ich stehen und betrachte mein Spiegelbild: dieselbe mittelgroße Statur, dieselben sanften Rundungen wie zuvor, schwarze Haare flattern im Wind um ein hübsches, herzförmiges Gesicht.
Was geht hier vor?
Unruhig beschleunige ich meine Schritte. Als ich die Meadows verlasse, weiß ich genau, wo es als Nächstes hingeht. An den einzigen Ort, der mir schlüssig erscheint. Ich muss dahin zurück, wo alles angefangen hat. Zurück ins Bett, und wenn ich aufwache, wird alles wieder so sein wie vorher.
Das muss es einfach.
Als ich in die Straße einbiege, aus der ich gekommen bin, lege ich noch einmal einen Zahn zu und eile zur Kreuzung hinauf, von wo ich heute Vormittag gestartet bin. Aber weiß ich überhaupt noch, aus welcher Tür ich gekommen bin? Oder die Hausnummer?
Mist.
Als ich heute Vormittag so überstürzt losgezogen bin, habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich vielleicht zurückkommen würde. Doch während ich an den Cafés und Restaurants vorbeigehe, kommt die Erinnerung langsam zurück – an die Tapasbar, den Zeitungsladen und das Café mit der lila Fassade. Den Grußkartenladen mit dem Schmuck im Schaufenster. Die Tür, aus der ich gekommen bin, lag direkt daneben. Ihre rote Farbe war schon ziemlich verblichen, und in der Mitte prangte eine verrostete Sieben.
Aber wie um alles in der Welt komme ich jetzt wieder rein? Ich habe doch gar keinen Schlüssel mitgenommen.
So was Blödes.
Ich muss unbedingt zurück in diese Wohnung. Wenn ich wenigstens schon mal ins Treppenhaus käme. Einen Moment lang starre ich auf die Klingelknöpfe an der Seite, bevor ich willkürlich einen von ihnen drücke.
Nichts passiert.
Zaghaft probiere ich den nächsten, und eine grantige Stimme schallt mir gereizt aus dem Lautsprecher entgegen. »Ich erwarte keine Lieferung, ich will keine Werbung, und ich kaufe auch nichts. Also verschwinden Sie gefälligst.«
Ich stehe erschrocken da und bringe kein Wort heraus.
Aber ich muss da rein, koste es, was es wolle.
Ich drücke einen weiteren Knopf, dann den nächsten, und mit jeder Stille, die mir entgegenschlägt, pocht mein Herz heftiger.
Schließlich bleibt nur noch die Klingel ganz oben rechts, die zu der Wohnung gegenüber meiner gehören muss, die mit den dreckigen Turnschuhen vor der Tür.
Ein Rauschen.
»Hallo?«, fragt eine freundliche männliche Stimme.
Gott sei Dank!
»Hallo. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meinen Schlüssel vergessen und –«
Ich zucke beinahe zusammen, als sofort der ersehnte Summton erklingt, und zögere einen Moment, bevor ich die Tür aufdrücke. Im Inneren des Mietshauses ist es kühl und dunkel, die reinste Wohltat nach der endlosen Weite des Himmels draußen. Ich kann immer noch nicht recht fassen, dass meine Stimme so … englisch klingt. Verstörend, selbst in einem Traum. Während ich die Steintreppen hinaufgehe, überlege ich fieberhaft, wie ich in meine Wohnung kommen soll. Na ja, einen Schritt weiter bin ich immerhin schon mal. Als ich den letzten Treppenansatz umrunde, steht zu meiner Überraschung oben im Flur ein Mann mit strubbeligen, dunklen Haaren und leichter Sonnenbräune. Er trägt kakifarbene Shorts und darüber ein verschlissenes schwarzes T-Shirt, doch es sind seine Augen, die mich in ihren Bann ziehen – geheimnisvoll waldgrün leuchtende Augen, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Seine großen Hände ruhen auf dem Geländer, und er schaut mit einem schiefen Grinsen zu mir herab. Oben angekommen, bleibe ich unsicher vor ihm stehen.
»Du hast dich also ausgeschlossen«, stellt er gelassen fest. Jetzt, wo ich direkt vor ihm stehe, fallen mir die Staubflecken auf seinem T-Shirt auf, das Grübchen auf einer Seite seines Gesichts und seine schlanken, aber kräftigen Arme. Einen davon ziert ein ungewöhnliches Tattoo, und trotz der merkwürdigen Situation fühle ich mich irgendwie von ihm angezogen.
Und werde das unbestimmte Gefühl nicht los, ihn zu kennen.
»Ich hab meinen Schlüssel vergessen«, erwidere ich schließlich.
Er deutet mit dem Daumen auf die offene Wohnungstür hinter ihm. »Ist ja mal gut, dass ich heute früher aus der Werkstatt nach Hause gekommen bin, sonst hättest du womöglich noch lange da draußen gesessen und ein unfreiwilliges Sonnenbad genommen.«
Er grinst, doch ich bin immer noch viel zu überwältigt von der gesamten Situation, um etwas zu erwidern. Aber habe ich da nicht einen leichten Akzent wahrgenommen – amerikanisch vielleicht? Oder kanadisch?
»Alles in Ordnung?«, fragt er nach einer Weile, und sein Grinsen weicht einem eher besorgten Gesichtsausdruck.
»Klar, alles bestens«, erwidere ich nickend, als wäre das alles hier vollkommen normal und ich wäre nicht gerade auf mysteriöse Weise mitten in das Leben einer anderen Person katapultiert worden. »Ich glaube, ich war heute einfach zu lange in der Sonne.«
»Warte mal kurz«, sagt er und verschwindet in seiner Wohnung.





























