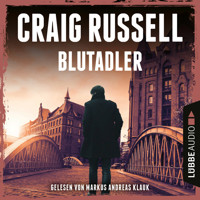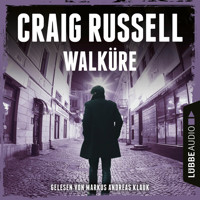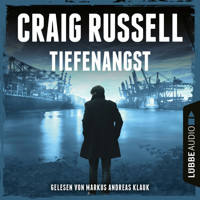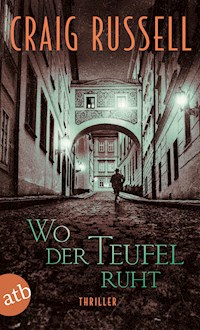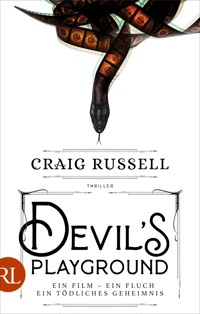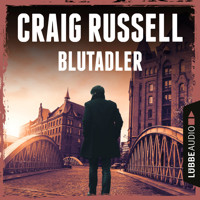8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jan-Fabel-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Im Hamburger Rotlichtviertel wird ein britischer Popstar tot aufgefunden, mit Messerstichen übersät. Hat der Engel von St. Pauli wieder zugeschlagen, ein Serienkiller, der vor zehn Jahren seine blutige Spur durch Hamburg zog - und der nie gefasst wurde? Hauptkommissar Jan Fabel hat seine Zweifel. Denn es sieht so aus, als ob dieser Fall mit anderen Morden im In- und Ausland in Zusammenhang steht. Dem Tod eines serbischen Gangsters. Der Ermordung eines Journalisten in Norwegen. Und mit einer Legende aus der Zeit des Kalten Krieges: drei junge Frauen, die zu professionellen Killern ausgebildet wurden. Man nannte sie die Walküren, nach den Kriegsmaiden der nordischen Sage. Hat eine von ihnen überlebt? Und tötet sie heute für Geld - oder aus Rache?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Ähnliche
Über Craig Russel
Craig Russell, Jahrgang 1956, wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, seine Bücher wurden in 23 Sprachen übersetzt. Er hat sich schon als Student für deutsche Kultur interessiert und lebt in der Nähe von Edinburgh.
Drei Romane um den Hamburger Polizisten Jan Fabel sind mit Peter Lohmeyer in der Hauptrolle für das deutsche Fernsehen verfilmt worden.
Der neue Roman „Auferstehung“ erscheint bei Rütten & Loening.
Informationen zum Buch
Im Hamburger Rotlichtviertel wird ein britischer Popstar tot aufgefunden, von Messerstichen zerfetzt. Hat der Engel von St. Pauli wieder zugeschlagen, ein Serienkiller, der vor zehn Jahren seine blutige Spur durch Hamburg zog - und der nie gefasst wurde?
Hauptkommissar Jan Fabel hat seine Zweifel. Denn es sieht so aus, als ob dieser Fall mit anderen Morden im In- und Ausland in Zusammenhang steht. Dem Tod eines serbischen Gangsters. Der Ermordung eines Journalisten in Norwegen. Und mit einer Legende aus der Zeit des Kalten Krieges: drei junge Frauen, die zu professionellen Killern ausgebildet wurden. Man nannte sie die Walküren, nach den Kriegsmaiden der nordischen Sage.
Hat eine von ihnen überlebt? Und tötet sie heute für Geld - oder aus Rache?
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Craig Russell
Walküre
Thriller
Aus dem Englischen vonBernd Rullkötter
Inhaltsübersicht
Über Craig Russel
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Epilog
Danksagung
Impressum
Für Wendy
Rot wird die Luft
von Menschenblut,
Eh’ unser weissagendes
Lied verhallt.
Die Saga von Njal
Das über Leben oder Tod entscheidende Los wurde von den Walküren verteilt, den Handmaiden Odins in Walhalla, der Halle der im Kampf gefallenen Krieger.
Es waren die Walküren, deren schreckliches Kriegsgeschrei den Himmel erfüllte. Sie fegten über die Schlachtfelder und sammelten die Seelen jener auf, denen sie den Tod zugewiesen hatten.
Im Altnordischen bedeutet valkyrja »Erwählerin der Erschlagenen«.
Prolog
I. Mecklenburg 1995
Schwestern sind wie Spiegelbilder, dachte sie.
Ute saß da und betrachtete sich in ihrem jüngeren Spiegelbild: in Margarethe, die erschöpft wirkte. Und traurig. Es schmerzte Ute, sie so vor sich zu sehen. Auch in ihrer Kindheit war die Energie ungleichmäßig zwischen ihnen verteilt gewesen. Margarethe hatte immer den Eindruck des lebhafteren, klügeren, hübscheren Mädchens gemacht. Zudem schmerzte es Ute, ihre Schwester an einem Ort wie diesem besuchen zu müssen.
»Erinnerst du dich an die Zeit, als wir klein waren?«, fragte Margarethe und musterte das blau getönte Fensterglas. »Erinnerst du dich, wie wir an den Strand gegangen sind und über den Schaalsee geschaut haben? Und wie du gesagt hast, dass wir eines Tages über ihn fortsegeln würden? In den anderen Teil Deutschlands. Oder nach Dänemark oder Schweden. Und wie du mir erklärt hast, dass das nicht erlaubt sei? Erinnerst du dich, wie wütend ich geworden bin?«
»Ja, Margarethe, ich erinnere mich.«
»Darf ich dir ein Geheimnis verraten, Ute?«
»Natürlich, Margarethe. Schließlich sind wir Schwestern. Genau wie früher, als wir uns immer unsere Geheimnisse anvertraut haben. Abends, wenn das Licht aus war und wir miteinander flüstern konnten, ohne dass Mama und Papa etwas hörten. Erzähl mir jetzt von deinem Geheimnis.«
Sie saßen an einem Tisch am Fenster, das auf die Gärten hinausblickte. Es. war ein heller, sonniger Tag, und die Blumenbeete standen in voller Blüte, doch durch das dicke Fensterglas war die Aussicht mit einem leichten kobaltblauen Schimmer überzogen. Es muss daran liegen, dass es ein Spezialglas ist, dachte Ute. Unzerbrechlich. Zumindest war es besser, als durch Gitter zu schauen.
Margarethe musterte misstrauisch die anderen Patientinnen und Besucher sowie das anwesende Personal. Dann verbannte sie alle wieder aus ihren Gedanken, um ihr Universum auf sich selbst, ihre Schwester und die blau getönte Aussicht einzugrenzen. Sie beugte sich verschwörerisch vor. In diesem Moment wurde sie wieder zu dem hübschen kleinen Mädchen, das sie einst gewesen war. Dem sehr hübschen Mädchen von früher.
»Es ist ein schreckliches Geheimnis.«
»Die hat jeder«, sagte Ute und legte ihre Hand auf die ihrer Schwester.
»Es wird lange dauern, es dir zu erzählen. Sehr viele Besuche. Bis jetzt habe ich es niemandem verraten, aber nun kann ich nicht mehr anders. Kommst du wieder her, um dir meine Geschichte anzuhören?«
»Natürlich.« Ute lächelte traurig.
»Erinnerst du dich, wie Mama und Papa abgeholt wurden? Erinnerst du dich, wie sie uns getrennt und in verschiedene Heime gebracht haben?«
»Wie könnte ich so etwas vergessen? Aber lass uns jetzt nicht über solche Dinge sprechen.«
»Sie haben mich an einen besonderen Ort gebracht, Ute.« Ihre Stimme hatte sich zu einem Flüstern gesenkt. »Sie sagten, ich sei etwas ganz Besonderes und zu außergewöhnlichen Dingen fähig. Ich könne zur Heldin werden. Sie brachten mir Dinge bei. Grässliche Dinge. So schlimm, dass ich dir nie davon erzählt habe. Nie. Darum bin ich hier. Darin besteht mein Problem. All die fürchterlichen, grauenhaften Dinge in meinem Kopf …« Sie runzelte die Stirn, als bereite der Gedanke ihr Schmerzen. »Ich wäre nicht hier, wenn sie mir nicht beigebracht hätten, so schreckliche Dinge zu tun.«
»Was für Dinge, Margarethe?«
»Ich erzähle es dir. Jetzt gleich. Aber du musst mir versprechen, dass du dann alles für mich in Ordnung bringst.«
»Das verspreche ich, Margarethe. Du bist doch meine Schwester. Ich verspreche dir, dass ich alles in Ordnung bringe.«
II. Hamburg, Januar 2008
Sie wartete auf ihn.
Seit er zum ersten Mal auf der Erichstraße, gegenüber dem Erotic Art Museum, in ihr Blickfeld geraten war, hatte sie ihn verfolgt. Nun kam er auf sie zu, konnte sie jedoch noch nicht sehen. Sie wich in die Dunkelheit des kleinen, mit Kopfstein gepflasterten Platzes zurück. Hier würde es geschehen. Der Platz war unbeleuchtet, nur von den Straßen zu beiden Seiten sickerte etwas Helligkeit durch. Außerdem warfen die beiden kahlen Bäume, die aus der ungepflasterten Mitte des Platzes emporwuchsen, ihre Schatten.
Sie wartete auf ihn.
Während er sich näherte, erkannte sie sein Gesicht. Sie war ihm nie begegnet, hatte ihn nie leibhaftig zu Gesicht bekommen, doch sie erkannte ihn. Er war jemand aus der nichtrealen Welt. Jemand, den sie aus dem Fernsehen, aus der Presse, von Postern in Schaufenstern kannte. Eine vertraute Person, allerdings vertraut aus einem parallelen Universum.
Sie zögerte einen Moment lang. Wegen seiner Position würden noch andere da sein. Begleiter. Leibwächter. Sie trat zurück in den Schatten. Doch dann sah sie, dass er wirklich allein war. Er bemerkte sie nicht, bis er sie fast erreicht hatte und bis sie sich aus dem Schatten hervorschob.
»Hallo, ich kenne dich«, sagte sie auf Englisch.
Er blieb stehen. Einen Augenblick lang war er verblüfft. Unsicher. Dann erwiderte er: »Natürlich kennst du mich. Jeder kennt mich. Bist du meinetwegen hier?«
Sie öffnete ihren Mantel und entblößte ihre Nacktheit. Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Sie schlang den Arm um ihn und zerrte ihn in den Schatten. Er legte die Hände unter den Mantel auf ihre Haut, die sich in der kalten Winternacht heiß und sanft anfühlte. Auch ihr Atem war heiß, als sich ihr Mund seinem Ohr näherte.
»Ich bin deinetwegen hier«, sagte sie.
»Ich hatte andere Pläne«, protestierte er atemlos, aber er ließ sich tiefer in die Dunkelheit ziehen.
»Und ich bin nicht wegen deines Autogramms gekommen.« Ihre Hand glitt an seinem Bauch hinunter. Umfasste ihn.
»Wie viel?« Seine Stimme war ruhig, doch gespannt vor Erregung.
»Wie viel?« Sie trat zurück, schaute ihm in die Augen und lächelte. »Nein, Schatz, das kostet nichts. Du wirst es nie vergessen, aber du kriegst es umsonst.«
Sie wandte den Blick nicht von ihm ab, während sich ihre Hände schnell und geschickt bewegten. Er merkte, wie sein Gürtel gelockert und sein Hemd hochgeschoben wurde. Die kalte Nacht berührte seine nackte Haut.
Er stürzte zu Boden.
Die Pflastersteine waren feucht und kalt, und er lachte leise, überrascht über seine Unbeholfenheit. Mit breit gespreizten Beinen lehnte er sich an die Ziegelwand hinter seinem Rücken. Warum war er hingefallen? Seine Beine schienen ihm nicht zu gehören. Er musterte sie und fragte sich, warum sie plötzlich nachgegeben hatten. Dann blickte er zu ihr auf.
Sie stand über ihm, und das Feuer in ihren Augen beängstigte ihn. Jäh übergab er sich, ohne Übelkeit verspürt zu haben. Eine die Knochen durchdringende Kälte ergriff seinen Körper.
Er betrachtete das Erbrochene, das seine Brust und die Pflastersteine um ihn herum bedeckte. Es glänzte schwarzrot im trüben Licht.
Er schaute wieder zu ihr auf, damit sie ihm erklärte, warum er gestürzt war und weshalb er so viel Blut vergossen hatte. Dann sah er die in ihrem Handschuh funkelnde Stahlklinge. Er spürte etwas Warmes und Nasses in seiner Kleidung. Seine zitternden Finger fanden seine Hemdbrust und rissen daran; Knöpfe flogen in die Dunkelheit und prallten auf die Pflastersteine. Sein Bauch war aufgeschlitzt, und im Halbdunkel quoll etwas aus der Wunde hervor: grau und schimmernd, feucht und rot gestreift. Dunst stieg aus seinem geöffneten Bauch in die Winternacht empor, und aus der klaffenden Wunde strömte rhythmisch Blut, im Takt mit dem Hämmern des Pulses in seinen Ohren. Ihm war kalt, und er fühlte sich schläfrig.
Die Frau beugte sich über ihn und wischte an der Schulter seines teuren Mantels das Blut von der Klinge ab. Dann durchsuchte sie seine Taschen mit der gleichen Geschicklichkeit und Präzision, mit der sie ihn aufgeschnitten hatte. Nachdem sie seinen Terminkalender, seine Brieftasche und sein Handy an sich genommen hatte, beugte sie sich zu ihm, und die Hitze ihres Atems drang erneut an sein Ohr.
»Sag ihnen, wer es getan hat«, flüsterte sie immer noch auf Englisch, immer noch verführerisch. »Dass es der Engel war, der dich aufgeschlitzt hat.« Sie erhob sich und ließ das Messer in ihre Manteltasche gleiten. »Sag es ihnen auf jeden Fall, bevor du stirbst.«
III. Vierundzwanzig Jahre vorher: Berlin-Lichtenberg, Deutsche Demokratische Republik, Februar 1984
»Wir reden von Kindern. Wir reden doch von Kindern, oder nicht?« Major Georg Dreschers Frage hing in der rauchgeschwängerten Luft. Alle schwiegen, während eine junge Frau in der Uniform des Felix-Dsershinski-Wachregiments mit einem Tablett hereinkam, auf dem eine Kaffeekanne und mehrere Tassen standen.
Das Ministerium für Staatssicherheit – oder MfS – der Deutschen Demokratischen Republik, von der Bevölkerung, der es angeblich diente, harsch als Stasi abgekürzt, nahm einen ganzen Block im Ostberliner Ortsteil Lichtenberg ein. Der mächtige Raum, in dem Major Drescher saß, befand sich im ersten Stock der Zentrale in der Normannenstraße. Der eindrucksvolle Konferenzsaal war mit Eichenholz getäfelt, und eine große, Ost und West umfassende Deutschlandkarte beherrschte die eine Wand. Neben der Karte hing das gerahmte Wappen des Ministeriums, das sich als »Schild und Schwert der Partei« verstand. Wie ein Flugzeugträger beherrschte ein mächtiger Konferenztisch aus Eiche die Mitte des Zimmers. Eine kleine Lenin-Büste stand in der Ecke, und von der gegenüberliegenden Wand blickten Porträts von Generalsekretär Erich Honecker und Staatssicherheitsminister Erich Mielke finster auf die am Tisch Versammelten hinunter.
Dies war der Raum des Ministeriums, in dem man sich beratschlagte, Strategien verabschiedete und Taktiken plante. Hier schmiedete die erfolgreichste Geheimpolizei der Welt Ränke gegen ihre Feinde im Ausland und gegen ihr eigenes Volk.
Die Stasi hatte noch andere Räume in diesem Gebäudekomplex und im nur ein paar Kilometer nördlich gelegenen Hohenschönhausen. Dort wurden keine Beratungen abgehalten. Etliche Lagerräume waren mit Unterwäsche vollgestopft, die man heimlich aus den Schubladen möglicher Regimekritiker entwendet hatte. Jedes Stück war mit einem Namen und einer Nummer gekennzeichnet, damit, wenn sich die Notwendigkeit ergab, die speziell abgerichteten Spürhunde der Stasi einer bestimmten Witterung folgen konnten. In anderen Räumen wurden Abhörgeräte und Spezialwaffen entworfen und hergestellt sowie Gifte und Seren entwickelt und getestet, und in noch anderen schrieb man zahllose Stunden abgehörter Gespräche nieder, entwickelte Tausende von Fotos und begutachtete Kilometer heimlich angefertigter Filme und Videobänder. Ganze Stockwerke der Stasi-Zentrale waren mit dem umfassenden Aktenarchiv über Bürger der DDR gefüllt. Kein Staat hatte je so viele Informationen über sein eigenes Volk angehäuft. Informationen, die durch das Stasi-Netz aus 91000 Agenten und 300000 gewöhnlichen Bürgern gesammelt wurden. Die Letzteren arbeiteten »inoffiziell« mit dem Ministerium zusammen – zum Wohle des Staates, aus Geldgründen oder zum Zweck der Beförderung. Oder auch nur, um nicht selbst ins Gefängnis zu kommen. Einer von fünfzig Angehörigen der ostdeutschen Bevölkerung bespitzelte Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder.
Und natürlich gab es noch weitere Räume: solche mit dick gepolsterten, schalldichten Wänden. Räume, in denen Schmerzen als Instrument des Staates dienten.
Aber dies war ein Raum für Gespräche. Drescher kannte den Mann am Kopf des Tisches. Oberst Ulrich Adebach trug Uniform, genau wie der jungenhaft aussehende Leutnant zu seiner Linken, der ein geöffnetes rotes Päckchen Salem vor sich liegen hatte und rauchte. Adebach war ein vierschrötiger Mann in den Fünfzigern mit streng zurückgekämmtem grauen Haar und einem unratsamen Walter-Ulbricht-Spitzbart. Seine Schulterklappen zeigten den Rang eines Obersten an. Major Georg Drescher dagegen trug eine Sportjacke und Flanellhosen sowie einen Rollkragenpullover. Seine Kleidungsstücke deuteten verdächtig auf ein nicht inländisches Design und eine ebensolche Herstellung hin. Allerdings genoss er als Angehöriger der Hauptverwaltung Aufklärung Kontakte zum Westen, die fast all seinen Landsleuten verwehrt waren.
Drescher kannte weder den Offizier links von Adebach noch die ältere Frau in Zivil, und der Oberst hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie vorzustellen. Der junge Leutnant, dessen Uniformkragen ihm um den Hals schlotterte, war vermutlich Adebachs Adjutant. Wie Drescher bemerkte, zündete er sich, sobald er die vorherige ausgedrückt hatte, eine neue Salem an. Die Luft im Konferenzsaal hatte durch den Zigarettenrauch bereits eine bläuliche Färbung angenommen.
Während alle darauf warteten, dass die junge Soldatin des Wachregiments den Kaffee servierte und das Zimmer verließ, betrachtete Drescher die düstere Miene von Staatssicherheitsminister Mielke auf dem Porträt. Wenn Generalsekretär Honecker der Tiberius Ostdeutschlands war, dann gab Mielke seinen Sejanus.
Drescher unterdrückte ein Lächeln. Humor und Fantasie waren keine Merkmale, die an einem Stasi-Vertreter geschätzt wurden, und ein Gefühl der stillen inneren Rebellion war noch weniger willkommen. Drescher verbarg all diese Aspekte seines Charakters den Vorgesetzten und überhaupt allen anderen gegenüber. Doch insgeheim lehnte er sich auf, indem er in seinen Gedanken Karikaturen zeichnete, die er wahrscheinlich nie zu Papier bringen würde: Er stellte sich seine Vorgesetzten nackt und in lächerlich kompromittierenden Situationen vor.
Die Soldatin des Wachregiments beendete ihre Aufgabe und verließ den Raum.
»Was soll das heißen? Wollen Sie damit etwa sagen, dass sie moralische Einwände gegen diese Aktion haben?«, fragte Oberst Ulrich Adebach und zertrümmerte Dreschers geistiges Bild des kleinen, dicken, freudlosen Erich Mielke, der nichts als ein Tutu trug und wie ein Schulmädchen kicherte, während Generalsekretär Honecker ihm den Hintern versohlte.
»Nein, Genösse Oberst, keine moralischen, sondern praktische Einwände. Diese Mädchen sind offenbar alle noch sehr jung. Wir reden davon, unreife Mädchen einen unveränderlichen Weg einschlagen zu lassen. Ihnen gefährliche und komplizierte Aufträge zu erteilen, wobei sie von jeder direkten Befehlsstruktur völlig abgeschnitten sind.« Drescher lächelte bitter. »Ich habe selbst drei Nichten und weiß, wie schwierig es sein kann, sie ihre Zimmer aufräumen zu lassen, geschweige denn, sie auf riskante Aufgaben anzusetzen.«
»Die Altersspanne liegt zwischen dreizehn und sechzehn Jahren.« Adebach erwiderte das Lächeln nicht. »Und sie werden in den nächsten Jahren noch nicht im Feld eingesetzt werden. Vielleicht sollte ich Sie daran erinnern, Major Drescher, dass ich gegen die Nazis gekämpft habe, als ich genauso alt war wie diese jungen Frauen.«
Nein, daran brauchst du mich nicht zu erinnern, dachte Drescher, denn du erzählst es mir jedes Mal, wenn es sich irgendwie ins Gespräch einflechten lässt.
»Fünfzehn«, fuhr Adebach fort. »Ich war fünfzehn Jahre alt, als ich mich mit der Roten Armee durch die Straßen von Berlin vorkämpfte.«
Drescher nickte und überlegte, was es bedeutet hatte, deutsche Landsleute zu töten und dann beiseitezutreten, als zahllose deutsche Frauen von Adebachs Waffenbrüdern vergewaltigt wurden. Oder vielleicht auch nicht beiseitezutreten. »Mit Verlaub, Genösse Oberst«, entgegnete er, »dies sind junge Mädchen. Und wir sprechen nicht vom Kampf. Von der Hitze des Gefechts.«
»Haben Sie die Akte gelesen?«
»Natürlich.«
»Dann werden Sie wissen, dass wir diese zwölf Mädchen sehr sorgfältig ausgewählt haben. Sie alle erfüllen eine Reihe von klaren Kriterien. Jede dieser jungen Frauen hat überdurchschnittliche sportliche und geistige Fähigkeiten, und alle weisen – aus dem einen oder anderen Grund – eine gewisse emotionale Bindungslosigkeit auf.«
»Ja, das habe ich in der Akte gelesen. Aber die Bindungslosigkeit rührt in den meisten Fällen von einem psychischen Trauma in der Vergangenheit her. Ich würde sagen, dass man sie als … na ja, als gestört bezeichnen könnte. Es sind Problemkinder.«
»Keines der Mädchen ist geistesgestört.« Diesmal antwortete die ältere Frau. Drescher überraschte es nicht, dass sie einen russischen Akzent hatte. »Und sie sind auch keine wirklichen Soziopathinnen. Aber durch Erfahrung oder einfach durch Veranlagung sind sie emotional weniger ansprechbar als ihre Altersgenossinnen.«
»Ich verstehe«, sagte Drescher. »Aber das allein ist doch wohl kaum eine Voraussetzung für das, was wir von ihnen erwarten. Ich meine … Wie soll ich es formulieren … Ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft mit idealer Chancen- und Geschlechtergleichheit, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass Männer … aggressiver sind. Sie neigen eher zu Gewalt. Das Töten fällt ihnen leichter.«
Adebach lächelte schief und stand auf. Er ging um den Tisch und stellte sich hinter die Frau. »Vielleicht sollte ich Sie miteinander bekannt machen. Darf ich Ihnen Major Dr. Iwana Ljubimowa vorstellen? Sie ist uns von unseren sowjetischen Genossen zugeteilt worden. Major Ljubimowa hat ebenfalls im Großen Vaterländischen Krieg gedient. Bei der Siebzigsten Schützendivision. Spezielle Waffenausbildung in Busuluk.«
»Als Scharfschützin?«, fragte Drescher.
»Dreiunddreißig nachgewiesene Tötungen«, erwiderte Ljubimowa ausdruckslos.
»Und nun sind Sie Militärärztin?«, hakte Drescher nach, der an dreiunddreißig deutsche Tote dachte.
»Psychiaterin. Und nicht beim Militär.«
»Aha.« Drescher wusste, dass die matronenhafte Russin nicht aus großer Entfernung hatte anreisen müssen: bloß aus Karlshorst, unmittelbar südlich von Lichtenberg. Dort lag die KGB-Zentrale.
»Ich bin auf Gefechtspsychologie spezialisiert«, fuhr die Russin fort. »Sie haben recht: Frauen neigen viel weniger als Männer dazu, im Affekt zu töten. Die überwiegende Mehrheit der Morde auf der Welt wird von Männern begangen, deren Antriebe Wut, sexuelle Eifersucht oder Alkohol sind. Oder eine Kombination aus diesen Elementen. Und Sie haben auch recht mit Ihrer Aussage, dass männliche Soldaten in Frontgefechten, besonders im Nahkampf, aggressiver auftreten. Aber wenn es um kaltblütiges Töten geht – um geplanten, vorsätzlichen Mord –, dann schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Frauen, die töten, handeln oft kaltblütig und aus Motiven, die nichts mit Wut zu tun haben und ziemlich abstrakt sein können. Deshalb waren so viele meiner Genossinnen ausgezeichnete Scharfschützen. Und deshalb eignen sich diese Mädchen perfekt für das, was wir planen.«
»Ich weiß nicht«, widersprach Drescher. »Das Töten ist nur ein kleiner Teil davon. Diese Mädchen … Frauen … müssen getrennt von ihrer Leitung existieren.«
»Genau hier kommen Sie ins Spiel, Major Drescher. Sie haben eine Menge Erfahrung in Sektion A gesammelt«, sagte Adebach. Er bezog sich auf die HVA-Schule der Stasi, die für die Ausbildung ostdeutscher Spione verantwortlich war. »Sie werden eine Gruppe von Instrukteuren leiten, die die Mädchen in einem sehr breiten Spektrum von Fertigkeiten ausbildet. Den Fertigkeiten, die sie benötigen, um den Westen zu infiltrieren und dort ihre Tarnung aufrechtzuerhalten.« Adebach setzte sich wieder auf seinen Platz.
Drescher nippte an seinem Kaffee und lächelte: Rondo Melange. Er schätzte guten Kaffee. Obwohl er die besten Sorten der Welt – in Kopenhagen, Wien, Paris, London – probiert hatte, ließ sich für ihn nichts mit Rondo vergleichen. Dieser Kaffee gehörte zu den wenigen Dingen, die dem Produktionsapparat der DDR gelungen waren. »Was schwebt Ihnen vor?«, fragte er.
Adebach nickte seinem Adjutanten zu, der Drescher eine Akte reichte. »Wissen Sie, was der japanische Begriff kunoichi bedeutet? Eine kunoichi ist das weibliche Gegenstück zum Ninja. Beide wurden für das perfekte Töten ausgebildet, aber man sah ein, dass das Geschlecht eine Rolle für die Ausführung des Auftrags spielte. Die kunoichi verstanden sich auf alle Formen des unbewaffneten Kampfes, doch auch auf die Kunst der Verführung. Sie kannten sich mit dem menschlichen Körper aus und wussten nicht nur, wie seine erotischen Reaktionen ausgelöst werden, sondern auch, wo seine schwachen Stellen sitzen, wie ein rascher Tod mit einem Minimum an Gewalt herbeigeführt wird und wie man, wenn nötig, keine oder fast keine Spur hinterlässt. Sie waren auch Expertinnen der Verkleidung und verstanden es, sich als Dienerinnen, Prostituierte oder Bäuerinnen zu tarnen, Waffen zu verstecken oder mit Haushaltsgegenständen zu improvisieren. Außerdem galten die kunoichi als unübertroffene Giftmischerinnen. Sie waren in Botanik ausgebildet und konnten einen tödlichen Giftstoff aus den Pflanzen der Umgebung anfertigen.
Major Drescher, wir beabsichtigen, unsere eigene kunoichi-Truppe aufzubauen und sie tief in die Struktur des westlichen Kapitalismus einzuschmuggeln. Diese Agentinnen werden sämtliche Fertigkeiten der kunoichi besitzen, aber auch mit allen modernen Waffen umgehen können.«
»Warum?«, fragte Drescher. »Ich meine, warum gerade dieser Operationstyp? Warum jetzt? Und warum wird das Ministerium für Staatssicherheit damit betraut?«
»Die Genossin wird mir die Bemerkung sicherlich nachsehen« – Adebach nickte in Ljubimowas Richtung –, »aber wir haben die bei Weitem beste Erfolgsquote hinsichtlich der Infiltration der westlichen Sicherheitsdienste und Staatsorgane. Natürlich haben wir einen Vorteil gegenüber unseren Verbündeten im Warschauer Pakt: Wir sprechen dieselbe Sprache wie unser Hauptfeind.« Adebach steckte sich eine Zigarette der Marke Sprachlos an und nahm einen langsamen Zug.
»Und warum wir diese Operation jetzt einleiten …«, nahm Major Ljubimowa Adebachs Faden auf. »Wir brauchen neue Strategien zur Bekämpfung des Westens. Wir müssen ein Skalpell statt eines stumpfen Instruments benutzen. Wie Sie wissen, haben wir gerade unsere größte Mobilisierung beendet. Ende letzten Jahres hat der Westen uns an den Rand eines umfassenden Atomkriegs getrieben. Anscheinend wusste die NATO nicht, dass wir kurz davor standen, einen defensiven Präventivschlag einzuleiten. Die sogenannte Operation Able Archer 83 erwies sich schließlich doch nur als NATO-Übung, aber es war der größte Einsatz westlicher Waffen und Truppen seit dem Ende des Krieges. Die Kapitalisten waren dumm genug, ein vollständiges Manöver durchzuführen, bis hin zur Nachrichtenübermittlung innerhalb der Befehlsstruktur. Die Nachrichten konnten wir abfangen.
Unsere Überwachung ergab auch, dass die britische Premierministerin Margaret Thatcher oft mehrere Male täglich chiffrierte Mitteilungen mit Präsident Reagan austauschte. Heute wissen wir, dass es dabei nicht um Vorbereitungen für einen Weltkrieg, sondern um die amerikanische Besetzung von Grenada ging. Es waren einfach zwei Imperialisten, die sich darüber stritten, wer die Kolonialrechte für ein Stück Land besaß.«
»Ich kann Ihnen versichern, Major Drescher«, schaltete sich Adebach ein, »dass der Mann auf der Straße hier und im Westen nie erfahren wird, wie nahe wir der Katastrophe waren. Das Einzige, was einen allgemeinen Atomkrieg verhindert hat, war die Sammlung und Analyse von Informationen durch die Nachrichtendienste. – Auf beiden Seiten, wie man zugeben muss. Unsere Agenten schafften es gerade noch, den kalten nicht zu einem heißen Krieg werden zu lassen.
Wir müssen neue Wege finden, den Feind zu treffen, ohne dass die Situation zum Krieg eskaliert. Ihre Abteilung hat bei der Infiltration des Westens mit Informationssammlern Großartiges geleistet. Und unsere Erfahrung des letzten Jahres macht deutlich, wie unsinnig es ist, militärische Mittel gegeneinander einzusetzen. Wenn wir unseren Feind angreifen müssen, dann sollten wir es an der unsichtbaren Front tun.
Wir planen mehrere Operationen, die alle darauf abzielen, intensiver denn je auf Geheimdienstinformationen, Sabotage und Unterwanderung zurückzugreifen. Dies ist eine davon. Die jungen Frauen werden unsere Waffen tief im feindlichen Gebiet werden. Vielleicht werden sie im Westen wohnen, ohne je zum Einsatz zu kommen, oder sie könnten dauernd aktiv sein – je nach der vorherrschenden politischen Situation. Die Hauptsache ist, dass sie, falls es nötig wird, die Möglichkeiten des Feindes stark einschränken oder seine Pläne behindern können.«
»Durch Tötungen?« Drescher goss sich Kaffee nach. »Ich muss betonen, Genösse Oberst, dass wir bereits die Mittel und das Personal haben, um Eliminierungen auf feindlichem Territorium durchzuführen.«
»Wir reden nicht von skandinavischen Journalisten oder dem ein oder anderen fehlgeleiteten Fußballstar«, sagte Adebach mit einem Blick auf Mielkes Porträt. »Ich spreche von der Fähigkeit, wichtige Amtsinhaber, sogar Regierungschefs, im Westen zu töten, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Und zwar ohne Verdacht zu erwecken. Zum Beispiel planen wir, eine Walküre in eine der Terroristengruppen einzuschmuggeln, die wir im Westen finanzieren.«
»Walküren?« Drescher unterdrückte ein Grinsen, allerdings nur mit größter Mühe. Er kannte Adebachs Wagner-Leidenschaft. »Werden wir sie so nennen? Ist das nicht ein bisschen … wagnerianisch? Es klingt nach einer Sonderabteilung des Bundes Deutscher Mädel.«
»Das ist der Codename, den wir ihnen zugewiesen haben«, erklärte Adebach streng. »Ihre Aufgabe, Major Drescher, besteht darin, die Instrukteure anzuleiten, die die jungen Frauen ausbilden werden. Zwölf Mädchen, von denen nur drei in die endgültige Auswahl kommen. Und diese letzten drei … Lassen Sie es mich folgendermaßen ausdrücken: Niemand wird je über drei so perfekte Tötungsmaschinen verfugt haben. Bis dahin sind Sie, Genösse Major, Vater, Mutter, Beichtvater, Lehrer und Behüter dieser Mädchen. Dort ist alles zusammengefasst.« Adebach deutete mit dem Kinn auf die Akte in Dreschers Händen. »Nehmen Sie den Ordner mit, aber machen Sie keine Kopien. Jede dieser jungen Frauen wird, wie viele unserer freiberuflichen Agenten, den Status eines Inoffiziellen Mitarbeiters haben. Bitte geben Sie die Unterlagen bis zum Wochenende zurück. Alle Personalakten Ihrer Schülerinnen werden am Ende der Ausbildung vernichtet. Es darf keine Aufzeichnungen über die Vorbereitung und den Einsatz der Agentinnen geben.«
Drescher erhob sich. »In Ordnung. Aber ist das nicht unnötig? Kein Fremder wird unsere Akten je zu Gesicht bekommen …«
IV. Vor der Küste von Jütland, Dänemark, August 2002
Goran Vujačić beobachtete das blonde Mädchen, das sich matt auf dem Liegestuhl am Heck der Jacht ausstreckte. Ihre Gliedmaßen waren lang und geschmeidig, doch sie war nicht so mager und jungenhaft schmal um die Hüften wie ihre Gefährtin. Vujačić legte Wert darauf, dass seine Frauen wie Frauen aussahen. Er trank einen Schluck von seinem Bier und war dankbar für die kühle Flüssigkeit an diesem heißen Tag. Vujačić hatte nicht damit gerechnet, dass es so warm sein würde. Das nordeuropäische Klima gefiel ihm nicht besonders, denn er gehörte in die schwüle Mittelmeerhitze der Adria oder unter die brennende Sonne eines Balkansommers. Heute jedoch herrschte gutes Wetter, und er konnte zusehen, wie die Mädchen vom Heck des Schiffes in die Nordsee sprangen.
Er wollte die Blondine haben. Es würde ein Teil der Vereinbarung, eine Goodwill-Geste im Rahmen des Abkommens sein: dass er die Blondine ficken konnte. Dafür waren Frauen schließlich da. Dafür und für die Verzierung von Jachtdecks.
»Dieses kleine Ruderboot muss dich einiges gekostet haben«, sagte er zu Knudsen und fuhr mit der Hand über das rote Leder und das lackierte Teakholz der eingebauten Polsterbank. Der bosnische Serbe Vujačić unterhielt sich mit dem Dänen Knudsen auf Englisch, in der Sprache des internationalen Geschäfts und des organisierten Verbrechens.
»Die Jacht ist ungefähr fünf Millionen Euro wert, aber ich habe sie zum Selbstkostenpreis bekommen«, erwiderte Knudsen ironisch. »Habe mich mit dem Besitzer darauf geeinigt. Möchtest du wirklich keinen Champagner?«
»Im Moment genügt mir das Bier«, antwortete Vujačić und warf erneut einen Blick über die Schulter zu den Mädchen hinüber. »Vielleicht später …«
»Ja, später kannst du dich ein bisschen entspannen, nicht, Goran? Wenn alles erledigt ist.«
Vujačić lächelte. Er fühlte sich unbesorgt, wenn auch nicht unbesorgt genug, um auf Zlatkos Begleitung zu verzichten. Sein Leibwächter stand stumm hinter ihm, ungeschützt vor der Sonne und finster in sein Hawaiihemd hineinschwitzend. Es belustigte Vujačić, dass nun ein Kroate auf ihn aufpasste. Wie sich die Zeiten geändert hatten.
Knudsen, ein großer, hartgesotten wirkender Däne, saß mit Vujačić in einer luxuriös ausgestatteten Nische nicht weit vom Heck der Motorjacht. Im Schatten der Markise standen uniformierte Mannschaftsmitglieder – weit genug entfernt, um das Gespräch nicht mithören zu können – und warteten darauf, das Mittagessen zu servieren. Vujačić atmete tief ein, als inhaliere er den von der Jacht ausgehenden Duft des Wohlstands.
»Weißt du, Peter«, sagte er, »dies ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Und weißt du auch, warum? Weil wir einander ergänzen. Angebot und Nachfrage. Was du brauchst, kann ich liefern. Unsere kleine Unternehmung wird die Haupthandelsroute für große Drogenmengen nach Skandinavien und Deutschland eröffnen. Du und ich, mein Freund, werden sehr, sehr reich werden. Oder in deinem Fall noch reicher. Vielleicht werde ich mir eine Jacht wie diese zulegen … Wenn ich auch eine zum Selbstkostenpreis bekommen kann.« Vujačić grinste zu dem blonden Mädchen hinüber. »Und vielleicht auch einen Teil des Inventars …«
»Sag mal, Goran«, wechselte Knudsen das Thema, »bist du sicher, dass auf deiner Seite alles in Ordnung ist? Ich meine vertrieblich. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Probleme mit ein paar Konkurrenten hattest.«
»Jetzt nicht mehr. Ich habe sämtliche Probleme gelöst, bevor wir zusammengekommen sind. Bei unserem ersten Treffen habe ich dir gesagt, dass ich die völlige Kontrolle über das Vertriebsnetz habe. Und das ist weiterhin der Fall. Ich musste dafür sorgen, dass sich einige Leute aus dem Geschäft zurückzogen. Für immer. Leider musste ich etwas diskreter als üblich vorgehen. Deshalb wurde die Sache ein wenig teurer als sonst.«
»Du hast einen Fremden angeheuert?«, fragte Knudsen.
Vujačić antwortete nicht sofort. Stattdessen schlürfte er sein Bier und musterte den hochgewachsenen Dänen, als müsse er abwägen, wie weit er ihm trauen konnte. Vujačić wusste, dass Knudsen ein vermögender Mann mit guten Beziehungen war. Alles an ihm hatte der Überprüfung standgehalten. Aber Vujačić hatte in Kriegen gekämpft – häufig in solchen, denen er besser ferngeblieben wäre. Und die Erfahrung hatte den Serben gelehrt, Männer in zwei klar umrissene Gruppen zu teilen: in Krieger und in die anderen. Genau wie er Frauen in diejenigen teilte, die man bumste, und in alte Weiber. Knudsen beunruhigte ihn. Der Däne war Ende vierzig, vielleicht Anfang fünfzig, doch nichts an ihm hatte an Härte verloren. Keine seiner Kanten war durch das gute Leben abgestumpft. Andererseits mochte es eine einfache Erklärung dafür geben: die Mitgliedschaft in einem teuren Fitnessstudio.
Vujačić beugte sich vor und senkte verschwörerisch die Stimme. Seine Worte waren offenkundig nicht für Zlatkos Ohren bestimmt. »Du weißt, dass ich einen Partner habe … Noch einen weiteren Partner.«
»Ja, dein anderer Partner …« Knudsen runzelte die Stirn. »Das gefällt mir immer noch nicht, Goran. Ich meine, nicht zu wissen, wer diese andere Person ist.«
»Aber die Sache betrifft dich nicht, mein Freund. Meine andere Partnerschaft hat nichts mit unserem Geschäft zu tun. Genau wie du nichts über diese Leute weißt, kennen sie keine Einzelheiten über dich. Unterschiedliche Geschäftsfelder. Ich erfülle deine pharmazeutischen Bedürfnisse, während ich für meinen anderen Partner sozusagen als Personalberater tätig bin.« Der Serbe lachte über seinen eigenen Insiderwitz. »Außerdem ist die Partnerschaft zwischen uns beiden ebenbürtiger. Unser Geschäftsumfang mag beachtlich sein, aber für meinen anderen Partner wäre er eine Kleinigkeit. Es handelt sich bei ihm um einen großen Fisch. Einen wirklich großen Fisch. Solche Leute spielen ein ganz anderes Spiel als du und ich, Peter. Und um Einsätze, die sogar für uns unerreichbar sind.«
»Und was für ein Spiel ist das?«, fragte Knudsen.
»Es hat nichts mit Drogen zu tun, wenn dir das Sorgen macht. Wie gesagt, ich liefere ihnen …« Er fuhr sich über seine Haarstoppel und dachte über die beste Bezeichnung nach. »… Personal. Aber selbst wenn ich alles wüsste – was nicht der Fall ist –, dürfte ich dir nichts davon erzählen. Jedenfalls musste ich, wie gesagt, ein paar Schwierigkeiten mit der Konkurrenz beilegen. Mein anderer Partner kennt eine Vertragsfirma. Anscheinend die beste auf diesem Gebiet.«
»Einen Auftragsmörder?«
»Ja. Oder vielleicht eine Auftragsmörderin, wenn an dem Codenamen etwas dran ist.« Vujačić neigte sich noch dichter zu Knudsen hin und sprach noch leiser. »Walküre. Aber welche Frau wäre dazu fähig, stimmt’s, Peter? Die sogenannte Walküre hält sich in Deutschland auf. Anscheinend in Hamburg. Er – oder sie – soll der beste Auftragskiller der Welt sein.«
»Besser als der Mexikaner?«, fragte Knudsen.
»Carlos Ramos? Ich habe gehört, dass er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Aber die Antwort lautet Ja. Mindestens so gut, wenn nicht besser. Ich könnte mich natürlich auch selbst um die Dinge kümmern. Gott weiß, ich habe mich damals in den Neunzigern in der Heimat um eine Menge Dinge gekümmert …« Vujačić drehte sich um, als wolle er sich überzeugen, dass Zlatko, sein kroatischer Leibwächter, ihn nicht hören konnte. Dann wandte er sich wieder dem Dänen zu. »Aber diese kleine Sache erforderte etwas mehr Finesse, verstehst du? Deshalb hat die Walküre alles Unerledigte abgewickelt. Meistens sah es nach einem Unfall oder Selbstmord aus. Die Bullen untersuchen nur zwei Fälle. Wirklich gute Arbeit. Sauber. Aber egal. Wichtig ist nur, dass du dir über den Vertrieb nicht den Kopf zu zerbrechen brauchst.«
»Schön«, sagte Knudsen. »Wenn du dir da sicher bist, Goran. Alles klar?«
»Alles klar.« Vujačić drehte sich erneut um und nickte Zlatko zu. Der riesige Kroate legte eine Laptoptasche auf den Deckstisch vor Vujačić hin, der ein flaches schwarzes Gerät hervorzog. Er tippte auf die Tastatur, und die abesicherte Bank-Website öffnete sich auf dem Bildschirm. »Ist Bluetooth nicht herrlich?« Er grinste.
Knudsen winkte dem blonden Mädchen zu. Sie hüllte sich in ein Tuch, näherte sich den beiden Männern und reichte Knudsen ein Handy. Dieser führte zwei sehr kurze Gespräche.
»Meine Kontaktperson hat die Ware entgegengenommen«, sagte er und gab dem Mädchen das Telefon zurück.
Vujačić schloss den Laptop. »Und der Geldtransfer ist bestätigt worden.« Wieder grinste er in Richtung der Blondine. Seine Augen bohrten sich durch das transparente Tuch und folgten den Kurven ihres Körpers. »Vielleicht sollten wir jetzt feiern und etwas Spaß haben. Möchtest du feiern, Süße?«
»Frag den Chef«, erwiderte sie. »Es ist seine Jacht.«
»Gehört dir denn alles in dieser Gegend?«, fragte Vujačić seinen Gastgeber.
Knudsen stand auf und gab der Besatzung ein Zeichen. »Ihr könnt jetzt auftragen.«
Vujačić hatte keine Zeit zu einer Reaktion.
Plötzlich wurde die Ruhe durch ein Dutzend Stimmen durchbrochen. Sie brüllten ihn an, sich nicht zu rühren. Die Besatzungsmitglieder hatten automatische Waffen unter der Abdeckung des Servierwagens hervorgezogen. Gleichzeitig sprangen die Türen auf, und schwer bewaffnete Gestalten in schwarzer Uniform und mit kugelsicheren Westen stürmten an Deck. Vujačić hörte, wie Zlatko hinter ihm zu Boden gezwungen wurde. Es gab keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Instinktiv hatte sich seine Hand zu der Beretta geschoben, die er unter dem lockeren Hemd im Hosenbund verbarg, doch er hielt inne, denn er wusste, dass eine weitere Bewegung ihn das Leben kosten würde.
»Braver Junge«, flüsterte die Blondine ihm auf Englisch ins Ohr und stieß den Lauf ihrer Dienstwaffe grob in das weiche, stoppelbedeckte Fleisch unter seinem Kinn. »Wolltest du mich ficken, Goran? Zu deiner Information, du Dreckskerl: Du bist es, der hier gefickt wird.«
Erstes Kapitel
1.
Hamburg hatte ein einzigartiges Mauerwerk. Die Stadt schien aus roten Ziegeln zusammengefügt zu sein. Man sagte sogar, dass die Maurer, von denen Gebäude wie dieses errichtet worden waren, nicht mit Backsteinen gebaut, sondern mit ihnen gestrickt hätten.
Martina Schümann betrachtete die schmale rote Ziegelfassade der Davidwache, des berühmtesten Polizeireviers in Deutschland. Es befand sich mitten im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli und diente nicht nur als funktionsfähige Polizeiwache, sondern es war auch ein unter Denkmalschutz stehendes nationales Kulturgut. Martina hatte sechs ihrer fünfzehn Jahre bei der Polizei Hamburg hier gearbeitet. Dann war sie weitergezogen. Immer weiter nach oben und schließlich weg von der Polizei.
Während sie in der kalten, feuchten Nachtluft wartete, bis ein zweitrangiger britischer Prominenter sein lüsternes Interesse an der Reeperbahn befriedigt hatte, dachte sie darüber nach, warum sie fortgegangen war. Bei der Polizei Hamburg war sie eine Aufsteigerin gewesen, aber sie hatte mehr gewollt. Die Gründung ihrer eigenen Firma hatte ihr den Weg geebnet, und nun, mit vierzig, schien sie alles erreicht zu haben: Geld, Ansehen, Erfolg. Doch in diesem Moment, vor der roten Ziegelfassade der Davidwache, erinnerte sie sich an ihre sechs Dienstjahre in diesem Gebäude. Es war eine großartige Zeit gewesen. Und ein großartiges Team.
Martina presste den Knopf ihres verborgenen TETRA-Funkgeräts ans Ohr und drückte auf die PTT-Taste an ihrem Knopflochmikro. »Wo zum Teufel ist er?«
»Ich weiß nicht, Chefin … Ich bin in der Gerhardstraße«, antwortete Lorenz, Martinas Angestellter, mit seinem breiten sächsischen Akzent. »Er ist in die Herbertstraße gegangen und noch nicht wieder rausgekommen.«
»Warum in Gottes Namen hast du ihn nicht begleitet? Ich habe dir doch gesagt, dass du dicht dranbleiben sollst.« Martina konnte die Frustration in ihrer Stimme nicht unterdrücken. Rasch umrundete sie die Davidwache und überquerte die Davidstraße bis zum Eingang der Herbertstraße. Hier musste sie stehen bleiben. Eine metallene Schutzwand versperrte die Sicht, erlaubte jedoch den verborgenen Zugang in die achtzig Meter lange Straße. Jedenfalls, wenn man keine Frau und kein Mann unter achtzehn Jahren war. Achtzig Meter des Hamburger Straßennetzes verwehrten den Frauen der Stadt den Zutritt, es sei denn, sie waren Prostituierte, die in der Herbertstraße arbeiteten und wie Fleischstücke in der Auslage eines Metzgers hinter aufschwenkbaren Scheiben im Licht zur Schau gestellt wurden. Obwohl die Hamburger Behörden die Errichtung der Metallschutzwände an beiden Seiten finanziert hatten, war das Frauenverbot nicht von der Stadt verhängt worden, sondern von den Prostituierten selbst. Jede Frau, die trotzdem eintrat, musste damit rechnen, mit Wasser oder Bier oder sogar mit Urin begossen zu werden.
»Er wollte, dass ich auf ihn warte …«, erklang Lorenz’ Stimme kläglich aus dem Funkgerät. »Er wollte sich alles allein angucken. So sind die verdammten Promis eben. Sie glauben, dass alles ein Spiel ist.«
»Scheiße.« Sie schaute auf ihre Uhr. Er war seit zwanzig Minuten in der Herbertstraße, was wahrscheinlich bedeutete, dass er sich eines der Mädchen ausgesucht hatte. »Lorenz, geh rein und versuch, ihn aufzutreiben.«
»Aber wenn er …«
»Mach schon.«
In diesem Moment hörte Martina den Schrei einer Frau. Irgendwo in der Ferne, hinter der Herbertstraße.
2.
Jan Fabel saß vorgebeugt auf dem Rand eines Ledersessels. Er trug noch seinen Regenmantel und hielt seine Handschuhe zwischen den Fingern. Alles an seiner Haltung deutete auf einen baldigen Aufbruch hin, obwohl er gerade erst eingetroffen war.
Vor langer Zeit war dieses Vorstadthaus in Hamburg-Borgfelde Fabels Zuhause gewesen. Er kannte jedes Zimmer, jeden Flur, jeden Winkel. Es war der Mittelpunkt seines Lebens gewesen. Sein Zuhause. Seitdem hatte sich natürlich vieles geändert: die Möbel, die Tapeten, das Fernsehgerät in der Ecke.
»Du musst mit ihr reden.« Renate saß ihm gegenüber. Ihre Beine waren übereinandergeschlagen und ihre Arme vor dem Körper auf die defensive Art verschränkt, an die er sich gut erinnerte. Ihr Haar hatte nicht mehr das satte Kastanienbraun wie bei ihrer ersten Begegnung, wie bei ihrer Hochzeit, und er vermutete, dass sie es nun färbte. Sie war immer noch eine hübsche Frau, doch die Falten um ihren Mund hatten sich vertieft, sodass ihr Gesicht einen Eindruck von Sparsamkeit vermittelte. Gott weiß, dachte Fabel, dass sie keinen Grund zur Verbitterung hat.
»Ich werde mit ihr reden«, antwortete er. »Aber ich kann nichts versprechen. Gabi ist ein intelligentes Mädchen. Unabhängig. Sie ist durchaus fähig, sich eine eigene Meinung über ihre Zukunft zu bilden.«
»Soll das heißen, dass du es billigst? Es unterstützt?«
»Ich werde alles unterstützen, wofür Gabi sich entscheidet. Aber persönlich wäre es mir lieber, wenn sie noch einmal über ihren Berufnachdenken würde. Wenn sie sich am Ende für diese Möglichkeit entscheidet …« Er zuckte resigniert die Achseln. »Aber wir wollen nichts überstürzen. Sie hat noch viel Zeit, sich alles durch den Kopf gehen zu lassen. Du weißt, wie sie ist … Wenn sie meint, dass wir Druck auf sie ausüben, wird sie sich auf die Hinterbeine stellen.«
»Es ist deine Schuld«, sagte Renate. »Wenn du kein Polizist wärest, hätte sie nie den Einfall gehabt, den gleichen Weg einzuschlagen. Gabi betet dich an. Es ist leicht, ein Held zu sein, wenn man Teilzeitvater ist.«
»Und wer trägt dafür die Verantwortung?« Fabel versuchte, den Ärger zu unterdrücken, der in ihm aufwallte. »Ich ganz bestimmt nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich aus ihrem Leben hinausgedrängt worden – und zwar von dir.«
»Und ich bin durch deine verfluchte Arbeit aus deinem Leben hinausgedrängt worden.«
»Direkt in Ludiger Behrens’ Bett, wenn ich mich nicht irre«, entgegnete Fabel und bedauerte seine Äußerung sofort. Renate war eine kleinliche Frau, was ihm erst im letzten Stadium ihrer Ehe aufgefallen war. Und sie hatte immer die Gabe gehabt, ihn auf ihr Niveau hinunterzuziehen. »Lassen wir’s, das Ganze fuhrt zu nichts. Wir bauschen die Sache viel zu sehr auf. Gabi hat doch gerade erst angefangen, über ihre Berufswahl zu sprechen. Warten wir einfach ab, bis sie ihr Abiturzeugnis bekommt, und dann sehen wir weiter. Wirklich, es ist noch lange hin, bis sie sich entscheiden muss. Ich werde mich mit ihr unterhalten und dafür sorgen, dass sie weiß, worauf sie sich einlässt. Aber ich wiederhole, Renate: Wenn sie entschlossen ist, zur Polizei zu gehen, werde ich sie vorbehaltlos unterstützen.«
Renates ohnehin finstere Miene umwölkte sich noch mehr. »Das ist einfach verkehrt. Es ist kein Beruf für eine Frau.«
Fabel sah Renate entgeistert an. »Ich kann’s kaum glauben. Ausgerechnet du. Was soll das heißen: Bei der Polizei zu arbeiten ist kein Beruf für eine Frau? Solange wir verheiratet waren, hätte ich dich nie für einen ›Kinder, Küche, Kirche‹-Typ gehalten. Andererseits, bei der Vorgeschichte deines Vaters …«
Fabel wusste, dass er von dem Feuer verbrannt werden würde, das plötzlich in Renates grünen Augen aufgeflammt war, doch zu seiner Erleichterung klingelte, gerade als sie sich anschickte, ihrem Zorn freien Lauf zu lassen, sein Handy.
»Hallo, Chef, hier ist Anna. Du hast dich doch in den Siebzigern und Achtzigern für britische Popmusik begeistert, stimmt’s?«
»Das dürfte eine rhetorische Frage sein«, sagte Fabel mit warnender Stimme. »Was ist los?«
»Jake Westland – du weißt schon, der Leadsänger dieser Gruppe aus den Siebzigerjahren –, also er ist zurzeit in Deutschland auf Tournee und sollte morgen im NDR ausführlich interviewt werden.«
Fabel seufzte ins Telefon. »Anna … Worum geht’s?«
»Darum, dass er nicht zu dem Interview aufkreuzen wird. Er hat sich schon ausgekotzt… auf der Reeperbahn. Und Chef, er sagt, dass ihn eine Frau aufgeschlitzt hat. Dann hat sie ihm befohlen, uns mitzuteilen, wer sie ist. Nämlich der Engel…«
»Shit.« Fabel benutzte das englische Wort und schaute zu seiner Exfrau hinüber. Das Feuer war erloschen; ihre Miene ließ nun eine abweisende Resignation erkennen wie immer, wenn seine Arbeit ihn zwang, sich zu entfernen. »Ich komme sofort.«
Man hatte Westland durch die Stadt zur Notaufnahme ins Krankenhaus St. Georg gefahren, und da er nicht vernehmungsfähig war, machte sich Fabel über die Ost-West-Straße zur »Sündigen Meile« Hamburgs auf: der Reeperbahn. Wo Seilmacher einst Taue oder Reepe für Segelschiffe gedreht hatten, wodurch die Reeperbahn zu ihrem Namen gekommen war, funkelten nun die Neonlichter von Stripclubs und Sexshops, Bars und Theatern in der eisigen Nacht. Als Fabel an der Davidwache eintraf, war er schlechter Laune. Das Treffen mit Renate war so verdrießlich verlaufen wie erwartet, und er hatte zudem seinen MP3-Player verloren. Immer wenn er gestresst war, verband er das Gerät mit der Stereoanlage seines BMW. Keine Musik, mehr Stress.
Die Presseleute hatten sich bereits in großer Zahl vor der Davidwache versammelt, und drei Uniformierte hielten sie in Schach. Neben dem Medienzirkus vor dem Revier hatte sich ein weiterer Tumult in der Davidstraße um die Ecke entwickelt. Junge Beamte der Bereitschaftspolizei in Schutzausrüstung versuchten, sich widersetzende Frauen in große grüne Polizeiwagen zu laden. Einige Medienvertreter waren in die Davidstraße gelaufen, um Aufnahmen von der Nebenattraktion zu machen, aber trotzdem wurde Fabel von einer Blitzlichtsalve begrüßt, als er von seinem Auto zur Doppeltür der Davidwache eilte. Ein Fernsehnachrichtenteam hatte sich nach vorn gedrängt. Fabel erkannte die Reporterin Sylvie Achtenhagen, die für einen der Satellitenkanäle arbeitete. Wunderbar, dachte er, als wäre das Medieninteresse nicht genug, habe ich nun auch noch dieses Biest am Hals.
»Erster Hauptkommissar Fabel« – Achtenhagen betonte seinen vollständigen Rang für die Aufnahme –, »können Sie bestätigen, dass das Opfer dieses Überfalls der britische Sänger Jake Westland ist?«
Fabel ignorierte sie und ging weiter.
»Und stimmt es, dass es das Werk des sogenannten Engels von St. Pauli war? Der Serienmörderin, die die Polizei Hamburg in den Neunzigerjahren nicht hat fassen können?« Da er immer noch nicht reagierte, fuhr sie fort: »Dürfen wir annehmen, dass Ihre Hinzuziehung als Leiter der geplanten ›Supermordkommission‹ auf die Bedeutung des Vorfalls hinweist? Haben Sie den Auftrag, die Fehler zu korrigieren, die die Polizei Hamburg bei den ursprünglichen Ermittlungen gemacht hat?«
Fabel versteckte seinen Arger hinter einer Maske des Gleichmuts und wandte sich der Reporterin zu. »Die Presseabteilung des Polizeipräsidiums wird zu gegebener Zeit eine ausführliche Erklärung abgeben. Sie sollten das Prozedere inzwischen kennen, Frau Achtenhagen.«
Er drehte ihr den Rücken zu, ging durch die Doppeltür und stieg die Treppe zur Davidwache hinauf. Der kleine Empfangsbereich war mit Beamten gefüllt. Er hörte Rufe aus den hinten links liegenden Zellen.
Fabel wurde von einem stämmigen, über fünfzigjährigen Mann mit Stoppelhaar sowie von einer hübschen dunkelhaarigen Frau empfangen, die Jeans und eine übergroße Bikerjacke trug. Fabel nickte Kriminaloberkommissar Werner Meyer und Kriminalkommissarin Anna Wolff grimmig zu. »Wie zum Teufel hat Achtenhagen von der Verbindung zum Engel erfahren?«, fragte er.
»Mit Geld geht alles«, sagte Anna Wolff. »Die Tussi schreckt nicht davor zurück, die Unfallwagenbesatzung oder das Krankenhauspersonal zu bestechen, um sich eine Exklusivmeldung zu verschaffen.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Die hat uns noch gefehlt. Ihre ganze Karriere ist praktisch auf dem Engel-Fall aufgebaut.« Er nickte in Richtung des Tumults draußen in der Davidstraße. »Was ist da los?«
»Ein Fall von perfektem Timing«, antwortete Werner. »Eine Feministinnengruppe hat beschlossen, ausgerechnet heute Abend einen Protest abzuhalten. Sie sind in die Herbertstraße einmarschiert, weil sie es empörend finden, dass eine Hamburger Straße für Frauen nicht zugänglich ist. Ein Verstoß gegen ihre Menschenrechte oder so.«
»Ehrlich gesagt, da ist was dran«, meinte Fabel. Er seufzte. »Also, was liegt vor?«
»Das Opfer ist Jake Westland, dreiundfünfzig Jahre alt, britischer Staatsbürger«, las Werner aus seinem Notizbuch vor. »Ja, der Jake Westland. Laut unseren Informationen hat er einen unerwarteten Spaziergang um die Reeperbahn gemacht. Und zwar nicht, um den Geist der Beatles einzufangen, wenn du’s genau wissen willst. Seltsam – ich hätte gedacht, dass er vor allem an den Schwulenbars interessiert wäre. Schließlich ist er Engländer.«
Fabel reagierte mit ungeduldiger Miene auf Werners Scherz.
»Ich weiß nicht, warum sie es tun«, fuhr der Oberkommissar fort. »Diese Promis, meine ich. Jedenfalls ist Westland in die Herbertstraße verschwunden, um seine Leibwächter abzuschütteln. Als Nächstes findet ihn eine Dame vom Gewerbe, die unterwegs zum Kiez ist, und sein Inneres ist nach außen gewendet. Er sagt, seine Angreiferin habe behauptet, der Engel zu sein. Dann hat er das Bewusstsein verloren.«
»Wie ist sein Zustand?«
»Im Krankenwagen hat er noch gelebt. Anscheinend verstand das Mädchen, das ihn gefunden hat, etwas von Erster Hilfe. Aber ich vermute, seine Produzenten planen schon eine Gedenk-CD mit seinen größten Hits.«
»Das Mädchen, das ihn gefunden hat, ist hinten«, sagte Anna Wolff. Sie tauschte einen Blick mit Werner aus, und ihr rot geschminkter Mund verzog sich zu einem Grinsen. »Außerdem seine Leibwächter. Ich dachte mir, du würdest sie gern persönlich vernehmen.«
»In Ordnung, Anna«, seufzte Fabel. »Gibt es irgendein Problem?«
»Westland wurde vom Sicherheits- und Personenschutzdienst Schümann betreut.«
»Martina Schümann?«
»Ihr beide habt euch nahegestanden, wie ich höre?«
»Martina Schümann war eine ausgezeichnete Polizistin«, erwiderte Fabel.
»Dann muss sie damals bessere Arbeit geleistet haben als jetzt«, warf Werner ein.
Ein uniformierter Oberrat trat zu ihnen. Er war kleiner als Fabel und hatte dichte dunkle, ungebärdige Haare. »Was ich wirklich wissen möchte«, sagte er streng, während er Fabel die Hand schüttelte. »Hat jemand ein Autogramm von ihm gekriegt?«
»Hallo, Carsten«, erwiderte Fabel grinsend. »Du reißt also immer noch deine geschmacklosen Witze.«
»Lässt sich nicht vermeiden.« Carsten Kaminski war Leiter des Polizeikommissariats 15, also der Davidwache. Dieses Revier war zuständig für den Kiez, das 0,7 Quadratkilometer große Rotlichtviertel mit der Reeperbahn als Mittelpunkt. An jedem Wochenende strömten über zweihunderttausend Besucher durch das Viertel. Manche davon waren betrunken, und manche büßten ihre Brieftasche oder andere Wertsachen ein. Und für einige endete der Abstecher ins Abenteuer mit einer wirklichen Katastrophe.
Die Schutzpolizisten der Davidwache benötigten eine besondere Fähigkeit: Sie mussten kommunikationsfähig sein. Der Kiez war eine von Zuhältern und Prostituierten sowie von kleinen und weniger kleinen Gaunern bevölkerte Gegend. Sie wurde unter anderem von jungen Männern aus den Vorstädten besucht, die häufig zu rasch und zu viel tranken. Die meisten Situationen, die die Beamten der Davidwache zu bewältigen hatten, erforderten Fingerspitzengefühl und Humor. Nicht wenige Nachtschwärmer wurden dazu überredet, friedlich nach Hause zu fahren, statt in eine Zelle eingesperrt zu werden.
Carsten Kaminski war in St. Pauli geboren worden und hier aufgewachsen, und niemand war so sehr wie er mit dem Rhythmus und der wechselnden Atmosphäre des Kiez vertraut. Außerdem besaß er den für St. Pauli typischen bodenständigen Humor.
»Was genau hat es mit dem Protest auf sich?«, hakte Fabel noch einmal nach.
»Es handelt sich um eine Gruppe namens Muliebritas. Genauer gesagt, sind die Teilnehmerinnen von der feministischen Zeitschrift Muliebritas zum Protest aufgerufen worden«, erklärte Kaminski. »Sie sind in die Herbertstraße geströmt, und es wäre fast zu einer handfesten Auseinandersetzung mit den Nutten gekommen. So etwas wäre an sich schon schlimm genug gewesen, aber da sich auch noch der Vorfall mit Westland abgespielt hat … Wir haben sie aufgefordert, sich zu entfernen, weil sie einen Tatort kontaminierten und die Ermittlungen behinderten, aber eine einvernehmliche Zusammenarbeit mit der Polizei schien ihnen fremd zu sein.« Wiederum ertönte Geschrei aus den Zellen, als sollten seine Worte unterstrichen werden. »Egal, du bist nicht ihretwegen hier. Übrigens, wusstest du, dass Martina im Revier ist?« Kaminski grinste.
»Ja«, sagte Fabel. »Von Anna.«
»Wart ihr beide nicht …«
»Ja, Carsten«, stöhnte Fabel. »Aber das hatten wir schon. Gibt es eine Beschreibung der Frau, die Westland überfallen hat?«
»Wir wissen nur, dass sie behauptet hat, der Engel zu sein. Und auch das nur aus zweiter Hand von der Prostituierten, die ihn gefunden hat.«
»Woher wissen wir, dass sie nicht selbst der Engel ist?«
»Allem Anschein nach hat sie ihr Bestes getan, um Westland am Leben zu erhalten, bis der Unfallwagen eintraf. Und wenn es wirklich das Werk des Engels war, dann wäre das Mädchen, das ihn gefunden hat, zu jung für die früheren Morde. Obwohl sie versucht hat, sich unbeeindruckt zu zeigen, stand sie offensichtlich unter Schock. Der Arzt wollte ihr ein sanftes Beruhigungsmittel verabreichen, aber sie hat ihm gesagt, er solle es sich sonst wohin stecken.«
»Trotzdem möchte ich mit ihr sprechen.«
»Und mit Martina?« Kaminski grinste erneut und warf Werner und Anna Wolffeinen Blick zu.
»Auch mit Martina. Was ist mit der Videoüberwachung, die wir auf dem Kiez installiert haben? Ist etwas zu sehen?«
»Nein«, antwortete Kaminski. »Westlands Angreiferin hatte entweder Glück, oder sie war sehr clever. Es gibt keine Kameras an der betreffenden Straße und auch nicht in der Nähe des Hofes. Wie du weißt, mussten wir für die Installation der Kameras bestimmte Auflagen einhalten. Keine ist an einer Stelle angebracht, an der man beobachten kann, wie die ehrenwerten Bürger unserer schönen Stadt in eine Peepshow oder in einen Sexshop schleichen. Deshalb haben wir eine Menge schwarzer Löcher. Aber ich habe in der Einsatzzentrale des Präsidiums Bescheid gesagt, damit die Aufnahmen eine Stunde vor bis eine Stunde nach dem Mord abgeholt und analysiert werden. Vielleicht sehen wir etwas auf den umliegenden Straßen: zum Beispiel, wie die Angreiferin zum Tatort unterwegs ist oder sich davonmacht.
Vorläufig schicke ich jede Menge Schutzpolizisten hinaus auf die Straßen.« Kaminski deutete auf die im Foyer versammelten Beamten. »Wir werden jede Nutte, jeden Zuhälter und jeden Clubbesitzer in der Gegend befragen. Die Geschäfte gehen zurzeit nicht besonders gut auf dem Kiez, und Westland war ja nicht gerade ein unbekanntes Opfer. So etwas ist schlecht fürs Gewerbe. Vielleicht haben wir Glück.«
»Danke, Carsten.«
»Also, wenn es dir nichts ausmacht, Jan, möchte ich meinen Leuten noch ein paar Anweisungen geben.« Kaminski nickte zu den Schutzpolizisten hinüber, die er herbeibeordert hatte. »Es sei denn, du möchtest ihnen verklickern, wonach wir Ausschau halten.«
»Nein, Carsten, es ist dein Revier«, sagte Fabel. Niemand kannte den Kiez besser als Kaminski.
Fabel hängte seinen Regenmantel in der Garderobe der Polizeiwache auf, nachdem er all seine Taschen abgetastet hatte.
»Hast du etwas verloren?«, fragte Anna.
»Meinen verdammten MP3-Player.«
Zusammen mit Werner und Anna ging er in den hinteren Teil des Gebäudes. Bis 2005 hatte die Davidwache ausschließlich Schutzpolizisten beherbergt, doch um sich dem Wandel der Zeit anzupassen, hatte man die ursprüngliche Wache nach hinten erweitert. In diesem neueren Gebäudeteil befanden sich nun die Räume der Kriminalpolizei. Kaminski hatte das Konferenzzimmer für Zeugenverhöre zur Verfügung gestellt. Fabel schaute aus dem Fenster über die Davidstraße und einen Teil der Friedrichstraße hinaus. Er sah, wie die grünen Wagen der Bereitschaftspolizei zur Verkehrsampel fuhren. Sie brachten sämtliche Protestlerinnen, die nicht in den winzigen Zellentrakt der Davidwache passten, zum Polizeipräsidium.
»Anna, ich glaube, du solltest die Zeugin vernehmen«, sagte er. »Das Mädchen, das Westland gefunden hat, meine ich. Sie scheint in einem ziemlich schlechten Zustand zu sein.«
»Warum ich, Chef?«, fragte Anna. »Weil ich eine Frau bin?«
»Ich nehme an, dass sie für dich empfänglicher sein wird.« Anna gehörte seit fünf Jahren zu seinem Team, doch es fiel ihm immer noch schwer, mit ihr umzugehen. Sie zu durchschauen. Anna Wolff sah viel jünger aus als ihre einunddreißig Jahre. Sie hatte ziemlich kurzes, schwarzes Haar, war nicht größer als einen Meter vierundsechzig und strebte mit ihrer dunklen Wimperntusche, dem feuerwehrroten Lippenstift und der übergroßen Bikerjacke eine Art Punk-Look an. Und sie war sehr attraktiv, obwohl Fabel sein Bestes tat, es nicht zur Kenntnis zu nehmen. Vor allem jedoch war Anna Wolff das bei Weitem rabiateste, aggressivste Mitglied seines Teams. Und auch das aufsässigste.
»Ach so.« Anna hatte eine Miene gespielter Erleuchtung aufgesetzt. »Offenbar bin ich verständnisvoller. Als Frau, meine ich. Tut mir leid … Ich habe vergessen, dass es ein unüberwindliches Hindernis für Mitgefühl ist, einen Schwanz zu haben.«
»Ich bin nicht sexistisch, Anna, einfach nur praktisch.« Fabel konnte einen ärgerlichen Klang in seiner Stimme nicht verhindern. »Vergiss es. Ich werde selbst mit ihr reden.«
»Ich meinte nur …«
»Ja. Anna. Du meinst immer nur. Ich werde das Verhör führen.« Er blickte auf seine Uhr. Es war 2.30 Uhr. »Werner, du bleibst hier. Anna, du hast Feierabend.«
»Ach, hör mal… Ich wollte doch nur …«
»Morgen um 14 Uhr halte ich eine Teambesprechung ab. Aber ich möchte dich vorher in meinem Büro sehen, Anna. Sei um 13 Uhr da«, befahl Fabel. Anna riss ihre Lederjacke von der Stuhllehne und stürmte hinaus.
»Das war ein bisschen schroff, Jan«, sagte Werner.
»Sie geht zu weit. Das weißt du doch. Ich habe es satt, dass jeder Befehl infrage gestellt oder kommentiert wird. Und es gefällt mir nicht, dass ich dauernd Beschwerden über Anna höre.«
»Das haben wir früher energische Polizeiarbeit genannt, Jan.«
»Die Tage sind vorbei, Werner. Seit Langem. Dies ist das einundzwanzigste Jahrhundert.«
»Aber sie hat nicht ganz unrecht, Jan.« Werner wirkte unsicher. »Ich meine mit der Männlich-weiblich-Sache. Du teilst Anna tatsächlich die meisten Vernehmungen von Frauen zu.«
»Worauf willst du hinaus?«
»Nur darauf – bitte, versteh mich nicht falsch –, dass du dazu neigst, Frauen wie eine andere Art Mensch zu behandeln.«
»Wie kannst du das behaupten, Werner? Mein Team ist immer ausgewogen gewesen. Na ja, jetzt vielleicht nicht. Nicht seit…«
Beide Männer schwiegen. Der Name Maria Klee hing unausgesprochen in der Luft.
»Schon gut, Jan«, sagte Werner eine Sekunde zu spät. »Ich finde nur, du solltest Anna etwas nachsichtiger behandeln.«
Fabel wurde durch eine Beamtin am Antworten gehindert, die ein Mädchen in dunklen Jeans und Steppanorak in den Raum führte. Sie umklammerte eine Wollmütze und einen Schal. Fabel vermutete, dass sie kein Strichmädchen war, denn die Prostituierten, die um die Herbertstraße herum arbeiteten, kleideten sich bunt, scharten sich zu Gruppen zusammen und hielten, ob es feucht war oder nicht, pastellfarbene Regenschirme hoch, um möglichen Kunden anzuzeigen, dass sie verfügbar waren. Ihre aufgesetzte Fröhlichkeit sollte bewirken, dass ihre Kunden sich weniger schäbig fühlten.
Fabel bemerkte, wie jung das Mädchen war. Sie sah nicht viel älter aus als Gabi, seine eigene Tochter. Er forderte sie auf, sich zu setzen, und bemühte sich, ihr die Angst zu nehmen. Christa Eisel war hübsch – sehr hübsch – und hatte schulterlange blonde Haare. Aus der Einfachheit ihrer Kleidung und ihrer Attraktivität schloss Fabel, dass sie eines der Schaufenstermädchen aus der Herbertstraße war und erst kurz vor der Arbeit etwas Aufreizenderes anlegte. Während des Gesprächs knetete Christa die Mütze und den Schal auf ihrem Schoß, doch in ihren Augen spiegelte sich ein gewisser Trotz wider.
»Das müssen wir Ihnen leider wegnehmen«, sagte er lächelnd.
Sie senkte den Blick auf ihre blutbefleckte Jacke. »Die kann ich sowieso nicht mehr gebrauchen. Ich habe meine Handschuhe unten gelassen. Sie sind auch verdorben.« Das Mädchen schlüpfte aus der Jacke und reichte sie Fabel. Werner legte das Kleidungsstück in einen großen Spurensicherungsbeutel aus Plastik.
»Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Gegend, Christa?«, fragte Fabel.
»Sechs Monate. Nur an den Wochenenden. Und nicht an jedem. Ich habe einen Platz in einem der Fenster, und hin und wieder arbeite ich auch als Hostess.«
»Müssen Sie eine Sucht finanzieren, Christa? Entschuldigung, aber die Frage muss ich stellen.«
Das Mädchen wirkte aufrichtig verblüfft. »Nein … nein, natürlich nicht.«
»Was machen Sie? Ich meine, wenn Sie nicht hier arbeiten.«
»Ich bin Studentin. An der Uni Hamburg.«
»Tatsächlich? Da war ich auch. Ich habe Geschichte studiert. Und Sie?«
»Medizin.«
Fabel musterte sie einen Moment lang. »Medizin? Also warum …?«
»Geld. Ich muss mir etwas dazuverdienen.«
»Aber auf diese Art?«
»Wieso nicht?« Wieder glitzerte Trotz in ihren Augen. »Viele Studentinnen tun das wegen zusätzlicher Einnahmen.«
»Sie sind ein intelligentes, hübsches Mädchen, und vor Ihnen liegt ein Leben voller Chancen, Christa. Ich begreife einfach nicht, warum Sie diese Möglichkeit gewählt haben. Meinen Sie etwa, dass eine typische Frau sich so verhält?«
»Sind Sie enttäuscht, weil ich kein Junkie bin und nicht ausgebeutet werde? Es stimmt, ich habe diese Möglichkeit gewählt. Mein Körper gehört mir, und ich kann damit tun, was ich will. Außerdem ist es ziemlich leicht verdientes Geld. In ein paar Stunden am Wochenende verdiene ich mehr als die meisten in einem Monat. Sie können mir glauben, dass mir das Medizinstudium dadurch sehr erleichtert wird.«
»Das ist nicht der entscheidende Punkt, Christa. In diesem Beruf habe ich wirklich erfahren, welch finstere Seiten die menschliche Natur besitzt, und ich verstehe nicht, warum sich jemand wie Sie darin verstricken will. Sie meinen vielleicht, dass Sie das ein oder zwei Jahre tun werden und dann Ihr normales Leben fortsetzen können. Aber glauben Sie mir, so funktioniert das nicht. Sie werden es für den Rest Ihres Lebens nicht mehr abschütteln. Jede Ihrer Beziehungen wird dadurch beeinträchtigt werden. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, das Gute in den Menschen zu sehen.«
»Was geht Sie das an, Herr Hauptkommissar? Versuchen Sie etwa, meine Seele zu retten?«
»Es geht mir nicht um Ihr moralisches Wohlbefinden, Christa, sondern darum, dass Sie sich in Gefahr bringen. Sie studieren Medizin, also kennen Sie die Risiken. Für Ihre Gesundheit, meine ich.«
»Und weil ich Medizin studiere, kann ich auf mich aufpassen. Wirklich, Herr Fabel, ich brauche mich nicht vor Ihnen zu rechtfertigen. Frauen werden seit Jahrhunderten von Männern ausgebeutet. Nun revanchiere ich mich ein bisschen.«
Fabel merkte, dass Christa trotz ihrer vorgetäuschten Unbekümmertheit durch die Ereignisse der letzten Stunde stark erschüttert worden war. Doch er wusste nicht, warum er sich auf die Diskussion mit ihr eingelassen hatte. Ihr Verhalten ging ihn tatsächlich nichts an, und er beschloss, das Thema fallen zu lassen.
»Es ist Ihr Leben, Christa …« Fabel seufzte. Er betrachtete die vor ihm liegenden Notizen. »Ich weiß, dass es sehr schwer für Sie ist, aber versuchen Sie bitte, sich daran zu erinnern, ob Sie etwas gesehen oder gehört haben, das in Ihrer Aussage bisher unerwähnt geblieben ist. Ist niemand aus dem Hof gekommen? Ich meine, als Sie hineingingen.«
»Nein. Niemand. Nicht dass ich es vergessen oder nicht bemerkt hätte. Ich bin sicher, dass niemand da war. Wenn ich in Eile bin, laufe ich meistens durch diese Gasse. Sie führt von der Erichstraße direkt bis zum Hof. Man muss immer vor widerlichen Kerlen auf der Hut sein, deshalb habe ich die Augen offengehalten. Es war niemand da.«
»Aber das ist doch widersprüchlich. Sie müssen Sekunden nach dem Überfall dort eingetroffen sein.«
»Bin ich auch, nach seinem Blutverlust zu schließen. Aber das ändert nichts daran, dass ich niemanden aus der Gasse kommen oder hineingehen sah.«
»Wie ich hörte, haben Sie Erste Hilfe geleistet. Ihre medizinische Ausbildung hat Sie also aktiv werden lassen?«
»Allerdings nur in Maßen. Inzwischen dürfte er tot sein. Der Täter war sehr geschickt. Westland ist durch einen einzigen Schnitt aufgeschlitzt worden, der wie bei einem japanischen Selbstmord, dem seppuko