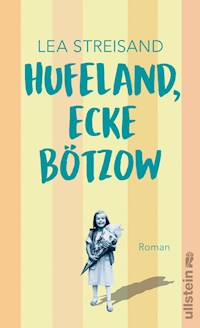13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lea Streisand sagt die Wahrheit. Jetzt. Hier. Und überhaupt. Lea Streisand ist unterwegs durch die große Stadt. Sie guckt hin, wenn die Beknacktheiten des täglichen Lebens passieren und schreibt Geschichten darüber, damit sie wahrer als die Wahrheit werden. Sie erzählt von Omilein aus dem Westen, von damals, als der Helmholtzplatz noch Drogenumschlagplatz war, und der Herausforderung, sich zwischen laktosefreiem Möhre-Wallnus-Eis oder glutenfreiem Mango-Bärlauch-Eis zu entscheiden. Berlin entfaltet sich hier als nie endender Rummel, ein Spiegelkabinett, in dem man in jeder noch so kuriosen Begegnung auch ein kleines Stückchen von sich selbst erkennt. »Lea, wenn ich das mal so sagen darf: Du bist Bombe!« Bettina Rust, Radio Eins
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Lea Streisand ist unterwegs durch die große Stadt. Sie guckt hin, wenn der Alltag sich von seiner schrägen Seite zeigt, und schreibt Geschichten darüber, damit sie wahrer als die Wahrheit werden. Über Frieda, die als Kinderärztin zu viel arbeitet, oder Hannes, der vor lauter Tinderdates nicht mehr zum Schlafen kommt. Sie erzählt von Omilein aus dem Westen, von damals, als der Helmholtzplatz noch Drogenumschlagplatz war, und nicht zuletzt über den Vorsatz, niemals aus der alten Wohnung auszuziehen, um nicht in die Fänge des mietpreistreibenden Gentrifizierungsmonsters zu geraten.
In War schön jewesen versammelt Lea Streisand ihre schönsten Lesebühnentexte, taz-Kolumnen und Radiotexte – und zeichnet dabei ein sehr persönliches Porträt ihrer Heimat.
Die Autorin
Seit 1986 kann sie lesen, seit 2003 liest sie auf Lesebühnen und Poetry Slams in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lea Streisand ist Mitglied der Neuköllner Lesebühne Rakete 2000. Außerdem schreibt die gebürtige Berlinerin Kolumnen für die taz und hat seit Herbst 2014 eine wöchentliche Hörkolumne auf Radio Eins.
Lea Streisand
War schön jewesen
Geschichten aus der großen Stadt
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1265-1
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© 2016 Lea StreisandUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München; Stephan Pramme (Foto)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für T.
Lerne lachen ohne zu weinen
Die Ratten am Paul-Lincke-Ufer rennen nach rechts. Vom Wasser weg über den Weg zu den Mülleimern. Die Tiere sind groß wie Meerschweinchen und zahlreich wie Fruchtfliegen über dem Biomüll.
»Is ja eklig«, sagt Kathi.
Wir suchen ein ruhiges Plätzchen zum Reden. Es ist Samstagabend. In den ganzen Sofabars in der Weserstraße waren zu viele zu junge zu fröhliche Menschen für uns. Wir haben unser Bier im Späti gekauft. Jetzt suchen wir eine Bank. Zum Sitzen, nicht zum Abheben.
Wir finden ein rattenloses Rondell, das neben einem geschlossenen Kiosk um einen Baum herum gebaut ist. Ein Kaugummiautomat steht im Gebüsch. Wie ein tapferer kleiner Zinnsoldat.
Kathi geht es gar nicht gut, deshalb haben wir auch Zigaretten gekauft. Und ein Feuerzeug. Eigentlich hat sie vor drei Monaten aufgehört, aber das hier ist ein Notfall.
»Alle sind schwanger, Lea, alle!«, sagt Kathi und pustet den Rauch in die Luft.
»Ja«, sage ich und nicke weise.
»Alle haben sie Kinder und sind verheiratet und sitzen da in ihren schönen Wohnungen und reden über Stilldemenz und Kitaplätze. Und dann gucken sie mich an und fragen: ›Und, Kathi, wie läuft’s bei dir so?‹, und ich sag: ›Och, na ja, ich komm im Fitnessstudio nicht so richtig voran.‹«
Tränen kullern über die hübschen Wangen meiner Freundin. Kathis Vollpfosten von Exfreund hat es vor kurzem geschafft, die Beziehung mit ihr volle Kanone gegen die Wand zu donnern. Außerdem hasst sie ihren Job, und sie muss aus ihrer Wohnung raus. Alles Kacke, deine Kathi, sozusagen.
Gleich weine ich mit, denke ich und nehme sie in den Arm.
Irgendwie hat gerade die ganze Welt Liebeskummer. Jeder Zweite wurde gerade verlassen. Die andere Hälfte ist im Begriff, sich zu trennen. Und der Rest ist auch nur einsam und unglücklich. Dabei ist doch Frühling! Die Sonne scheint, die Vöglein piepen lauter von Tag zu Tag. Und doch sickern Nacht für Nacht Bäche aus Rotz und Wasser in die Kopfkissen der Hauptstädter. Und in die Pullover ihrer Freundinnen.
Ein kleiner Wasserfleck hat sich auf meiner Schulter gebildet.
»’tschuldigung«, schnieft Kathi und versucht, ihn wegzuwischen.
»Is egal«, sage ich und reiche ihr ein neues Taschentuch.
»Danke«, näselt sie, um übergangslos hinzuzufügen: »Er ist so ein Arschloch!«
»Ja«, sage ich.
Die beiden wollten zusammenziehen, Kinder kriegen. Das volle Programm. Und dann hat er Schluss gemacht. Per WhatsApp! Definitiv ein neuer Rekord auf der Scheiße-sein-Skala. Sie hatten sich gestritten. Wegen irgendwas. Sie schrieb: »Wenn du nicht mitmachst, dann hat das alles keinen Sinn!« Und er antwortete: »Dann lassen wir’s eben bleiben. Ich komm auch gut alleine klar.« Trottel!
Meine Freundin Kathi ist eine sehr stolze Persönlichkeit. Die lässt sich so etwas nicht bieten. Würde mein Freund zu mir so was sagen, wäre ich vielleicht drei Tage beleidigt, höchstens vier. Mir fehlt da einfach irgendein Nachtragend-sein-Hormon. Man könnte es auch Mangel an Charakter nennen. Davon abgesehen würde mein Freund so was nie zu mir sagen. Es ist schon fast peinlich, wie gut wir uns verstehen bei dem ganzen Unglück um uns rum.
Mein Exfreund war von der gleichen Sorte wie der von Kathi. Typ großer kleiner Junge. Die Beziehung war wie eine Himbeere. Sehr süß am Anfang und im Verlauf dann irgendwann trocken, eingeschrumpelt und ein bisschen verfault. Der Exfreund und ich sind trotzdem noch befreundet. Wir haben einander fünf Jahre unseres Lebens geschenkt, die schmeißt man nicht so einfach weg. Für Kathi käme so was nicht in Frage. Sie ist eine stolze Frau. Eine Schlussstrichlerin.
»Ich bin ja nur froh, dass ich Heuschnupfen habe«, sagt Kathi und schnaubt geräuschvoll. »Kann ich immer die Birkenpolle vorschieben, wenn jemand fragt, warum ich schon wieder so scheiße aussehe.«
Sie hat sich jetzt eine Kühlmaske angeschafft. Weil die Tränensäcke nicht mehr abschwellen wollten. Und wasserfesten Mascara.
»Ich bin so nah am Wasser grade, neulich hab ich sogar beim Fernsehen geheult.«
»Chick flicks?«, frage ich. Wenn es mir schlechtgeht, laufen bei uns zu Hause immer sämtliche Jane-Austen-Verfilmungen in Dauerschleife, inklusive Bridget Jones. Oder Harry Potter.
»Nee!«, sagt Kathi. »Tierparkfilme!«
»Was?«, rufe ich und spucke ein bisschen Bier auf den Gehsteig.
»Mir tat schon das Rehkitz so leid, das von seinen Geschwistern geschubst wurde«, erzählt Kathi. »Als dann das Nashorn kam, dem sie Frau und Kind nahmen …«
Sie winkt ab. Es ist schlimmer, als ich dachte.
»Ich kann auch nicht mehr U-Bahn fahren«, erzählt sie weiter. »Sobald jemand nur traurig guckt, möchte ich ihm um den Hals fallen und rufen: ›Ich versteh dich. Mir geht’s auch nich gut.‹«
»Das kenn ich aber auch ohne Liebeskummer«, erwidere ich.
»Wenn du dich ma so richtig runterbringen willst«, schlägt Kathi vor, »musste mal U8 fahren.«
»Au ja!«, rufe ich. »Die Selbstmörderbahn! Von Wedding nach Neukölln und zurück. Ein Panoptikum der Alten, Kranken und Unglücklichen.«
»Irgendjemand heult immer«, sagt Kathi. »Und irgendwer macht immer grad am Telefon Schluss.«
»Ja!«, jubele ich. »Und einer hat immer grad was aufs Maul gekriegt.« Jetzt laufen mir die Tränen über die Wangen, weil ich so lachen muss.
Drei Jungs kommen vorbei. Ihre Hosen hängen so tief unter ihren nicht vorhandenen Ärschen, dass es an ein physikalisches und orthopädisches Wunder grenzt, dass die Träger sich nicht auf die Fresse packen.
Kathi schluchzt schon wieder.
»Warum is denn alles so scheiße, Lea?«, wimmert sie.
»Ach Kathilein!«, sage ich.
Die Jungs gucken sich um, sehen den Kaugummiautomaten, mustern uns kurz, dann zücken sie ihre Filzstifte und kritzeln ihre Tags auf den kleinen roten Kasten.
»Wir sind vonna UdK«, sagen sie zu uns. »Wir machen hier’n Kunstprojekt.«
Kathi schnieft. Die Jungs beenden ihr Kunstprojekt, dann schmeißen sie ihr Kleingeld zusammen und werfen es in den Automaten.
»Geil!«, sagt der eine und hält eine kleine Kugel in die Höhe. »Kaugummi aus’n Achtzjan!«
»Kannste zerbröseln und rauchen«, schlägt der andere vor, während er sich ins Gebüsch erleichtert. Hoffentlich pinkelt er ein paar Ratten auf den Kopp!
»Quatsch, Mann!«, sagt der Erste. »Ditt vaticken wa im Berghain als neue Designerdroge!«
Der Dritte fummelt ein bisschen an dem Automaten, dann tritt er dagegen und heult triumphierend auf. »Ey, ’ne große!«, ruft er. »Is bestimmt ’ne Kette drin!«
Kathi lacht, hält kurz inne und bricht dann wieder in Tränen aus.
»Kathilein«, sage ich und wiege sie im Arm.
Plötzlich stehen die Jungs vor uns. Sie halten uns die Kaugummikugeln hin und grinsen niedlich.
»Is der neue heiße Scheiß!«, sagt der eine.
»Hilft jegen allet!«, sagt der andere.
Der Dritte gibt Kathi die Kette: »Is echt Silber!«, sagt er.
»Danke schön«, krächzt Kathi und weiß nicht mehr, ob sie lachen oder weinen soll. Macht sie halt beides.
Ernte 1964
Es ist Frühling in Berlin. Man könnte spazieren gehen oder Radtouren machen. Mein Freund steht in der Küche auf der Leiter und brüllt Zahlen durch die Wohnung.
»ZweitausendNEUN!«, ruft er. Vorwurfsvoll. Wehklagend fast.
»Ja, Mann!«, rufe ich aus dem Arbeitszimmer. »Konserven werden nicht schlecht. Das wusste schon meine Großmutter!«
Einmal im Jahr kriegt Paul einen Rappel. Dann fängt er an, wild Sachen auszusortieren, die eigentlich noch total in Ordnung sind. Kaffeepötte mit Werbeaufdrucken, die irgendwelche ehemaligen Mitbewohner hier zurückgelassen haben. Oder Plastetüten. ODER Konserven.
»Das IST keine Konserve, das ist Kartoffelbreipulver!«, ruft Paul.
»Kartoffelbreipulver is instant!«, sage ich. »Ergo Konserve.«
Ein Geräusch kommt aus der Küche, als würde etwas gegen die Schranktür schlagen.
»Du ISST überhaupt keinen Kartoffelbrei!«, ruft Paul.
»Dann schmeiß ihn halt weg«, sage ich. »Wirste schon sehn, watte davon hast.«
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er keine Produkte aus den Neunzigern gefunden hat. So ’n Raider wäre doch cool. Was jetzt Twix heißt. Aber ich wohne hier auch erst zehn Jahre.
Als meine Oma gestorben ist, haben wir bei ihr im Keller Pflaumenmus gefunden, da stand Ernte 1964 auf dem Etikett. Das hatte überhaupt kein Verfallsdatum. Von meiner Oma hab ich auch die Packung ATA-Scheuersand geerbt, die da oben im Küchenschrank liegt.
»Das schmeißt du aber nicht weg!«, sage ich zu Paul. »Das Zeug wird noch putzen, wenn der Kommunismus gesiegt hat.«
Ich putze ja fast nie. Seit ich mit Paul zusammen bin, habe ich mich zur schlechtesten Hausfrau der Welt entwickelt. In dieser amerikanischen Zeichentrickserie mit den gelben Figuren gibt es eine Folge, wo Marge und Homer eine echte Ehekrise haben. Sie schmeißt ihn raus, und er muss im Garten im Baumhaus wohnen. Nach nur zwei Tagen sieht Homer aus wie ein Höhlenmensch. »Das Einzige, was ich dir bieten kann«, sagt er zur Versöhnung zu Marge, »ist meine absolute Abhängigkeit.« Genau so funktioniert meine Beziehung.
»Wie schaffst du das, die Wohnung innerhalb eines Wochenendes genauso aussehen zu lassen wie vor meinem Einzug?«, fragte Paul, als er neulich mal drei Tage weggefahren war. »Unsere Küche sieht aus wie die Kulisse zu einem Splatter-Film!«
»Das war die Tomatensoße«, murmelte ich.
Ich habe einfach immer so wahnsinnig viel zu tun, wenn er nicht da ist. Telefonieren, lesen, arbeiten, Filme gucken, Freunde treffen. Eigentlich dasselbe wie immer. Nur, dass mir dann eben keiner ständig alles nachräumt.
Es ist mir schon peinlich. Früher hab ich wenigstens noch regelmäßig gekocht. Aber auch das hat er mittlerweile übernommen. Er ist einfach der leidenschaftlichere Hausmann. Wenn Paul sich entspannen will, nimmt er den Staubsauger zur Hand. Und wenn das nicht reicht, dann wischt er noch mal feucht drüber. Manchmal bin ich schon fast eifersüchtig auf unseren Fußboden.
Als wir ganz frisch zusammen waren, damals, in dieser Phase, wo man öfter am Tag Sex hat, als man Mahlzeiten einnimmt, da passierte es. Ich saß in der Küche in Pauls WG in Neukölln, Paul machte sich am Herd zu schaffen. Es sah sehr gut aus. Das Essen auch.
»Paul?«, sagte ich.
»Lea?«, fragte er.
»Paul!«, sagte ich. »Komm mal her! Ich will dich küssen!«
Paul lächelte in den Topf, in dem er rührte, hielt inne, stellte die Gasflamme kleiner, nahm den Löffel aus der Soße, schlug ihn am Topfrand ab und legte ihn auf ein eigens dafür bereitgestelltes Brettchen. Dann riss er ein Stück Küchenpapier von der Rolle ab, drehte sich zu mir und wischte sich, näher kommend, mit dem Papier die Hände ab.
Als er fast bei mir war, als ich schon die Hände nach ihm ausstreckte, um ihn zu greifen und an mich zu ziehen, glitt sein Blick plötzlich von mir weg nach unten auf den Küchenfußboden, wo er kleben blieb wie ein breitgelatschter Klecks Marmelade, und dann bückte Paul sich und wischte mit dem zerknüllten Papier etwas weg.
Fassungslos starrte ich ihn an, als er wieder auftauchte. Die Hände waren mir genauso runtergefallen wie die Kinnlade.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst«, sagte ich.
Das war vor sieben Jahren.
»Zweitausendacht«, ruft Paul. Er beugt sich vor und hält eine Dose Mais in der Hand.
»Ja«, sage ich und denke an was anderes.
»Wie?«, fragt er.
»Zweitausendacht«, sage ich, »da sind wir zusammengekommen.«
Paul grinst mich an und dreht sich wieder zum Küchenschrank.
Ich gucke ihm beim Räumen zu.
»Du, sag mal?«, sage ich nachdenklich.
»Mhm«, macht er.
»Kann es sein, dass du dieses T-Shirt damals schon hattest?«
Paul dreht sich auf der Leiter halb zu mir um und macht ein sehr empörtes Gesicht. »Was denn?«, sagt er und guckt an seiner Brust herunter. Der Baumwollstoff ist fadenscheinig, das ehemals kräftige Rot zu einem ungesunden Seelachsfilet-Orange verwaschen. Der Schriftzug in Brusthöhe ist eine Ruine, und am Kragen reihen sich die Löcher aneinander, als wäre es ein Kettenhemd.
»Das ist doch noch gut«, sagt Paul.
Da sind wir definitiv geteilter Meinung. Ich finde wirklich, er könnte mal seinen Kleiderschrank ausmisten, statt hier völlig intakte Grundversorgungsgüter wegzuschmeißen! Mein Freund besitzt T-Shirts, die sind so alt, als die genäht wurden, hat Kurt Cobain das Gras noch geraucht, statt reinzubeißen.
»Das sind historische Artefakte!«, tönt Paul von der Leiter.
»Das sind stinkende Lappen«, sage ich.
Paul grummelt eine Weile vor sich hin und klappert mit den Büchsen.
»Okay, Deal«, sagt er schließlich. »Ein T-Shirt gegen zehn Konserven.«
»Von wegen!«, rufe ich. »Fünf T-Shirts gegen fünf Konserven.«
Wir einigen uns schließlich auf eine Drei-zu-fünf-Quote, und alle sind glücklich. Er, weil die Schränke leer sind; ich, weil er nicht mehr wie ein Penner rumrennt.
Ich denke, ich werde mal einkaufen gehen. Im Supermarkt ist diese Woche Linsensuppe im Angebot. Und im Küchenschrank ist jetzt so wahnsinnig viel Platz.
Der Grund für die Ehekrise der Simpsons war übrigens, dass Homer in der Öffentlichkeit intime Details über ihr eheliches Privatleben ausgeplaudert hat. Käme mir ja zum Glück nie in den Sinn.
Teelichte
Frieda und ich fahren zu diesem schwedischen Möbelhaus. Einmal im Jahr geben wir uns die volle Dröhnung. Mit Kötbullar und Apfelstrudel und allem Drum und Dran.
Frieda ist meine erstbeste Freundin. Sie legt großen Wert auf diese Bezeichnung. Als Kathi damals vor sieben Jahren bei mir einzog, als meine Wohnung noch eine WG war, benahm Frieda sich wochenlang wie ein beleidigter Liebhaber.
»Du kannst ja deine Freundin Kathi fragen«, sagte sie ständig, oder: »Kathi hat da bestimmt mehr Ahnung von als ich.«
Das Problem war, dass Kathi das Gleiche studiert hatte wie ich und genauso arm war, während Frieda gerade ihren Facharzt machte und mit einem Ingenieur zusammenzog.
»Sag doch, dass du mich verachtest, weil ich eine Spülmaschine besitze!«, zeterte Frieda, und ich sagte: »Du darfst mir deine Spülmaschine gerne schenken, wenn es dir damit bessergeht.«
Sie hatte einfach so wahnsinnig Angst, dass ich unter die Räder kommen würde.
»Du musst doch von irgendwas leben!«, sagte Frieda.
»Aber ich lebe doch!«, sagte ich.
Frieda und ich kennen uns schon ewig. Und trotzdem hat sie es nicht verstanden. Ich glaube, sie hatte auch einfach ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Ideale verraten hat. Frieda hat früher Gedichte geschrieben und jeden Punker unter den Tisch gesoffen. Und sie hat mindestens so oft vom Saufen gekotzt wie Paul in seiner Jugend.
Ich selber habe früher überhaupt nichts getrunken. Dafür habe ich mehr geraucht als alle anderen.
Seit ich durch glückliche Fügung beim Radio gelandet bin, hat Frieda zumindest keine Angst mehr, dass ich morgen unter der Brücke wohne. Radio ist was Reales, das kann sie nachvollziehen. Außerdem habe ich jetzt ein Einkommen und kann mir Sachen kaufen. Das ist auch neu. Und ich besitze eine eigene Spülmaschine. Die hat Paul mitgebracht, als er eingezogen ist, nachdem Kathi ausgezogen war, weil Kathi, wie sie erklärte, einmal im Leben alleine gewohnt haben wollte, bevor sie heiraten würde.
»Frieda?«, brülle ich gegen Mittag aus dem Badezimmer bei uns zu Hause.
Wir wollen seit Stunden losfahren. Aber ich musste mich noch schminken, Frieda wollte eine rauchen, dann noch einen letzten Kaffee, schon musste ich pullern.
»Was’n?«, fragt sie.
»Du, sag ma«, sage ich, »WARUM will ich nochma zu IKEA?«
»Du brauchst Blumentöppe«, sagt Frieda. »Und ’nen neuen Duschvorhang.«
»Ach ja, richtig«, sage ich, stehe auf, ziehe die Hose hoch, stoße dabei mit dem Ellenbogen das Mundwasser um, fluche, stelle das Mundwasser wieder hin, wasche mir die Hände, drücke die Klospülung und rufe: »Los!«
Sechs Stunden später schieben wir einen Einkaufswagen von der Größe eines Kleintransporters über den Parkplatz vor IKEA in Lichtenberg. Wir brauchen unser beider Körperkraft, um das Metallgefährt zu Friedas Auto zu bugsieren. Friedas Auto ist klein und rot und hat zwei Türen. Kurz habe ich die Vision, dass das Auto ängstlich schluckt, als wir um die Ecke biegen.
Wir laden in den Kofferraum: drei große Blumentöpfe mit Untersetzer, ein kleines Regal fürs Bad, einen Schreibtischstuhl für Paul, einen Satz tiefe Teller, Sitzkissen für die Stühle in der Küche, einen Satz flache Teller, zweimal Bettwäsche weiß, vier Spannbettlaken in den Farben Blau, Weiß, Rot und Schlamm. Und eine Blumenvase. »Brauchst du die?«, hat Frieda mich an der Kasse gefragt. »Nein«, hab ich gesagt, »aber ich will sie haben.«
»Sitzkissen sind was für Leute, die ihren Arsch nicht dabeihaben«, sagt Frieda.
»Na ja, guck mich an«, sage ich und packe die Kissen zwischen die Teller ins Auto.
»Jetzt krieg ich aber eine Zigarette«, sagt Frieda und macht den Kofferraum zu.
»Frieda!«, sage ich und gucke sie an.
»Was?!«, fragt Frieda.
»Frieda!«, sage ich. »Wir haben den Duschvorhang vergessen!«
Frieda sieht aus, als wolle sie jetzt gerne irgendwas kaputtmachen.
Ich gehe ihr eine Zigarette schnorren. Frieda raucht ja nicht mehr. Eigentlich. Wie alle meine Freundinnen.
Als wir uns durch die Drehtür schieben, schlägt uns erneut der Geruch von Hot Dogs und Kiefernholz entgegen.
»Hach!«, sagt Frieda. »Jetz erst mal Kötbullar und Apfelstrudel! Und aufm Rückweg können wir gleich noch ein paar Teelichte einpacken!«
Die Bäume in der Hufelandstraße
Ich sitze in einem Strandkorb und blicke auf das Haus, in dem ich den größten Teil meiner Kindheit verbracht habe: Hufelandstraße 26, Ecke Bötzowstraße, mitten in Prenzlauer Berg, dem Zentrum der Gentrifizierung. Die Straße gilt als Paradebeispiel innerstädtischen Strukturwandels nach der Wende.
Die Fassade des Hauses ist jetzt lindgrün, sie haben Stuck drangeklebt, aber die Haustür ist dieselbe wie 1986, als meine Eltern und ich in die Wohnung einzogen, am 20. Februar bei fünfzehn Grad minus und einem Meter Schnee.
»Das war alles in dem Jahr«, hat meine Mutter mir erzählt. »Der Umzug, deine Einschulung, Tschernobyl.«
Mein Vater rutschte beim Kistenschleppen auf einer vereisten Pfütze aus und prellte sich das Steißbein. Er konnte zwei Wochen lang nicht sitzen.
Ich fand die Wohnung einfach nur scheußlich, besonders am Anfang. Beletage, erster Stock. Zu groß, zu dunkel, zu hoch.
Mir gehörte ein riesiges Berliner Zimmer mit Fenster zum Hof. Unten im Haus war ein Friseur. Der Damenfrisiersalon Modische Linie. Dessen Lüftungsanlage befand sich genau unter meinem Kinderzimmerfenster. Den Geruch habe ich bis heute in der Nase.
Eltern mit kleinen Kindern laufen an meinem Strandkorb vorbei. Sie sprechen Englisch, Italienisch, Französisch.
Anfang der Neunziger zog Natalie in die Wohnung gegenüber. Natalie war Ende zwanzig, Studentin, Französin und wunderschön. Sie hatte eine kleine Tochter, Elena, deren Babysitterin ich wurde. Natalie brachte mir bei, wie man Augenbrauen zupft und Beinhaare epiliert. Als ich zum ersten Mal verliebt war, gab Natalie keine Ruhe, ehe sie den Knaben gesehen hatte. Das machte sie ganz subtil. Sie steckte den Kopf ins Kinderzimmer und flötete: »Hallo, ich bin die Nachbarin«, während der Junge verunsichert auf dem Boden vor dem Plattenspieler kauerte.
Der Hinterhof war eine Stein gewordene Tristesse. In der Fassade klafften die Einschusslöcher der Häuserkämpfe von 1945, darunter Mülltonnen, eine Teppichstange und ein mickriges, spindeldürres Bäumchen, das sich tapfer dem Licht entgegenstreckte.
Auf der anderen Seite vom Hof wohnte Ronny, der sah schon damals aus wie ein Nazi. Der stellte im Sommer immer die Boxen seiner Stereoanlage ins Fenster. Damit auch alle was davon hatten. Ronnys Mutter, eine blondierte Schönheit, verbrachte die Abende meist im Bötzowstübl. Das war die Altberliner Eckkneipe in der Bötzowstraße, die ihre Lüftung ebenfalls auf den Hof raus hatte. Der Duft meiner Kindheit ist ein Friseur mit Kneipenbetrieb. Wenn Ronnys Mutter nach Hause kam, stellte sie sich in den Hof und sang aus vollem Hals Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, den Schlager von Karel Gott. Wo früher die Modische Linie war, ist heute ein asiatisches Restaurant, im ehemaligen Bötzowstübl ist ein Coffeeshop.
In die Wohnung über uns war damals gleichzeitig mit uns Familie Reuter eingezogen, die hatten drei Kinder. Die älteste, Michelle, war so alt wie ich. Zusammen spielten wir Schweinebammel an den Teppichstangen im Hof. Frau Reuter arbeitete im Bäcker auf der anderen Straßenseite, da, wo heute das Café drin ist, vor dem der Strandkorb steht, in dem ich jetzt gerade sitze.
Nach der Wende zogen Reuters in ein Haus am Stadtrand, in ihre Wohnung zogen lauter gutaussehende Studenten. Ich war siebzehn und fand das sehr aufregend. Meine Mutter nicht so.
»Oh nee!«, rief sie, »Studenten! Die ziehen bestimmt die Dielen ab.« Sie schrieb gerade ihre Habilitation und war etwas geräuschempfindlich. Eine Woche später setzten die Schleifmaschinen ein.
Die Tür des Hauses Hufelandstraße 26 steht offen, stelle ich fest, als ich aufblicke. Jemand muss vergessen haben, sie zuzuziehen.
Ich bezahle schnell meinen Kaffee, packe meine Sachen zusammen, laufe über die Straße und schlüpfe mutig hinein in das Haus meiner Kindheit.
Der Hof ist genauso hässlich wie damals. Nur die Mülltonnen sind jetzt bunt und dreimal so zahlreich. Und die Belüftungen haben Rohre, die den Gestank nach oben ableiten. Es stinkt auch anders. Asiatisches Essen und Latte macchiato statt Kneipe und Friseur. Prenzlauer Berg eben. Früher und heute. Der komische Kronleuchter im Treppenhaus ist auch noch derselbe wie Mitte der Neunziger, als sie das Treppenhaus sanierten und das klassische Berliner Ochsenblut an den Wohnungstüren durch ein neumodisches Babydurchfallbraun ersetzten. Dafür versperren jetzt Kinderwagen statt Fahrrädern den Weg.
Ich mache Fotos mit meinem Handy und komme mir vor wie ein Stasispitzel.
Frank, der Friseur, hat mir mal erzählt, er sei irgendwann Mitte der Achtziger auf einer Fete in der Hufelandstraße gewesen, vielleicht sogar bei uns im Haus. »Da wohnte ’ne Frau, die war Model«, sagte Frank, »in so ’ner riesigen Wohnung mit Erker. Und in dem Erker, ditt weeß ick noch, stand so ’n überdimensionaler Ficus Benjamin, sowatt hatte damals jeder. Die Frau is denn rüber inn Westen kurz danach.« Während Frank erzählte, erinnerte ich mich, dass damals 1986 noch eine dritte Familie frisch eingezogen war. »Stasi«, hatte meine Mutter gesagt, hinter vorgehaltener Hand, aber natürlich nicht zu mir, ich hätte es ja doch gleich wieder in der Schule erzählt. Erzählen konnte ich immer gut.
Meine Eltern hatten die Wohnung im Tausch gegen unsere Altneubauwohnung in Adlershof bekommen. Ich wäre viel lieber da geblieben. Mein Kinderzimmer dort war lichtdurchströmt, ganz oben, der Spielplatz direkt vor dem Haus.
Als ich die Wohnung das erste Mal sah, wohnten da noch die Vormieter. Im Osten gab es keine Makler und keine Immobilienseiten im Internet. Man tauschte Wohnungen. Meine Eltern wollten eine größere Wohnung, unsere Vormieter suchten eine kleinere; meine Eltern wollten Altbau, die Vormieter lieber Neubau; sie wollten aus dem Zentrum raus, wir ins Zentrum rein.
Alles an der neuen Wohnung war großzügig. Vier Meter hohe Räume, Stuck an der Decke, Parkettfußboden. Aber die Vormieter, nennen wir sie Fitzners, hatten im Wohnzimmer, das durch Flügeltüren Richtung Arbeitszimmer sogar auf doppelte Größe erweitert werden konnte, auf Brusthöhe eine Holzvertäfelung angebracht, die dem vormals ballsaalartigen Raum das Flair einer Bahnhofskneipe verlieh.
Um dem Ganzen gewissermaßen den Kronkorken aufzusetzen, waren oben, auf dem Sims der Vertäfelung, zur Dekoration Büchsen drapiert. Bierbüchsen. Eine Dose DAB-Bier, eine Dose Becks, eine Dose DAB-Bier, eine Dose Becks, immer abwechselnd. Fitzners waren jedenfalls nicht bei der Stasi. Im Osten gab es nämlich kein Büchsenbier. Auch wenn Egon Krenz, der letzte Staats- und Parteichef der DDR, das offenbar vergessen hatte, als er Ende 1989 in einem Rundfunkinterview gefragt wurde, wie er als Staatsoberhaupt denn seinen Feierabend gestalte: »Na, das Gleiche, was ein ganz normaler Arbeiter auch macht. Ich setze mich auf die Couch, sehe fern und trink ’ne Dose Bier.«
In der Hufelandstraße holte die Stasi gleich nach unserem Einzug 1986 Erkundigungen über uns ein.
Frau Petersen, die alte Dame in der Wohnung schräg über uns, erzählte es uns gleich brühwarm am nächsten Tag: »Ick hab denen jesacht, ditt sind ruhige Leute.«
Man muss dazu wissen, dass Frau Petersen halb taub war. Nach dem Polterabend meiner Eltern mit Freejazzband und hundert Gästen, bei dem ein ganzer Porzellanladen auf dem Treppenabsatz zerschmettert worden war, empörte sie sich regelrecht am nächsten Morgen. »Wir ham janischt jehört«, sagte Frau Petersen. »Ick hab schon zu mein Mann jesacht: Die müssen wa ma rischtisch feiern lernen!«
Ich muss lachen, als ich daran denke.
»Entschuldigen Sie, was MACHEN Sie hier eigentlich?«, sagt plötzlich eine Stimme hinter mir.
Ich drehe mich um. Vor mir steht eine Frau in meinem Alter mit Kleinkind auf dem Arm.
»Entschuldigung«, sage ich, »ich habe hier mal gewohnt.«
»Ach so«, sagt sie und setzt das Kind in einen der Kinderwagen. »Ich dachte schon, sie wollten das Haus kaufen.«
»Ahahaha«, lache ich und folge ihr auf die Straße.
Zwei Frauen laufen an mir vorbei, als ich mein Fahrrad abschließe. Sie riechen teuer und sehen aus, als wären sie hier zu Hause. »Das ist dynamisch, das ist lebendig«, sagt die eine, »das sind nette, angenehme Leute.« Sie sagt »Loite«. Ihre Freundin ist schwanger.
Langsam rolle ich auf dem Fahrrad die Straße runter, vorbei an der Apotheke Hufeland-/Ecke Esmarchstraße. Die war bis zur Jahrtausendwende auf der gegenüberliegenden Straßenecke, einmal diagonal über die Kreuzung rüber. Die Apotheker hatten nach dem Umzug bestimmt Orientierungsprobleme. Stellt euch das vor! Da kommt man morgens zur Arbeit, und plötzlich ist alles seitenverkehrt.
Genau so müssen meine Eltern sich gefühlt haben, als sie am Morgen nach der Währungsreform 1990 in den Konsum kamen. Der war gegenüber der Apotheke. Sämtliche DDR-Produkte waren aus den Regalen verschwunden und durch Westsachen ersetzt worden. »Das war, als wär man im falschen Film«, hat meine Mutter erzählt.
Der Konsum wurde zum Spar-Markt, die Verkäuferinnen blieben dieselben. Aber weil wir jetzt Westen hatten, mussten sie plötzlich lächeln und »Guten Tag!« sagen. Papa sagt, das Schöne war, dass sie die Höflichkeitsfloskeln im gleichen Tonfall und mit genau dem gleichen Gesichtsausdruck vortrugen wie früher das »Ham wa nich, kriegn wa nich. Imma wieda reinschaun, imma wieda nachfragn!«.
Ich fahre weiter bergab über das Kopfsteinpflaster. Fürchterliches Zeug. Deswegen sind wir als Teenager schon immer auf dem Bürgersteig Fahrrad gefahren. Meine Freundin Annemarie wohnte in der Nummer 6, sie war mit Michelle zur Grundschule gegangen. Wir hatten uns beim Schweinebammeln kennengelernt, und später gingen wir aufs selbe Gymnasium. Annemarie holte mich jeden Morgen pünktlich um halb acht zu Hause ab, aber seit wir zusammen gingen, kam sie nie wieder pünktlich zur Schule. Annemaries Eltern trennten sich wie meine und zogen auseinander. Sie wohnt heute in Pankow wie ich.
Als wir Anfang 1986 hierher zogen, war die Straße noch gesäumt von Linden, die waren so alt wie das Jahrhundert, genauso wie die Häuser.
Ende April fuhren wir an die Müritz. Ich sollte im September eingeschult werden. Es war das letzte Mal, dass meine Eltern außerhalb der Ferien mit mir wegfahren konnten. Als wir wiederkamen, blühten überall in der Stadt die Bäume. Der Volkspark Friedrichshain war grün wie eine Oase. Nur die Linden in der Hufelandstraße waren kahl. Abgestorben. Haushohe, tote Bäume auf beiden Seiten der Straße. Wie die Kulisse zu einem Endzeitfilm.
Drei Tage zuvor war in Tschernobyl der Reaktor Nummer vier in die Luft geflogen. Beinahe hätten wir es überhaupt nicht mitgekriegt. An der Müritz gab es solche Nachrichten nicht. Papa hat sich nur aufgeregt, dass die »scheiß Ostpresse« lediglich die Hälfte der Teilnehmer der Friedensfahrt auflistete, des großen Radrennens an der deutsch-polnischen Grenze. Dass die westlichen Teilnehmer aus Angst vor radioaktiver Strahlung abgesagt hatten, stand nicht in der Zeitung.
Meine Mama freute sich über den tollen Salat, den es plötzlich überall zu kaufen gab. Zum Glück kam Onkel Lukas uns besuchen und erzählte, was passiert war. In diesem Urlaub mussten wir keinen Salat mehr essen.
Zwei Wochen später fuhren wir nach Hause. Meine Mutter hat mir erzählt: »Wir kamen mit unseren Koffern und Rucksäcken von der Bushaltestelle in der Greifswalder, bogen in die Hufelandstraße ein und blieben stehen wie vom Donner gerührt.«
Meine Eltern hatten schon Angst, die radioaktive Wolke sei genau über unserem neuen Zuhause niedergeregnet. »Et wusste ja keiner, watt Sache is«, hat Mama mir später gesagt.
Sie ist dann sogar zu einer Bürgerversammlung im Vorfeld der Volkskammerwahl gegangen, die im Juni 1986 stattfinden sollte. Meine Mutter setzte sich da hin, meldete sich dann und stellte dem Genossen die Frage, was denn mit den Bäumen in der Hufelandstraße passiert sei.
»Erst wurde es totenstill«, erzählte meine Mutter. »Und dann fing der Genosse da vorne an zu reden: Vom Frieden. Vom Weltfrieden. Vom Weltfrieden im Allgemeinen und im Besonderen. Von der Bedeutung des Sozialismus für den Weltfrieden. Und über den Beitrag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zum Weltfrieden. Über die Bäume verlor er kein Wort.«
Erst nach der Wende wurde öffentlich, was damals passiert war: Die Gasversorgung im gesamten Bötzowviertel war 1986 von Stadtgas auf Erdgas umgestellt worden. Weil Erdgas aber trockener ist als Stadtgas, wurden die Muffen undicht und das ganze giftige Zeug trat ins Erdreich aus. Durch die Hufelandstraße verlief die Gashauptleitung, deswegen sind bei uns die Bäume kaputtgegangen, in den anderen Straßen nicht. Als die Linden Monate später gefällt wurden, konnte man sehen, dass alle Wurzeln verfault waren.
Die Gasleitungen wurden erneuert. Anstelle der Bäume wurden Riesenblumentöpfe aus Waschbeton auf die Bürgersteige gestellt, die nur Platz wegnahmen und in denen jede Pflanze sofort verdorrte.
Nach der Wende pflanzte man in der ganzen Straße Platanen.
»Die sind widerstandsfähiger als Linden«, hat Mama gesagt, »aber auch die wurden nie gegossen.« Nur meine Mama hat sich des Bäumchens vor unserem Haus angenommen und ist selbst in der größten Hitze jeden Tag mit einem Eimer Wasser die Treppe runtergestiegen und hat ihn an dem Setzling ausgekippt. Jeden Sommer. Und noch heute ist die Platane vor der 26 die größte und kräftigste von allen Bäumen in der Hufelandstraße.
Trainspotting
Seit einigen Wochen schon, seit die Temperaturen sich mühsam in den positiven Grad-Celsius-Bereich hochgearbeitet haben, geraten einem auf den Fahrradwegen durch die Parks dieser Stadt wieder ständig diese hechelnden Menschen zwischen die Speichen: Jogger.
Keuchend und schweißsprühend dauerlaufen sie einem entgegen, mit wippenden Pferdeschwänzen und wackelnden Popos. Sämtliche Sitzgelegenheiten werden zu Halterungen für Dehnungsübungen entfremdet, und hinter jedem Busch kommt ein verschämt grinsender Mensch hervor, der die isotonischen Erfrischungsgetränke nicht mehr halten konnte.
Als ich klein war, sind wir in den Park gegangen, um zu spazieren, auf Spielplätzen wurde gewippt und geschaukelt, und als Teenager saßen wir abends in den Parks und spielten Woodstock. Heute wird in Grünanlagen nur noch gerannt.
Bei schönem Wetter setzen Paul und ich uns bisweilen abends mit einem Bier in den Bürgerpark, auf eine Bank an der Panke, und prosten den Joggern zu, die vorbeikommen. Manchmal zählen wir laut die Runden mit, die sie zurückgelegt haben. Wir finden das sehr lustig.
»Vielleicht«, sagt Paul, »ist das aber auch ein Ausgleich für das Umherschleichen mit den Kinderwagen.« Er unterdrückt einen Rülpser. »Das sind doch bestimmt alles dieselben jungen Eltern, die tagsüber neben ihren anderthalbjährigen Caspar-David-Friedrichs und Anna-Sophie-Charlottes herschleichen müssen, weil die Kinder gerade laufen gelernt haben und deshalb nicht gefahren werden wollen.«
»Nee«, sage ich, »meine Mutter hat nie gejoggt, und ich bin die größte Trantüte von allen.«
»Na, wegen deinem Gehfehler!«, sagt Paul. Er meint meine Behinderung. Infantile Zerebralparese. Mein linkes Bein ist ein bisschen kürzer und nicht so beweglich wie das rechte. Wahrscheinlich durch Sauerstoffmangel bei meiner Geburt passiert.
»Na ja, nee«, sage ich.
»Deine Schlafmützigkeit hat nichts mit deiner Behinderung zu tun«, hat meine Mutter immer gesagt. »In der Beziehung biste einfach meine Tochter. Ick war immer die Letzte in der Umkleide.«
Ich auch! Und ich war auf einer Körperbehindertenschule in einer Klasse mit zwei Rollstuhlfahrern, einem Herzkranken, zwei Epileptikern und einer Kleinwüchsigen. Die restlichen Kinder hatten ähnliche Behinderungen wie ich, nur schlimmer, und trotzdem war ich immer die Letzte. Ich war auch die Schlechteste.
»Ich bin dermaßen unsportlich, dass ich auf der Körperbehindertenschule auf dem Zeugnis in Turnen eine Vier hatte«, sage ich zu Paul. »Das muss man sich mal vorstellen!«
»Wahnsinn«, murmelt Paul.
»Vielleicht könnte ich die heute wegen Diskriminierung drankriegen«, überlege ich laut.
»Mhm«, brummt er in den Flaschenhals, saugt den letzten Rest Bier heraus, schluckt, rülpst und sagt: »Viel Spaß dabei!«
In der fünften Klasse bin ich im Sportunterricht sogar verunglückt. Hüftaufschwung am Barren, der Alptraum aller Orthopäden. Nach nur drei Mal Schwung holen lag ich schreiend unter dem Barren auf der Matte, statt elegant oben auf der Stange zu sitzen. Zerrung in der Schulter, zwei Wochen kein Sportunterricht.
Meine Mutter hatte es als Kind bei derselben Übung sogar zu einem richtigen komplizierten Splitterbruch im Ellenbogen gebracht. Sie brauchte danach ein Jahr lang keinen Sport mehr mitmachen, die Glückliche!
Sie hat bis heute einen Metalldraht im Ellenbogengelenk. Mit dem treibt sie manchmal die Zollbeamten in den Wahnsinn, wenn sie am Flughafen noch eine Weile Zeit hat, bis der Flieger startet. Dann ist ihr nicht so langweilig. Dreimal lässt meine Mutter sich abtasten und durchleuchten, dann schlägt sie die Hand vor die Stirn und sagt: »Ich Idiotin! Ich hatte doch diese OP vor fünfzig Jahren!«
»Ist noch Bier da?«, frage ich Paul.
Er kramt im Rucksack und fördert zwei weitere Flaschen zutage. Unsere Parkbank ist mittlerweile eine kleine Altglassammelstelle. Drei leere Flaschen haben wir schon.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.