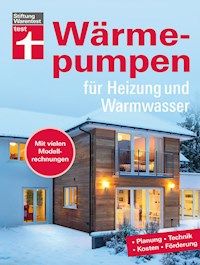
Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser - Umstieg in erneuerbare Energien - Rechtliches und Verträge - Inkl. Tabellen und Checklisten E-Book
Hans-Jürgen Seifert
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wärmepumpen – Ihr Einstieg in erneuerbare Energien Die Energiekrise zeigt deutlich, wie dringlich eine Trendwende auf dem Heizungsmarkt hin zu erneuerbarer Wärme ist. So soll jede in Deutschland neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Wärmepumpen werden als perfekte Lösung zur Beheizung ohne fossile Energieträger und ohne CO2-Ausstoß propagiert. Warum, wie funktionieren Wärmepumpen und was macht sie so besonders? Wann lohnt sich der Umstieg, wie finde ich die richtige Pumpe und welche Vorgaben gilt es zu beachten? All diese Fragen sowie die nötigen Informationen zu Planung, Einbau und Inbetriebnahme erfahren Sie in diesem Ratgeber der Stiftung Warentest. Wichtige Grundlagen zum Verständnis der Technologie, Kennzahlen, um einschätzen zu können, welche Wärmepumpenheizung für den eigenen Bedarf am besten geeignet ist und gesetzliche Vorgaben zur Energieeffizienz werden erklärt. Außerdem erhalten Sie viele praktische Tipps zu Dokumentation, Wartung, Fehlersuche und Optimierung Ihrer Anlage. Dieses Buch dient nicht nur als Entscheidungshilfe, ob der Wechsel zur Wärmepumpenanlage für Sie in Frage kommt, sondern bietet Ihnen die Möglichkeit, sich herstellerneutral über die verschiedenen Angebote zu informieren. Abhängig vom Wärmepumpentyp gibt es diverse gesetzliche Vorgaben, die Sie als Bauherr oder Sanierer zu beachten haben. Genehmigungen müssen vor Baubeginn eingeholt oder finanzielle Förderungen geklärt werden. Die nötigen Checklisten, Tabellen und Musterrechnungen dafür finden Sie in diesem Handbuch. - Grundlagen: Funktion, Kennzahlen und technische Vorschriften - Wärmepumpenarten: Was bietet der Markt? - Rahmenbedingungen: Rechtliches, Verträge, Förderung - Inbetriebnahme und Wartung: Mit Abbildungen und Tipps, um Fehler zu vermeiden - Tabellen und Checklisten: Zur Entscheidungshilfe und Fehlerbehebung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser
Hans-Jürgen Seifert
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
Grundlagen: Funktion, Kennzahlen, technische Vorschriften
Warum eine Wärmepumpe?
Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch
Sanierung im Fokus
So funktionieren Wärmepumpen
Der umgekehrte Kühlschrank
So funktioniert der Kältekreislauf
Absorption und Adsorption
On / off- und invertergeregelte Wärmepumpen
Kältemittel machen‘s möglich
Verschiedene Betriebsweisen
Pro und Contra von Wärmepumpen
Brennwertheizungen
Höchste Energieeffizienz
Was für Wärmepumpen spricht
Mögliche Probleme
Wo lassen sich Wärmepumpen aufstellen?
Kennzahlen verstehen
Leistungszahl / Coefficient of Performance (COP)
Die Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl ermitteln und überwachen
Welche Jahresarbeitszahl kann erreicht werden?
Energetische Vorgaben zu Neubau und Bestand
Vorschriften für Neubauten
Vorschriften für Bestandsgebäude
So lassen sich Wärmeverluste vermeiden
Wann lohnt sich der Umstieg?
Voraussetzungen
Was gilt es zu beachten?
Clever kombinieren
KAPITEL 2
Wärmepumpenarten: Was bietet der Markt?
Single-Varianten
Sole / Wasser-Erdwärmepumpe
Sonderformen der Erdwärmeabsorber
Direktverdampfer – Sonden und Flächenkollektoren
Offene Systeme
Eisspeicher
Luft-Wärmepumpen
Hybridmodelle
Stand der Entwicklung
Kompakte Hybrid-Wärmepumpen
Getrennte Hybrid-Wärmepumpenanlagen
Kombination mit Photovoltaik- und thermischen Solaranlagen
Energiemanagementsystem nutzen
Heizflächen für Wärmepumpen
Flächenheizungen
Heizkörper
Kühlen mit Wärmepumpen
Passive Kühlung
Aktive Kühlung
Platzierung der Geräte
Weitere Bedingungen
Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen
Gesetzliche Vorgaben
Zentrale und dezentrale Trinkwassererwärmung
Indirekt beheizter Warmwasserspeicher
Trinkwarmwasser – Speicherladesystem
Pufferspeicher mit Frischwasserstation
Bivalente Trinkwarmwasserspeicher
Warmwasser-Wärmepumpe
Bivalente Systeme mit Vorwärmstufe
KAPITEL 3
Das richtige Wärmepumpensystem finden
Bedarf ermitteln
Heizwärmebedarf im Neubau
Heizwärmebedarf im Bestand
Bedarf für Trinkwarmwasserbereitung
Anforderungen für Effizienzhäuser
Integration der Wärmepumpe in die Haustechnik
Vorplanung
Heizflächen
Festlegung der Betriebsweisen
Pufferspeicher / Wärmespeicher
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe
Zu klärende Fragen
Vorgehen bei der Auswahl
Wärmepumpe auswählen
Wie erzielt man das beste Ergebnis?
Planung und Erschließung der Wärmequellen
Dimensionierung und Errichtung von Erdwärmesonden
Dimensionierung und Errichtung horizontaler Flächenkollektoren
Auslegung und Installation von Brunnenanlagen
Planung und Ausführung für die Wärmequelle Luft
Schallemissionen bei Luftwärmepumpen
Anlagenkonzept und Detailplanung
Hydraulikschema mit Hydraulikplan und Regelungskonzept
Auswahl und Betrieb von Umwälz- und Förderpumpen
Planung und Dimensionierung der Wärmepumpe
Der Bivalenzpunkt
Dimensionierung der Wärmepumpe
Vorlauftemperatur bestimmen
Inbetriebnahme, Dokumentation und Wartung
Inbetriebnahme
Der hydraulische Abgleich
Funktionsheizen
Einweisung
Dokumentation und Wartung
KAPITEL 4
Wirtschaftlichkeit und Ertrag optimieren
Was rechnet sich wirklich?
Jahresarbeitszahl simulieren
Parameter für die Berechnung
Berechnete Daten
Auswirkungen von Variablen
Nutzung der Musterrechnungen
Bewertung der Varianten
Häufige Fehlerquellen bei der Planung
Häufige Fehler bei der Planung der Wärmequelle
Häufige Fehler bei der Planung der Heizflächen und Speicher
Häufige Fehler bei Auswahl und Dimensionierung der Anlage
Fehler bei der Planung vermeiden
Grundsätze für die richtige Auslegung
Mehr Effizienz – Ertrag optimieren
Einflussmöglichkeiten durch den Hersteller
Einflussmöglichkeiten durch den Installateur
Was Betreiber tun können
KAPITEL 5
Herstellerangaben bewerten und Angebote vergleichen
Herstellerangaben bewerten
Heizleistung und Leistungszahl
Energieeffizienzklasse
Einsatzgrenzen
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel
Kältemittel / Füllgewicht / GWP-Wert
Elektrische Daten
Angebote vergleichen
Begriffsklärung
Angebote einholen in der Praxis
Beauftragungsarten
Kriterien eines Angebots
Angebote richtig vergleichen
Häufige Fehler beim Einholen und Vergleichen von Angeboten
Zusammenfassung
KAPITEL 6
Rechtliches, Verträge, Förderung
Gesetzliche Rahmenbedingungen und Genehmigungen
Allgemeine Bestimmungen
Spezielle Rahmenbedingungen
Vertragsinhalte, Konformitätserklärungen, Versicherungen
Vorbereitungen für einen Vertragsabschluss
Inhalte eines Werkvertrags
Versicherungen
Förderungen
Allgemeine Fördervoraussetzungen
Fristen und Zuständigkeiten
Förderfähige Kosten
Mögliche Fallstricke bei der Förderung
Stromversorgung für Wärmepumpen und Zusatzheizer
Stromversorgung für Wärmepumpen
Zusatzheizer
KAPITEL 7
Inbetriebnahme und Wartung: Fehler vermeiden
Bei der Inbetriebnahme
Vor dem Anruf beim Installateur
Einweisung des Betreibers in die Anlagenperipherie
Einweisung des Betreibers in den Wärmepumpenregler
Betrieb, Inspektion, Wartung und Service
Betrieb einer Wärmepumpe
Inspektion, Wartung und Service – Allgemeines
Inspektion
Wartung
Wer wartet meine Wärmepumpe?
Fehlersuche und Behebung, Service
Häufige Fehler und Fallstricke
Probleme erkennen und lösen
ANHANG
Service
Tabellen und Checklisten
Stichwortverzeichnis
GRUNDLAGEN: FUNKTION, KENNZAHLEN, TECHNISCHE VORSCHRIFTEN
Wärmepumpen werden seit geraumer Zeit als perfekte Lösung zur Beheizung unserer Häuser ohne fossile Energieträger und ohne CO2-Ausstoß propagiert. Warum, wie funktionieren Wärmepumpen in der Praxis und was macht sie so besonders? Hier geht es um die Grundlagen zum Verständnis dieser Technologie.
Warum eine Wärmepumpe?
So funktionieren Wärmepumpen
Pro und Contra von Wärmepumpen
Kennzahlen verstehen
Energetische Vorgaben zu Neubau und Bestand
Wann lohnt sich der Umstieg?
Warum eine Wärmepumpe? Wir Menschen haben eine sehr lange Tradition, unsere Wohnungen und Wirtschaftsgebäude mit Hitze aus der Verbrennung von Naturmaterialien zu erwärmen. Das geht heute besser.
WAS ERFAHRE ICH?
Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch
Sanierung im Fokus
Seitdem unsere prähistorischen Vorfahren gelernt haben, das Feuer zu kontrollieren, wurde es – neben der Zubereitung von Speisen und als Lichtquelle – dazu genutzt, um sich aufzuwärmen. Zunächst wurde vor allem Holz verbrannt. Viel später und besonders mit der einsetzenden Industrialisierung wurden zunehmend fossile Energieträger eingesetzt, anfangs vorrangig Braun- und Steinkohle, dann auch Gas und Erdöl. Verbrennung von organischen Energieträgern setzt allerdings ungeheure Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (chemisch: CO2) frei – das hat über die Jahrhunderte ganz wesentlich zum globalen Klimawandel beigetragen, dessen Auswirkungen wir seit einigen Jahren immer deutlicher erleben können.
Hinzu kommt im ressourcenarmen Deutschland eine fatale Abhängigkeit von den Lieferanten dieser Brennstoffe, die die Stabilität unserer Energieversorgung bedroht. Den extremen Preisanstieg bei Gas, Öl und Benzin seit Anfang 2022 spüren wir alle schmerzhaft an der Zapfsäule der Tankstelle und bei den Rechnungen der Energieversorger.
Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch
Was können wir also tun, um die fatale Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu vermindern und längerfristig möglichst auch ganz zu beenden?
Die Erschließung von Sonnenenergie, Wind und Wasserkraft als alternative Energiequellen ist schon auf einem guten Weg. Sie liefern in erster Linie elektrischen Strom und – wie im Falle der Solarthermie – direkt nutzbare Wärme, die allerdings nicht gleichmäßig rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Der nachwachsende Rohstoff Holz kann nur wenig zum steigenden Energiebedarf der Weltbevölkerung oder auch nur aller Menschen in Deutschland beitragen. Für eine umfassende Versorgung mit Brennstoff müsste viel mehr Holz geschlagen werden als in der gleichen Zeit nachwachsen kann. Zudem binden Wälder CO2 aus der Atmosphäre und produzieren lebenswichtigen Sauerstoff.
Da kommt eine Technik ins Spiel, die in der Industrie seit Generationen bekannt ist und auch in nahezu jedem Haushalt bereits genutzt wird: Eine elektrische Wärmepumpe kühlt in der Küche unsere verderblichen Speisen. Dieses Prinzip „Kühlschrank“ kann man auch so umdrehen, dass ein Innenraum erwärmt wird, indem man der Umgebung Wärmeenergie entzieht. Wie das genau funktioniert, erklären wir im nächsten Abschnitt ab Seite 10.
Beim Neubau – insbesondere von Eigenheimen – sind Wärmepumpen in sehr gut gedämmten Häusern in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und Flächenheizungen quasi der neue Standard für die Heizung von Wohnräumen. Als primäre, also überwiegend für das Heizen eingesetzte Quelle werden bei den regenerativen Energiequellen mittlerweile meist Wärmepumpen gewählt.
Sanierung im Fokus
Deswegen hat die Bundesregierung ab Mitte 2022 insbesondere die energetische Sanierung und Umrüstung des vorhandenen Gebäudebestands in den Fokus gestellt und will die Umrüstung von fossilen Energieträgern auf Wärmepumpenheizungen möglichst umfassend vorantreiben. Dass dies nicht bloße Lippenbekenntnisse sind, zeigen zahlreiche Förderprogramme (siehe dazu „Förderungen“ ab Seite 171, die einen Teil der bei einem Umstieg nötigen Einstiegsinvestition abfedern.
Der Boom der Wärmepumpenheizungen hat zu einer große Vielfalt der unterschiedlichsten Produkte und Systeme geführt. Was ist denn aber nun das Beste für das eigene Haus, eine Luft-Luft-Wärmepumpe, eine Luft-Wasser-, Grundwasser- oder Erdwärmepumpe? Was leisten diese Anlagen, wie energieeffizient sind sie und was kostet das alles? Und was ist an behördlichen Vorgaben und bei der Beantragung von Fördermitteln zu beachten?
Im Bestand, also bei Planungen für eine energetische Sanierung, war und ist die größte Hürde, dass Wärmepumpen am energieeffizientesten arbeiten, wenn die Vorlauftemperaturen für den Heizungskreislauf möglichst niedrig gehalten werden können. Das heißt, dass sie am besten im Zusammenspiel mit einer sehr guten Wärmedämmung des Gebäudes und großen Heizflächen, also Fußboden- oder Wandflächenheizungen, funktionieren. Sind im Gebäude die typischen Heizkörper, man spricht auch von Radiatoren, verbaut, müssen Lösungen für einen wirtschaftlichen Wärmepumpenbetrieb gefunden werden.
KURZE GESCHICHTE DER WÄRMEPUMPE
Auch wenn Wärmepumpen erst seit relativ kurzer Zeit allgemein bekannt geworden sind: Die Ursprünge dieser Zukunftstechnologie liegen bereits im 18. Jahrhundert. Dem schottischen Mediziner William Cullen gelang die Herstellung geringer Mengen künstlichen Eises, indem er Diethylether durch Unterdruck zum Verdampfen brachte, wobei dem Wasser in einem Reaktionsgefäß Wärme entzogen wurde. Das Jahr 1777 wird deshalb als Geburtsjahr der Erzeugung künstlicher Kälte bezeichnet. 1852 konnte William Thompson dann nachweisen, dass Kältemaschinen auch zum Heizen eingesetzt werden können – mit einem Energiegewinn im Vergleich zur direkten Wärmeerzeugung. Das Jahr 1852 gilt deshalb als Geburtsstunde der Wärmepumpe.
In Deutschland installierte Klemens Oskar Waterkotte bereits 1968 in seinem Haus die erste erdgekoppelte Wärmepumpe in Verbindung mit einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Die Firma Viessmann produzierte schon in den Jahren 1979 bis 1987 die ersten Wärmepumpen, was sich jedoch aufgrund des sinkenden Ölpreises damals nicht rentierte. Der schwankende Ölpreis verhinderte weitere 30 Jahre lang den Marktdurchbruch der Wärmepumpentechnologie. Ein spürbarer Aufschwung, der sich in der Folge zu einem regelrechten Boom entwickelte, setzte in Deutschland erst ab dem Jahr 2006 ein.
Abbildung: Wärmepumpe aus dem Jahr 1979
Dieses Buch soll Ihnen das nötige Wissen vermitteln, um die Heizung und Brauchwassererwärmung mithilfe einer Wärmepumpe zu verstehen und das passendste System mit den auf Dauer geringsten Kosten zu planen und in die Praxis umzusetzen – beim Neubau oder im Zuge einer Umrüstung im Bestand.
So funktionieren Wärmepumpen: Auch bei Minustemperaturen Wärme aus der Umwelt gewinnen und in nutzbare Heizwärme umwandeln: Was wie ein Wunder klingt, funktioniert nach demselben Prinzip wie ein Haushaltsgerät, das jeder kennt.
WAS ERFAHRE ICH?
Der umgekehrte Kühlschrank
So funktioniert der Kältekreislauf
Absorption und Adsorption
On / off- und invertergeregelte Wärmepumpen
Kältemittel machen‘s möglich
Verschiedene Betriebsweisen
Wie Wärmepumpen wirken, lässt sich so zusammenfassen: Mittels eines elektrisch betriebenen Antriebs erzeugen Wärmepumpen aus Wärmequellen mit relativ niedrigem Temperaturniveau – etwa aus der Luft bis minus 25 Grad Celsius, aus Brunnen mit 8 bis 10 Grad Celsius oder mithilfe von Erdsonden oder Erdkollektoren mit Soletemperaturen bis minus 5 Grad Celsius – Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad Celsius. Als VORLAUFTEMPERATUR bezeichnet man die Temperatur, auf die ein Wärmeträger (etwa Wasser) gebracht werden muss, bevor er dem Heizsystem zugeführt wird. Diese Wärme wird dem Wärmeübertrager dann entzogen und kann im Wohnbereich zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Der Wärmeübertrager wird anschließend mit einer geringeren RÜCKLAUFTEMPERATUR zum Wärmeerzeuger zurückgeführt und der Kreislauf beginnt von neuem. Doch wie funktioniert das genau, wo kommt die Wärme her? Vereinfacht gesagt, geht es im KÄLTEKREISLAUF einer Wärmepumpe um die Phasenumwandlung einer Flüssigkeit in Gas und umgekehrt bei definierten Drücken und definierter Temperatur. Das im Kältekreis zirkulierende Arbeitsmedium wird als Kältemittel bezeichnet.
Der umgekehrte Kühlschrank
Prinzipiell bestehen elektrisch angetriebene Kompressionswärmepumpen und Kältemaschinen, also etwa Kühlschränke, aus den gleichen Hauptkomponenten (siehe Grafik auf Seite 11):
Verdampfer
Verdichter
Verflüssiger
Expansionsventil
Verdampfer und Verflüssiger sind WÄRMEÜBERTRAGER, in denen sich der Aggregatzustand des in einem geschlossenen Kreislauf befindlichen Kältemittels durch Wärmezufuhr (im Verdampfer) und Wärmeentzug (im Verflüssiger) permanent ändert. Das funktioniert durch eine stete Abfolge von Verdampfung, Verdichtung, Verflüssigung und Entspannung. Die dafür benötigten Hauptkomponenten Verdampfer (im Bild blauer Pfeil), Verdichter, Verflüssiger (im Bild orangefarbener Pfeil) und das Expansionsventil werden in der Regel über Kupferrohre miteinander verbunden, abgedrückt, evakuiert und mit Kältemittel befüllt. Es handelt sich hierbei, wie in der nebenstehenden Grafik rechts dargestellt, um einen linksläufigen Kreisprozess.
Im Inneren eines Kühlschranks befindet sich der Verdampfer meistens hinten oder oben, wo er dem Kühlgut Wärme entzieht. Der Verflüssiger hingegen befindet sich in der Regel außen an der Rückwand des Kühlschranks, wo die Wärmeenergie an die Umgebungsluft abgegeben wird (siehe Grafik auf Seite 12). Nur besteht beim Kühlschrank das Ziel darin, einen definierten Raum zu kühlen, während Wärmepumpen vorzugsweise zum Heizen eingesetzt werden. Allerdings können einige von ihnen sowohl wärmen als auch kühlen – mehr dazu ab Seite 58.
So funktioniert der Kältekreislauf
Bei der Wärmepumpe läuft der geschilderte Kreislauf also in umgekehrter Reihenfolge ab: Dem flüssigen Kältemittel wird bei niedrigem Druck (Niederdruckseite) über den Verdampfer – etwa durch Außenluft, Grundwasser oder Sole – mit einer Eintrittstemperatur von 0 Grad Celsius Wärmeenergie zugeführt. Der Clou: Durch die niedrige Verdampfungstemperatur des Kältemittels funktioniert das auch, wenn die Wärmequelle Temperaturen im Minusbereich aufweist. Das flüssige Kältemittel verdampft und entzieht dabei der Umwelt Wärmeenergie, die VERDAMPFUNGSWÄRME.
Mittels Verdichtern (Kompressoren) wird das dampfförmige Kältemittel unter Zuführung mechanischer Arbeit nun komprimiert, wobei sich der Druck und die Dichte des Gases erhöhen. Dieser Vorgang wird leicht begreiflich, denkt man an eine Luftpumpe: Jeder, der einem Fahrradreifen schon einmal mit einer Handpumpe Luft zugeführt hat, weiß, dass das Pumpengehäuse nach wenigen Hüben warm wird. Anschließend wird das unter hohem Druck (Hochdruckseite) stehende dampfförmige Kältemittel durch den Verflüssiger oder Kondensator geleitet, wo es wieder in einen flüssigen Aggregatzustand übergeht. Die im Kältemittel enthaltene Wärmeenergie wird in diesem Prozess auf das Heizwasser übertragen. Schließlich wird der Druck über ein Expansions-/Entspannungsventil wieder auf das Ausgangsniveau herabgesenkt, und der Prozess beginnt von vorn.
FUNKTIONSSCHEMA EINER WÄRMEPUMPE
Kreislauf des Kältemittels in einer Wärmepumpe: Im Verdampfer wird die Wärme aus dem Erdkollektor aufgenommen, durch Verdichtung erhöht und im Verflüssiger an die Heizung abgegeben.
Wo beim Kühlschrank als Nebenprodukt „Wärme“ entsteht, die auf der Rückseite des Kühlschrankes als Wärmeenergie abgeleitet wird, produziert eine Wärmepumpe als Nebenprodukt „Kälte“, die bei Bedarf genutzt werden kann (siehe „Kühlen mit Wärmepumpen“ ab Seite 58). Dabei ist unter dem Begriff „Kälte“ im thermodynamischen Sinn die Abwesenheit von „Wärme“ zu verstehen.
FUNKTIONSSCHEMA EINES KÜHLSCHRANKS
Analogie zum Kühlschrank
Absorption und Adsorption
On / off- und invertergeregelte Wärmepumpen
Bei On/off-Wärmepumpen („Ein/aus-Wärmepumpen“, auch als Fixed-Speed-Wärmepumpen bekannt) wird der Verdichter immer mit einer KONSTANTEN DREHZAHL betrieben. Werden sie eingeschaltet, so bringen sie im definierten Arbeitspunkt, zum Beispiel Sole 0 Grad Celsius / Wasser 35 Grad Celsius, immer die im Datenblatt angegebene volle Heizleistung. Da die volle Heizleistung nur bei der tiefsten Normaußentemperatur benötigt wird, erfolgt die Leistungsregulierung über die Laufzeit. Wird der eingestellte Temperatursollwert zur eingestellten Schalthysterese (beispielsweise 5 Kelvin) unterschritten, schaltet die Wärmepumpe ein. Ist der Sollwert erreicht, schaltet die Wärmepumpe wieder ab. Ist die Wärmepumpe zu groß dimensioniert, schaltet sie in der Übergangsperiode häufig ein und aus (sie taktet zu viel), was sich nachteilig auf Effizienz und Lebensdauer auswirkt.
TECHNISCHE PARAMETER VERSCHIEDENER KÄLTEMITTEL FÜR WÄRMEPUMPEN
Bei einer invertergeregelten Wärmepumpe (auch modulierende Wärmepumpe genannt) wird die Drehzahl des Verdichters über die FREQUENZÄNDERUNG so geändert, dass die Wärmepumpe nur die jeweils benötigte Heizleistung erzeugt. Die Heizleistung ist also über den Modulationsbereich variabel, während bei einer On/off-Wärmepumpe die Leistungsabgabe immer gleich ist, wenn sie eingeschaltet ist. Fährt eine modulierende Wärmepumpe nicht die volle, sondern nur die angeforderte Leistung, befindet sie sich im TEILLASTBETRIEB. Bei zweistufigen Wärmepumpen ist die Teillast der Betrieb mit nur einem Verdichter.
Da sich eine invertergeregelte Wärmepumpe dem Leistungsbedarf anpasst, kommt sie auch auf wesentlich höhere, in etwa doppelte Laufzeiten. On/off-Wärmepumpen regeln ihre Wärmeabgabe über die Laufzeit durch das Ein- und Ausschalten. Darum haben sie wesentlich geringere Betriebsstunden und höhere Ein- und Ausschaltungen. On/off-Sole/Wasser-Wärmepumpen werden für den Heiz- und Warmwasserbetrieb mit 2 400 Stunden pro Jahr geplant.
Kältemittel machen‘s möglich
Kältemittel, die bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur unter Zufuhr von Umweltenergie verdampfen und sich bei hohem Druck und unter Wärmeentzug wieder verflüssigen, sind der Schlüssel zur Funktion von Wärmepumpen. Während Wasser bekanntlich bei normalem Luftdruck unter Zufuhr von Wärmeenergie bei zirka 100 Grad Celsius verdampft, liegt der Siedepunkt eines der bekanntesten natürlichen Kältemittel, R 290 (Propan), beispielsweise unter einem Druck von 4,745 bar bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius (die Verdampfungstemperatur ändert sich mit dem Dampfdruck).
Wurden früher überwiegend Kältemittel mit hohen Treibhauspotenzialen eingesetzt, beschränken mittlerweile zahlreiche Gesetze und Verordnungen den Verkauf umweltschädlicher Kältemittel und ermöglichen die langfristige Umstellung auf umweltfreundliche Kältemittel.
On / off-Sole / Wasser-Wärmepumpen werden für den Heiz- und Warmwasserbetrieb mit 2 400 Stunden pro Jahr geplant.
Für den Betreiber einer Wärmepumpe spielen in erster Linie die Anlagensicherheit und die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Deshalb sollte beim Kauf einer Wärmepumpe auch ein besonderes Gewicht auf die Auswahl des Kältemittels gelegt werden, das allerdings der Hersteller festlegt. Kältemittel sollten folgende Eigenschaften besitzen:
umweltfreundlich, geringes „Global Warming Potential“
nicht giftig
schwer entflammbar
passende thermodynamische Eigenschaften (Siedetemperatur, spezifische Wärmekapazität, Drücke, Verflüssigungstemperatur, Temperaturbereich)
Nachhaltigkeit (Einhaltung von Gesetzen, Gefahrenpotenzial, Entsorgung)
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Verschiedene Betriebsweisen
Wärmepumpen können alleine oder in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern eingesetzt werden. Man unterscheidet folgende Betriebsweisen:
MONOVALENT
In diesem Betrieb übernimmt die Wärmepumpe allein die Beheizung und die Trinkwassererwärmung des Gebäudes. Sie wird überwiegend im Neubau angewandt. Die Wärmequelle muss so ausgeführt sein, dass sie das ganze Jahr zur Verfügung steht.
MONOENERGETISCH
Hierbei wird ab dem Zeitpunkt, wo die Heizleistung der Wärmepumpe nicht mehr ausreicht, um den Wärmebedarf zu decken, ein zweiter Wärmeerzeuger (Elektroheizstab oder -durchlauferhitzer) mit dem gleichen Energieträger zugeschaltet (Strom für die Wärmepumpe und den Zusatzheizer). Die Außentemperatur beziehungsweise den Zeitpunkt, an dem der zweite Wärmeerzeuger zugeschaltet wird, bezeichnet man als BIVALENZPUNKT. Meistens werden monoenergetische Wärmepumpenanlagen so ausgelegt, dass der Bivalenzpunkt bei einer Außentemperatur von minus 5 Grad Celsius liegt, da bei dieser Betriebsweise die Wärmepumpe bis zu 95 Prozent des Jahresenergiebedarfs übernehmen kann. Diese Betriebsweise wird meistens bei Luft-Wärmepumpen angewendet.
BIVALENT-ALTERNATIV
Bei dieser Betriebsart arbeiten die Wärmepumpe und ein zweiter Wärmeerzeuger mit anderem Energieträger bis zum Bivalenzpunkt zusammen. Dann wird die Wärmepumpe abgeschaltet und der zweite Wärmeerzeuger übernimmt allein die Bedarfsdeckung. Diese Betriebsweise wird häufig dort eingesetzt, wo höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden.
BIVALENT-PARALLEL
In einem solchen Betrieb übernehmen die Wärmepumpe und der zweite Wärmeerzeuger mit einem anderen Energieträger die Wärmeversorgung. Der zweite Wärmeerzeuger wird ab einem DIMENSIONIERUNGSPUNKT zugeschaltet. Der Bivalenzpunkt ergibt sich aus dem Wärmebedarf und den Leistungsdaten der Wärmepumpe, also aus einem Punkt, der sich je nach Dimensionierung der Wärmepumpe ergibt. Ab da arbeiten die Wärmepumpe und der zweite Wärmeerzeuger parallel zusammen. Wird in einem Bestandsgebäude mit Heizkörpern, die auf Vorlauf-/Rücklauftemperaturen von 70/55 Grad Celsius ausgelegt sind, eine Wärmepumpe bivalent dazu installiert, schafft die Luft-Wärmepumpe die Beheizung etwa nur mit 55 Grad Celsius Vorlauftemperatur bis 4 Grad Celsius. Ab dem Bivalenzpunkt wird die Wärmepumpe abgeschaltet und der Ölkessel übernimmt den weiteren Betrieb. Die Wärmepumpe muss so ausgelegt sein, dass sie über den Bedarfszeitraum in Betrieb bleiben kann. Diese Variante kann bei Hybridanlagen angewendet werden.
Ob die Wärmepumpe oder der alternative Wärmeerzeuger in Betrieb sein soll, kann bei Wärmepumpenreglern mit TRIVALENZPUNKT danach entschieden werden, welcher Wärmeerzeuger nach den hinterlegten Bezugspreisen gerade wirtschaftlicher arbeitet. Beim Trivalenzpunkt erfolgt die Umschaltung auf einen anderen Wärmeerzeuger (Öl oder Gas) nach mehreren Kriterien. Der witterungsgeführte Wärmepumpenregler bezieht in die Berechnung die Energiepreise, den COP der Wärmepumpe bezogen auf die angeforderte Vorlauf- und Quellentemperatur, den Wirkungsgrad des zweiten Wärmeerzeugers und das Zeitprogramm für die Tarifzeiten mit ein. Je nach Energiepreisen und Vorlauftemperatur kann der Betrieb mit der Wärmepumpe oder zum Beispiel mit einem Gas-Brennwertkessel wirtschaftlicher sein. Die Entscheidung hängt hierbei also weniger von den technischen Daten, sondern vielmehr von den Preisen der Energieträger ab.
Grundsätzlich sollten Wärmepumpenanlagen für die monovalente oder die monoenergetische Betriebsweise geplant werden, wodurch Investitionskosten, Nebenkosten für Zähler und Bezirksschornsteinfeger sowie Wartungskosten für den zweiten Wärmeerzeuger vermieden werden. Die bivalente Betriebsweise wird eigentlich nur bei größeren Anlagen eingesetzt oder wenn hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden. Ein Vorteil ist die mögliche Auswahl des Energieträgers bei plötzlichen Preisexplosionen. Im Eigenheim lohnt sich das aber wegen der aufgeführten Nebenkosten nicht. Hier ist es preiswerter und besser, auf Tieftemperaturheizkörper umzurüsten (siehe ab Seite 56).
Pro und Contra von Wärmepumpen: Wärmepumpen kommen weitgehend oder ganz ohne fossile Energieressourcen aus und arbeiten am Einsatzort emissionsfrei. Und auch in weiteren Punkten sind sie im Vergleich zu anderen Heizungsarten im Vorteil.
WAS ERFAHRE ICH?
Brennwertheizungen
Höchste Energieeffizienz
Was für Wärmepumpen spricht
Mögliche Probleme
Wo lassen sich Wärmepumpen aufstellen?
Brennwertheizungen
Während Wärmepumpen aus einer Kilowattstunde vier bis fünf und noch mehr Kilowattstunden erzeugen können, haben Wärmeerzeuger für fossile Brennstoffe (Gas, Öl, Holz und Pellets) Wirkungsgrade von um die 90 Prozent.
Theoretisch sind Wirkungsgrade von mehr als 100 Prozent nicht möglich. Bei einer Brennwertheizung werden jedoch Wirkungsgrade von 108 bis 110 Prozent angegeben. Möglich wird das dann, wenn beispielsweise die im Abgas einer Gas- oder Ölheizung enthaltene Kondensationswärme nutzbar gemacht wird. Das geschieht, indem mithilfe geeigneter Wärmeübertragerflächen im Brennwertkessel und in der Schornsteinanlage die Abgastemperatur so weit abgekühlt wird, dass der im Abgas enthaltene Wasserdampf kondensiert. Dieses Kondensat läuft an der Innenwand der Abgasanlage über die Wärmetauscherflächen des Kessels, wo diese Kondensationswärme zusätzlich nutzbar gemacht wird, zum Kondensatablauf.
Da das Kondensat auch sauer sein kann, werden die dampfdichten Abgasleitungen aus Kunststoff und die Wärmeübertragerflächen aus Edelstahl gefertigt. Danach wird das Kondensat unter bestimmten Bedingungen neutralisiert und anschließend in das Kanalsystem abgeleitet.
Wichtig zu wissen: Der Brennwerteffekt kann nur genutzt werden, wenn die Taupunkttemperatur des jeweiligen Abgases unterschritten wird, welche von der Zusammensetzung des Brennstoffs abhängt. Bei einer Ölheizung liegt die Abgas-Taupunkttemperatur bei 47 Grad Celsius, bei einer Gasheizung bei 57 Grad Celsius. Deshalb sollten die Heizflächen einer Brennwertheizung so ausgelegt werden, dass bei Gas-Brennwertkesseln die Vorlauftemperaturen 56 Grad Celsius und bei Öl-Brennwerttechnik 46 Grad Celsius nicht überschreiten. Flächenheizungen sind für die Brennwerttechnik somit besonders prädestiniert! Wie später zu sehen sein wird, haben Brennwerttechnik und Wärmepumpe hier eine nicht zu unterschätzende gemeinsame Eigenschaft (siehe ab Seite 46).
Höchste Energieeffizienz
Seit Ende 2015 sind Raum- und Kombiheizgeräte sowie Warmwasserbereiter EU-weit mit einem Energielabel zu versehen. Damit soll erreicht werden, dass der Verbraucher Geräte mit einem geringen PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH leichter erkennt und sich beim Kauf für ein Produkt mit möglichst sparsamem Energieverbrauch entscheidet. Von Haushaltsgeräten sind die Energielabel mit der farbigen Kennzeichnung der Energieeffizienzklassen von Tiefrot für Energiefresser bis Tiefgrün für sehr sparsame Geräte allgemein bekannt. Auf dem Etikett von Raumheizgeräten umfasst die Skala die Energieeffizienzklassen von A+++ bis D.
Weiter wird unterschieden nach Produktlabel des Herstellers und Verbundlabel, welches von Herstellern, Großhändlern oder Handwerkern ausgestellt werden kann. Verbundlabel werden für Kombinationen aus Raumheizgerät, Kombigerät oder Warmwasserspeicher mit einem oder mehreren Komponenten wie Temperaturregler, thermische Solaranlage, Speicher und zusätzliche Wärmeerzeuger ausgestellt. Verbundanlagen können höhere Effizienzwerte als ein Produkt mit einem reinen Wärmeerzeuger erreichen.
Im Unterschied zu Gas- oder Ölkesseln erreichen Wärmepumpen, insbesondere bei Erdwärme, die höchsten Effizienzklassen A++ und A+++. Gas- und Öl-Brennwertkessel erreichen gerade die Effizienzklasse A, während Niedertemperaturheizkessel auf Basis fossiler Brennstoffe auf den unteren Rängen zu finden sind.
Was für Wärmepumpen spricht
Zunächst soll noch einmal betont werden: Wärmepumpen sind keine neue Technologie. Ihre Wirkungsweise beruht – wie die des Kühlschranks – auf einem schon lange Zeit erprobten, verfeinerten und zuverlässigen technischen Prinzip von hoher LEBENSDAUER. Es ist also nur in sehr seltenen Fällen mit Störungen zu rechnen, gleichwohl sollten natürlich gewisse Wartungsintervalle eingehalten werden.
DAS ENERGIELABEL DER EUROPÄISCHEN UNION
Inzwischen verfügbare Langzeiterfahrungswerte weisen eine äußerst geringe Ausfallquote der Anlagen nach, was bedeutet, dass der ausführende Installationsbetrieb beziehungsweise Hersteller nicht zwingend aus der örtlichen Umgebung des Aufstellortes stammen muss; hier ist also freie Wählbarkeit garantiert.
Starke Anziehungskraft üben Wärmepumpen auf viele Menschen durch die Aussicht auf UNABHÄNGIGE ENERGIEVERSORGUNG aus – unabhängig von Energielieferanten, unabhängig von steigenden Energiepreisen, relativ unabhängig vom Vorhandensein endlicher fossiler Energieträger, – den Großteil des im System Wärmepumpe aufkommenden Energievolumens (etwa 75 Prozent) stellt die Umwelt selbst. Und je nach System sind im Sommer sogar passive und aktive Kühlung mit einer Wärmepumpe möglich (siehe ab Seite 58).
Weitere Vorteile fallen erst beim zweiten Blick auf: Wo nichts verbrannt wird, entfallen eben auch die jährlichen Abgasmessungen sowie Wartungsintervalle klassischer Verbrenneranlagen.
Gefahrenherde wie Gasleitungen oder der Öltank auf eigenem Grund und Boden gehören mit einer Wärmepumpe der Vergangenheit an. Auch ein Schornstein wird nicht mehr benötigt. Zusätzlicher Pluspunkt: Lagerkapazitäten für fossilen oder organischen Brennstoff werden ebenfalls nicht mehr gebraucht. Nahezu völlig emissionsfrei wird eine Wärmepumpe in Kombination mit einer PHOTOVOLTAIKANLAGE, über die der für den Betrieb notwendige Strom zur Verfügung gestellt wird.
Für Bauherren besonders interessant: Eine Wärmepumpe als Bestandteil der Energieversorgung des neuen Hauses ermöglicht problemlos die Einstufung in den EFFIZIENZHAUSSTANDARD – und eröffnet damit den Weg zu höchsten Fördersätzen (siehe Seite 76, 171). Aber auch wer im Bestand von einer Öl- oder Gasheizung auf eine effizientere Wärmepumpe umsteigen möchte, profitiert von umfangreichen Förderprogrammen. Zudem bedeutet dies eine Wertsteigerung des Hauses.
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE VON WÄRMEPUMPEN
Erprobte, ausgereifte Technologie
Weitgehende Unabhängigkeit: von Energielieferanten, steigenden Rohstoffpreisen, fossilen Energien
Etwa 75 Prozent der erforderlichen Energie können aus der Umwelt bezogen werden
Niedrige Betriebskosten
Sehr lange Lebensdauer (problemlos 20 Jahre und mehr)
Zusätzlich passive Kühlung mit Erdsonden, aktive Kühlung mit Luftwärmepumpen möglich
Wärmepumpen ermöglichen Effizienzhausstandard (Förderung)
Mögliche Probleme
Der wohl gewichtigste Nachteil von Wärmepumpen liegt im hohen ANSCHAFFUNGSPREIS; hier schlagen neben der technischen Apparatur hauptsächlich die Erdbohrungen zu Buche, zumindest wenn die Wärmeenergie zuverlässig aus dem Boden kommen soll, was der effizientesten Energiegewinnung in dieser Sparte entspricht. Zudem kann die Installation einer Wärmepumpe nicht durch Laien erfolgen. Hier müssen qualifizierte Fachleute ran.
Nachteilig wirken sich zudem verhältnismäßig hohe Warmwasser- und Vorlauftemperaturen aus, wie sie vor allem bei Konvektoren und Radiatoren erforderlich sind. Diese sorgen ebenso wie eine schlechte Wärmedämmung der energieführenden Leitungen für schlechte Arbeitszahlen und damit HOHE STROMKOSTEN, siehe dazu auch die umfangreiche Prüfliste „Was tun, wenn die Stromkosten zu hoch sind?“ auf Seite 202 im Serviceteil.
Einen ganz eigenen Aspekt bildet die mögliche Lärmbelästigung durch eine im Betrieb befindliche Wärmepumpe (das betrifft nicht die sehr leisen Sole-Wärmepumpen). Ist sie außen aufgestellt, können sich Nachbarn durch einen konstant tiefen Brummton in ihrer Ruhe gestört fühlen. Solche Probleme treten aber eher selten auf. Bislang sind die Gerichte oftmals geneigt, sich auf die Seite der Anlagenbetreiber zu schlagen, wie etwa ein exemplarisch vor dem Oberlandesgericht München verhandelter Fall aus dem Jahr 2020 zeigt (Aktenzeichen 3 U 3538/17). Allerdings lässt sich keine grundsätzliche Entscheidung aus diesem Einzelfall ableiten. In jedem Fall sollte eine mögliche Geräuschemission bei der Wahl des Aufstellorts berücksichtigt werden (siehe Seite 102).
Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass im Lauf der Zeit ein mögliches Risiko der AUSKÜHLUNG beispielsweise von Erdsonden besteht. Dadurch kann sich die Qualität der Wärmequelle verschlechtern, sodass sich der Energieertrag mit der Zeit verschlechtern kann. Auf die dauerhaft gleichbleibende Energiemenge aus dem Erdreich am speziellen Einsatzort kann niemand eine Garantie geben. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Verschlechterung ist jedoch gering.
DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE
Relativ hohe Anschaffungskosten
Hohes Fachwissen bei Installateuren erforderlich
Hohe Vorlauf- und Warmwassertemperaturen
Bei schlechter Wärmedämmung arbeiten Wärmepumpen nicht effizient
Eventuell Geräuschbelastung
Verschlechterung der Wärmequelle (zu geringe Auslegung, Auskühlung von Erdsonden)
Wo lassen sich Wärmepumpen aufstellen?
Ein besonderer Vorteil von Wärmepumpen besteht darin, dass sie grundsätzlich flexibel eingesetzt werden können. Ob als Außen- oder Innenaufstellung, im Keller, Dachgeschoss oder auf dem Dach – für jeden Ort gibt es Lösungen, um eine Wärmepumpe zu installieren. Bei der Standortwahl sollte man sich frühzeitig über die folgenden Aspekte Gedanken machen – und natürlich die in der jeweiligen Installationsanleitung genannten Punkte berücksichtigen:
Insbesondere im Bestand, aber auch beim Neubau, sind die Einbringmaße wichtig. Im Bestand sollten Sie besonders auf die vorhandene Raumhöhe und die geringste Türbreite achten, damit sich nicht zu spät herausstellt, dass die geplante Wärmepumpe gar nicht in den vorgesehenen Raum passt. Prüfen Sie rechtzeitig, ob eine Mindestraumgröße (beispielsweise nach Art und Menge des Kältemittels) vorgeschrieben ist! Bedenken Sie auch eventuelle spätere bauliche Veränderungen.
Je nach Typ und Leistungsgröße kann das Gewicht der Wärmepumpe und der Speicher mehrere Hundert Kilogramm betragen. Es muss gewährleistet sein, dass der vorgesehene Untergrund tragfähig ist.
Insbesondere bei einer Außenaufstellung, aber auch bei der Aufstellung im eigenen Haus, müssen eventuelle Schallemissionen berücksichtigt werden (siehe Seite 102). Außen aufgestellte Luft-Wärmepumpen brauchen einen Anfahrschutz. Bei Luft-Wärmepumpen muss zudem ein frostfreier Kondensatablauf garantiert sein.
In der unmittelbaren Umgebung der Wärmepumpe muss genug Platz für eine komfortabele Bedienung und für Wartungsarbeiten bleiben, eventuelle Schutzbereiche und Sicherheitsabstände (zum Beispiel bei brennbaren Kältemitteln) sind zu berücksichtigen.
Gegebenenfalls ist eine bestimmte Entfernung zu Medienanschlüssen zu gewährleisten, Sole/Wasser-Wärmepumpen müssen wegen der Gefahr der Tauwasserbildung nahe am Eingang der Soleleitungen platziert werden.
Kennzahlen verstehen: Um einschätzen zu können, welche Wärmepumpe für den eigenen Bedarf am besten geeignet ist, ist das Wissen um die wichtigsten Kennzahlen elementar.
WAS ERFAHRE ICH?
Leistungszahl / Coefficient of Performance (COP)
Die Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl ermitteln und überwachen
Welche Jahresarbeitszahl kann erreicht werden?
Leistungszahl / Coefficient of Performance (COP)
Um Wärmepumpen miteinander vergleichen zu können, muss man die Leistungszahl COP (Coefficient of Performance) – bisweilen auch nur als Leistungszahl bezeichnet – unter definierten Betriebspunkten kennen und verstehen. Um die Leistungszahlen zu garantieren, lassen Hersteller ihre Wärmepumpen in unabhängigen Testzentren (TÜV, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Wärmepumpentestzentrum Chur/Schweiz …) nach gültigen Prüfbedingungen (früher EN 255, heute DIN EN 14511) im Labor testen. Die PRÜFSTELLE kontrolliert die vom Hersteller angegebenen COP-Werte und die Schallleistung. Erfüllt die Wärmepumpe die Anforderungen bezüglich der Effizienz und der geforderten Dokumentationen, wird ein entsprechendes Gütesiegel erteilt.
Neben dem Europäischen Gütesiegel gibt es das Keymark-Gütesiegel als freiwilliges, unabhängiges europäisches Zertifizierungszeichen (ISO Typ 5) für Wärmepumpen, welches unter den Anwendungsbereich der Ökodesignverordnung der Europäischen Kommission fällt.
Die Leistungszahl (LZ) ist der Quotient aus erzeugter Wärmeleistung (kW) und der aufgenommenen elektrischen Leistung (kW) als Momentaufnahme. Als Faustregel kann man sich merken: Je höher die Leistungszahl (oder der COP), desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Die Leistungszahl wird je nach Wärmepumpentyp unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt:
Sole/Wasser-Wärmepumpe bei B 0/W 35: B 0 steht für 0 Grad Celsius Soletemperatur und W 35 für eine Vorlauftemperatur von 35 Grad Celsius.
Wasser/Wasser-Wärmepumpe bei W 10/W 35: W 10 entspricht einer Wassertemperatur von 10 Grad Celsius und W 35 steht für 35 Grad Celsius Vorlauftemperatur.
LEISTUNGSZAHL(inkl. Pumpenleistungsanteil)
Quelle: Max Weishaupt GmbH
Leistungszahl in Abhängigkeit von Vorlauftemperatur und Außentemperatur.
Luft/Wasser-Wärmepumpe bei A 2/W 35: Dabei steht A 2 für eine Lufttemperatur von plus 2 Grad Celsius und W 35 für eine Vorlauftemperatur von 35 Grad Celsius.
Mit Inkrafttreten der Energy-related-Product-Richtlinie (ErP) wurde zusätzlich zu der auf nur einen Punkt ausgerichteten Leistungszahl COP die SAISONALE LEISTUNGSZAHL SCOP eingeführt. Mit der Leistungsmessung bei vier unterschiedlichen Temperaturen können leistungsgeregelte Inverter-Wärmepumpen auch im Teillastbetrieb entsprechend bewertet werden. Während die Leistungszahl von On/off-Wärmepumpen nur auf einen Betriebspunkt bezogen ist (bei Luft-Wärmepumpen auf A 2/W 35), wird sie bei Inverter-Wärmepumpen hingegen aus mehreren Betriebspunkten ermittelt. Luft-Wärmepumpen werden bei den festgelegten Arbeitspunkten A 7/W 35; A 2/W 35; A -7/W 35 und A -10/W 35 getestet. Außerdem wird beim SCOP die Leistung der elektrischen Zusatzheizung mit erfasst.
VORSICHT BEIM VERGLEICH DER LEISTUNGSZAHL!
Die Leistungszahlen bei Luft-Wärmepumpen werden normalerweise beim Arbeitspunkt A 2/W 35 verglichen. Bei entsprechenden Vergleichen ist jedoch besondere Aufmerksamkeit geboten, da manche Hersteller in ihren Prospekten nur die Leistungszahl für A 7/W 35 angeben.
Interessant an dieser Stelle ist bei Luft-Wärmepumpen der Verlauf der Leistungszahl bei Außentemperaturen mit Minusgraden. Hier lässt sich ablesen, dass bei den meisten Luft-Wärmepumpen in diesem Bereich die Leistungszahlen mit abnehmender Lufttemperatur relativ stark nachlassen. Ebenso verschlechtern sich die Leistungszahlen mit steigender Vorlauftemperatur. Je geringer der Temperaturhub von der Wärmequelle zur Wärmesenke ist, umso besser ist die Leistungszahl.
Die Leistungszahl ist jedoch nur eine Momentaufnahme unter definierten Arbeitspunkten und beschreibt die Effizienz der Wärmepumpe unter den Bedingungen am Prüfstand. Sie kann deshalb von einem Laien in der Praxis kaum exakt nachgeprüft werden.
Die Jahresarbeitszahl
Maßgeblich für die Bewertung der Effizienz einer Wärmepumpenanlage ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie bezeichnet das Verhältnis der über das Jahr von der Wärmepumpenanlage erzeugten Wärmemenge zur Menge der von der Anlage verbrauchten Elektroenergie. Beispiel: Wird in einem gut gedämmten Eigenheim viel warmes Wasser von 50 Grad Celsius verbraucht, sinkt die Gesamt-Jahresarbeitszahl, auch wenn sich für die Heizung mit maximal 35 Grad Celsius Vorlauf eine gute Arbeitszahl von über 4 ergibt.
Die Jahresarbeitszahl wird im Unterschied zum Coefficient of Performance (COP) nicht im Labor, sondern INDIVIDUELL UNTER REALEN BEDINGUNGEN ermittelt. Sie berücksichtigt im Unterschied zum COP je nach Bilanzgrenze (siehe nächste Seite und Abbildung unten) – also unter Einbeziehung der aufgewendeten Hilfsenergien für außen liegende Umwälzpumpen, Mischer und ähnliches – weitere Systemkomponenten und wird durch eine Reihe von Faktoren wie zum Beispiel das Nutzerverhalten, die Klimazone und die Warmwasserbereitung beeinflusst. Daher kann sie auch erst nach Kauf und Einbau der Wärmepumpe bestimmt werden und ist abhängig vom Betrachtungszeitraum. Im Wärmepumpenregler wird sie permanent fortgeschrieben, deshalb steht dort im Display „Arbeitszahl Heizbetrieb“, „Arbeitszahl Warmwasserbetrieb“, „Gesamt-Arbeitszahl“. Beläuft sich der Betrachtungszeitraum auf ein Jahr, erhält man die Jahresarbeitszahl (JAZ).
Sie wird wie folgt berechnet:
Beispiel: Werden mit der Wärmepumpe 20 000 kWh/a Wärmeenergie erzeugt und am Stromzähler eine elektrische Arbeit von 5 000 kWh/a abgelesen, dann ergibt sich eine Jahresarbeitszahl von 4.
Die erzeugte Wärmemenge wird meist im Wärmepumpenregler angezeigt, für den Stromverbrauch gibt es einen Sonderstromzähler. Falls kein separater Stromzähler für die Wärmepumpe vorhanden ist, sollte man unbedingt einen geeichten Unterzähler einbauen lassen. Wichtig dabei ist, dass alle weiteren Verbraucher, etwa Heizstäbe und Ähnliches, mit erfasst werden. Manchmal sind die Elektroheizeinsätze auch an andere Stromzähler angeklemmt. Bei Vergleichen gilt es deshalb, die BILANZGRENZEN mit zu beachten.
SYSTEMGRENZE FÜR DIE BERECHNUNG DER ARBEITSZAHLEN
Quelle: Fraunhofer Institut
Bilanzgrenzen zur Berechnung der Arbeitszahl
MINDESTEFFIZIENZWERTEder Wärmepumpenarten
Typ
SCOP
Sole / Wasser
4,1
Wasser / Wasser
4,1
Luft / Wasser
3,5
Luft / Luft
3,4
Direktverdampfung / Wasser
4,1
Die Mindesteffizienzwerte beziehen sich auf Average-Climate- und Niedrig-Temperatur-Anwendungen. Für Brauchwasserwärmepumpen gibt es keine Mindesteffizienzanforderungen.
Die Grafik auf der vorhergehenden Seite zeigt im gelben Rahmen die Wärmepumpe inklusive der Solepumpe. Hier wird der Stromverbrauch des Verdichters, des Wärmepumpenreglers und der Soleumwälzpumpe über den Stromzähler erfasst. Im grünen Rahmen werden über Wärmemengenzähler die erzeugten Wärmemengen für Heizung und Warmwasser gemessen und erfasst. Die Zubringerpumpe, die Heizungsumwälzpumpe und die Zirkulationspumpen werden somit bei dieser Bilanzgrenze nicht mit in die Berechnung der Arbeitszahl einbezogen. Bei Vergleichen müssen deshalb genau diese Bilanzgrenzen berücksichtigt werden.
Separate Wärmemengen- und Stromzähler sind übrigens genauso eine Voraussetzung für die WÄRMEPUMPENFÖRDERUNG durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wie die Tatsache, dass die zu fördernde Wärmepumpe in der Liste der förderfähigen Wärmepumpen des Bafa enthalten sein muss.
In vielen Wärmepumpenreglern werden die Arbeitszahlen für die Heizung, die Warmwasserbereitung und die Gesamtarbeitszahl direkt ausgewiesen.
ACHTUNG: Die Leistungszahl und die Jahresarbeitszahl werden relativ häufig verwechselt. So passiert es des Öfteren, dass, wenn beispielsweise für eine Sole/Wasser-Wärmepumpe die Leistungszahl bei B 0/W 35 mit 4,8 angegeben ist, automatisch angenommen wird, dass auch die Jahresarbeitszahl 4,8 beträgt. Das ist zwar theoretisch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Möglich wäre es zum Beispiel nur, wenn die Quellentemperatur wesentlich höher als üblich ist, was bei stark von fließendem Wasser umströmten Erdsonden vorkommen kann.
Jahresarbeitszahl ermitteln und überwachen
Es empfiehlt sich, die Arbeitszahlen für Heizung und Warmwasser über bestimmte Zeiträume, zum Beispiel monatlich, zu ermitteln beziehungsweise abzulesen und mit den Vorjahreswerten zu vergleichen. Dabei ist zu beachten, dass die Gesamtarbeitszahlen je nach Jahreszeit und Warmwasserbedarf variieren. So ist es vollkommen normal, dass die Arbeitszahl in den Sommermonaten schlechter ist als in der Heizperiode, da bei steigender Vorlauftemperatur für die Warmwasserbereitung die Leistungszahl und folglich die Arbeitszahl sinkt. Für die Warmwasserbereitung fährt die Wärmepumpe bei Warmwassertemperaturen von 50 Grad Celsius immer mindestens mit 55 Grad Celsius Vorlauf oder ihrer maximalen Vorlauftemperatur von 62 oder 65 Grad Celsius. Dadurch wird die Arbeitszahl schlechter. Bei Vergleichen muss deshalb die erzeugte Menge warmes Wasser mit herangezogen werden.
Mit der regelmäßigen Ermittlung und Kontrolle der Arbeitszahl kann man bösen Überraschungen vorbeugen, wie folgendes Beispiel verdeutlichen soll:
Tritt im Kältekreis ein kleines Leck auf, durch das ein wenig Kältemittel kontinuierlich entweicht, so kann die Wärmepumpe unter Umständen trotzdem noch einige Monate weiterarbeiten, bevor sie auf Niederdruckstörung geht. Sie arbeitet dann bei schleichendem Kältemittelverlust mit weniger Heizleistung weiter, ohne dass der Betreiber dies unmittelbar registriert. Der Stromverbrauch der Wärmepumpe steigt, und bei der Energieabrechnung fällt auf, dass der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher liegt. Erst dann läuten die Alarmglocken, also reichlich spät. Hätte der Betreiber dieser Anlage die Arbeitszahl regelmäßig überprüft und mit den Vorjahresergebnissen verglichen, wäre ihm schon viel eher aufgefallen, dass sich die Arbeitszahl verschlechtert und mit der Anlage irgendetwas nicht stimmt.
Die Jahresarbeitszahl lässt sich nach dem Verfahren der VDI 4650 Blatt 1: 2019–03 mit verschiedenen Softwareprogrammen unter bestimmten Kriterien (wie Wärmepumpentyp, Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Warmwassertemperatur, Warmwassermenge, Betriebsweise …) für eine Wärmepumpenanlage vorausberechnen. Leicht handhabbar ist hier etwa der Jahresarbeitszahlrechner des Bundesverbandes Wärmepumpe. Im Ergebnis werden die Jahresarbeitszahlen für den Heizbetrieb, die Warmwasserbereitung und die Gesamtarbeitszahl ausgewiesen.
JAHRESARBEITSZAHLEN (JAZ) DER WÄRMEPUMPENARTEN IM VERGLEICH
Die im Praxisbetrieb gemessene Arbeitszahl liegt in der Regel niedriger als die berechnete Arbeitszahl.
Mit der im Voraus ermittelten rechnerischen Jahresarbeitszahl kann man Unterschiede bei den Wärmepumpentypen und Anlagenkonzeptionen ermitteln. Da sich in der Praxis entsprechend dem Nutzungsverhalten (Raumtemperatur, Warmwassermenge, Lüftungsverhalten etc.) unterschiedliche tatsächliche Bedingungen ergeben, weicht die in der Praxis ermittelte Jahresarbeitszahl in der Regel von der RECHNERISCHEN JAHRESARBEITSZAHL ab.
Welche Jahresarbeitszahl kann erreicht werden?
Der Tabelle auf Seite 23 können Sie mit dem Jahresarbeitszahlrechner des Bundesverbandes Wärmepumpe ermittelte Jahresarbeitszahlen für bestimmte Wärmepumpenarten und verschiedene Vorlauftemperaturen entnehmen.
Die Tabelle zeigt, welche Jahresarbeitszahlen mit den verschiedenen Wärmequellen rein rechnerisch erreicht werden können. Sie dient als ENTSCHEIDUNGSHILFE für die Auswahl der Wärmequelle und der Heizflächen mit den entsprechenden Vorlauftemperaturen. Klar zu erkennen ist, dass mit Wasser/Wasser-Wärmepumpen und Sole/Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) rein rechnerisch die besseren Ergebnisse erzielt werden können.
Bei der Berechnung wurde im Bestand von der gesamten Wärmeerzeugung ein üblicher Warmwasseranteil von 18 Prozent angesetzt. Da sich im Neubau durch die geringe spezifische Heizlast das Verhältnis von Wärmebedarf für die Heizung und Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung je nach Art des Gebäudes um bis zu 50 Prozent verschieben kann, wurde hier mit einem Warmwasseranteil von 30 Prozent gerechnet.
Für die Warmwassertemperatur wurden überall 50 Grad Celsius angesetzt, da 60 Grad Celsius nur unter Hinzunahme des Elektroheizstabes oder wie unter 3. mit Hochtemperatur-Wärmepumpen erreicht werden können. Bei der Wasser/Wasser-Wärmepumpe wurde jede Variante mit und ohne ZWISCHEN-WÄRMEÜBERTRAGER (im alltäglichen Sprachgebrauch auch Zwischen-Wärmetauscher, ZWT, genannt) gerechnet. Hier ist deutlich zu erkennen, dass die Effizienz durch den Einsatz eines Zwischen-Wärmeübertragers deutlich sinkt. Grundsätzlich gilt hier: Werden die Anforderungen an die Wasserqualität für eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe nicht erfüllt, ist es gegebenenfalls besser, eine Wärmepumpe mit Erdkollektor einzusetzen.
Das Ergebnis in der Tabelle wird nur in den wenigsten Fällen mit den im Praxisbetrieb der Anlage gemessenen Werten übereinstimmen oder besser sein, da bestimmte Einflussfaktoren wie das Nutzerverhalten, die Jahresmitteltemperatur, die entnommene Warmwassermenge und andere Parameter im Alltag von den Eingabewerten abweichen können.
MERKE: Die im Praxisbetrieb gemessene Arbeitszahl liegt in der Regel niedriger als die berechnete Arbeitszahl mit angenommenen Eingabewerten. Der Hersteller gibt keine Arbeitszahlen an, sondern nur Leistungszahlen oder saisonale Leistungszahlen. Er kann keine Arbeitszahlen garantieren, weil sie zu großen Teilen vom Betreiber beeinflussbar sind.
HIER GEHT ES WEITER:WAERMEPUMPE.DE/JAZRECHNER





























