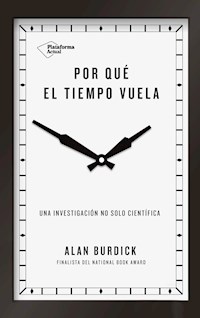8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»In dieser klarsichtigen, umsichtigen und wunderbar geschriebenen Erkundung der Zeit bietet Burdick nicht weniger als eine völlig neue Sichtweise darauf, was es heißt, Mensch zu sein.« Hanya Yanagihara, Autorin von "Ein wenig Leben"
Die Zeit kann dahinkriechen oder rasend schnell verfliegen. Wir wünschen uns alle Zeit der Welt und wissen doch, dass sie irgendwann abläuft. Über Zeit zu sprechen heißt, in Bildern zu sprechen. Denn was genau ist Zeit? Erlebt ein Kind sie so wie ein Erwachsener? Warum fließt sie zäh wie Honig dahin, wenn wir uns langweilen, und zerrinnt im Alter wie Sand zwischen den Fingern? Warum und wie verfliegt die Zeit?
In seiner ebenso leichtfüßigen wie tiefgreifenden Erkundung sucht Alan Burdick nach dem Uhrwerk, das in uns allen tickt. Ein Jahrzehnt lang hat er die wissenschaftliche Forschung über unsere Wahrnehmung von Zeit verfolgt und dabei die genaueste Uhr der Welt besucht (die nur auf dem Papier existiert), herausgefunden, das "jetzt" tatsächlich den Bruchteil einer Sekunde her ist, in der Arktis gelebt, um jegliches Zeitgefühl zu verlieren und, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment, in einem Labor den Fluss der Zeit umgekehrt.
Ein größtenteils wissenschaftliches, mitreißend persönliches und faszinierendes Buch über unsere lebenslange Beziehung mit der Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Die Zeit kann dahinkriechen oder rasend schnell verfliegen. Wir wünschen uns alle Zeit der Welt und wissen doch, dass sie irgendwann abläuft. Über Zeit zu sprechen heißt, in Bildern zu sprechen. Denn was genau ist Zeit? Erlebt ein Kind sie so wie ein Erwachsener? Warum fließt sie zäh wie Honig dahin, wenn wir uns langweilen, und zerrinnt im Alter wie Sand zwischen den Fingern? Warum und wie verfliegt die Zeit?
Ein größtenteils wissenschaftliches, bemerkenswert persönliches und faszinierendes Buch über unsere lebenslange Beziehung mit der Zeit.
Zum Autor
Alan Burdick schreibt für den New Yorker, wo er bereits als leitender Redakteur tätig war. Sein erstes Buch Out of Eden wurde für den National Book Award nominiert und vom Overseas Press Club ausgezeichnet. Seine Arbeiten erschienen u. a. in GQ, Harper’s, Outside und der Anthologie Best American Science and Nature Writing. Burdick ist Guggenheim Fellow und Namensgeber des Asteroiden Nr. 9291, er lebt mit seiner Familie in der Nähe von New York.
ALAN BURDICK
WARUM DIE ZEIT
VERFLIEGT
EINE GRÖSSTENTEILS
WISSENSCHAFTLICHE ERKUNDUNG
AUS DEM ENGLISCHEN
VON YVONNE BADAL
BLESSING
Originaltitel: Why Time Flies – A Mostly Scientific Investigation
Originalverlag: Simon and Schuster, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bildnachweise: Alle Illustrationen stammen von Stephen Burdick Design, mit Ausnahme von:
Mit freundlicher Genehmigung von Ernst Pöppel, from Mindworks:
Time and Conscious Experience:[[››]], [[››]]
Mit freundlicher Genehmigung von Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: [[››]]
Mit freundlicher Genehmigung von Trustees of the Boston Public Library/Rare Books: [[››]]
Mit freundlicher Genehmigung von Lauren Peters-Collaer: [[››]], [[››]], [[››]], [[››]]
Copyright © 2017 by Alan Burdick
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, nach einem Entwurf von Lauren Peters-Collaer
Umschlagabbildung (Rahmen): Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-22052-5V001
www.blessing-verlag.de
Für Susan
Ich bekenne dir, Herr, dass ich immer noch nicht weiß, was Zeit ist. Und zugleich bekenne ich dir, dass ich weiß, dass ich dies in der Zeit ausspreche, dass ich hier schon lange über die Zeit spreche und dass dieses ›lange‹ nichts anderes ist als eine Zeitspanne.
Augustinus, Bekenntnisse
Eines der Mädchen erfand eine Methode, Couverts zu stempeln, mit der sie hundert bis hundertzwanzig pro Minute abarbeiten konnte. […] Wir wissen nicht, welche Prozesse im Zuge der Entwicklung dieser Methode abgelaufen waren, denn als das Mädchen ihre Gedanken umsetzte, machte der Autor Ferien.
Frank Gilbreth, Motion Study: A Method for Increasing the Efficiency of the Workman
INHALT
VORWORT
VORAB GESAGT
DIE STUNDEN
DIE TAGE
DIE GEGENWART
WARUM DIE ZEIT VERFLIEGT
DANK
BIBLIOGRAFIE
VORWORT
Literatur über die Zeit steht in Hülle und Fülle zur Verfügung. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte haben Denker ihre Ideen dazu vorgebracht, viele wohlbedacht, andere anekdotisch oder provokativ, doch bis vor Kurzem nur relativ wenige aus wissenschaftlicher Sicht. Auf die Gefahr hin, zugleich jedoch mit dem ausdrücklichen Ziel, dabei große Schneisen philosophischer und religiöser Gedanken zu ignorieren, fokussiere ich mich hier im Wesentlichen auf Forschungen, die das menschliche Verhältnis zur Zeit mithilfe von Experimenten ergründen – und solche Studien werden ernsthaft erst seit ungefähr eineinhalb Jahrhunderten betrieben. Ich entschloss mich dazu im vollen Bewusstsein, dass selbst wohlgemeinte Experimente dürftig konzipiert sein können oder uneindeutige bis widersprüchliche Ergebnisse hervorbringen oder jeweils nur so kleine Aspekte unserer Zeiterfahrungen ansprechen, dass die Forscher kaum selbst noch beurteilen können, ob ihre Erkenntnisse wirklich übertragbar sind auf die Zeit jenseits all der Labore, in denen sie erdacht wurden.
Hinzu kommt, dass allein schon die Literatur dieser experimentierenden Untergruppe voluminös ist. Gleich zu Beginn meiner Recherchen begegnete ich dem Lebenswerk des amerikanischen Philosophen Julius T. Fraser, der wohl bedeutendsten Autorität auf dem Gebiet der interdisziplinären Zeitforschung. 1966 gründete er die International Society for the Study of Time, die im Dreijahresrhythmus Konferenzen veranstaltete und Geistesgrößen aller Couleur zusammenbrachte, ob Physiker, kantische Philosophen, Mittelalterhistoriker, Neurobiologen, Anthropologen oder Proust-Gelehrte. Peu à peu versammelte Fraser die ebenso eklektischen wie scharfsinnigen Abhandlungen dieser Denker in einer zehnbändigen Reihe unter dem Titel The Study of Time, daneben schrieb und edierte er viele weitere Werke, darunter Time, the Familiar Stranger und The Voices of Time: A Cooperative Survey of Man’s View of Time as Expressed by the Humanities. Der Dichter und Universalgelehrte Frederick Turner nannte Fraser einmal bewundernd »eine Kombination aus Einstein, Yoda, Gandalf, Dr. Johnson, Sokrates, dem Alten Testament, Gott und Groucho Marx«. Ich wusste, dass Fraser sich inzwischen nach Connecticut zurückgezogen hatte, doch bis ich schließlich genügend von ihm gelesen hatte, um zuversichtlich genug in Kontakt mit ihm treten zu können, war er im Alter von siebenundachtzig gestorben.
Dieses Buch darf nicht mit einer Enzyklopädie der Zeit verwechselt werden (wovon es zumindest zwei gibt: die eine, 1994 veröffentlicht, ist siebenhundert Seiten lang und wiegt drei Pfund; die andere erschien 2009, ist sechzehnhundert auf drei Bände verteilte Seiten lang und wiegt elf Pfund), denn ich kann Ihnen garantieren, dass die kommenden Seiten gewiss nicht jede Ihrer dringlichsten Fragen über die Zeit beantworten werden. Im Interesse des Lesers wie des Autors habe ich mich auf das beschränkt, was mir menschenmöglich schien – auf einen kurzen Überblick über die Erkenntnisse der Disziplinen und Zeitstudien, die mich, und insofern vielleicht auch Sie, am meisten interessieren. Leser, die nach weiterführenden Lektüren zum Thema Ausschau halten, finden im Anhang meine Hauptquellen aufgelistet. Folge dem weißen Kaninchen.
VORAB GESAGT
In manchen Nächten – neuerdings häufiger, als mir lieb ist – werde ich vom Geräusch der Nachttischuhr geweckt. Das Zimmer ist dunkel und konturlos, und in dieser Dunkelheit dehnt sich der Raum derart aus, dass ich mir vorkomme wie draußen unter einem endlos leeren Himmel und zugleich in einer riesigen unterirdischen Höhle. Ich könnte gerade durch den Raum fallen. Oder träumen. Oder tot sein. Nur die Uhr bewegt sich mit gleichförmigem Tick-tack voran, gemächlich, unerbittlich. In diesen Momenten wird mir auf klarste und schaurigste Weise deutlich, dass die Zeit sich nur in eine Richtung bewegt.
Am Anfang, oder kurz davor, gab es keine Zeit. Nach Aussage der Kosmologen begann das Universum vor fast vierzehn Milliarden Jahren mit einem Big Bang, dehnte sich aus, erreichte beinahe sofort seine gegenwärtigen Ausmaße und expandiert seither schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Davor war nichts: keine Masse, keine Materie, keine Energie, keine Schwerkraft, keine Bewegung, keine Veränderung. Keine Zeit.
Vielleicht können Sie sich das ja vorstellen. Ich kann es nicht. Mein Hirn verweigert sich dieser Idee und stellt mir stattdessen inquisitorische Fragen: Woher kam das Universum? Wie entsteht etwas aus nichts? Ich will mal rein rhetorisch davon ausgehen, dass vor dem Big Bang tatsächlich nichts existiert hat – aber es explodierte doch etwas inetwas hinein, nicht wahr? Was war das? Was war vor dem Anfang da?
Solche Fragen zu stellen, sagte der Astrophysiker Stephen Hawking einmal, sei wie am Südpol zu stehen und zu fragen, welche Richtung Süden ist: »Frühere Zeiten werden nicht definiert.« Vielleicht will Hawking uns beruhigen, aber letztendlich sagt er damit doch nur, dass die menschliche Sprache Grenzen hat. Wir (jedenfalls wir Übrigen) stoßen jedes Mal an diese Grenze, wenn wir über das Kosmische nachsinnen. Unsere Vorstellungskraft funktioniert durch Analogie und Metapher, mit deren Hilfe wir das Fremdartige und Unermessliche mit dem Vertrauten und Kleinen vergleichen: Das Universum ist eine Kathedrale, ein Uhrwerk, ein Ei. Doch solche Gleichnisse hinken. Nur ein Ei ist ein Ei. Uns gefallen diese Analogien, weil sie das Universum in erfahrbare, fassbare Bestandteile aufgliedern. In sich sind diese Begriffe autark – aber sie können nicht den Behälter beinhalten, der sie beinhaltet.
Genauso ist es mit Zeit. Wann immer wir über sie sprechen, tun wir das mit Begriffen für etwas Geringeres. Wir finden oder verlieren Zeit wie einen Schlüsselbund; wir sparen und vergeuden Zeit wie Geld. Zeit kriecht, fliegt, flieht, zerrinnt, steht still, ist noch reichlich vorhanden oder wird knapp. Sie lastet auf uns mit spürbarem Gewicht. Glocken schlagen einen »kurzen« oder »langen« Ton an, so als ließe sich die Dauer ihres Klangs mit einem Lineal bestimmen. Die Kindheit entschwindet und Deadlines rücken näher, so als erblickten wir Zeit wie eine Landschaft. Zwei Amerikaner, der Linguist George Lakoff und der Philosoph Mark Johnson, haben in einem gemeinsamen Buch ein Gedankenexperiment vorgeschlagen: Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und versuchen Sie einmal, Zeit strikt als das zu thematisieren, was sie ist, bar jeder Metapher. Sie werden sehen, dass Sie aufgeschmissen sind. »Wäre Zeit noch Zeit für uns, wenn wir sie nicht verschwenden oder verplanen könnten?«, fragten sie sich. »Das können wir uns nicht vorstellen.«
Beginne mit einem Wort, so wie Gott es tat, drängt Augustinus seine Leser: »Also hast du gesprochen, und es wurden die Dinge. In deinem Wort hast du sie gemacht.«1
Wir schreiben das Jahr 397. Augustinus ist dreiundvierzig, hat ergo die Mitte seines Lebens bereits überschritten. Er ist Bischof von Hippo, der römischen Küstenstadt in Nordafrika, und fühlt sich überfordert. Er hat bereits Dutzende Bücher geschrieben – Philosophisches und Autobiografisches, Gelehrtes gegen seine theologischen Feinde – und ist gerade mit der Niederschrift seiner Confessiones (Bekenntnisse) befasst, ein seltsames, aber fesselndes Werk. In den ersten neun der dreizehn Kapitel berichtet er von Schlüsselerlebnissen aus seiner Kindheit und als junger Mann bis hin zu seinem Übertritt zum Christentum im Jahr 386 und dem Tod seiner Mutter im anschließenden Jahr. Er bekennt seine Verfehlungen, darunter Diebstahl (er schüttelte Früchte vom Birnbaum des Nachbarn), Astrologie, Wahrsagerei, Aberglaube, Freude am Theater und Unzucht. (In Wirklichkeit lebte Augustinus fast sein Leben lang monogam, zuerst mit einer Gefährtin und, nach einer arrangierten Hochzeit, mit seiner Ehefrau, dann wurde er keusch.)
Die restlichen vier Kapitel unterscheiden sich vollständig. Sie sind erweiterte Meditationen über – in aufsteigender Reihe – das Gedächtnis, die Zeit, die Ewigkeit und die Schöpfung. Offen spricht er von seinem mangelnden Wissen über das Göttliche und die natürliche Ordnung, und verbissen strebt er nach Erkenntnis. Seine Art, zu Schlussfolgerungen zu gelangen, seine introspektiven Methoden, sollten noch Jahrhunderte später die Philosophen beeinflussen, ob Descartes (dessen cogito ergo sum – »Ich denke, also bin ich« – das Echo von Augustinus’ dubito ergo sum ist – »Ich zweifle, also bin ich«) oder Heidegger oder Wittgenstein. Und auch er rang mit dem Anfang:
Sieh, das ist meine Antwort, wenn jemand fragt: »Was machte Gott, bevor er Himmel und Erde machte?« Ich antworte nicht wie der, der mit einem Witzwort der harten Frage ausweichen wollte und der gesagt haben soll: »Er baute eine Hölle für Leute, die zu hohe Dinge erforschen wollen.«2
Augustinus’ Bekenntnisse werden oft als die erste echte Autobiografie bezeichnet – eine selbst erzählte Geschichte über die Entwicklung und Wandlung des Selbst im Lauf der Zeit. Auf mich wirken sie eher wie Memoiren über die Möglichkeiten des Ausweichens. In den ersten Kapiteln klopft das Göttliche an, aber Augustinus antwortet nicht. Er zeugt einen unehelichen Sohn; während seines Rhetorikstudiums in Karthago umgibt er sich mit einer aufrührerischen Gruppe von Freunden, die er »die Umstürzler« nennt; seine fromme Mutter quälte sich seines ausschweifenden Lebensstils wegen. Später im Buch nennt er diese Phase seines Lebens ein »zerteilendes Ausdehnen«.3 Die Bekenntnisse offenbaren etwas, das uns eine durch und durch moderne Idee scheint – sie ist jedem vertraut, der sich mit Psychotherapie auskennt: Augustinus bewies, dass die diffusen Bruchstücke der eigenen Vergangenheit sich zu einer sinnvollen Gegenwart gestalten lassen. Deine Erinnerungen sind allein die deinen, durch sie kannst du eine neue eigene Geschichte gestalten, die dich erleuchtet und definiert.
So kann ich frei werden vom Vergangenen und dem Einen folgen. Ich kann das Gewesene vergessen. Statt mich im Blick auf das zukünftig Vergängliche zu zerspalten, strecke ich mich aus nach dem, was vor mir ist …4
Das ist Autobiografie als Selbsthilfe. Bekenntnisse ist ein Werk über vieles, vor allem aber über Worte und ihre mögliche erlösende Wirkung in der Zeit.
Lange Zeit war Zeit für mich etwas, dem ich mit aller Mühe zu entgehen versuchte. Zum Beispiel weigerte ich mich die längste Zeit meines Lebens, eine Uhr zu tragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es zu dieser Entscheidung gekommen war; ich erinnere mich nur vage daran, einmal gelesen zu haben, dass Yoko Ono niemals eine Uhr trägt, weil ihr die Vorstellung, Zeit am Handgelenk festzuzurren, verhasst ist. Das leuchtete mir ein. Zeit schien mir ein von außen auferlegtes und deshalb repressives Phänomen zu sein – und damit etwas, das ich meiner freien Entscheidung nach von meiner Person fernhalten oder irgendwo zurücklassen konnte.
Zunächst verschaffte mir diese Vorstellung ein tiefes Glücksgefühl und Erleichterung, wie so häufig der Fall, wenn man rebelliert. Aber natürlich bedeutete es auch, dass ich mich, wenn ich auf dem Weg zu einer Verabredung war, nicht etwa außerhalb der Zeit befand, sondern ihr schlicht und einfach hinterherhinkte. Ich kam zu spät. Ich konnte mir die Zeit dermaßen versiert vom Leib halten, dass es lange dauerte, bis ich überhaupt begriff, dass ich es tat. Dieser Erkenntnis folgte schnell die nächste: Ich vermied Zeit, weil ich sie insgeheim fürchtete. Die Vorstellung, Zeit sei etwas rein Äußerliches, schenkte mir ein Gefühl von Kontrolle, so als sei sie etwas, in das ich mich beliebig hineinbegeben und aus dem ich beliebig wieder heraustreten konnte. Sie erweckte das Bild eines Flusses, durch den ich waten und aus dem ich jederzeit wieder ans Ufer treten konnte, oder das eines Laternenpfahls, um den ich einfach herumlaufe. Doch tief im Inneren spürte ich die Wahrheit: Zeit war – ist – in mir, in uns. Sie ist da, vom Moment des Erwachens bis zum Moment des Einschlafens, sie erfüllt die Luft, sie durchdringt Geist und Körper, sie kriecht durch deine Zellen, durch jede Sekunde deines Lebens, und sie wird weiter voranschreiten, noch lange nachdem sie jede deiner Zellen verlassen hat. Ich fühlte mich infiziert. Und doch konnte ich nicht sagen, woher Zeit kam, geschweige denn, wohin sie ging – und weitergeht und weiterhin pausenlos versickert. Wie bei so vielem, das man fürchtet, ohne zu wissen, was es ist, hatte ich keine Ahnung, was Zeit eigentlich ist. Derweil führte mich die Findigkeit, mit der ich ihr zu entgehen versuchte, immer weiter weg von jeder möglichen Antwort.
Also begab ich mich eines schönen Tages, der inzwischen länger zurückliegt, als es mir lieb ist, auf eine Reise durch die Welt der Zeit. Ich wollte sie verstehen – wollte wie Augustinus fragen: »Aber woher kommt sie, wohindurch geht sie, wohin verschwindet sie …?«5 Die physikalischeren und mathematischeren Aspekte von Zeit werden unter den großen Geistern der Kosmologie nach wie vor debattiert, was mich jedoch interessierte, und was die Wissenschaft erst seit Kurzem peu à peu enthüllt, ist die Frage, wie Zeit sich in der Biologie manifestiert. Wie interpretieren Zellen und die subzelluläre Maschinerie Zeit? Wie sickert diese Erzählung nach oben in die Neurobiologie, die Psyche, in das Bewusstsein unserer Spezies ein? Als ich mich aufmachte, die Welt der Zeitforschung zu bereisen und viele ihrer -ologen aufzusuchen, erhoffte ich mir Antworten auf Fragen, die mich, wie vielleicht auch Sie, schon lange quälen. Zum Beispiel: Wieso scheint uns Zeit in der Kindheit in Hülle und Fülle vorhanden gewesen zu sein? Verlangsamt Zeit sich bei einem Autounfall wirklich? Wie kommt es, dass ich produktiver bin, wenn ich viel zu tun habe, wohingegen ich nichts gebacken kriege, wenn ich alle Zeit der Welt zu haben scheine? Gibt es in uns eine Uhr, die die Sekunden, Stunden und Tage runterzählt, so wie die Uhr im Computer? Und wie beeinflussbar ist diese Uhr, wenn wir sie denn in uns tragen? Kann ich Zeit beschleunigen, verlangsamen, anhalten, zurückdrehen? Wie und warum fliegt die Zeit dahin?
Ich kann nicht genau sagen, um was es mir dabei wirklich ging – um Seelenfrieden vielleicht, oder um eine Erklärung für meine »sture Leugnung der Vergänglichkeit von Zeit«, wie meine Frau Susan einmal sagte. Für Augustinus war Zeit ein Fenster zur Seele. Die moderne Wissenschaft ist eher mit der Erforschung der Bezugssysteme für unser und der Beschaffenheit von unserem Bewusstsein befasst, mit einer Idee also, die kaum weniger verschwommen ist. (William James qualifizierte das Bewusstsein einmal als »den Namen für ein Nichtsein« ab: »Diejenigen, die immer noch daran festhalten, halten an einem reinen Echo fest, an einem vagen Gerücht, das der Philosophie von der verschwindenden ›Seele‹ hinterlassen wurde.«6) Doch wie man es auch nennt, so haben wir doch alle eine ungefähre Vorstellung davon, was damit gemeint ist – nämlich das anhaltende Gefühl von der Existenz eines Selbst, das in einem Meer aus Selbsts dahintreibt, abhängig und doch allein; das Gefühl oder vielleicht auch ein tiefer, uns allen gemeiner Wunsch, dass das Ich irgendwie dem Wir und dieses Wir etwas noch Größerem und noch Unbegreiflicherem angehört. Aber vor allem ist Bewusstsein der immer wiederkehrende Gedanke – der sich so einfach beiseiteschieben lässt in unserem täglichen Bemühen, sicher die Straße zu überqueren oder unsere To-do-Listen abzuarbeiten, geschweige denn, uns mit den wirklichen Krisen auf der Welt zu konfrontieren –, dass meine Zeit, unsere Zeit, eben deshalb von Bedeutung ist, weil sie endet.
Also stellte ich mir eine Art Meditation vor, die mit etwas Glück zu einer ehrlichen Konfrontation mit mir selbst führen würde. Vielleicht sollte ich hier erwähnen, dass ich für die Niederschrift meines vorangegangenen Buchs wesentlich länger brauchte, als ich es beabsichtigt oder überhaupt für möglich gehalten hatte. Deshalb schwor ich mir, ein neues Buch nur in Angriff zu nehmen, wenn ich mir absolut sicher war, es rechtzeitig abschließen zu können – und damit meinte ich: in angemessener Zeit. Ein Buch über die Zeit, das den Titel Warum die Zeit verfliegt trägt, sollte doch irgendwie im vereinbarten Zeitrahmen bleiben. Aber natürlich blieb es das nicht. Was als eine Reise in die Zeit begonnen hatte, entwickelte sich zu einer Mischung aus Zeitvertreib und Sucht. Es begleitete mich durch den einen Job und den nächsten, die Geburt meiner Kinder, deren Vorschule, Grundschule, Ferien am Strand, durch die Verschiebungen einer Deadline zur nächsten und die Absage einer Dinnerverabredung nach der anderen. Unterdessen hatte ich einen Blick auf die präziseste Uhr der Welt geworfen, die weißen Nächte der Arktis erlebt und mich aus großer Höhe in die Arme der Schwerkraft fallen lassen. Mein Thema war zu einem hungrigen, betörenden und lehrreichen Hausgast geworden, der auf lange Zeit bei uns Einzug hielt, nicht viel anders als die Zeit selbst.
Kaum hatte ich zu recherchieren begonnen, stolperte ich über eine entscheidende Tatsache: Es gibt nicht nur eine Wahrheit über die Zeit. Ich stellte fest, dass sich eine Vielzahl unterschiedlicher Wissenschaftler im Spektrum der Zeitforschung tummeln. Jeder sprach selbstbewusst über den eigenen Wellenlängenbereich, aber keiner konnte mir sagen, wie sich das alles zu Weißlicht summiert oder wie es als Ganzes betrachtet aussieht. »Gerade wenn du denkst, du verstehst, was da vorgeht«, erklärte mir einer, »gibt’s ein anderes Experiment, das einen winzigen Aspekt verändert, und mit einem Mal hast du keine Ahnung mehr, was da passiert.« Wenn Zeitforscher sich denn in einer Sache einig sind, dann darin, dass einfach niemand genug über Zeit weiß und dass dieser Wissensmangel wirklich überraschend ist angesichts der Tatsache, dass Zeit so allgegenwärtig ist und unser Leben derart durchdringt. Ein anderer Forscher bekannte: »Ich kann mir vorstellen, dass eines Tages Aliens aus dem All eintreffen und sagen, ›Zeit? Na, die ist so und so‹, und dass wir dann alle nicken und so tun, als sei uns das die ganze Zeit klar gewesen.« Wenn hier überhaupt ein Vergleich möglich ist, dann vielleicht einer mit dem Wetter: Zeit ist etwas, über das jeder spricht, dem sich aber niemand aussetzen will. Ich beabsichtigte, beides zu tun.
Start Fußnote
1 Anm. d. Übers.: Augustinus, Bekenntnisse 11/V.7, aus dem Lateinischen übersetzt und herausgegeben von Kurt Flasch und Burkhard Mojsisch, Stuttgart (1989), 2008.
2 ibd., 11/XII.14.
3 ibd., 3/III.6 und 11/XXIX.39.
4 ibd., 11/XXIX.39.
5 Anm. d. Übers.: Augustinus, Bekenntnisse, op. cit., 11/XXI.27.
6 Anm. d. Übers.: William James, »Gibt es ein Bewußtsein«, in: Pragmatismus und radikaler Empirismus. Hrsg., übersetzt und mit einem Nachwort von Claus Langbehn. Frankfurt a. M., 2006, S. 7.
DIE STUNDEN
DIE STUNDEN
Eher werden noch die Philosophen übereinstimmen als die Uhren.
Seneca, Apocolocyntosis oder die Verkürbissung des Claudius
Ich nehme in der Pariser Métro Platz und reibe mir den Schlaf aus den Augen. Ich treibe ohne Anker dahin. Mein Kalender zeigt späten Winter, aber draußen vorm Fenster ist ein warmer, sonniger Tag, an den Ästen glitzern die Knospen, die Stadt strahlt. Gestern traf ich aus New York ein und saß bis nach Mitternacht mit Freunden zusammen, heute herrscht in meinem Kopf noch nächtliches Dunkel, so als sei er an der Jahreszeit und der Zeitzone angeleimt, die mehrere Stunden hinter mir liegen. Ich werfe einen Blick auf die Uhr: 9.44. Wie üblich bin ich zu spät dran.
Die Uhr ist ein Geschenk meines Schwiegervaters Jerry, der sie jahrelang selbst getragen hat. Zur Verlobung mit Susan boten ihre Eltern mir eine schöne neue Uhr an. Ich lehnte dankend ab, plagte mich dann aber lange mit dem Gedanken, dass ich damit einen ziemlich lausigen Eindruck hinterlassen haben muss. Welche Art von Schwiegersohn ignoriert schon die Zeit? Als Jerry mir schließlich wenigstens seine alte Armbanduhr schenken wollte, nahm ich augenblicklich an. Sie hat goldene Zeiger und Striche statt Ziffern, ein schwarzes Blatt, auf dem der Markenname (Concord) und in fetten Buchstaben quartz stehen, und ein breites silbernes Armband. Ich mochte das Gewicht an meinem Handgelenk, es gab mir das Gefühl, wichtig zu sein. Ich dankte Jerry und bemerkte zutreffender, als es mir in diesem Moment klar war, dass sie ein wichtiges Utensil für meine Recherchen über die Zeit sein werde.
Meine Sinne machten mich immer glauben, dass die Zeit all der Zeitmesser und Uhren und Zugfahrpläne »da draußen« eine messbar andere sei als die Zeit, die durch meine Zellen, meinen Körper, meinen Kopf fließt. Doch die Wahrheit ist, dass ich über Erstere genauso wenig wusste wie über Letztere. Weder konnte ich sagen, wie diese oder jene Uhr funktioniert, noch, wie es ihr gelingt, fast immer genau mit all den anderen Uhren übereinzustimmen, auf die zufällig mein Blick fiel. Wenn es denn einen Unterschied zwischen äußerer und innerer Zeit gibt – einen so realen wie der zwischen Physik und Biologie –, dann hatte zumindest ich keine Ahnung, worin er besteht.
Meine neue alte Uhr war also eine Art Experiment. Welch bessere Möglichkeit hätte es auch geben können, meine Beziehung zur Zeit auszuloten, als sie nun eine Weile lang doch physisch an mir festzuzurren? Resultate ergaben sich fast sofort. In den ersten paar Stunden, die ich sie trug, konnte ich an nichts anderes denken. Das Handgelenk war schweißnass, sie zog am ganzen Arm. Die Zeit zerrte buchstäblich und im übertragenen Sinne an mir, weil meine Gedanken ständig um dieses Zerren kreisten. Aber es dauerte nicht lange, und ich vergaß die Uhr. Erst am nächsten Abend fiel sie mir plötzlich wieder auf. Ich badete gerade einen unserer Zwillingssöhne, als ich sie an meinem Handgelenk sah. Unter Wasser.
Insgeheim hoffte ich, dass diese Uhr ein gewisses Maß an Pünktlichkeit auf mich übertragen würde. So wie gerade eben, als ich glaubte, ich bräuchte nur oft genug auf sie zu blicken, um noch pünktlich zu meiner Zehn-Uhr-Verabredung im Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) im Pariser Vorort Sèvres einzutreffen, wo Wissenschaftler sich der Perfektionierung, Kalibrierung und Standardisierung aller Maße und Gewichte zu einem internationalen Einheitssystem verschrieben haben. Seit der Globalisierung unserer Volkswirtschaften wird es immer unumgänglicher, dass wir allesamt auf genau derselben messtechnischen Wellenlänge sind, dass ein Kilo in Stockholm exakt einem Kilo in Jakarta entspricht, ein Meter in Bamako exakt einem Meter in Schanghai, eine Sekunde in New York exakt einer Sekunde in Paris. Das Büro ist die UNO der Maßeinheiten, der Standardisierer weltweiter Standards.
Gegründet wurde es 1875 durch die Internationale Meterkonvention, einen Vertrag, »vom Wunsch geleitet, die internationale Einigung und die Vervollkommnung des metrischen Systems zu sichern«. (Der erste Akt des Büros bestand in der Aushändigung von dreißig »Linealen«: exakt vermessene Platin-Iridium-Stäbe für das sogenannte Meternormal oder Urmeter, durch die der weltweite Streit um die korrekte Länge eines Meters beigelegt wurde.) Siebzehn Nationen waren ihm beigetreten, achtundfünfzig gehören ihm heute an, darunter alle großen Industriestaaten. Die Garnitur der Referenzkörper für die Basis- oder SI-Einheiten, die das Büro bewahrt, ist mittlerweile auf sieben angewachsen: der Meter (Länge), das Kilo (Masse), das Ampere (elektrische Stromstärke), das Grad Kelvin (thermodynamische Temperatur), das Mol (Stoffmenge), die Candela (Lichtstärke) und die Sekunde.
Zu den vielen Pflichten des Büros zählt also auch die Wartung des einzigen offiziellen, weltweit gültigen Zeitstandards, genannt Coordinated Universal Time oder UTC (vor der globalen Einführung der UTC im Jahr 1972 hatten sich die Parteien nicht verständigen können, ob man das englische Akronym CUT oder das französische TUC verwenden sollte, also fand man den Kompromiss UTC). Jeder Zeitmesser über oder auf der Welt, von den hypergenauen Uhren in den GPS-Satelliten bis hin zu unseren Armbanduhren, ist direkt oder indirekt an der UTC ausgerichtet. Wo immer man steht und geht und nach der Zeit fragt, erhält man eine Antwort, die letztendlich von den Zeitwächtern des Pariser Büros stammt.
»Zeit ist, was nach allgemeiner Vereinbarung Zeit ist«, sagte einmal ein Zeitforscher zu mir. Wer zu spät kommt, verspätet sich demzufolge im Rahmen einer Konvention. Die Zeit des Büros ist aber nicht nur die genaueste Zeit der Welt, sondern genau genommen auch die einzig korrekte. Als ich gerade eben erneut auf meine Uhr blickte, erkannte ich demnach, dass ich nicht einfach nur zu spät dran war, sondern so viel zu spät, wie ich der einzig richtigen Zeit nach überhaupt nur sein konnte. Ich sollte schon bald erfahren, wie weit ich der Zeit wirklich hinterherhinkte.
Eine Uhr tut zwei Dinge: Sie tickt und sie zählt ihre Ticks. Eine Klepsydra, die Wasseruhr der alten Griechen, tickte zu dem steten Tropfen, der in ein Einlaufbehältnis fiel, in dem man anhand des Wasserstands die Stundenlinien ablesen konnte. Bei den fortschrittlicheren Varianten trieben die Tropfen bereits eine Reihe von Rädchen an, die ihrerseits einen Zeiger die Linie entlangstießen, an der sich der Lauf der Zeit ablesen ließ. Klepsydren wurden schon vor mindestens dreitausend Jahren verwendet. Römische Senatoren nutzten sie, um ihre Kollegen von allzu langen Reden abzuhalten: Das Wasser tickte, akkumulierte Zeit, und irgendwann war die Redezeit »ausgeschöpft«.
Die längste Zeit der Geschichte war es jedoch die Erde, die in den meisten Uhren tickte. Während der Planet um seine Achse rotiert, zieht die Sonne ihre Himmelsbahn und bewegt ihren Schatten über sie; fällt dieser auf eine Sonnenuhr, zeigt sie an, welcher Punkt des Tages es ist. 1656 erfand Christiaan Huygens die Pendeluhr, die sich die Schwerkraft zunutze machte: Ein Pendel reguliert mit seinen Schwingungen den Gang der Hemmung und löst damit eine Aktion im Werk aus, die die Zeiger weiterdreht. Ein Tick ist schlicht eine Schwingung, ein steter Takt. Den Rhythmus gibt die Erdrotation vor.
Faktisch war das, was tickte, der Tag: das Rotationsintervall von einem Sonnenaufgang zum nächsten. Alles dazwischen – die Stunden, die Minuten – war erfunden, eine vom Menschen ersonnene Möglichkeit, den Tag in beherrschbare Einheiten aufzuteilen, die der eine genießen und der andere zum Handeln nutzen konnte. Heute werden unsere Tage mehr und mehr von Sekunden beherrscht. Sie sind die Währung des modernen Lebens, die Groschen unserer Zeit: omnipräsent und notfalls entscheidend (wie dann, wenn es dir gerade eben noch gelingt, den Anschlusszug zu erreichen), doch zugleich hinreichend marginal, um verplempert werden zu können oder reihenweise gedankenlos unbeachtet zu bleiben. Jahrhundertelang existierte die Sekunde nur theoretisch, als eine kontextdefinierte mathematische Untergruppe: 1/60 von einer Minute, 1/3 600 von einer Stunde, 1/86 400 von einem Tag. Im 16. Jahrhundert tauchten die ersten Uhren mit Sekundenzeiger in Deuschand auf, doch erst als der englische Uhrmacher William Clement 1670 der Huygens’schen Pendeluhr das vertraute Tick-tack eines zweiten Pendels für die Sekunden zufügte, nahmen sie eine verlässliche physische oder zumindest hörbare Form an.
Ihren endgültigen Einzug in unser Leben hielt die Sekunde im 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Quarzuhr. Wissenschaftler hatten herausgefunden, dass ein Quarzkristall Zehntausende Male pro Sekunde wie eine Stimmgabel schwingen kann, wenn er durch ein oszillierendes elektrisches Feld dazu angeregt wird. Die genaue Frequenz hängt von der Größe und Form des Kristalls ab. In einer 1930 von den Bell Telephone Laboratories publizierten Abhandlung mit dem Titel The Crystal Clock wurde erstmals vermerkt, dass diese Eigenschaft auch eine Uhr antreiben könnte. Und da diese ihre Zeit nicht mehr von der Schwerkraft, sondern von einem elektrischen Feld bezieht, kann sie auch in Erdbebengebieten, fahrenden Zügen und Unterseebooten ein verlässlicher Zeitgeber sein. Moderne Quarzuhren, ob an der Wand oder am Handgelenk, verwenden dazu üblicherweise einen laserbearbeiteten Uhrenquarz, der exakt 32 768 (oder 215) mal pro Sekunde bei 32 768 Hz vibriert. Damit hatte man eine praktikable Definition: Eine Sekunde sind 32 768 Quarzvibrationen.
Seither gelang es Wissenschaftlern, der Sekunde immer weitere Dezimalstellen anzufügen, bis man in den 1960er-Jahren schließlich zur folgenden offiziellen Definition gelangte: »Die Sekunde ist das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids133Cs [Cäsium] entsprechenden Strahlung.« Die Atomsekunde war geboren, die Zeit war auf den Kopf gestellt worden. Das alte Zeitschema der »Weltzeit« – bei dem die Sekunde als der Bruchteil eines Tages berechnet wurde, der durch die Bewegung der Erde im All definiert war – war ein Top-down-Prinzip gewesen. Jetzt wurde der Tag nach dem Prinzip der Akkumulation von Sekunden bottom-up gemessen. Philosophen debattierten, ob diese neue Atomzeit ebenso »natürlich« sei wie die alte Zeit. Dabei gab es ein noch weit größeres Problem zu lösen: Die beiden Zeitmessungen waren sich nicht einig. Durch die zunehmende Genauigkeit der Atomuhr wurde offenbar, dass die Erdrotation sich peu à peu verlangsamt, wodurch jeder Tag um einen Hauch länger wird. Alle paar Jahre summieren sich diese winzigen Unterschiede zu einer Sekunde. Deshalb werden der Internationalen Atomzeit seit 1972 »Schaltsekunden« im bisherigen Wert von fast einer halben Minute zugefügt, um sie mit dem Planeten zu synchronisieren.
Früher konnte jeder durch simple Division seine eigenen Sekunden berechnen. Heute werden uns die Sekunden von Experten geliefert. Der Fachausdruck dafür lautet »Aussaat« oder »Verteilung« (dissemination), was wie Gärtnern oder nach einer Propaganda-Aktion klingt. Es gibt weltweit dreihundertzwanzig Cäsiumuhren, vornehmlich in den nationalen Zeitmesslaboren, und jede von der Größe eines kleinen Koffers. Mehr als hundert große, Maser7-gesteuerte Geräte generieren oder »realisieren«, wie man es nennt, nahezu kontinuierlich höchst akkurate Sekunden. (Die Cäsiumuhren werden ihrerseits mit einer Standardfrequenz abgeglichen, die von sogenannten Cäsiumfontänen generiert wird – es gibt rund ein Dutzend davon –, welche die Cäsiumatome mit einem Laser in eine »ballistische Flugbahn« im Vakuum katapultieren.) Anhand dieser Normsekunden wird dann die exakte Tageszeit hochgerechnet beziehungsweise realisiert. Tom Parker, einst Gruppenleiter bei der amerikanischen Bundesbehörde NIST (National Institute of Standards and Technology), erklärte mir: »Die Sekunde ist das Ding, das tickt, Zeit ist das Ding, das die Ticks zählt.«
Das NIST trägt zur Produktion der offiziellen Zeit für die Vereinigten Staaten bei. In seinen beiden Laboren (Gaithersburg, Maryland, und Boulder, Colorado) wartet es rund um die Uhr ein Dutzend oder mehr Cäsiumuhren. Denn so präzise diese Uhren auch sind, so weichen sie doch im Messbereich von Nanosekunden voneinander ab. Deshalb werden sie alle zwölf Minuten Tick für Tack miteinander verglichen, um festzustellen, welche zu schnell und welche zu langsam läuft, und um genau wie viel sie es jeweils tut. Dann werden die Daten des Uhrenensembles zu einem »kunstvollen Mittelwert« vermischt, wie Parker sagt, der die Grundlage für die offizielle Zeit liefert.
Wie diese Zeit uns erreicht, hängt ganz davon ab, welchen Zeitmesser wir benutzen und wo wir uns gerade befinden. Die Uhr im Laptop oder Computer gleicht sich regelmäßig mit anderen Uhren im Internet ab und kalibriert sich automatisch; und zumindest einige von diesen anderen Uhren laufen irgendwann zur Präzisierung über einen Server des NIST oder von dem einer anderen nationalen Uhr. NISTs viele Server registrieren tagtäglich 13 Milliarden Pings von Computern aus aller Welt, die sich die korrekte Zeit abholen. Ist man in Tokio, geschieht das durch den Zeitserver des Nationalen Metrologischen Instituts von Japan in Tsukuba, ist man in Deutschland, läuft es über einen Server der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
Die Uhren unserer Smartphones empfangen ihre Zeit hingegen sehr wahrscheinlich überall, wo man sich gerade aufhält, vom Global Positioning System, einer Reihe von Satelliten, die mit dem U. S. Naval Observatory bei Washington, D. C. – das seine Sekunden mit rund siebzig Cäsiumuhren realisiert – synchronisiert werden. In vielen anderen Uhren – Wanduhren, Tischuhren, Armbanduhren, Reiseweckern, den Armaturenuhren im Auto – ist ein winziger Funkempfänger verbaut, der (in den Vereinigten Staaten) permanent auf Empfang für die Signale des Zeitzeichensenders WWBV des NIST in Fort Collins steht (das Signal wird in einer sehr niedrigen Frequenz – 60 Hz – und auf so schmaler Bandbreite gesendet, dass der Code eine gute Minute bis zum Empfänger braucht). Solche Uhren könnten die Zeit zwar auch eigenständig generieren, sind aber meist nur Dienstleister zur Übermittlung der Zeit, die von weit präziseren Uhren irgendwo weiter oben in der Zeithierarchie generiert wurde.
Meine Armbanduhr verfügt weder über einen Funkempfänger noch über irgendeine Möglichkeit, mit Satelliten zu reden. Sie ist ganz und gar offline. Um sie mit aller Welt zu synchronisieren, muss ich auf eine präzise Uhr gucken und dann am Rädchen von meiner drehen. Wollte ich es genauer, könnte ich sie regelmäßig in ein Uhrengeschäft bringen und ihren Mechanismus mit einem Quarzoszillator abgleichen lassen, der seine Präzision anhand der vom NIST kontrollierten Standardfrequenz wahrt. Anderenfalls wird meine Uhr ihre Realisierungen für sich behalten und bald aus dem Tritt mit allen anderen Uhren geraten. Ich hatte immer geglaubt, das Anlegen einer Uhr bedeute, mir die konkrete Zeit ums Handgelenk zu binden. Doch wenn ich meine Uhr nicht ständig mit anderen Uhren um mich herum kalibriere, bin ich noch immer ein Sonderling. »Du bist ungetaktet«, sagt Parker.
Zwischen dem späten 17. und dem frühen 20. Jahrhundert residierte die präziseste Uhr der Welt im Royal Observatory von Greenwich, England. Sie wurde regelmäßig vom Astronomer Royal nach den Himmelsbewegungen gestellt. Das war gut für die Welt, aber schlecht für den Hofastronomen. Denn seit ungefähr 1830 klopften immer häufiger Greenwicher Bürger an seine Tür und störten ihn bei der Arbeit: Verzeihung, können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
Schließlich wurde das den Leuten so zur Gewohnheit, dass die Stadt den Astronomen bat, einen angemessenen Zeitdienst einzurichten. 1836 betraute er seinen Assistenten John Henry Belville mit dieser Aufgabe, und der stellte seinen Zeitmesser, einen Taschenchronometer, der einst vom berühmten Uhrmacher John Arnold & Son für den Duke of Sussex angefertigt worden war, jeden Montagmorgen nach der Observatoriumszeit. Dann begab er sich auf den Weg nach London zu seinen Klienten – Uhrmachern, Uhrenwerkstätten und Privatpersonen, die sich ihre Zeiten für eine Gebühr mit seiner und infolgedessen der Zeit des Observatoriums synchronisieren ließen. (Belville ließ das goldene Gehäuse seines Chronometers bald durch ein silbernes ersetzen, um »in den weniger begehrenswerten Vierteln der Stadt« keine Aufmerksamkeit zu erregen.) Als Belville 1856 starb, übernahm seine Witwe die Aufgabe; als sie sich 1892 zurückzog, übertrug sie die Dienstleistung an ihre Tochter Ruth, die man bald nur noch die »Greenwicher Zeitlady« nannte. Miss Belville, die nach wie vor den väterlichen Chronometer verwendete, von ihr »Arnold 345« genannt, behielt auch die Tour des Vaters bei, um unter ihren Klienten jene Zeit auszusäen, welche man inzwischen zur Greenwich Mean Time und offiziellen Zeit Englands erklärt hatte. Erst mit der Erfindung des Telegraphen, durch den bald Uhren im ganzen Land zu beträchtlich geringeren Kosten mit der Greenwich Time synchronisiert werden konnten, wurden die Dienste von Miss Belville überflüssig – jedenfalls fast, denn bis sie sich um 1940, sie war Mitte achtzig, zur Ruhe setzte, hatte sie noch immer rund fünfzig Klienten bedient.
Start Fußnote
7 Anm. d. Übers.: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Mikrowellenverstärkung durch stimulierte Strahlenemission): ein Laser im Mikrowellenbereich.
Ich war nach Paris gereist, um mich mit der modernen Zeitlady zu treffen, einer Miss Belville für die ganze Welt namens Dr. Elisa Felicitas Arias, ihres Zeichens Direktorin der »Abteilung für die Berechnung und Aufrechterhaltung der koordinierten Weltzeit (UTC)« am BIPM, eine schlanke Dame mit langem, braunem Haar und der Aura einer huldvollen Aristokratin. Als studierte Astronomin hatte sie fünfundzwanzig Jahre lang in Observatorien ihrer Heimat Argentinien gearbeitet, die letzten zehn davon am Marine-Observatorium in Buenos Aires. Ihr Fachgebiet ist die Astrometrie, das heißt die exakte Vermessung von Entfernungen im All. Seit einiger Zeit kooperiert sie mit dem Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme (IERS), der jede kleinste Abweichung der Bewegungen unseres Planeten verzeichnet und insofern auch bestimmt, wann die nächste Schaltsekunde dem Zeitmix beigefügt werden muss. Ich treffe sie in ihrem Büro, sie bietet mir Kaffee an. »Wir arbeiten alle für ein Ziel«, sagt sie über ihre Abteilung, »nämlich einen Zeitmaßstab zur Verfügung zu stellen, der sich als internationale Referenz eignet.« Dabei erstrebten sie »höchste Nachvollziehbarkeit«.
Unter den Hunderten Uhren und Uhrenensembles, die von den achtundfünfzig Mitgliedstaaten des Pariser Büros betrieben werden, vermitteln nur fünfzig – die sogenannten Mutteruhren, eine pro Land – die offizielle Zeit. Sie realisieren in aller Welt die Sekunden, vierundzwanzig Stunden am Tag. Doch diese Realisierungen decken sich nicht. Zwar geht es dabei um Nanosekunden – oder das Milliardstel einer Sekunde –, was nicht ausreicht, um Elektrizitätsversorgern Probleme zu bereiten (da sie der Präzision nur im Millisekundenbereich bedürfen), oder um Telekommunikationssysteme zu beeinträchtigen (die im Mikrosekundenbereich arbeiten). Doch die Uhren der verschiedenen Navigationssysteme – dem vom amerikanischen Verteidigungsministerium etablierten GPS oder dem Galileo-Netzwerk der Europäischen Union – müssen sich auf Nanosekunden-Niveau einig sein, um einen stimmigen Dienst anbieten zu können. Das heißt, die Weltuhren müssen sich decken oder für die Realisierung der »Universell Koordinierten Weltzeit« zumindest größtmögliche Synchronie anstreben.
Diese Koordinierte Weltzeit wird durch einen steten Vergleich aller Mitgliedsuhren errechnet, also durch die Überprüfung ihrer Synchronie und die Feststellung ihrer Abweichungen. Das ist eine gewaltige technische Herausforderung. Zum einen sind diese Uhren Hunderte oder Tausende Kilometer voneinander entfernt, und angesichts der Dauer, die ein elektronisches Signal – das sozusagen den Befehl gibt: »Beginne jetzt zu ticken« – zur Überwindung solcher Distanzen braucht, lässt sich schwer mit absoluter Genauigkeit bestimmen, was »gleichzeitig« bedeutet. Um dieses Problem zu umgehen, nutzt Arias’ Abteilung GPS-Satelliten zum Datentransfer. Die Satelliten kreisen auf bekannten Positionen, ihre Uhren sind alle mit dem U. S. Naval Observatory synchronisiert, und dank deren Informationen kann das BIPM die exakten Momente berechnen, in denen die Zeitsignale der Uhren aus aller Welt abgeschickt wurden.
Doch selbst unter diesen Bedingungen bleiben Ungewissheiten. Die Position eines Satelliten kann nicht absolut präzise bestimmt werden; schlechtes Wetter und die Erdatmosphäre können den Weg eines Signals verzögern oder verändern und damit die Dauer seiner realen Übermittlungszeit verzerren. Außerdem verursachen Geräte ein elektronisches Rauschen, das ebenfalls zu Verzerrungen der präzisen Messungen beitragen kann. Arias deutet zur Tür, um mir das Ganze mit einer Analogie zu erklären: »Wenn ich Sie frage, wie spät es ist, dann sagen Sie mir Ihre Zeit und ich vergleiche die mit meiner. Dabei stehen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wenn ich aber sage, ›Gehen Sie raus, schließen Sie die Tür und sagen Sie mir dann, wie spät es ist‹, werde ich nachhaken müssen, ›Nein, nein, nein, wiederholen Sie das, da ist zu viel Lärm zwischen uns‹« – sie macht einen sirrenden Laut mit den Lippen, Brrrrrrrrip! Es fließt also eine Menge Mühe und Arbeit in die Umgehung solchen Rauschens, um sicherstellen zu können, dass die im BIPM eingetroffene Botschaft auch wirklich das relative Verhalten der Weltuhren spiegelt.
»Wir haben achtzig Labore auf der Welt«, sagt Arias. Einige Staaten haben mehr als nur eines. »Und wir müssen die Zeiten von allen organisieren.« Dabei klingt sie liebenswürdig aufmunternd, so wie einst die amerikanische Koch-Queen Julia Child, wenn sie die Essenz einer guten Vichyssoise erklärte. Zuerst besorgt sich Arias’ Pariser Team alle Zutaten, also die Nanosekundendifferenzen zwischen allen Mitgliedsuhren und allen maßgeblichen anderen Uhren, plus eine gute Prise lokaler Daten über das historische Verhalten von jeder dieser Uhren. Diese Informationen werden dann durch »den Algorithmus gejagt«, wie Arias sagt, der erstens die Anzahl der Uhren berücksichtigt, die gerade in Betrieb sind (denn es können ja jederzeit einige in der Wartung oder Neukalibrierung sein), zweitens etwas mehr Gewicht auf die statistisch nachweislich präziseren von ihnen legt und drittens das Ganze dann zu einer homogenen Textur verquirlt.
Der Prozess wird jedoch nicht allein von Computern bewältigt. Es bedarf eines Menschen, um kleine, doch entscheidende Faktoren ins Kalkül zu ziehen, wie zum Beispiel, dass nicht alle Labore ihre Zeitdaten auf die genau gleiche Weise berechnen oder dass eine bestimmte Uhr sich in letzter Zeit seltsam verhalten hat und ihr Beitrag deshalb neu gewichtet werden muss oder dass aufgrund eines Softwarefehlers einige Minuszeichen in der Tabelle fälschlicherweise in Pluszeichen verwandelt wurden und deshalb eine Rückrechnung nötig ist. Die Handhabung des Algorithmus erfordert eine gewisse mathematische Kunstfertigkeit. »Da ist schon etwas persönliches Flair beteiligt«, sagt Arias.
Das Endergebnis ist eine »Durchschnittsuhr« im besten Sinne des Wortes, erklärt sie, deren Zeit stabiler ist, als es von einer einzelnen Uhr oder einem nationalen Uhrenensemble jemals zu erhoffen wäre. Doch per definitionem und universellem Abkommen, jedenfalls zumindest dank der Vereinbarung von achtundfünfzig Unterzeichnerstaaten, ist die Zeit dieser Uhr perfekt.
Es dauert seine Zeit, um eine Koordinierte Weltzeit zu produzieren. Allein die Minimierung aller Ungewissheiten und die Umgehung des Rauschens der GPS-Empfänger dauert zwei bis drei Tage. Außerdem wäre die Berechnung der UTC eine überwältigende logistische Aufgabe, müsste man es kontinuierlich tun, deshalb liest jede Mitgliedsuhr nur jeden fünften Tag um exakt null Uhr UTC ihre Zeit ab. Am vierten oder fünften Tag des Folgemonats schickt jedes Labor seine Datensammlung an das BIPM, auf dass Arias und ihr Team diese analysieren, mitteln, gegenkontrollieren und dann veröffentlichen.
»Wir versuchen das immer schnellstmöglich zu tun, ohne dabei jedoch irgendwelche Kontrollen zu vernachlässigen«, erklärt sie. »Dieser Prozess dauert mehr oder weniger fünf Tage. Wir empfangen am vierten oder fünften Tag jedes Monats, beginnen mit unseren Berechnungen am siebten und veröffentlichen am achten, neunten oder zehnten Tag.« Technisch gesehen wird dabei die internationale Atomzeit zusammengefügt. Die Erschaffung der UTC besteht dann nur noch aus der simplen Aufgabe, ihr die korrekte Anzahl an Schaltsekunden beizumischen. »Natürlich gibt es keine Uhr, die die exakte UTC anzeigt. Man hat immer nur lokale Realisierungen der UTC.«
Plötzlich verstehe ich: Die Weltuhr gibt es nur auf Papier und immer nur im Rückblick. Arias lächelt: »Wenn die Leute fragen, ›Kann ich die beste Uhr der Welt sehen?‹, dann antworte ich, ›Okay, bitte sehr, das ist die beste Uhr der Welt‹.« Und sie reicht mir ein Bündel zusammengehefteter Papiere. Es ist ein Monatsbericht, eines der Rundschreiben, die die Zeitlabore aller Mitgliedsstaaten erhalten, überschrieben mit Circular T. Und ebendieser Bericht ist der Daseinszweck der Zeitabteilung des BIPM. »Er kommt einmal im Monat heraus und informiert über die Zeit der Vergangenheit, das heißt, über die des Vormonats.«
Die beste Uhr der Welt ist ein Newsletter. Ich blättere ihn durch und sehe spaltenweise Zahlen. In der linken Spalte stehen die Namen der Mitgliedsuhren: IGMA (Buenos Aires), INPL (Jerusalem), IT (Turin) und so weiter. In der oberen Querspalte ist der vorangegangene Monat in Fünftagesschritten angegeben: Nov. 30, Dez. 5, Dez. 10, und so fort. Die Zahl in jeder Zelle steht für die Differenz zwischen der Koordinierten Weltzeit und der lokalen UTC-Realisation eines bestimmten Labors an einem bestimmten Tag. Am 20. Dezember zum Beispiel betrug die Zahl für die Nationaluhr von Hongkong 98,4 – womit angezeigt wird, dass sie 98,4 Nanosekunden hinter der Koordinierten Weltzeit zurücklag. Die Zahl für die Uhr von Bukarest zeigt minus 1 118,5 an, was bedeutet, dass sie dem universellen Mittel um 1 118,5 Nanosekunden – ein beträchtlicher Schritt – voraus gewesen war.
Der Sinn und Zweck von Circular T ist laut Arias, den Mitgliedslaboren zu helfen, ihre Präzision in Relation zur UTC zu überwachen und zu verbessern, eine Prozedur, die man steering oder lotsen nennt: Sobald die Labore erfahren, wie weit ihre Uhren im Vormonat vom UTC-Mittel abgewichen waren, können sie ihre Gerätschaften justieren und korrigieren, sodass sie dem Mittel im nächsten Monat vielleicht etwas näher kommen. Keine Uhr erreicht jemals absolute Präzision, Konsistenz reicht aus: »Es ist nützlich, weil Labore ihre UTCs lotsen«, erklärt Arias, womit sie das Bild von Zeit als einem Schiff in einem Kanal weckt. »Sie müssen wissen, wie die UTC sich lokal verhält. Also prüfen sie, ob sie korrekt auf Circular T zugesteuert sind. Deshalb checken sie auch ständig ihre Mails und das Internet – sie wollen wissen, wo sie allesamt letzten Monat in Relation zur UTC standen.«
Für die präzisesten Uhren ist ein Steering unerlässlich. »Manchmal hat man eine sehr gute Uhr, und dann macht sie plötzlich einen Zeitschritt – einen Zeitsprung.« Arias deutet in ihrem Exemplar des jüngsten Circular T auf die Zahlenreihe für das U. S. Naval Obervatory. Die Abweichungen sind bewundernswert klein, im Bereich von zweistelligen Nanosekunden. »Das ist eine vorzügliche Realisierung der UTC«, erklärt sie. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn das U. S. Naval Observatory, das über die meisten Uhren im internationalen Pool verfügt, trägt 25 Prozent zur UTC bei, und da es auch federführend beim Steering der Zeit des GPS-Systems ist, trägt es eine globale Verantwortung für die strikte Annäherung an die UTC.
Aber Steering ist nicht jedermanns Sache. Eine Uhr zu lotsen erfordert teure Gerätschaften, und nicht alle Labore können sich die leisten. »Sie lassen ihre Uhren ein Eigenleben führen.« Arias deutet auf die Zahlenreihe eines Labors in Weißrussland, das in aller Muße ein Leben weit abseits der Norm zu führen scheint. Ich frage, ob das BIPM jemals ein Labor wegen zu ungenauer Beiträge ablehnt. »Niemals«, antwortete sie. »Wir wollen ihre Zeiten immer.« Solange ein nationales Labor mit einer vernünftigen Uhr und einem Empfänger ausgestattet ist, dienen auch seine Beiträge der Erfassung des UTC-Mittels. »Wenn man Zeit konstruiert«, dann ist ein Ziel immer ihre »breite Aussaat« – UTC kann nur dann als Weltzeit betrachtet werden, wenn jeder einbezogen wird, ganz egal wie sehr er aus der Reihe tanzt.
Ich blicke noch immer nicht ganz durch: Was – und wann – ist denn nun Koordinierte Weltzeit? (»Ich habe dafür Jahre gebraucht«, gesteht Tom Parker mir später.) Wenn man denn von einer Papieruhr sprechen kann, dann existiert sie doch nur in der Vergangenheitsform, da ihre Zeit von Daten abgeleitet wird, die im Vormonat gesammelt wurden. Arias bezeichnet die UTC als einen »postrealen Zeitprozess«: ein dynamisches Präteritum. Andererseits dienen die Zahlenreihen ihrer Papieruhr den realen Uhren da draußen zu ähnlichen Zwecken wie den Schiffen eine Kurskorrektur oder Kanalmarkierung, damit sie in die richtige Richtung steuern – so als sei UTC ein Futurum, das wie der nächste Hafen gleich hinterm Horizont auftauchen wird. Blickt man auf die eigene Armbanduhr, den Wecker oder die Zeitangabe im Smartphone, um die offizielle Zeit abzulesen, die aus Boulder oder Tsukuba oder Braunschweig empfangen wird, dann erhält man also nur die bestmögliche Schätzung der koordinierten Zeit, die man erst in rund einem Monat kennen wird. Eine perfekt synchronisierte Zeit gibt es offenbar nicht. Es gibt nur eine, die gerade vorbei und noch nicht ganz eingetroffen ist, eine, die sich im steten Zustand des Werdens befindet.
Ich war mit der Vorstellung nach Paris gereist, dass die präziseste Zeit der Welt von einer greifbaren, ultraraffinierten Vorrichtung bezogen wird, von einer hochgezüchteten Uhr mit Zeigern und Ziffern, einer Anordnung von Computern, einer winzigen, schillernden Cäsiumfontäne. Die Wirklichkeit ist sehr viel menschlicher: Die exakteste Uhr der Welt, die Koordinierte Weltzeit, wird von einem Komitee produziert. Das Komitee verlässt sich dabei auf hoch entwickelte Computer und Algorithmen und den Input von Atomuhren, doch die Metaberechnung, die leichte Bevorzugung des Inputs der einen Uhr vor dem einer anderen, wird letztendlich durch die Debatten bedächtiger Wissenschaftler gefiltert. Zeit ist eine Gruppe diskutierender Menschen.
Arias bemerkt noch, dass ihre Zeitabteilung in einen größeren Rahmen eingebunden ist: Beiräte, Beratergruppen, fallweise hinzugezogene Forschungsgruppen und Überwachungsgremien. Sie empfängt regelmäßig internationale Experten, veranstaltet hie und da Tagungen, gibt Berichte heraus und analysiert das Feedback. Es wird geprüft, kontrolliert und kalibriert. Gelegentlich meldet sich auch das übergreifende Consultative Committee for Time and Frequency (CCTF) zu Wort. »Wir operieren nicht allein auf der Welt«, sagt sie. »Bei geringfügigeren Fragen können wir selbst Entscheidungen treffen. Bei größeren müssen wir dem CCTF Vorschläge unterbreiten, dann werden die Fachleute aus den besten Laboren ›Wir stimmen zu‹ oder ›Wir stimmen nicht zu‹ sagen.«
All diese Redundanzen sind das Gegengewicht für ein unabwendbares Problem: Keine einzige Uhr, kein einziges Komitee, kein einziger Mensch kann allein Hüter der perfekten Zeit sein. Das ist, wie sich herausstellt, das Wesen von Zeit auf allen Ebenen. Bei meinen Gesprächen mit Forschern, die die Wirkung von Zeit in und auf Körper und Geist studieren, hörte ich immer wieder auf die eine oder andere Weise den Vergleich der Funktionsweisen von Zeit mit denen eines Kongresses. Jedes unserer Organe, jede unserer Zellen besitzt eine eigene Uhr, und all diese Uhren kommunizieren miteinander und halten sich gegenseitig im Takt. Unser Gespür für die Vergänglichkeit von Zeit ist nicht in einer bestimmten Hirnregion angesiedelt, sondern das Ergebnis des Zusammenklangs von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Gefühl und anderen Hirntätigkeiten, die sich nicht unbedingt einzeln lokalisieren lassen, denn Zeit im Gehirn ist eine kollektive Aktion, nicht anders als Zeit außerhalb von ihm. Dennoch sind wir gewohnt, uns ein oberstes Kollektiv irgendwo da drinnen vorzustellen – eine Kerngruppe aus Sichtern und Sortierern, wie ein inneres Büro für Maße und Gewichte, vielleicht geleitet von einer braunhaarigen argentinischen Astronomin. Wo ist unsere Dr. Arias?
An einem Punkt bitte ich Arias, ihre persönliche Beziehung zur Zeit zu beschreiben.
»Sehr schlecht«, antwortet sie. Auf ihrem Schreibtisch steht eine kleine Digitaluhr. Sie greift danach und richtet das Display zu mir. »Wie viel Uhr ist es?«
Ich lese ab: »Viertel nach eins.«
Dann deutet sie auf meine Armbanduhr: »Wie viel Uhr ist es?«
Die Zeiger stehen auf 12.55. Arias’ Uhr geht zwanzig Minuten vor.
»Daheim habe ich keine einzige Uhr, die die gleiche Zeit angibt«, sagt sie. »Ich komme oft zu spät zu Verabredungen. Mein Wecker geht fünfzehn Minuten vor.«
Ich bin erleichtert, das zu hören, aber im Namen der Welt doch auch etwas beunruhigt. »Vielleicht ist das einfach so, wenn man die ganze Zeit über Zeit nachdenkt«, meine ich mitfühlend. Wenn es deine Aufgabe ist, die Weltzeit zu koordinieren, aus den irdischen Gradienten von Licht und Dunkel eine einheitlich koordinierte Zeit zu erschaffen, dann betrachtest du dein Zuhause vielleicht als eine Zuflucht, als den einzigen Ort, an dem du deine Uhr ignorieren, die Füße hochlegen und endlich ein bisschen Zeit genießen kannst, die nur dir gehört.
»Ich weiß nicht«, sagt Arias mit pariserischem Achselzucken. »Ich habe noch nie einen Flug oder einen Zug verpasst. Aber wenn ich weiß, ich kann mir ein bisschen Freiheit herausnehmen, dann tue ich es.«
Wir reden über Zeit gerne so, als sei sie unser Feind, der uns etwas stiehlt, uns unterdrückt, uns beherrscht. Der amerikanische Ökonom und Gesellschaftskritiker Jeremy Rifkin lamentierte in seinem 1987 (also am Beginn des digitalen Zeitalters) erschienenen Buch Time Wars (Uhrwerk Universum), dass die Menschheit »eine künstliche Zeitumgebung« geschaffen habe,
interpunktiert durch mechanische Apparate und elektronische Impulse: eine Zeitebene, die quantitativ, schnell, effizient und vorhersehbar ist.8
Vor allem Computer beunruhigten Rifkin, weil sie in einem Zeitrahmen arbeiten, »in dem die Nanosekunde die hauptsächliche Zeiteinheit ist« – eine »Geschwindigkeit jenseits der bewußten Wahrnehmung«.
Diese neue Rechenzeit [computime] stellt die endgültige Abstraktion der Zeit und ihre völlige Trennung von menschlicher Erfahrung und den Rhythmen der Natur dar.9
Dafür pries er die Bemühungen der neuen »Zeitrebellen« – eine breite Kategorie, zu der er die Verfechter alternativer Bildungsmöglichkeiten ebenso zählte wie die Vorkämpfer für Frauenrechte und für Abrüstung, für nachhaltige Landwirtschaft und für Tierrechte –, da sie allesamt erkannt hätten, dass die von uns erschaffenen künstlichen Zeitwelten die Abspaltung des Menschen von den »Rhythmen der Natur« nur noch beschleunigen. Dieser Darstellung nach ist Zeit ein Werkzeug des Establishments und sowohl der Feind der Natur als auch der des Selbst.
Damals wirkte diese Rhetorik überzogen, doch dreißig Jahre später trifft Rifkins Klage einen Nerv bei uns allen. Oder warum sonst wären wir so besessen von Produktivität und Zeitmanagement, wenn nicht des Versuchs wegen, vernünftigere Möglichkeiten der Navigation durch unser Leben zu finden? Heute werden wir weniger von Computime als von unserer sklavischen Anhänglichkeit an Tablets und Marken-Smartphones gehetzt, die unsere Arbeitstage und Arbeitswochen ins Endlose verlängern. Keine Uhr zu tragen war meine Art, der Autorität – The Man – die kalte Schulter zu zeigen, wiewohl ich sie – ihn – noch nie zu Gesicht bekommen habe.
Dennoch, wenn man der »künstlichen« Zeit Schuld an so vielem zuschiebt, dann billigt man der Natur indirekt zu viel zu. Vielleicht gab es ja mal eine Zeit, in der Zeit eine rein persönliche Angelegenheit war, aber man kann sich kaum noch vorstellen, wann das wohl gewesen sein könnte. Im Mittelalter schufteten Leibeigene zum fernen Klang der Dorfglocken. Schon Jahrhunderte zuvor erwachten, psalmodierten und knieten Mönche im Rhythmus des Glockengeläuts. Im 2. Jahrhundert v. d. Z. verfluchte der römische Dichter Plautus die beliebte Sonnenuhr, weil sie »Glied für Glied mir armen Kerl den Tag zerriß«.10 Die Inka nutzten einen komplexen Kalender, um zu berechnen, wann sie säen und ernten sollten und wann die verheißungsvollste Zeit für Menschenopfer war. Selbst die Frühmenschen müssen sich die wandelnden Lichtverhältnisse schon auf Höhlenwände notiert haben, damit sie in der Sicherheit des Tageslichts jagen und rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zurückkehren konnten. Doch wiewohl all diese Bräuche den »Rhythmen der Natur« natürlich wesentlich mehr entsprachen, eignen sie sich wohl kaum als Vorbilder für die Milliarden Menschen, die heute auf Erden leben.
Ich blicke noch einmal auf den Stapel Papiere, den Arias mir gegeben hat, dann auf ihre Uhr, dann auf meine: Es ist an der Zeit zu gehen. Seit Monaten hatte ich Aufsätze von Soziologen und Anthropologen gelesen, die behaupten, dass Zeit ein »soziales Konstrukt« sei, was ich als so etwas wie »künstlich aromatisiert« ausgelegt hatte. Doch nun verstand ich: Zeit ist ein soziales Phänomen. Und dieses Merkmal ist nichts, das der Zeit bloß indirekt zu eigen wäre: Es ist das Wesen von Zeit. Zeit, ob in Einzellern oder in Vielzellern wie uns Menschen, ist der Motor von Interaktion. Eine einzelne Uhr funktioniert nur dann, wenn sie sich früher oder später, offensichtlich oder nicht, auf andere Uhren um sie herum bezieht. Darüber kann man sich aufregen, und wir tun das zur Genüge, doch ohne Uhr und ohne die Zeit als Dirigent echauffiert sich ein jeder still und für sich.
Start Fußnote
8 Anm. d. Übers.: Jeremy Rifkin, Uhrwerk Universum. Die Zeit als Grundkonflikt des Menschen, aus dem Amerikanischen von Mara Huber, München, 1988, S. 23.
9 ibd., S. 27.
10 Anm. d. Übers.: Zitiert aus Lustspiele des Markus Accius Plautus,in alten Sylbenmaaßen deutsch wiedergegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen von Georg Gustav Samuel Köpke, Bd. 1, Berlin, 1809, S. XX.
DIE TAGE
DIE TAGE
So begann dieser endlose Tag. Ihn in seiner Gänze zu beschreiben wäre zu mühsam. Eigentlich geschah nichts, und doch gab es keinen bedeutsameren Tag in meinem Leben. Ich durchlebte tausend Jahre, ein jedes so qualvoll wie das andere. Ich gewann wenig und verlor viel. Am Ende des Tages – wenn man denn sagen kann, er habe ein Ende gehabt – konnte ich nur behaupten, noch am Leben zu sein. Unter den gegebenen Umständen hatte ich kein Recht, mehr zu erwarten.
Admiral Richard Byrd, Alone
Wenn ich nachts aufwache, bin ich versucht, auf die Uhr zu sehen, obwohl ich schon weiß, wie spät es ist, denn ich wache immer zur gleichen Zeit auf: vier bis zehn Minuten nach vier. Ein paar Nächte hintereinander geschah es befremdlicherweise genau um 4.27 Uhr. Ohne nachzusehen, kann ich die Zeit herleiten, im Winter von dem Ping, das der Radiator im Schlafzimmer macht, wenn er sich wieder aufheizt, oder von dem großen Abstand, in dem die Autos vorbeifahren. Proust schrieb:
Im Schlaf versammelt der Mensch um sich im Kreise den Lauf der Stunden, die Ordnung der Jahre und der Welten. Er zieht sie instinktiv zu Rate, wenn er aufwacht, und liest in einer Sekunde daraus ab, an welchem Punkt der Erde er sich befindet, wieviel Zeit bis zu seinem Erwachen verflossen ist …11
Das tun wir ständig, wissentlich oder nicht. Psychologen nennen das die »temporale Orientierung«. Sie kennzeichnet den »erwachsenen« Zeitsinn, das heißt unsere Fähigkeit, die Uhrzeit, den Tag oder das Jahr zu wissen, ohne auf die Uhr zu sehen oder in einen Kalender zu blicken. Wie wir diese Orientierung entwickeln, hat man im Rahmen unzähliger Studien herauszufinden versucht. Bei einem Experiment stellten Forscher Passanten auf der Straße eine simple Frage – »Welcher Tag ist heute?« – oder konfrontierten sie mit einer Richtig/Falsch-Aussage wie »Heute ist Dienstag« und fanden dabei heraus, dass der richtige Tag sehr viel schneller dann angegeben wird, wenn die Befragung kurz vor oder an einem Wochenende stattfindet. Einige finden die richtige Antwort, indem sie zurückblicken – »Gestern war X, also muss heute Y sein« –, andere, indem sie auf den bevorstehenden Tag vorausblicken. Welche Richtung sie einschlagen, hängt davon ab, welches Wochenende näher liegt, das vergangene oder das kommende. Man berechnet das Heute also eher dann am Gestern, wenn heute Montag oder Dienstag ist; je näher das Heute am Freitag liegt, desto eher wechselt der Bezugspunkt zum Morgen.
Vielleicht positionieren wir uns ja stets mithilfe von temporalen Bezugspunkten. Wir orientieren uns am Wochenende wie an einer Insel am Horizont vor oder hinter uns und bestimmen auf diese Weise unsere Position im Meer der Tage. (In diesem Zusammenhang ist vielleicht erwähnenswert, wie oft wir von Zeit in räumlichen Dimensionen sprechen: Das nächste Jahr ist noch »weit weg«, das 19. Jahrhundert liegt »weit zurück«, mein Geburtstag »nähert« sich, so als säße man im Zug und er sei der Bahnhof.) Oder wir stellen im Kopf eine Liste der Tage auf, die heute sein könnten, und streichen so lange ungeeignete Kandidaten aus, bis nur noch einer übrig bleibt. (»Es könnte Dienstag sein, jedenfalls ist es definitiv nicht Mittwoch, denn mittwochs gehe ich immer ins Fitnessstudio, und ich habe keine Sporttasche dabei.«) Doch keines dieser Beispiele erklärt, wieso sich unser temporaler Bezugspunkt in der Wochenmitte umstellt – warum retrospektive Gedanken mit dem Fortschreiten der Woche abnehmen. Unabhängig davon, wie wir es tun, betreiben wir solche Orientierungsversuche buchstäblich nonstop, quer durch die Sekunden, Minuten, Tage, Jahre hindurch. Wir erwachen aus einem Traum, verlassen das Kino, blicken von einem fesselnden Buch auf und denken: Wo bin ich? Wann bin ich? Wir verlieren unser Zeitgefühl und brauchen einen Moment, um uns wieder zu positionieren.
Auch wenn ich mitten in der Nacht erwache und ohne auf die Uhr zu sehen weiß, wie spät es ist, könnte das durch simple Induktion geschehen: Als ich das letzte Mal mitten in der Nacht aufwachte, war es 4.27 Uhr, genauso war es vorletztes Mal gewesen, also ist es wahrscheinlich auch jetzt 4.27 Uhr. Die Frage ist, wieso oder wie kann ich so konstant sein? William James schrieb:
Mein ganzes Leben lang staunte ich über die Präzision, mit der ich Nacht für Nacht und Morgen für Morgen zur exakt gleichen Minute erwache, wiewohl die Gewohnheit vom Zufall bestimmt ist.12
Unter all meinen wachen Momenten ist es dieser, in dem ich mir bewusst werde, dass ich im Dienst von etwas stehe: Da ist eine Maschine in mir, oder vielleicht bin ich der Geist in einer Maschine.