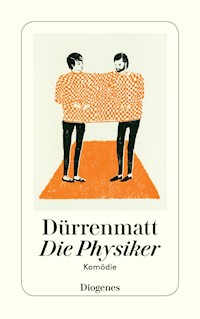17,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kommode Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
David Starr Jordan war ein Professor für Taxonomie. Ein Mann, der sich mit der Einordnung der Lebewesen in systemischen Kategorien befasste, der davon besessen war, Ordnung in die natürliche Welt zu bringen. Im Laufe der Zeit wurde ihm die Entdeckung und Benennung von fast einem Fünftel aller Fische zugeschrieben, die den Menschen dieser Zeit bekannt waren. Doch je mehr er Elemente des verborgenen Bauplans des Lebens entdeckte, desto mehr schien das Universum ihn daran hindern zu wollen. Seine Sammlungen wurden durch Blitzschlag, Feuer und schließlich 1906 durch das Erdbeben in San Francisco zerstört, bei dem mehr als tausend in zerbrechlichen Gläsern aufbewahrte Funde zu Boden stürzten. In einem Augenblick war sein gesamtes Lebenswerk zerstört. Viele hätten in diesem Moment vielleicht aufgegeben und wären verzweifelt. Aber nicht Jordan. Er betrachtete die Trümmer zu seinen Füßen, fand den ersten Fisch, den er damals benannte, und begann zuversichtlich, seine Sammlung wieder aufzubauen. Als die NPR-Reporterin Lulu Miller diese Anekdote zum ersten Mal im Vorbeigehen hörte, hielt sie Jordan für einen Narren – ein abschreckendes Beispiel für Selbstüberschätzung oder Verleugnung. Doch während sie ihr eigenes Leben langsam entwirrte, begann sie, sich über ihn Gedanken zu machen. Vielleicht war er stattdessen ein Vorbild dafür, wie man weitermacht, wenn alles verloren scheint. Was sie nicht wusste: alles, was sie über sein Leben herausfinden würde, würde ihr Verständnis von Geschichte, Moral und der Welt unter ihren Füßen tiefgreifend verändern. Teils Biografie, teils Memoiren, teils wissenschaftliches Abenteuer: "Warum es keine Fische gibt: Eine Geschichte von Verlust, Liebe und der verborgenen Ordnung des Lebens" ist eine wundersame Fabel über das Durchhalten in einer Welt, in der das Chaos immer die Oberhand behalten wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Ähnliche
Lulu Miller
Warum es keine Fische gibt
Eine Geschichte von Verlust, Liebe und der verborgenen Ordnung des Lebens
1. Auflage
© 2023 Kommode Verlag, Zürich
Alle Rechte vorbehalten.
Originaltitel: Why Fish Don’t Exist,
Simon & Schuster, 2020
Übersetzung: Sabine Wolf
Illustrationen: Kate Samworth
Lektorat: Patrick Schär/torat.ch
Korrektorat: Kristina Wengorz/torat.ch
Titelbild, Gestaltung und Satz: Anneka Beatty
Druck: Beltz Graphische Betriebe
ISBN 978-3-905574-19-7
eISBN 978-3-905574-26-5
Kommode Verlag GmbH, Zürich
www.kommode-verlag.ch
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert im Rahmen des Programms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Lulu Miller
Warum es keine Fische gibt
Eine Geschichte von Verlust, Liebe und der verborgenen Ordnung des Lebens
Aus dem Englischen von Sabine WolfIllustrationen von Kate Samworth
Dad, für Dich.
INHALT
Prolog
1. Ein Junge mit dem Kopf in den Sternen
2. Ein Prophet auf einer Insel
3. Gottloses Intermezzo
4. Auf Frauenfang
5. Genesis im Glas
6. Krachbumm
7. Das Unzerstörbare
8. Über die Einbildung
9. Das bitterste Zeug der Welt
10. Die reinste Schreckenskammer
11. Die Leiter
12. Löwenzähne
13. Deus ex Machina
Epilog
PROLOG
Denken Sie an den Menschen, den Sie am meisten lieben. Denken Sie daran, wie dieser Mensch auf dem Sofa sitzt, Müsli isst und sich dabei über irgendetwas Bezauberndes aufregt, etwa, wie es ihn nervt, wenn Leute E-Mails mit einem Kürzel unterschreiben, statt sich die abschließende Mühe von ein paar extra Tastenschlägen zu machen –
Das Chaos wird diesen Menschen holen.
Das Chaos wird ihn von außen zerbrechen – durch einen herabstürzenden Ast, einen Raser, eine Kugel – oder von innen auftrennen, durch eine Meuterei seiner ureigenen Zellen. Das Chaos wird Ihre Pflanzen verrotten und Ihr Fahrrad verrosten und Ihren Hund töten. Das Chaos wird Ihre kostbarsten Erinnerungen zersetzen, Ihre Lieblingsstädte stürzen und jeglichen Zufluchtsort, den Sie sich je errichten können, vernichten.
Es ist kein Falls, sondern ein Wann. In dieser Welt ist Chaos die einzig sichere Sache. Der Meister, der über uns alle herrscht. Mein Wissenschaftler-Vater brachte mir schon früh bei, dass es vor dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kein Entrinnen gibt: Entropie nimmt nur zu; sie kann nie abnehmen, egal, was wir tun.
Ein kluger Mensch nimmt diese Wahrheit an. Ein kluger Mensch versucht nicht, gegen sie anzukämpfen.
Doch an einem Frühjahrstag im Jahr 1906 wagte ein groß gewachsener Amerikaner mit Walrossschnurrbart, Meister Chaos herauszufordern.
Der Mann hieß David Starr Jordan, und in vielerlei Hinsicht bestand sein täglich Brot darin, das Chaos zu bekämpfen. Er war Taxonom, die Art von Wissenschaftler, deren Aufgabe es ist, Ordnung in das Chaos der Welt zu bringen, indem sie die Gestalt des großen Lebensbaumes freilegen – jene verzweigte Karte, die offenbaren soll, wie sämtliche Pflanzen und Tiere miteinander verbunden sind. David Starr Jordans Spezialität waren Fische, und er verbrachte seine Tage damit, um die Welt zu segeln, auf der Suche nach neuen Arten. Nach neuen Hinweisen, von denen er sich erhoffte, sie würden mehr über die versteckten Baupläne der Natur verraten.
Jahrelang, jahrzehntelang arbeitete er so unermüdlich, dass er und sein Team schließlich ein ganzes Fünftel der heute bekannten Fische entdecken sollten. Tausendfach zog er neue Arten an Land, dachte sich Namen für sie aus, stanzte die Namen in glänzende Blechschildchen, ließ die Schildchen zu den Präparaten in ethanolgefüllte Gläser sinken und stapelte seine Entdeckungen langsam höher und höher.
Bis an einem Frühjahrsmorgen 1906 die Erde bebte und seine schillernde Sammlung zu Boden schmiss.
Hunderte Gläser zerschellten beim Aufprall. Seine Fischpräparate durch Glasscherben und umgestürzte Regale verstümmelt. Aber am schlimmsten waren die Namen. Die sorgsam platzierten Blechschildchen lagen wahllos über den ganzen Boden verteilt. In einer Art schrecklicher Rückwärts-Genesis hatten sich seine Tausenden fein säuberlich benannten Fische zurückverwandelt in einen riesigen Haufen Unbekanntes.
Doch als Jordan dort in den Trümmern stand, sein zerstörtes Lebenswerk vor den Füßen, tat dieser schnurrbärtige Wissenschaftler etwas Seltsames. Er gab nicht auf und verzagte nicht. Er beachtete nicht weiter, was doch die klare Botschaft des Erdbebens zu sein schien: dass in einer vom Chaos regierten Welt jeder Versuch einer Ordnung zum Scheitern verdammt ist. Stattdessen krempelte er die Ärmel hoch und krabbelte umher, bis er schließlich, von allen Waffen der Welt, eine Nähnadel fand.
Er nahm die Nadel zwischen Daumen und Zeigefinger, fädelte Garn ein und setzte auf einen der wenigen Fische an, die er inmitten der Zerstörung erkannte. Mit einer einzigen fließenden Bewegung stieß er dem Fisch die Nadel in die Kehle und nähte ein Namensschildchen direkt an das Fischfleisch.
Bei jedem Fisch, den er retten konnte, wiederholte er diese winzige Handbewegung. Ab jetzt würde er die Blechschildchen nicht mehr schutzlos in den Gläsern schwimmen lassen. Stattdessen nähte er jeder Kreatur den Namen direkt an die Haut. Ein Name an eine Kehle genäht. Einer an einen Schwanz. Einer an einen Augapfel. Es war eine kleine Neuerung mit dem widerspenstigen Wunsch, dass seine Arbeit nun gegen die Anstürme des Chaos gewappnet wäre, sich seine Ordnung als standhaft erweisen würde, wenn das Chaos das nächste Mal zuschlüge.
•
Als ich zum ersten Mal von David Starr Jordans Attacke gegen das Chaos hörte, war ich Anfang zwanzig und fing gerade als Wissenschaftsjournalistin an. Ich hielt ihn sofort für einen Trottel. Die Nadel mochte bei einem Beben helfen, aber was war mit Feuer oder Hochwasser oder Rost oder irgendeiner der anderen Billionen Zerstörungsarten, an die er nicht gedacht hatte? Seine Innovation mit der Nähnadel wirkte so anfällig, so kurzsichtig, so ungeheuer ahnungslos gegenüber den Kräften, die über ihn herrschten. Er wirkte auf mich wie eine Lektion in Hochmut. Ein Ikarus der Fischesammlung.
Doch als ich älter wurde, als das Chaos mit mir machte, was es wollte, als ich mein eigenes Leben gegen die Wand fuhr und dann versuchte, es wieder zusammenzustückeln, gab mir dieser Taxonom allmählich zu denken. Vielleicht hatte er etwas begriffen – über Beharrlichkeit oder Bestimmung oder einfach, wie man weitermacht –, das ich wissen sollte. Vielleicht war ein wenig Selbstüberschätzung ja in Ordnung. Sich weiter ins Leben zu werfen und einfach auszublenden, wie aussichtslos die eigenen Aussichten waren, vielleicht war das ja nicht das Kennzeichen eines Deppen, sondern – der Gedanke erschien mir sündig – eines Siegers.
Also gab ich an einem Winternachmittag, an dem ich mich besonders desolat fühlte, den Namen David Starr Jordan bei Google ein, und mir begegnete die Sepia-Fotografie eines alten weißen Mannes mit buschigem Walrossschnurrbart. Sein Blick wirkte etwas streng.
Wer bist du?, fragte ich mich. Ein warnendes Beispiel? Oder ein Vorbild? Ich klickte mich durch weitere Bilder von ihm. Da war er als Junge, plötzlich lämmchenhaft, mit üppigen schwarzen Locken und abstehenden Ohren. Da war er als junger Mann, aufrecht in einem Ruderboot stehend, um die Schultern breiter geworden. Und wie er sich in die Unterlippe biss, konnte beinahe als sinnlich gelten. Da war er als großväterlicher alter Mann in einem Sessel und kraulte einen struppigen weißen Hund. Ich sah Links zu Aufsätzen und Büchern, die er geschrieben hatte. Handbücher über das Fischesammeln, taxonomische Studien der Fische Koreas, Samoas, Panamas. Aber es gab auch Essays über das Trinken und Humor und über Bedeutung und Verzweiflung. Er hatte Kinderbücher geschrieben und Satiren und Gedichte und – für die verlorene Journalistin, die in anderer Leute Leben Orientierung suchte, am allerbesten – vergriffene Memoiren mit dem Titel The Days of a Man, vollgestopft mit so vielen Details über besagte Tage besagten Mannes, dass sie in zwei Bände aufgeteilt waren. Das Buch war seit einem knappen Jahrhundert vergriffen, aber ich fand einen Antiquar, der es mir für 27,99 Dollar verkaufte.
Als das Päckchen ankam, fühlte es sich warm an, verzaubert. Als ob es eine Schatzkarte enthielte. Ich durchtrennte das Klebeband mit einem Steakmesser, und zwei olivgrüne Bände kamen hervor, mit goldglänzender Prägeschrift. Ich setzte eine riesige Kanne Kaffee auf und zog mich auf das Sofa zurück, auf dem Schoß den ersten Band, bereit herauszufinden, was aus einem wird, wenn man die Kapitulation vor dem Chaos verweigert.
1.
EIN JUNGE MIT DEM KOPF IN DEN STERNEN
David Jordan wurde 1851 auf einer Apfelplantage im Bundesstaat New York zur dunkelsten Zeit des Jahres geboren, und vielleicht trieben ihn darum später die Sterne so um. »Wenn ich an Herbstabenden Maiskolben schälte«, schrieb er über seine Kindheit, »wurde ich neugierig ob der Namen und Bedeutungen der Himmelskörper.« Er konnte sich nicht einfach an ihrem Funkeln freuen; er empfand sie als ein Durcheinander, in dem er Ordnung brauchte, Wissen. Mit etwa acht Jahren bekam er einen Atlas mit Himmelskarten in die Finger und verglich, was er auf dem Papier sah, mit dem, was er hoch über seinem Kopf sah. Nacht für Nacht ging er nach draußen, schlich sich aus dem Haus und versuchte, die Namen aller Sterne am Firmament zu lernen. Und laut ihm selbst dauerte es nur fünf Jahre, um Ordnung in den gesamten Nachthimmel zu bringen. Zur Belohnung suchte er sich »Starr« als Zweitnamen aus und trug ihn stolz bis an sein Lebensende.
Nachdem er das Himmlische gemeistert hatte, wandte sich David Starr Jordan dem Irdischen zu. Auf dem Land seiner Familie wogten und flossen ganz eigene Konstellationen von Bäumen, Felsbrocken, Hofgebäuden und Viehbestand. Seine Eltern hielten ihn mit allerlei Arbeiten beschäftigt, Schafe scheren, Gestrüpp lichten und – Davids besonderes Fachgebiet – Teppiche aus Flicken nähen (die Beugesehnen seiner Hand lernten früh, eine Nadel zu führen). Aber zwischen diesen Aufgaben fing David an, das Land zu kartieren.
Hilfe holte er sich bei seinem großen Bruder Rufus, dreizehn Jahre älter, ein stiller und sanftmütiger Naturfreund mit dunkelbraunen Augen. Rufus zeigte David, wie man die Pferde beruhigte, ihnen lang den Hals hinunterstrich, und wo man im Dickicht die saftigsten Blaubeeren fand. Fasziniert sah David Rufus dabei zu, wie der die Erde enträtselte; in seinen eigenen Worten empfand er für Rufus »absolute Anbetung«. Allmählich begann David, von allem, was er sah, kleinteilige Karten zu zeichnen. Er zeichnete Karten von der Obstplantage der Familie, von seinem Schulweg, und als er mit dem ihm bekannten Land fertig war, wandte er sich fernen Orten zu. Er zeichnete Karten weit entfernter Gemeinden ab, von Staaten, Ländern, Kontinenten, bis seine hungrigen kleinen Hände über fast jeden Winkel der Erde gekrabbelt waren.
»Der Eifer, den ich damals zeigte«, schrieb er, »war recht beunruhigend für meine Mutter«, eine füllige Frau namens Huldah. Eines Tages hatte sie genug, nahm den ganzen Haufen Karten, verknittert und fleckig von Davids Kinderschweißhänden, und warf ihn weg.
•
Warum? Wer weiß. Vielleicht, weil Huldah und ihr Ehemann Hiram strenge Puritaner waren. Sie brüsteten sich mit märtyrerhaften Leistungen, etwa, nie laut zu lachen oder jeden Morgen vor der Sonne auf dem Feld zu sein. Zeit darauf zu verwenden, Karten von bereits kartierten Ländern anzufertigen, muss ihnen wie eine Frivolität erschienen sein, eine Beleidigung der Nutzung des Tages, besonders, wenn man sich so abrackern musste wie sie, wenn es Äpfel zu pflücken gab und Kartoffeln zu hacken und Flicken zu vernähen.
Oder vielleicht spiegelte Huldahs Missbilligung einfach die damalige Zeit. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam das obsessive Ordnen der Natur allmählich aus der Mode. Das Zeitalter der Entdeckungen hatte vierhundert Jahre zuvor begonnen und 1758 so gut wie sein Ende erreicht, als Carl von Linné, der Vater der modernen Taxonomie, sein Meisterwerk Systema Naturae abschloss, eine Blaupause für sämtliche Verbindungen von Leben. (Auch wenn Linnés Aufstellung vor Fehlern wimmelte: Fledermäuse waren als Primaten geführt und Seeigel als Würmer, um nur ein paar zu nennen.) Als Schiffe häufiger von Hafen zu Hafen fuhren, schwand allmählich der Kitzel, einen Blick auf exotische Exemplare oder Karten zu erhaschen – einst Mittel, um Leute in Läden, Tavernen, Kaffeehäuser zu locken. Auf Kuriositätenkabinetten sammelte sich Staub; die Welt, so hatte es den Anschein, war bekannt.
Oder vielleicht war es doch etwas anderes. Genau zu jener Zeit ratterte ein blasphemischer Text durch die Druckerpressen. Der Ursprung der Arten wurde für die breite Masse 1859 veröffentlicht, just, als der kleine David anfing, die Nase in Richtung Sterne zu recken. Besteht die Möglichkeit, dass Huldah Zeitung gelesen hat, gespürt haben mag, dass die Ordnung der Welt bald zusammenbrechen würde?
Welchen Grund sie auch gehabt haben mag, Huldah gab nicht nach. Mit den zerknüllten Karten in der Faust sagte sie ihrem Sohn, er solle mit seiner Zeit etwas »Relevanteres« anfangen.
Wie ein guter Junge gehorchte er: Er hörte auf, Karten zu zeichnen. Aber wie ein echter Junge tat er es dann doch nicht. Nicht so wirklich.
»Die Landschaft rund um mein Zuhause war sehr reich an Wildblumen«, schrieb er später und wollte wohl der Erde die Schuld an seiner Sünde zuschieben. Auf dem Nachhauseweg von der Schule fing er nun an, gelegentlich einen samtigen blauen Pompon oder seidigen orangefarbenen Stern aus der Wiese zu pflücken. An manchen schnupperte er und warf sie wieder fort, doch manche blieben mitunter etwas länger in seiner Hand und schafften es zurück in sein Kinderzimmer, wo sie dann auf dem Bett lagen und ihn mit der geheimnisvollen Anordnung ihrer Blütenblätter quälten. Das Verlangen, sie zu kennen, ihre Namen, ihre genaue Stelle am Baum des Lebens, versuchte er zu unterdrücken. Und das schaffte er ganz gut, bis die Pubertät kam.
Am ersten Tag in der Mittelstufe schmuggelte David aus der Bibliothek »ein Büchlein über Blumen« nach Hause. Und kaum war er wieder ungestört in seinem Zimmer, saß er an seinem Schreibtisch, vor sich einen Haufen Blumen, Fibel in der Hand, und untersuchte, welche Blumen welche waren, legte ihre Gattung bloß, ihre Art. Mittlerweile bald ein Mann, mit ein paar Haaren auf den Zehen, die Stimme immer tiefer, plagte er seine Mutter, wenn er auf Spaziergängen hin und wieder die wissenschaftlichen Namen von Blumen nannte – Immergrün in Vinca major verwandelte oder Sonnenblumen in Helianthus annuus –, als wollte er sagen, dass sich seine Passion nicht aus ihm herausquetschen ließ, nicht zerknüllt und weggeworfen werden konnte. »Ich mag etwas weit gegangen sein, als ich die günstigerweise weißen Wände meines Zimmers mit den Namen der unterschiedlichen Pflanzen schmückte, die ich nach und nach bestimmte.«
Er begab sich in zweifelhafte Gesellschaft, nämlich in die eines armen Bauern von nebenan namens Joshua Ellenwood, der sich die wissenschaftlichen Namen fast aller Pflanzen der Gegend beigebracht hatte. Für diese Meisterleistung beschimpfte die Nachbarschaft den alten Mann als »faul« und einen »Zeitverschwender«.
David bewunderte ihn ehrfürchtig. Er hängte sich an den alten Mann auf dessen Spaziergängen durch die Natur und versuchte, so viele seiner Kniffe wie möglich zu verinnerlichen – wie sich Arten durch ihre Blattform verrieten oder durch die Anzahl ihrer Blütenblätter oder durch ihren Duft. Nachdem er Joshua kennengelernt hatte, sagte sich David von seiner Liebe für alles Schöne los und verkündete, dass langweilige und unattraktive Blumen – Löwenzahn (Taraxacum officinale) und Hahnenfuß (Ranunculus acris) – die besseren Hinweise auf die Baupläne der Natur gäben. »Die Kleinen«, schrieb er, »auch wenn sie nicht schön sein mögen, bedeuteten mir mehr als hundert Große, die alle gleich waren. Im Unterschied zum ästhetischen Interesse ist es ein besonderer Beweis wissenschaftlichen Interesses, sich um das Versteckte und Unscheinbare zu kümmern.«
Das Versteckte und Unscheinbare.
Gibt David hier vielleicht etwas über sich selbst preis? Auch wenn man es seinen Memoiren kaum anmerkt, konnte die menschliche Welt hart zu ihm sein. Der Historiker Edward McNall Burns schreibt, David habe, nachdem ihn seine Eltern auf ein Internat geschickt hatten, bei den dortigen »Mädchen als nicht allzu vielversprechend gegolten, während andere junge Männer manchmal nächtens in einem Holzkorb in den Schlafsaal der Mädchen gezogen worden sein sollen«. Der arme David erlebte das Wunder eines solchen Korbflugs kein einziges Mal.
Als er älter wurde, schien die Außenwelt brutaler zu werden. Er schrieb, wie er auf einem vereisten See Schlittschuh lief, nur, um dort in ein Gerangel mit einem viel kleineren Jungen zu geraten; wie er singen wollte und sein Musiklehrer ihm empfahl, es aufzugeben; von einem Baseballspiel, an dem er als Sechzehnjähriger teilnahm und das abrupt endete, als er nach einem hoch geschlagenen Ball hechtete und »mit einer gebrochenen Nase vom Feld gebracht wurde, die, weil schlecht gerichtet, immer leicht schief blieb«. Und dann kam seine erste Lehrerstelle, die Schüler eine Gruppe wilder Jungs aus einem nahe gelegenen Städtchen. Wochenlang versuchte David, so etwas wie Ordnung aufrechtzuerhalten, indem er den Unterricht mit einem hölzernen Zeigestock hielt; er fuchtelte damit umher und wollte so die Aufmerksamkeit der Jungen packen, wobei er den schlimmsten hin und wieder sogar den Stock überzog. Zumindest bis die Schüler revoltierten. Sie umzingelten David, schnappten sich seinen treuen Zeigestock und verbrannten ihn.
David schrieb, wie er sich als Kind einzelgängerischeren Vergnügungen zugewendet habe – Abenteuergeschichten und Gedichte las, sich völlig der Aufgabe widmete, seine »Hände zu verschränken und durch sie hindurchzuspringen«. Doch selbst in der Abgeschiedenheit war er nicht sicher. Eines Tages, als David elf Jahre alt war, gerade glücklich versunken in die »zuträgliche Aufgabe, Baumstümpfe auszubrennen«, trat seine ältere Schwester Lucia vor die Tür des Bauernhauses und schrie, wie er sich erinnerte, »dass ich, wolle ich meinen Bruder noch lebendig sehen, ins Haus eilen müsse«.
David war verwirrt. Rufus sollte gar nicht zu Hause sein. Als leidenschaftlicher Sklavereigegner war er vor Kurzem ausgezogen, um sich bei der Unionsarmee zu verpflichten. Doch noch bevor er das Schlachtfeld betreten und Gelegenheit bekommen sollte, die Stärke seiner Überzeugungen zu prüfen, hatte er sich im Übungslager mit einer geheimnisvollen Krankheit angesteckt. Die Krankheit bewegte sich schnell durch seinen Körper, ließ seine Temperatur steigen und überzog seine Haut mit rosafarbigen Flecken – eine Krankheit, deren Ursache und Heilung damals unbekannt waren und die einfach »Armeefieber« hieß. (Jahrzehnte später sollte sie »Fleckfieber« heißen.)
Als David an das Bett seines Bruders kam, kreisten Rufus’ Augäpfel wie Kompassnadeln, und er konnte kaum noch fokussieren. David blieb stundenlang an seiner Seite und beschwor das Schicksal, dem Körper seines Bruders etwas Stärke zurückzugeben.
Am nächsten Morgen wachte Rufus nicht mehr auf.
»Noch immer erinnere ich mich an die lange Zeit der Einsamkeit und Qual nach seinem zu frühen Tod«, schrieb David. »Nacht für Nacht träumte ich, dass es nicht geschehen und er heil und unversehrt zurückgekehrt wäre.«
•
Nach Rufus’ Tod explodierten in Davids Tagebüchern die Farben. Minutiös ausgeführte Skizzen von Wildblumen und Farnen und Efeu und Dornensträuchern und anscheinend jeglichem Stückchen Natur, das er der Welt abjagen konnte. Kunstvoll sind die Zeichnungen nicht; sie sind angestrengt, voller Bleistiftwischer, Tintenflecke, Radiergummispuren und kleiner Risse, wo allzu energisch ausgemalt wurde. Aber in der Unfertigkeit ist sie sichtbar – seine Besessenheit, seine Verzweiflung, die beinahe muskuläre Anstrengung, die er darauf verwendete, die Formen ihm unbekannter Dinge näher zu bestimmen. Unter jeder Zeichnung befindet sich ein wissenschaftlicher Name. Die Tinte fließt plötzlich flüssiger, die Buchstaben laufen mit größerer Beherrschung. Campanula rotundifolia. Kalmia glauca. Astragalus canadensis. David beschrieb das Gefühl, die Namen laut auszusprechen, jene lateinischen Erklärungen von Sieg und Herrschaft: »Ihre Bezeichnungen sind mir wie Honig auf den Lippen.«
Psychologen haben übrigens untersucht, wie lindernd Sammelei in Zeiten seelischen Leides wirken kann. In seinem Buch Sammeln: Eine unbändige Leidenschaft bemerkt der Psychologe Werner Muensterberger, der über Jahrzehnte zwanghafte Sammler betreute, dass sich die Gewohnheit oftmals rasant verstärke, nachdem es in irgendeiner Form zu »Entbehrung, Verlust oder Verletzung« gekommen sei, und dabei jedes neue Objekt dem Sammler einen berauschenden Schwall einer »phantasierten Omnipotenz« verschaffe. Francisca López Torrecillas, die an der Universität Granada seit Jahren zu Sammlern forscht, hat ein ähnliches Phänomen beobachtet, nämlich, dass Menschen, die Stress oder Angst erleben, sich der Sammelei widmen, um ihren Schmerz zu lindern: »Spüren Menschen keine Selbstwirksamkeit, hilft ihnen zwanghaftes Sammeln, sich besser zu fühlen.« Die einzige Gefahr, warnt Muensterberger, sei, dass es – wie bei jedem Zwang – eine Grenze gebe, an der die Gewohnheit vom »Erheiternden« ins »Ruinöse« kippe.
•
Als David größer wurde, sein Brustkorb breiter und sein Mund voller, wuchs auch sein Hunger nach neuen Präparaten. Doch offenbar konnte er niemanden finden, den das interessierte. Egal, wie sehr er lernte, egal, wie viele neue Artennamen er sich beibrachte oder wie viele seiner Aufsätze über Taxonomie veröffentlicht wurden, »in der Schule erfuhr dieses Interesse keinerlei Aufmerksamkeit«. Er schaffte es an die Cornell University, wo er in nur drei Jahren einen Bachelor und einen Master in Naturwissenschaften erwarb. Aber er hatte Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden. Universitäten suchten umgängliche Männer mit gut gebundener Krawatte, die einen Unterrichtsraum mit Schwung und Zeigestock zu beherrschen wussten. Das stille, knieaufgeschürfte, ellenbogendreckige Umherkrabbeln in der Natur, das David so liebte, galt als Kinderspielerei.
Und das hätte es dann sein können für David. Er, verzweifelt zur Blumensammelei getrieben. Die Welt, vom Wert seiner Berufung nicht überzeugt. Die Zeit wäre dahingegangen, während er sich langsam tiefer und tiefer in eine beblätterte Einsamkeit vergraben hätte.
Hätte er nicht Penikese Island betreten.
2.
EIN PROPHET AUF EINER INSEL
Penikese Island liegt zweiundzwanzig Kilometer vor der Küste von Massachusetts. Mit kaum anderthalb Kilometern Länge und so gut wie keinem Baumbestand zum Schutz vor der brennenden Sonne wurde das Eiland schon als »Kümmerling« einer Inselkette bezeichnet, als »trauriger und einsamer kleiner Felsen« und »Vorposten der Hölle«.
Doch aus irgendeinem Grund haben sich an diesen kahlen Ufern Menschen immer wieder der Hoffnung verschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Insel eine Leprakolonie, unter Aufsicht eines Arztes, der nach einer Heilung für seine Schutzbefohlenen suchte. In den 1950er-Jahren wurde die Insel zu einem Vogelschutzgebiet, wo Naturforscher das Schicksal einer schwindenden Seeschwalbenpopulation umzukehren suchten. In den 1970er-Jahren wurde die Insel eine Reformschule für straffällige oder problematische oder verhaltensauffällige Jungen (der Name abhängig vom jeweiligen Jahrzehnt), von der sich der Gründer – ein Marinesoldat und Fischer – erhoffte, ein Regime von Abgeschiedenheit, körperlicher Arbeit, Tierhaltung, Bootsbau, gemeinschaftlichem Leben und Schularbeit könne aus »vielen potenziellen Mördern noch Autodiebe« machen. Als ich schließlich von der Insel erfuhr, war sie ein Heroinentzugszentrum, wo Süchtige versuchen konnten, ein für alle Mal von der Droge loszukommen. Doch vor alldem, damals zu David Starr Jordans Zeiten, welche Gruppe suchte da auf dem einsamen kleinen Felsen ihr Heil? Naturkundler.
1873, als David ein frischgebackener Cornell-Absolvent war, befand sich einer der berühmtesten Naturforscher jener Zeit, Louis Agassiz, in ernster Sorge um die Zukunft seines Berufsstandes. Agassiz war ein Schweizer Geologe, ein charismatischer Bär von Mann mit buschigen Koteletten, der sich seinen Ruhm als einer der frühesten Fürsprecher der Eiszeittheorie verdient hatte. Die Vorstellung einer eisbedeckten Erde hatte Agassiz erst angenommen, nachdem er akribisch Fossilien und Schleifspuren im Felsgestein untersucht hatte. Das überzeugte ihn, dass die beste Methode zur Vermittlung von Wissenschaft sei, eingehend die Natur zu untersuchen. »Studiere die Natur, nicht die Bücher«, lautete sein Motto, und er war dafür bekannt, Studenten mit toten Tieren in einen kleinen Raum zu sperren und sie erst wieder herauszulassen, wenn sie »alle in den Objekten enthaltenen Wahrheiten« entdeckt hatten.
Mit Anfang vierzig trat Agassiz eine Stelle in Harvard an, und die Lage vor Ort besorgte ihn. Kein Herumwühlen im Dreck, keine mit modernden Winzkadavern eingesperrten Studenten. Nur Aufsätze und Prüfungen und Vorträge, um die in Fachbüchern abgedruckten Glaubenssätze nachzubeten. Dieser Ansatz beunruhigte Agassiz, der warnte, »Wissenschaft« könne »Glauben generell nicht ausstehen«. So glaubten noch bis in die 1850er-Jahre viele geachtete Wissenschaftler beispielsweise an die Vorstellung der »Spontanzeugung« – die Überzeugung, Flöhe und Maden könnten aus Staubkörnern entspringen; wenige Jahrzehnte zuvor hatten Wissenschaftler an eine magische Substanz namens »Phlogiston« geglaubt, die darüber bestimmte, ob ein Material brennbar war; und die Menschen kannten noch immer kein Mittel, um ihre Liebsten und Nächsten vor mysteriösen Krankheiten wie dem »Armeefieber« zu schützen, da Bakterien als Ursache der Krankheit noch nicht entdeckt worden waren. Nein, gab man sich mit den Glaubensüberzeugungen jener Tage zufrieden, so Agassiz’ Befürchtung, hielt einen das klein, kümmerlich, krank. Der Ausweg, der Weg zur Aufklärung, lag darin, die Felsen und Farne und Felle dieser Welt weiter zu betrachten, näher, länger.
Und so träumte Agassiz davon, ein Refugium zu schaffen, wo er diese Missstände würde korrigieren können, eine Art Sommerlager für junge Naturforscher, wo er die Kunst der direkten Beobachtung draußen in der Natur würde unterrichten können. Und als 1873 ein wohlhabender Grundbesitzer anbot, Penikese Island für die Sache zu stiften, packte Agassiz die Gelegenheit beim Schopf.
Die Lage des Eilands war ideal: eine Stunde vom Festland entfernt, leicht genug erreichbar, aber weit genug weg, um sich frei zu fühlen. Ebenso seine Größe: groß genug, um herumzustreifen, aber klein genug, um sich nie zu verlaufen. Und was die verfügbaren Lehrgegenstände auf Penikese Island betraf? Wo sollte man bloß anfangen. Die baumlosen Ufer bedeckte dichtes Seegras, das sich im Wind wiegte und vor Schätzen raschelte – Krabben, Libellen, Schlangen, Mäuse, Regenpfeifer, Käfer, Eulen. Dann waren da die Tidentümpel, schlickig vor lauter Schnecken und Tang und Seepocken. Und, vielleicht Agassiz’ Lieblinge, die großen hellen Felsbrocken, wie grobe Zähne über die ganze Insel verstreut, manche fast fünf Meter hoch, deren Schleifspuren verrieten, in welche Richtung sich ein mächtiger Gletscher gut zwanzigtausend Jahre zuvor geschoben hatte. Und schließlich war da noch das lieblich plätschernde Meer selbst. Eine strahlend blaue Servierplatte voll endloser Reichtümer – Seesterne, Quallen, Austern, Seeigel, Rochen, Pfeilschwanzkrebse, Seescheiden, Meeresleuchten und Fische um herrliche, glitschige, schimmernde Fische. Die Netze der Naturkundler würden nie leer sein. Für jemanden, der die Nutzung der Natur selbst zu unterrichten hoffte, war der Ort eine Goldmine.
Während Agassiz anfing, Bauholz auf die Insel zu schaffen, saß David Starr Jordan im weit entfernten Galesburg, Illinois, und las Zeitung. Endlich hatte er eine Anstellung gefunden und unterrichtete Naturwissenschaften an einer kleinen christlichen Universität namens Lombard College. Aber es ging ihm jämmerlich. Geografisch wie seelisch fühlte er sich einsam. Im Kollegium wurde er dafür kritisiert, dass er die gotteslästerliche Eiszeittheorie unterrichtete und, schlimmer noch, dass er die Studenten Laborinstrumente benutzen und »Chemikalien verschwenden« ließ. Es war kalt in Illinois, und das Land war platt, und ihm fehlten die blühenden Schluchten seiner Jugend. Doch eines dunklen Morgens im Vorfrühjahr blätterte er in seiner Zeitung und stieß auf eine Anzeige für einen »Kurs in der Unterweisung in die Naturhistorie, abgehalten an der Meeresküste«, von niemand anderem als Louis Agassiz höchstpersönlich.
Ich stelle mir vor, wie David seinen Frühstückskaffee durch die Nase prustet – nur wäre es kein Kaffee gewesen, denn er war lebenslanger Abstinenzler (und verzichtete nicht nur auf Alkohol und Tabak, sondern sogar auf Koffein, wegen dessen gefährlicher wahrnehmungsverändernder Eigenschaften). Also mag er Wasser geprustet haben oder Kräutertee oder sonst etwas, vor lauter Ungläubigkeit ob eines solchen Ortes. Er bewarb sich, so schnell er konnte. Innerhalb weniger Wochen kam die schriftliche Zusage, sein Ausweg aus Illinois, von Agassiz eigenhändig unterschrieben.
•
Nur wenige Monate später, am 8. Juli 1873, betrat David Starr Jordan in New Bedford, Massachusetts, einen Landungssteg und sah zum ersten Mal in seinem Leben das Meer. Er war zweiundzwanzig Jahre alt.
Langsam versammelten sich auf dem Anleger immer mehr Naturforscher, junge Männer wie Frauen. Es war ein schöner Morgen. Die Bucht war still, der Himmel strahlend blau. Ein Schleppschiff war zu ihnen unterwegs, um sie zu dem entlegenen Flecken am Horizont zu bringen. Die Laufplanke wurde ausgeklappt, und die fünfzig jungen Forscher gingen an Bord. Nur die Zeit weiß, worüber die Inselbesucher sprachen, als sie in die Wellen tuckerten. Vielleicht fragten sie einander, welchem Reich sie jeweils die Treue schworen: Tier, Pflanze oder Mineral? Auf die Frage hätte David womöglich einen seiner Lieblingswitze gebracht, er sei wegen des dichten Efeus um sein Elternhaus »Botaniker aus Selbstverteidigung« geworden. Oder vielleicht stand er auch wie festgeklebt an der Reling und suchte in den grauen Wellenhügeln nach aufblitzenden Tieren; später bekannte er eine dauerhafte Schüchternheit in jenen Jahren, eine Scheu vor neuen Orten; vielleicht tröstete er sich mit der uralten Technik, Zuflucht in der Natur zu finden.
Nach etwa einer Stunde drosselte der Schlepper die Motoren und näherte sich dem Inselufer. Von Deck aus konnte David den Umriss eines langen Steges mit einem Menschen an der Spitze erkennen. Er schrieb:
Keiner von uns wird je diesen ersten Anblick von Agassiz vergessen. Wir waren frühmorgens mit einem kleinen Schlepper aus New Bedford angereist, und Agassiz erwartete uns an der Anlegestelle der Insel. Er stand fast allein an dem kleinen Anleger, und sein großes Gesicht strahlte vor Freude …
Seine hochgewachsene, kräftige Gestalt, die breiten Schultern unter dem Gewicht der Jahre ein wenig gebeugt, sein großes rundes Gesicht, von gütigen dunkelbraunen Augen erleuchtet, sein fröhliches Lächeln … Als wir an Land kamen, begrüßte er uns überaus warmherzig. Er blickte uns in die Gesichter, wie um sich zu vergewissern, dass er unter den vielen, die er hätte wählen können, uns gewählt hatte.
Nachdem er jeden Studenten händeschüttelnd begrüßt hatte, führte »der große Naturkundler« sie den Hügel hinauf, um ihnen das neu errichtete Wohnheim zu zeigen. Der Bau hatte länger gedauert als erwartet, und das Gebäude befand sich nicht im besten Zustand. Es hatte noch keine Fensterscheiben und auch keine Dachschindeln, und die Wand, die den Schlafraum der Männer von dem der Frauen trennen sollte, war bislang nur ein fadenscheiniges Segeltuch, das von einem Dachbalken hing.
Einige Studenten waren entsetzt. Auf Frank H. Lattin, einen jungen Vogelbeobachter aus Rochester, wirkte die Insel mit ihrer »trostlosen« Lage, den klapprigen Bauten und der unentrinnbaren Sonne wie eine Art Hölle: »An und für sich war es ein überaus reizloser Ort, und anfangs konnte ich mich kaum selbst überzeugen, wie ich meinen Aufenthalt dort genießen sollte.«
Doch das Auge, dieses raffinierte Organ, zeigt unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge. Denselben heißen Erdboden fand David betörend, im goldenen Sand glitzerten geheimnisvolle Muscheln, Schwämme, Algen. Während die Studenten allmählich lockerer wurden, flirteten, sich in den langen Pritschenreihen ein Bett aussuchten, stahl sich David hinunter ans Ufer und tauchte die Hand zum ersten Mal in Salzwasser. Er las einen glatten schwarzen Stein auf, dann einen grünlichen, und in seinem Kopf machte sich Panik breit: »›Ist das Hornblende?‹ ›Und das da Epidot?‹ ›Wie unterscheidet man die denn?‹«
Bald wurde er zu einem zweiten Frühstück mit dem Rest der Gruppe in die Scheune gerufen. Die Schafe hatte man erst wenige Tage zuvor herausgetrieben – und durch Tische ersetzt –, und das Gebäude muss nach Heu, Urin, Gras, Leben gerochen haben. Über ihren Köpfen in den Dachsparren hingen noch Spinnennetze und Schwalbennester. Hier sollte ihr Hauptunterrichtsraum für den Sommer sein. Die Studenten setzten sich an die Tafel und schwatzten, während sie hungrig aßen. Womöglich bekam David bei diesem Frühstück flüchtig kastanienbraunes Haar zu sehen, das einer jungen Botanikerin aus Massachusetts namens Susan Bowen gehörte. In jenem Sommer sollten sich die beiden anfreunden und bei Mondschein gemeinsam die Inselufer erkunden, knöcheltief durch die dunklen Wellen waten, um grünes Meeresleuchten zu entfachen.
Als die Mahlzeit ihrem Ende zuging, erhob sich Agassiz und hielt eine Willkommensrede. Laut David waren diese Segensworte so schön, dass sie unbeschreiblich blieben. »Was Agassiz an jenem Morgen sagte, kann nie wieder gesagt werden.«
Zu unserem Glück war auch der berühmte Dichter John Greenleaf Whittier in jenem Sommer dabei und teilte Davids Einschätzung nicht. Whittier würde später das Gedicht »The Prayer of Agassiz« veröffentlichen, das ebendiese Rede nacherzählt. Er beginnt mit ein wenig Szenografie –On the isle of Penikese / Ringed about by sapphire seas – und kommt dann auf den Punkt, Agassiz’ A und O, warum nämlich Sammeln wichtig sei.
Said the Master to the youth:
»We have come in search of truth,
Trying with uncertain key
Door by door of mystery:
We are reaching, through His laws,
To the garment-hem of Cause,
Him, the endless, unbegun,
The Unnamable, the One,
Light of all our light,
the Source, Life of life,
and Force of force.
As with fingers of the blind,
We are groping here to find
What the hieroglyphics mean
Of the Unseen in the seen.«
Ich habe es nie so mit Gedichten gehabt, aber wenn ich die Großschreibungen hier richtig entschlüssele, dann suchten die Taxonomen im Begucken ihrer kostbaren Halme und Steine und Schnecken niemand Geringeres als …
Den Unnennbaren, den Einen, die Quelle, die Kraft, die Wahrheit, den Unsichtbaren …
Gott!
Und tatsächlich ist Agassiz in seinen Schriften deutlich: Er glaubt, jede einzelne Spezies sei »ein Gedanke Gottes« und die Arbeit der Taxonomie bestehe buchstäblich darin, »die Gedanken des Schöpfers … in menschliche Sprache zu übersetzen«.
Konkret glaubte Agassiz, in der Natur verberge sich eine himmlische Hierarchie von Gottes Geschöpfen, die, erst einmal erkannt, der moralischen Unterweisung dienen würde. Die Vorstellung eines in der Natur verborgenen Moralkodexes – einer Hierarchie, einer Leiter oder »Gradation« von Perfektion – begleitet uns schon sehr lange. Aristoteles malte sich eine heilige Leiter aus – später zur Scala Naturae latinisiert –, auf der sich sämtliche lebenden Organismen in einem Kontinuum vom Niederen bis zum Göttlichen anordnen ließen, mit dem Menschen an der Spitze, gefolgt von Tieren, Insekten, Pflanzen, Steinen und so weiter. Agassiz glaubte auch, dass man, wären diese Organismen erst in die richtige Ordnung gebracht, nicht nur die Pläne eines heiligen Schöpfers erblicken könne, sondern vielleicht sogar Weisungen, um ein besserer Mensch zu werden.
Manche Hierarchien erschienen Agassiz offenkundig. Körperhaltung zum Beispiel. Der Mensch bewies seine Überlegenheit durch seinen Stand, »den Blick himmelwärts«, wohingegen Fische »bäuchlings im Wasser« lagen. Andere Hierarchien waren subtiler. Betrachten wir den Papagei, den Vogel Strauß und einen Singvogel. Welcher der drei steht auf der Leiter am höchsten? Könnte man dieses Rätsel lösen, dachte sich Agassiz, würde man erfahren, was Gott wichtiger war: Sprache, Größe oder Gesang. Aber wie löste man das Rätsel nur? Nun, da fing der Spaß an. Da griff man zu Mikroskopen und Lupen. Mithilfe von Maßstäben, die Agassiz für objektiv befand – etwa »die Komplexität oder Einfachheit ihrer Struktur« oder »die Art ihrer Beziehungen zur Umwelt« –, ließen sich Organismen in die richtige Ordnung bringen. So punkteten beispielsweise Eidechsen stärker als Fische, weil sie »ihren Nachkommen größere Fürsorge zukommen« ließen. Parasiten waren derweil eindeutig zwielichtiges Pack, alle miteinander. Man musste sich nur ansehen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestritten: Sie schnorrten und betrogen und schmarotzten.
Doch die kostbarsten Lektionen, so Agassiz, lägen verborgen unter der Haut. An irgendeinem Punkt seiner Vorlesung auf Penikese Island warnte er seine Studenten sicherlich vor den Gefahren der Oberbekleidung – welche Schuppen oder Federn oder Stacheln eine Kreatur auch immer trug. Dieses äußere Gewand könne eine gefährliche Ablenkung sein, eine falsche Fährte, die den Taxonomen dazu verleite, Ähnlichkeiten zwischen Wesen zu sehen, wo keine bestanden (Igel und Stachelschweine etwa: äußerlich so ähnlich, innerlich Welten voneinander entfernt). Agassiz erklärte, den Weg zu Gott fände man am besten mit einem Skalpell. Um die Haut zu öffnen und hineinzuschauen. Dort würde man die »wahren Beziehungen« der Tiere entdecken. In ihren Knochen, ihrem Knorpel, ihren Eingeweiden. Ebendort offenbarten sich die göttlichen Gedanken am deutlichsten.
Fische zum Beispiel. All die Fische, die just in jenem Augenblick nicht weit von der Scheune umherschwammen. Griff man sich einen aus dem Ozean und nahm ihn aus, würde man eine recht klare Botschaft von Gott entdecken: »Wir können die mögliche Degradierung und das moralische Elend des Menschen nicht verstehen, solang wir nicht wissen, dass seine körperliche Natur ihren Ursprung bei den Fischen hat.« Der erschreckend ähnliche Skelettaufbau von Fischen (ihre Schädel, ihre Rückenwirbel, ihre rippenartigen Vorwölbungen) war laut Agassiz eine Warnung an den Menschen. Sie dienten als schuppige Mahnung, wie weit eine Person abrutschen konnte, falls sie ihren niederen Trieben nachgab: »Es liegt beim Menschen, die ihn von den Fischen unterscheidenden moralischen und intellektuellen Gaben zu gebrauchen oder zu missbrauchen … Er kann bis in die untersten Niederungen absinken oder zu geistiger Größe aufsteigen.« Als Agassiz älter wurde, ließ er minimal von der Idee der Artkonstanz ab, um Raum für ein Konzept zu schaffen, das er »Degeneration« nannte. Er befürchtete, selbst die höchsten Kreaturen könnten von ihrem Rang stürzen, nähmen sie sich nicht in Acht, und schlechte Angewohnheiten könnten irgendwie bewirken, dass eine Spezies körperlich und kognitiv verfiel.
Und so präsentierte Agassiz die Natur als heiligen Text. Selbst die lahmste Schnecke oder Pusteblume konnte spirituelle und moralische Orientierung geben, waren Menschen nur neugierig genug, um hinzuschauen. In ihrer Gesamtheit ergaben all diese Botschaften einen kunstvollen, Ehrfurcht gebietenden Plan, den Agassiz als göttlich bezeichnete. Gottes fabelreiche Erklärung der Bedeutung von allem, über die Einstufung aller Organismen hinaus, nichts weniger als der Wegweiser – geschrieben in verzwickter Moral – gen Himmel.