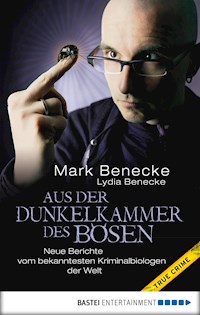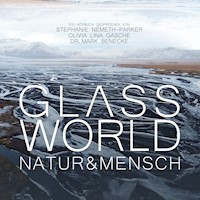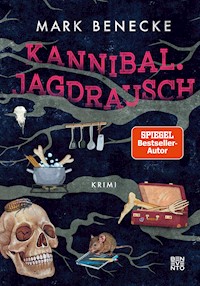12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe Life
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wissen Sie, warum schnarchende Studierende schlechtere Klausuren schreiben? Warum sich Männer in der Anzahl ihrer Sexualpartnerinnen verschätzen? Oder warum sich dumme Menschen besonders attraktiv finden?
Im Auftrag des Komitees des Spaß-Nobelpreises hat sich Mark Benecke auf die Suche nach Erklärungen viele weiterer Rätsel gemacht. Und zeigt dabei einmal mehr: Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet nicht zwangsläufig nur Zählen, Messen und Dokumentieren, sondern kann absolut spannend sein! In diesem Band zeigt Mark Benecke die verrücktesten und skurrilsten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dabei gilt das Motto: Erst lachen, dann nachdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Einleitung
Alte Männer verschätzen sich in der Anzahl ihrer Sexualpartnerinnen
Klebrige Duschvorhänge
Bernoulli und die Bananenflanken
Tödliche Getränkeautomaten
Lehrende laufen Gefahr, sich in Studentinnen zu verlieben
Ausziehungskraft junger Frauen
Kekse für Kenner
Neurobiologie und Psychophysik von Sprudelwasser
Mozarts Flüche
Jobzufriedenheit ist genetisch
Geruchskarten
Viel THC ist besser als wenig THC
Gib ihm Scharfes
Humor ist nicht erblich
Die Eheformel
Nackte verhindern Nachdenken
Staubige Vögel
Hühner bevorzugen schöne Menschen
Mücken und Limburger Käse
Schlafzimmer spiegelt die Seele
Eiskalte Penisknochen
Spuckende Igel
Frauenversteher und Pornografen
Taxifahren in Nigeria
Wer trinkt, verdient mehr
Große Füße
Köstliche Kaulquappen
Später sterben spart Steuern
Murphys Gesetz
Wer dumm ist, findet sich prima
Worüber Menschen in China lachen
Blutegel und saure Sahne
Individualität bei Goldfischen
Sex mit tätowierten Christen
Gepiercte Soziologen
Männer mit Milchschokolade
Alkohol liebende Ratten leben länger (Finnland)
Kneipenbrutalität bei Engländerinnen
Anagramme im Liegen
Fehlende Vorhäute
Gierige Suppen
Meteoriten und Lottoglück
Gefühle im Ohr
Fotoblinzler
Gaffende Laffen
Trinken macht schlau
Schöne Professoren lehren besser
Verständliche Wissenschaft
Der Name steuert das Leben (und den Ball)
Zitronenbier
Verliebt oder verrückt?
Tischtanzende Trinkgelder
Schoßtanzgefahren
Hardcore-Einparken
Springende Füchse im Krankenhaus
Juckmatrix gegen freien Willen
Wissenschaftliche Begriffe
Veröffentlichungen des Autors (Auswahl)
Über das Buch
Die verrücktesten Erkenntnisse vom Spaß-Nobelpreis
Wissen Sie, warum schnarchende Studierende schlechtere Klausuren schreiben? Warum sich Männer in der Anzahl ihrer Sexualpartnerinnen verschätzen? Oder warum sich dumme Menschen besonders attraktiv finden? Im Auftrag des Komitees des Spaß-Nobelpreises hat sich Mark Benecke auf die Suche nach Erklärungen viele weiterer Rätsel gemacht. Und zeigt dabei einmal mehr: Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet nicht zwangsläufig nur Zählen, Messen und Dokumentieren, sondern kann absolut spannend sein! In diesem Band zeigt Mark Benecke die verrücktesten und skurrilsten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dabei gilt das Motto: Erst lachen, dann nachdenken.
Über den Autor
Dr. Mark Benecke, geb. 1970, Kriminalbiologe, arbeitet als Molekularbiologe und Wirbellosenkundler an rechtsmedizinischen Fragen und der Biologie des Todes, ist Gastdozent und -professor an Universitäten in den USA, den Philippinen, Vietnam und Kolumbien sowie Ausbilder an Polizeiakademien und Gast u. a. an der FBI-Akademie und der »Body Farm«.
Er leitet kriminalistische Spezialausbildungen in den USA und Kanada, unter anderem zur Auswertung von Blutspritzmustern; ist Autor von Übersichtsartikeln zu genetischen Fingerabdrücken und rechtsmedizinisch-kriminalistischer Gliedertierkunde. Zudem besitzt er ein umfangreiches Forschungsarchiv zur Kriminalgeschichte im Nachkriegsdeutschland, ist insektenkundlicher Gutachter in bekannten Kriminalfällen und gewähltes Mitglied internationaler Forschungsakademien, darunter der ältesten Naturforschungsvereinigung, der Linnean Society of London der International Academy of Legal Medicine und der American Academy for Forensic Sciences.
Als sei dies nicht genug, betätigt sich Mark Benecke als Gastherausgeber des Sonderbandes »Forensic Entomology« für Forensic Science International und fungiert als wissenschaftlicher Berater für zahlreiche Fernsehsender.
Er wurde mit der Ehren-Kriminalmarke des »Bundes Deutscher Kriminalbeamter« ausgezeichnet. Neben Artikeln in Fachzeitschriften publiziert er regelmäßig in Tages- und Wochenzeitungen, darunter FAZ, SZ, Die Welt, Die Zeit und taz.
MARK BENECKE
WARUM NACKTBILDER ZU GEDÄCHTNISLÜCKEN FÜHREN
Die verrücktesten Erkenntnisse vom Spaß-Nobelpreis
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG
Umschlaggestaltung: Tanja ØstlyngenEinband-/Umschlagmotiv: Phil Johann @Sallyhateswing für @nullzwei_podcasteBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-4275-7
luebbe.delesejury.de
EINLEITUNG
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mögen sich mit Geld, Sex, dem Zustand der Welt oder der Gesundheit herumärgern, aber ein Problem haben sie nie: Langeweile. Diese Aussage werden Sie immer wieder hören, wenn Sie Forscher fragen, warum sie ihr scheinbar so spezielles und langweiliges Fach gewählt haben. »Es gibt in meinem Gebiet noch so viel Neues zu entdecken«, heißt es dann, »mein Leben reicht dazu nicht aus.«
Ein bunter Trupp internationaler Forscherinnen und Forscher hat sich vorgenommen, dabei das Lachen nicht zu vergessen. Viele dieser Forscher arbeiten gemeinsam an der Zeitschrift Annals of Improbable Research (AIR). Dort sammeln sie alles, was sich zwar verrückt anhört, aber doch mit dem Werkzeugkasten der heutigen Wissenschaften ermittelt wurde.
Im Laufe der letzten Jahre hat sich diese kleine, nerdige* (mit Sternchen* gekennzeichnete Ausdrücke werden am Ende des Buches in dem Kapitel »Wissenschaftliche Begriffe« näher erläutert) Sammlung von Forschungsarbeiten unerwartet stark ausgeweitet. Neben den Ig-Nobelpreisen*, die jedes Jahr an der Harvard-Universität in Cambridge (USA) kurz vor den echten Nobelpreisen verliehen werden, bringt beispielsweise der öffentlich-rechtliche Sender radioeins jeden Samstagmorgen live meine Kolumne, vor allem mit Forschungsbeiträgen, die es trotz Nominierung nicht zum Ig-Nobelpreis geschafft haben. Hier finden sich oft noch witzigere Ideen als bei den preisgekrönten Arbeiten.
Aus dieser Minishow mit ig-noblem Inhalt aus Berlin/Brandenburg ist dann der wohl erste deutsche Wissenschafts-Podcast geworden (markypod.com). Es gab dabei, passend zum Inhalt der Sendungen, immer wieder denkwürdige Sendeorte, beispielsweise eine Alpenhütte, den Hamburger S-Bahnhof »Schlump«, eine heruntergekommene Telefonzelle an der Kreuzung Second Avenue/St. Mark’s Place in Manhattan, den Moskauer Flughafen, einen brasilianischen Hotelkeller, ja sogar einen Bahnsteig in Transsilvanien.
Manchmal werden Ig-Nobelpreise auch an Forschende verliehen, die sich selbst gar nicht als Wissenschaftler bezeichnen würden. Dazu zählen der Erfinder des Grizzlybären-Schutzanzugs (Sparte Sicherheit, 1998, siehe: Grizzlybären fürchten Cola), Volkswagen für Verdienste um die Abgasverminderung (während Abgastests; Chemie-Preis 2016) sowie der Vatikan, der bezahlte Auftragsgebete von preiswerten Priestern in Indien beten lässt (Wirtschaft, 2004).
Ein besonders großes Herz hat das AIR-Team für forschende Kinder. Sie sind von Natur aus gute Forscher, denn Kinder frage immer weiter »Warum?« – mag die Umgebung darüber auch noch so genervt sein. Genau das machen Wissenschaftler auch. Deshalb ist es kein Wunder, dass der verrückte Forscher im Kino meist kauzig, zurückgezogen und scheinbar zerstreut ist. Er konzentriert sich auf Fragen, die dem Rest der Welt egal sind, wenn nicht sogar ziemlich abstrus erscheinen. Sehr wirklichkeitsnah ist das beispielsweise in dem Film Das Schweigen der Lämmer umgesetzt, in dem zwei Zoologen mit Kakerlaken Schach spielen. Ich könnte auf Anhieb mehrere Kollegen nennen, die so etwas schon gemacht haben.
Um auch normale Menschen zum Tüfteln anzuregen, hat der Herausgeber der Annals of Improbable Research, Marc Abrahams, eine kleine Anleitung verfasst, wie man auch ohne Laborgeräte jede beliebige Forschungsarbeit prüfen kann: Suchen Sie sich einen Forschungsbericht heraus, der Sie besonders interessiert.
Die Autoren des Artikels (und die Gutachter) haben den Artikel geschrieben und zum Abdruck freigegeben, weil sie meinen, etwas bislang Unbekanntes herausgefunden zu haben.
Stimmt das, was im Artikel steht? Wann »stimmt« überhaupt etwas?Haben die Autoren mit ihrem Experiment die Frage geprüft, die sie prüfen wollten?Gibt es mindestens eine bessere oder genauso gute andere Erklärung als diejenige, welche die Autoren als richtig annehmen?Sind die Autoren sich selbst gegenüber absolut ehrlich? Beweisen ihre Messergebnisse wirklich etwas, oder biegen die Autoren bloß alles in Richtung ihrer (Wunsch-)Annahme?Das Forschungsgebiet des Autors hört sich komisch an. Ist es das?Das Forschungsgebiet des Autors hört sich wichtig und fortschrittlich an. Ist es das?Sie sehen: Forschende glauben erst einmal gar nichts. Seien auch Sie respektlos, wenn Ihnen ein wissenschaftliches Ergebnis seltsam vorkommt. Denn weder »das wurde aber untersucht« noch »amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden«, noch ein Doktor- oder Professorentitel beweisen irgendetwas. Nur Experimente tun das.
Viele Experimente, selbst solche, die auf den ersten Blick als Unsinn erscheinen, erklären etwas, das bis dahin wirklich niemand wusste. Und nur darum geht es den Forschenden: Splitter der Welt zu verstehen – und wie kleine Kinder ewig weiter »Warum?« zu fragen.
Wien, Januar 2023
Mark Benecke
ALTE MÄNNER VERSCHÄTZEN SICH IN DER ANZAHL IHRER SEXUALPARTNERINNEN
Glaubt man Umfragen unter Männern, so haben sie bis zu viermal mehr Bettgefährtinnen als Frauen Bettgefährten. Das ist natürlich nicht möglich. Es muss ein ungefähres Verhältnis von eins zu eins herauskommen.
Eine mögliche Erklärung für den drei- bis vierfachen Frauenüberschuss wären Besuche bei Prostituierten oder mehr oder weniger flotte Dreier mit mehreren Frauen pro Mann.
Doch das wollte Martina Morris, heute Soziologie-Professorin an der Universität Washington, nicht glauben. Stattdessen vertiefte sie sich am Institut für Mathematik der Universität Cambridge in England und an der Columbia-Universität in New York in alle seriösen Befragungen zur Anzahl von Geschlechtspartner und -partnerinnen.
Dass auf der Erde viermal mehr Frauen als Männer leben, konnte sie dabei als mögliche Erklärung ausschließen. Das Verhältnis liegt heute zum Zeitpunkt der Geburt in reichen Ländern bei ungefähr 1,06 Jungen pro einem Mädchen.
Auch einen Stichprobenfehler (Stichprobe*) konnte sie nicht ausmachen. Ein Beispiel für einen solchen wäre, dass nur 60-jährige Männer und unter 16-jährige Frauen befragt worden wären. In diesem Fall hätte man eine tatsächlich vorhandene, unterschiedliche Gesamtzahl von Sexualpartnern ermittelt.
Auch Prostituiertenbesuche erklärten den starken Überhang nicht. Innerhalb von fünf Jahren nahmen nur ungefähr drei Prozent der Männer die Dienste der in den USA höflich commercial sex workers genannten Damen in Anspruch. Obwohl diese Zahl etwas zu niedrig liegen dürfte, spiegelt sie aber doch wider, dass auch hier kein Verhältnis von eins zu vier entstehen kann.
Nun wurde es spannend. Kollegin Morris entzerrte die verschiedenen Statistiken auf einer verlängerten Y-Achse (= Anzahl Geschlechtspartner) und fand, dass es haargenau bei angeblich 30, 40, 50 und 100 Geschlechtspartnern unerklärliche Häufungen gab – aber nur bei den befragten Männern, nicht bei den Frauen.
Daraus folgt: (Vor allem ältere) Herren können sich erstens nicht so genau an die Anzahl ihrer Partnerinnen erinnern und runden deshalb auf.
Zweitens verschätzen sie sich im Zweifel kräftig nach oben, weil das offenbar sozial erwünscht ist. In Wahrheit, so zeigt die Detailanalyse, haben 90 Prozent der Menschen weniger als 20 Geschlechtspartner in ihrem Leben. Bei dieser – der größten – Gruppe sinkt das Geschlechterverhältnis dann auch auf sinnvolle 1,2 zu 1.
Drittens gibt es einige Männer, die tatsächlich eine sehr hohe Anzahl von Partnerinnen haben und dies in Befragungen auch gern zugeben. Das bewirkt aber eine nach oben verzerrte durchschnittliche Anzahl von sexuellen Gefährtinnen. Wissenschaftlich heißt dieser verfälschende Effekt telling tails. Gemeint ist damit, dass die in einer Kurve aufgetragenen, seitlichen Ausziehungen (tails) auf einer Seite einen überstarken Einfluss auf das Ergebnis ausüben (siehe Abb.).
Wenn Sie die Untersuchung der Kollegin Morris im Bekanntenkreis fortführen wollen, hier noch ein Tipp von ihr: Fragen Sie ältere Herren wegen derer Gedächtnis-Ungenauigkeiten nur nach der Anzahl der Sexualpartnerinnen innerhalb der letzten fünf Jahre (also nicht im Verlauf des gesamten Lebens). Da sich die meisten Menschen wenigstens an die letzten Jahre noch erinnern können, tritt der Häufungsfehler bei den runden Zehnerwerten nicht mehr auf.
IG-GESAMTNOTE:Herrlich. Leider zu spät eingereicht beziehungsweise vom Komitee verbummelt. Erhält von mir aber eine titanene Erwähnung für konsequente Anwendung gesunden Menschenverstandes (TEfkAgM).
Martina Morris (1993), »Telling tails explain the discrepancy in sexual partner reports«. In: Nature, Nr. 365, S. 437–440.
KLEBRIGE DUSCHVORHÄNGE
Die Physik-Lehrenden der Welt irren, obwohl es ein so schönes Schulbeispiel ist: Der Bernoulli-Effekt (siehe: Bernoulli und Bananenflanken) ist nur teils daran schuld, dass Duschvorhänge in kleinen Nasszellen stets ihre eiskalten Falten in Richtung Nieren und Gesäß der menschlichen Opfer ausstrecken.
Dem Kollegen David Schmidt von der Universität Massachusetts war es komisch vorgekommen, dass ein Duschstrahl – genauer gesagt, die dicken Duschwassertropfen – für den entstehenden Unterdruck verantwortlich sein sollten. Als Experte für feinst verteilte, sehr schnell bewegte Tröpfchen setzte Schmidt sich daher nach getaner Arbeit an seinen heimischen Rechner und baute dort eine Nasszelle aus 50 000 Mini-Raum-Einheiten nach. Dann ließ er die Lieblings-Software der Flüssigkeitsdynamiker darüberlaufen.
Erstaunlicherweise zeigten sich dabei nur direkt am Duschkopf starke Bernoulli-Effekte. Sobald sich die dicken Tropfen beim Fallen spalteten, bewirkten sie stabile Verwirbelungen der sie umgebenden Luft. Diese kleinen Möchtegern-Windhosen bestehen zwar immer nur so lange, wie Wasser nachströmt. Ihr Sog bewirkt aber zugleich unvermeidlich, dass der Duschvorhang auch im unteren Körperbereich angezogen wird, wo Bernoulli-Kräfte mangels dicker Tropfen nicht mehr stark wirken würden. Gerade da also, wo der Körper des Duschenden am empfindlichsten ist, schmiegt sich das nasse Textil durch Wirbelwind-Unterdruck anstelle der Bernoulli-Kräfte an.
»Es sind echte Wirbelwinde, die in der Duschzelle herrschen«, sagt Schmidt, »allerdings liegen die Wirbel auf der Seite und saugen den Vorhang daher auch seitlich zum Duschenden an.
Der Wirbel entsteht, weil die Tropfen zwar von der Schwerkraft nach unten gezogen, aber gleichzeitig vom Luftwiderstand gebremst werden. Da für jede Aktion eine gleiche Gegenaktion besteht, bewegt sich stattdessen nun die Luft. Die entstehenden stabilen Luftkreisel sind die Mini-Windhosen.«
Würden die Duschtropfen während ihres Fallens dick bleiben, dann gäbe es keine Windhöschen, sondern nur oben in der Duschzelle einen normalen Bernoulli-Unterdruck. Dort würde er uns aber nicht stören, denn das nasse Textil ist hier an einer Stange befestigt und kann sich dem Körper nicht nähern.
»Wichtig ist«, schiebt Kollege Schmidt per E-Mail nach, »dass ich das Ganze nur für kaltes Wasser untersucht habe. Ich erhalte ständig Anfragen, was passiert, wenn man warm duscht. Ich sage dann einfach, dass ich eben kaltes Duschen vorziehe. Die Wahrheit ist: Bei warmem Wasser wird der Duschvorhang wahrscheinlich noch stärker und schneller angesaugt.«
Übrigens sind Duschvorhänge auch sonst eine spannende Sache. Bei der Recherche lernte ich beispielsweise, dass die fiesen Dinger vor ihrer Beschichtung mit Wasser abweisenden Materialien »gekrumpft« werden. »Nur so kann eine einlaufsichere, bügel- und geruchsfreie Ware erzielt werden«, verriet uns ein V-Mann, blieb aber angesichts des neuen Terminus technicus (gekrumpft?) ungewollt kryptisch.
IG-GESAMTNOTE: Ohne Funding*, mit viel Aufwand (zwei Wochen am privaten Rechner) und in der Freizeit erforscht, dazu nützlich und interessant: Den Ig-Nobelpreis für Physik nahm Prof. Schmidt im Jahr 2001 in Harvard persönlich entgegen. Er bedankte sich bei der Jury mit zwei Duschhauben.
BERNOULLI UND BANANENFLANKEN
Wenn Flüssigkeiten und Gase strömen, üben sie einen geringeren Druck auf ihre Umgebung aus, als wenn sie sich nicht bewegen. Je höher die Geschwindigkeit, desto geringer wird der Druck, den sie auf irgendetwas ausüben.1
Warum hebt ein Flugzeug vom Boden ab, wenn es anrollt? Nach einer Regel, die man auf den Schweizer Forscher Daniel Bernoulli (1700–1782) zurückführt, liegt das nicht daran, dass die Luft die schräg gestellten Flügel einfach »nach oben drückt« (so wie eine schräg gestellte Hand, die man aus dem Fenster eines fahrenden Autos streckt). Denn wenn das Hochdrücken auch bei Flugzeugen funktionieren würde, bräuchten die Tragflächen nicht so eigentümlich gekrümmt sein, wie sie es sind.
Das Flugzeug soll stattdessen nach oben gesaugt werden. Der Grund: Die Tragflächen sind auf der Oberseite stärker gekrümmt, sodass die Luft dort einen längeren Weg zurücklegen muss als auf der weniger stark gekrümmten Unterseite der Tragfläche. Die »gehetzte«, oben schneller strömende Luft soll einen Unterdruck erzeugen, der das Flugzeug nach oben hebt.
Richtig überzeugend ist diese Erklärung zumindest bei Flugzeugen aber nicht, denn die Luft auf der Oberseite des Flügels »weiß« ja nicht, wie schnell die Luft auf der Unterseite strömt. Man vermutet heute, dass der Bernoulli-Effekt an Tragflächen komplizierter verläuft, nämlich durch zusätzliche Luftverwirbelungen. Diese erzeugen den Unterdruck. Auch die Experimente mit den Tropfen am Duschvorhang zeigen, dass die Schulbucherklärungen zwar sehr schön, aber deswegen nicht unbedingt richtig sind.
Den Bernoulli-Effekt gibt es aber trotzdem, und er erklärt sehr viele Alltagserscheinungen:
Fährt ein Motorrad nah an einem LKW vorbei, wird es an den Laster gesaugt. Der Grund: Durch den verengten Raum zwischen LKW und Motorrad strömt die »eingeengte« Luft schneller. Das erzeugt einen Bernoulli-Unterdruck. Dasselbe passiert langen Ruderbooten, die auf einem Fluss an einem Frachter vorbeifahren. Im entstehenden Spalt zwischen Boot und Schiff fließt nun aber nicht die Luft, sondern das Wasser schneller und erzeugt die Saugwirkung. Der Sog entsteht auch bei gleich großen Objekten, beispielsweise zwischen zwei Frachtern, die während des Überholens auf einem Fluss nebeneinander fahren und dabei aneinander gezogen werden.Auch bei Eckbällen wirkt der Bernoulli-Effekt. Der Fußball wird dabei etwas seitlich angekickt, sodass er einen Drall erhält. Durch die raue Oberfläche des Balls wird eine dünne Luftschicht mitgedreht. Dabei entsteht ein leichter einseitiger Unterdruck. Der Bogenflug des Balls (Bananenflanke, Eckball um die Mauer herum) entsteht aber erst durch eine weitere Kraft. Auf derjenigen Seite des Balls, auf der die normale Umgebungsluft entgegen der mitgerissenen Luftschicht um den Ball strömt, entwickelt sich eine Querkraft, die zusammen mit dem Unterdruck den Ball eine Kurve fliegen lässt. Je schneller sich der Ball dreht, desto gebogener ist die Flugbahn, ein Effekt, den auch Tischtennis-(Schnippeln) und Tennisspieler (Topspin, Slice) kennen. Diese Kraft heißt nach ihrem Entdecker Heinrich Gustav Magnus (1802–1870) Magnus-Effekt.Ein stets verblüffendes Experiment in der naturwissenschaftlichen Anfängervorlesung ist dieses: Durch ein Rohr, das in eine Platte mündet, wird reichlich Luft gegen die Saaldecke geblasen. Nähert man das Rohr der Decke, so »klebt« es auf einmal daran fest und kann sogar ein ordentliches Gewicht tragen.Zur Erklärung dient die Bernoulli-Regel. Zwischen der Platte und der Zimmerdecke entsteht ein Spalt. Die dort eingeengte Luft wird schnell hindurchgepresst und erzeugt dabei einen Unterdruck im Vergleich zur Luft im übrigen Raum. Darum saugt sich die Platte an, obwohl der Luftstrom auf die Zimmerdecke gerichtet ist. Man müsste eigentlich vermuten, dass dieser Luftstrom das Rohr von der Decke wegdrückt – ohne die zusätzliche Platte würde das auch geschehen.Das Ganze funktioniert auch um 180 Grad gedreht: Steckt man einen Strohhalm bündig durch einen Bierdeckel und pustet hinein, so kann man ein Blatt Papier problemlos damit ansaugen – obwohl man dagegen pustet.Unsere Stimmlippen werden nicht nur durch Muskeln, sondern auch durch Bernoulli-Luft bewegt. Strömt zwischen ihnen beim Sprechen oder Singen Luft, so geraten sie näher aneinander und schließen sich ganz, um sich dann, mangels Luftstrom, sofort wieder zu öffnen. Das geht blitzschnell – bei Männern etwa 125-mal pro Sekunde (tiefe Stimme), bei Frauen ungefähr 200-mal pro Sekunde (höhere Stimme) und bei Kindern etwa 300-mal (hohe Kinderstimme). Die Stimmlippen können aber auch bewusst oder vererbt länger oder kürzer beziehungsweise mehr oder weniger gespannt sein. So kommt es, dass sie bei sehr tiefen Stimmlagen nur 80 Schwingungen pro Sekunde, bei hellen Sopranlagen aber auch bis zu 1000 pro Sekunde ausüben.1Bei Gasen bleibt die Summe aus statischem Druck und kinetischer Energiedichte immer gleich. Deswegen muss in einem Rohr mit unterschiedlichem Querschnitt der statische Druck an engen Stellen kleiner sein als an weiten Stellen. Dort, wo der Rohrquerschnitt geringer ist, herrscht also ein Unterdruck im Vergleich zum Druck außerhalb des Rohrs.
TÖDLICHE GETRÄNKEAUTOMATEN
Das Ig-Nobelpreiskomitee hat manchmal einen morbiden Humor. Es begann 1992, als die ärztlichen Kollegen Cosio & Taylor berichteten, dass neuerdings Menschen unter der Last von 324 Kilo (leer) bis 455 Kilo (voll) schweren Getränkeautomaten verstarben. Merkwürdig war dabei, dass es sich bei den Opfern erstens meist um US-Soldaten handelte, die zweitens im Ausland stationiert waren und drittens durchschnittlich nur 19,8 Jahre alt waren. Noch merkwürdiger war, dass die starken Jungs immer auf dem Rücken, also mit dem Gesicht zum auf ihnen liegenden Apparat, angetroffen wurden.
Ein Blick in die Literatur brachte auch in den USA Erschreckendes zutage. 1989 waren in San Diego vier Automatenopfer zu beklagen (zwei hatten mit Brüchen und Schwellungen überlebt), eine andere Studie brachte 19 weitere Fälle aus der Gegend um Washington an den Tag (vier Tote, 15 Verletzte). 1987 war das Jahr des schlimmsten Getränkeautomaten-Terrors: 22 Opfer der wild gewordenen Maschinen wurden in Krankenhäuser oder Leichenhallen eingeliefert.
Was geschehen war, konnten die in 15,5 Prozent der Fälle anwesenden Begleiter der Erdrückten erklären. Unter den jungen US-Soldaten kursierte das Gerücht, kräftiges Rütteln am Automaten zwänge diesen zur Gratisgabe eines Getränkes.
Das stimmte auch. Allerdings lag der Schwerpunkt der Automaten sehr hoch, weil die Suppen und Säftesirups in Plastikkanistern in der oberen Hälfte der Geräte sitzen. Bei zu heftigem Zerren und Reißen verlagert sich der Schwerpunkt unvermutet in Richtung Schnorrer.
Die jungen Leute – anstatt wegzulaufen – rissen nun reflexartig ihre Arme nach vorn und sanken so langsam aber sicher samt Getränkespender auf den Boden. Helfen konnten sie sich nicht, denn 450 Kilogramm sind auch für gut trainierte Soldaten nicht mehr zu stemmen. Die Schwächeren wurden erschlagen, die Stärkeren erstickten nach langsamer Brustkorb- und Lungenkompression.
Folge: Die Automaten werden heute entweder angekettet oder mit Klebeschildchen versehen, auf denen steht: »Nicht rütteln!« Der Autor hat sich an der FBI-Akademie und anderswo in den USA schon aus solchen Geräten bedient.
Es gibt sogar einen Namen für das traurige Syndrom: »Soda Pop Vending Machine Injuries« oder kurz »Killer Pop Machines«. Höhere Dienst-Ränge waren bislang von den Automaten übrigens nicht betroffen. Die Oberen verdienen wohl genügend, um eine Dose Limo bezahlen zu können.
IG-GESAMTNOTE:Heiß geliebt vom deutschen Jurymitglied, das in der Kindheit die österreichische Krimiserie Kottan ermittelt sah (dort verliert der Kaffee-Automat den fairen Kampf gegen die Menschen zuletzt). Wegen Geschmacklosigkeit von allen anderen abgelehnt.
M. Cosio (1988), »Soda Pop Vending Machine Injuries«. In: Journal of the American Medical Association, Nr. 260, S. 2697ff.
Daniel Spitz | W. Spitz (1990), »Killer Pop Machines«. In: Journal of Forensic Sciences, Nr. 35, S. 490ff.
LEHRENDE LAUFEN GEFAHR, SICH IN STUDENTINNEN ZU VERLIEBEN
Im Jahr 2000 wurde endlich bewiesen, was mancher Vaterschaftstest in meinem Labor schon andeutete: Wenn Männer von jüngeren Frauen umgeben sind, finden sie die eigene Lebensabschnittsgefåhrtin weniger attraktiv. Das zeigten bereits Versuche aus dem Jahr 1989, in denen Männer nach experimentellem Konsum von Playboy-Heften schlechtere Noten für ihre Beziehung abgaben als »playboylose« Vergleichspersonen. Die Frage war nun, ob die Beobachtungen aus dem Psycholabor auch auf die Wirklichkeit übertragbar wären.
Satoshi Kanazawa und Mary Still fiel beim Nachdenken darüber Folgendes auf:
Die Gesamtheit der US-College-Professoren beziehungsweise Gymnasiallehrer lassen sich im Vergleich zum untersuchten Bevölkerungsdurchschnitt seltener scheiden.Betrachtet man allerdings nur Männer (also keine Frauen), dann ergibt sich eine signifikant erhöhte Menge von zurzeit Geschiedenen (p* < 0,5).Wie das? Politisch inkorrekt, aber biologistisch bündig schlagen die Autorinnen folgende Erklärung vor: »Lehrer treffen dauernd auf Frauen, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Fortpflanzungsfähigkeit befinden … Im Vergleich zu den meisten erwachsenen Frauen haben Schülerinnen auch den von Männern bevorzugten geringeren Hüfte-zu-Taille-Quotienten.«
Seltsam bleibt, dass die dauernd derart verführte Zielgruppe nicht häufiger geschieden ist als die restliche Bevölkerung. Einzige Erklärung: Lehrende heiraten nur widerwillig, sowohl in jüngeren Tagen als auch nach der ersten Scheidung. Wegen ihres heiratsmuffeligen Verhaltens bleibt trotz der dauernden Hüfte-zu-Taille-Belastung die Gesamtzahl der Scheidungen im Normalbereich.
Mir fällt allerdings noch eine andere Erklärung ein: Was, wenn die Lehrer allesamt bärtige Käuze sind, die schlicht einen Korb nach dem anderen kassieren und deshalb geschieden oder unverheiratet ihr Dasein fristen? War nur so ein Gedanke.
IG-GESAMTNOTE: Eloquente, grausame und wahre Erkenntnisse: für US-Amerikaner schwer erträglich und daher in der Kommissions-Schlussrunde abgeschmettert.
Satoshi Kanazawa | Mary Still (2000), »Teaching may be hazardous to your marriage«. In: Evolution and Human Behavior, Nr. 21, S. 185–190.
AUSZIEHUNGSKRAFT JUNGER FRAUEN
Die Lehrerstudie (»Lehrende laufen Gefahr, sich in Studentinnen zu verlieben«) zeigt je nach Lesart, dass Männer dem Reiz junger Frauen nicht entgehen können – oder wollen. Es war für uns sehr spannend zu verfolgen, wie die Untersuchung aufgenommen werden würde. Denn dem einen mag es ganz selbstverständlich erscheinen, dass junge Frauen eine starke Anziehungskraft haben, dem anderen aber überhaupt nicht. Auch kulturell lässt sich in die Ergebnisse alles Mögliche hineindeuten, vom europäischen »typisch Mann« (oder »typisch Frau«) bis zu nutzenorientierten Verhaltensmaßnahmen. So schlug beispielsweise die Washington Post augenzwinkernd vor, künftig auf alle Heiratsurkunden, ähnlich wie auf Zigarettenschachteln, die Überschrift der wissenschaftlichen Originalveröffentlichung zu drucken: »Lehren kann ihre Beziehung gefährden«.
Das Gemeine an der Untersuchung ist, dass es sich nicht um ein reines Laborexperiment handelt. Dann könnte man immer behaupten, dass sich die unter künstlichen Bedingungen gewonnenen Ergebnisse eben nicht auf die Wirklichkeit übertragen lassen. Das gilt zum Beispiel für den Gedächtnisverlust durch Nackte (siehe: Nackte verhindern Nachdenken). Mary Still und Satoshi Kanazawa werteten aber tatsächliche Scheidungsquoten aus.
»Mit den alten Studien im Kopf«, berichtet Kanazawa, »dachte ich mir: Was passiert eigentlich, wenn Menschen sich nicht nur kurz im Labor aufhalten, sondern den ganzen Tag jungen Frauen ausgesetzt sind? Ich grübelte herum, wen wir sinnvollerweise untersuchen könnten, bis ich endlich auf Lehrer kam.« Um aber nicht hunderte von Lehrern nach ihren persönlichen Verhältnissen befragen zu müssen, griff er auf den seit 1972 regelmäßig durchgeführten »General Society Survey« (GSS) der Universität Chicago zurück. Unter den 32.845 Datenbögen fanden sich 646, die von männlichen und weiblichen Lehrern stammten. In einem ersten Schritt verglichen die beiden Forscher nun die Scheidungsrate der männlichen und weiblichen Lehrer mit der von US-Amerikanern, die keine Lehrer waren. Dabei zeigte sich, dass die männlichen Lehrer seltener heiraten und häufiger geschieden sind.
Jeder Sozialwissenschaftler weiß, dass nun größte Vorsicht geboten ist. Denn es könnte sein, dass diese scheinbare Übereinstimmung auf einer falschen Grundannahme beruht. Finden Sie es nicht auch verdächtig, dass die Zahlen genau das zeigen, was die Forschenden eh vermuteten?
Diese Fallgrube ist als Storchproblem* bekannt: Zwar ist es absolut richtig, dass in Dörfern mit vielen Störchen mehr Kinder geboren werden. Es stimmt deswegen aber noch lange nicht, dass der Storch die Kinder bringt. Hier stehen zwei richtige Beobachtungen nur scheinbar in Beziehung zueinander. Weil wir wissen, dass der Storch keine Kinder bringt, wissen wir, dass es falsch ist, die Anzahl Störche mit der Anzahl Kinder in Verbindung zu bringen. Andererseits – vielleicht hängen die beiden Beobachtungen doch zusammen? Das tun sie auch, es fehlt nur das entscheidende Bindeglied: Je mehr Störche es gibt, desto mehr Kamine gibt es im Dorf, desto mehr Familien leben dort und desto mehr Kinder werden geboren. Ursache und Wirkung liegen aber nicht immer so offen wie beim Storchproblem.
Deshalb prüften die Sozialwissenschaftler im zweiten Schritt, ob es nicht eine andere Ursache geben könnte, die ihre Beobachtung erklärt. Sie bezogen daher das Alter der Untersuchten, deren Einkommen, Hautfarbe und so weiter ein. Doch nichts zeigte einen Zusammenhang zum Unverheiratetsein der Lehrer. »Für uns bedeutet das, dass Lehrer dauernd ihre Ehefrauen oder Freundinnen mit den Schülerinnen vergleichen«, folgert Kanazawa, »bloß sind sie sich dessen nicht bewusst.«