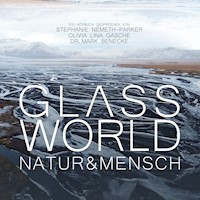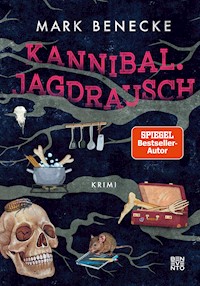9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Fall von spontaner Selbstentzündung im Londoner Hyde Park bringt Geisterjäger John Sinclair auf den Plan. Für ihn liegt nahe, dass es sich bei dem Opfer um einen Vampir gehandelt hat. Doch warum sollte sich ein Vampir dem Sonnenlicht aussetzen? Weitere Vorfälle folgen, und auch in Deutschland kommt es an verschiedenen Orten zu spontaner Selbstentzündung. Dort wird der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke zu einem solchen Fall hinzugezogen. Als John Sinclair davon erfährt, tut er sich mit dem bekannten Forensiker zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autoren
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Zwischenspiel
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Zwischenspiel
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Zwischenspiel
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Über das Buch
Ein Fall von spontaner Selbstentzündung im Londoner Hyde Park bringt Geisterjäger John Sinclair auf den Plan. Für ihn liegt nahe, dass es sich bei dem Opfer um einen Vampir gehandelt hat. Doch warum sollte sich ein Vampir dem Sonnenlicht aussetzen? Weitere Vorfälle folgen, und auch in Deutschland kommt es an verschiedenen Orten zu spontaner Selbstentzündung. Dort wird der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke zu einem solchen Fall hinzugezogen. Als John Sinclair davon erfährt, tut er sich mit dem bekannten Forensiker zusammen.
Über die Autoren
Dr. Mark Benecke, geb. 1970, Kriminalbiologe, arbeitet als Molekularbiologe und Wirbellosenkundler an rechtsmedizinischen Fragen und der Biologie des Todes, ist Gastdozent und -professor an Universitäten in den USA, den Philippinen, Vietnam und Kolumbien sowie Ausbilder an Polizeiakademien und Gast u. a. an der FBI-Akademie und der »Body Farm«.
Er leitet kriminalistische Spezialausbildungen in den USA und Kanada, unter anderem zur Auswertung von Blutspritzmustern; ist Autor von Übersichtsartikeln zu genetischen Fingerabdrücken und rechtsmedizinisch-kriminalistischer Gliedertierkunde. Zudem besitzt er ein umfangreiches Forschungsarchiv zur Kriminalgeschichte im Nachkriegsdeutschland, ist insektenkundlicher Gutachter in bekannten Kriminalfällen und gewähltes Mitglied internationaler Forschungsakademien, darunter der ältesten Naturforschungsvereinigung, der Linnean Society of London der International Academy of Legal Medicine und der American Academy for Forensic Sciences.
Als sei dies nicht genug, betätigt sich Mark Benecke als Gastherausgeber des Sonderbandes »Forensic Entomology« für Forensic Science International und fungiert als wissenschaftlicher Berater für zahlreiche Fernsehsender.
Er wurde mit der Ehren-Kriminalmarke des »Bundes Deutscher Kriminalbeamter« ausgezeichnet. Neben Artikeln in Fachzeitschriften publiziert er regelmäßig in Tages- und Wochenzeitungen, darunter FAZ, SZ, Die Welt, Die Zeit und taz.
Mark Benecke lebt und arbeitet in Köln.
Florian Hilleberg wurde 1980 in Uelzen geboren. Zum Studium der Forstwirtschaft zog es ihn nach Göttingen, wo er auch heute noch lebt. Nur Förster ist er nie geworden. Stattdessen hat er nach dem Studium eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, die ihn in die Psychiatrie gebracht hat. Dort arbeitet er noch heute, hat aber nebenbei seine Liebe zum Schreiben wiederentdeckt und ist inzwischen einer der neuen Autoren für die Heftromanserie JOHN SINCLAIR.
MARK BENECKE & FLORIAN HILLEBERG
BRANDMAL
Ein John Sinclair Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
»Geisterjäger«, »Geisterjäger John Sinclair« und »John Sinclair« sind eingetragene Marken der Bastei Lübbe AG. Die dazugehörigen Logos unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Die Figur John Sinclair ist eine Schöpfung von Jason Dark.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Jan F. Wielpütz, Bergisch GladbachTitelillustration: © shutterstock/loskutnikovUmschlaggestaltung: Thomas KrämerE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3961-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Prolog
Beißender Uringestank erfüllte das Turmzimmer, das von dem flackernden Schein unzähliger Kerzen erhellt wurde. Hemmungsloses Schluchzen ließ den entblößten Leib des Bauernmädchens erbeben, das an ein großes hölzernes Andreaskreuz gefesselt war, welches wiederum von zwei schweren Ketten gehalten wurde. Es hing schräg, so dass die Gefangene nach unten durch ein kreisrundes Gitter auf einen hölzernen Stuhl schauen konnte, der in dem darunterliegenden Raum stand.
Die angstvoll geweiteten Augen erblickten das scharfe Messer in der schlanken Frauenhand. Die polierte Klinge reflektierte das unstete Licht der Kerzen. Ein Knebel erstickte die panischen Schreie des Mädchens. Die aus Schmerz und Angst geborenen Laute geilten ihre Peiniger nur noch mehr auf. Die Erregung war dem schnellen, schweren Atem ihrer Folterer anzuhören.
»Bereit, Herrin?«
Die Frau, die das Messer in der linken Hand hielt, nickte.
»Bereit, Fitzko. Entferne den Knebel. Und beeil dich.«
Der schlanke junge Mann mit den sehnigen Muskeln griff nach oben und entfernte den groben, stinkenden Stofflappen, der im Mund des Mädchens steckte. Es half mit, indem es mit seiner Zunge dagegendrückte. Und noch ehe es sie zurückziehen konnte, um panisch zu kreischen, packte Fitzko mit den Backen der Zange zu, die er in der anderen Hand hielt.
Ein schmerzerfülltes Quieken drang aus der Kehle des Mädchens, aus dessen nacktem Schoß ein neuerliches Rinnsal lief. Es wusste, was jetzt kam. Eine Hand packte es an der Gurgel, damit es den Kopf nicht drehen konnte, und mit einer schnellen Bewegung schnitt die Frau ihm die Zunge ab. Die Peinigerin wich zurück, und auch Fitzko trat einen Schritt nach hinten. Der Kopf des Mädchens sackte nach vorne. Es kreischte und hustete, während ein Schwall dunklen Blutes aus seinem Mund durch das Gitter floss und auf den hölzernen Stuhl tropfte.
»Perfekt, Herrin. So ist es richtig.«
Die Frau mit der hohen Stirn und den großen, runden Augen antwortete nicht, sondern starrte fasziniert und lüstern auf das geschundene, entblößte Mädchen. Im nächsten Moment presste sie ihre Lippen auf seinen blutverschmierten Mund.
Zwei Herzschläge später schrie die Frau zornig auf und sprang zurück. Kindlicher Trotz lag auf den blut- und tränenverschmierten Zügen des Mädchens. Mit dem Handrücken wischte sich die Frau über die ebenfalls mit dem roten Lebenssaft besudelten Lippen.
Der junge Mann lachte glucksend. »Ich … ich habe Euch gesagt, wir müssen ihr die Zähne herausbrechen.«
Die Frau antwortete nicht und schenkte Fitzko keinerlei Beachtung. Wieder sprang sie vor und schwang das Messer. Ein blitzschneller Schnitt, und die linke Wange des Mädchens klaffte bis zum weißen Gebein auf.
Ihr schauerliches Gebrüll brach sich an den Wänden des Turmzimmers, während Fitzko lachte und in die Hände klatschte, um seine Herrin anzufeuern. Die verfiel in einen Rausch und fügte dem Mädchen immer neue Schnitte zu, überall an ihrem Körper, bis ihr der Mann in den Arm fiel.
»Halt. Ihr dürft sie noch nicht töten. Seht …« Er deutete auf das Gitter im Boden, durch das jetzt das Blut des Mädchens in einem wahren Regen herniederging. »Ihr müsst Euch beeilen, schnell, bevor die Quelle versiegt.«
Seine Herrin nickte und drückte Fitzko das Messer in die Hand. »Recht hast du, treuer Freund«, sprach sie und verschwand durch die Tür, hinter der eine Wendeltreppe in das darunterliegende Zimmer führte.
Fitzko wandte sich wieder dem Mädchen zu, dem, obwohl es aus dutzenden Schnitten blutete, die Gnade der Ohnmacht verwehrt blieb.
»Jetzt zu dir, mein Täubchen«, säuselte er, und die Gier ließ seine dunklen Augen bedrohlich funkeln. »Glaub mir, meine Kleine. Was du bisher hast erdulden müssen, waren doch nur harmlose Kinderspielchen.«
Fitzko bleckte die Zähne und ließ seine Zunge darüberfahren, ehe er das Blut vom Messer leckte und sich seinem wimmernden Opfer näherte.
Oh, er war ja so hungrig.
Kapitel 1
Das Tanktop klebte Emily wie eine zweite Haut am Körper.
Schwer atmend blieb die Zweiundzwanzigjährige stehen und stützte sich mit beiden Händen auf den Oberschenkeln ab.
Was war bloß los mit ihr?
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, der Atem ging schwer und pfeifend. Schwindel erfasste die junge Frau, so dass sie für zwei, drei Herzschläge die Augen schloss und sich bemühte, ihren Atem wieder unter Kontrolle zu bringen.
Wenn nur diese Hitze nicht wäre. Diese unerträgliche Hitze, die in Wellen ihren Körper erfasste und für immer neue Schweißausbrüche sorgte. Emily öffnete die Augen und sah das Wasser an ihren Armen entlangrieseln.
Sicher, es war Anfang September und immer noch sommerlich warm, doch um diese Zeit war die Kühle der Nacht noch deutlich zu spüren. Kein Grund also, schweißgebadet aus dem letzten Loch zu pfeifen, dachte Emily wütend. Immerhin war sie topfit und in Form. Als wollte sie diese Aussage bestätigen, spannte sie die durchtrainierte Oberschenkelmuskulatur unter der schwarzen Radlerhose.
Weiter, spornte sie sich selbst an. Nicht schlappmachen.
Sie wollte noch die restlichen zwei Meilen durch den Hyde Park schaffen, bis sie die Kensington Gardens erreichte. Immer in Sichtweite des östlichen Ufers des elf Hektar großen Sees namens Serpentine Lake.
Mit dem rechten Arm wischte sie sich den Schweiß von der Stirn. Schmerz, Schwindel und Hitze ignorierend, verfiel Emily in einen leichten Trab. Sie wollte es zunächst langsam angehen lassen und das Tempo gemächlich steigern.
Um diese Zeit und in dieser Ecke des Parks herrschte kaum Betrieb. Emily war allein. Selbst die allgegenwärtigen Geräusche der Großstadt vernahm sie nur, wenn sie genau hinhörte. Doch momentan galt ihre Konzentration einzig und allein ihrem Körper, der endlich Linderung erfuhr. Trotz des leichten Dauerlaufes fühlte sich Emily schlagartig besser.
Tief sog sie die würzige Parkluft in ihre Lungen und genoss die kühle Brise unter den dicht belaubten Kronen der Platanen, deren Äste von der Last der fleischig-grünen Blätter nach unten hingen. Nur vereinzelt drangen die Strahlen der Morgensonne durch das Laubdach und zeichneten ein gesprenkeltes Muster auf den geteerten Weg.
Der leichte Windhauch fuhr über Emilys feuchte Haut und sorgte für Kühlung. Sie schloss die Augen und trabte langsam vorwärts, achtete bewusst auf ihre Atmung und spürte mit Genugtuung, dass sich ihr Puls wieder regulierte.
Federnd erhöhte sie das Tempo, verließ den schattigen Bereich unter den Platanen und lief in den samtenen Schein der Sonne hinein.
Emily keuchte entsetzt, als ihr die Beine unter dem Körper wegzuknicken drohten. Die Knochen schienen aus Gummi zu bestehen, die Muskeln verkrampften sich, und plötzlich war auch die Hitze wieder da. Der Schweiß strömte ihr förmlich aus den Poren, und auf einmal wurde ihr die Luft knapp.
Ich bin krank!, fuhr es Emily durch den Kopf. Ich habe einen Infekt, ein Virus. Ihre Gedanken überschlugen sich, und in ihrer Panik entwickelte ihr Bewusstsein immer neue Horrorszenarien, angefangen von Ebola bis hin zu einem Tumor.
Emily begann zu taumeln, wäre beinahe über ihre eigenen Beine gestolpert und der Länge nach hingeschlagen, wenn sie nicht im letzten Augenblick Halt an der Lehne einer Bank gefunden hätte. Dahinter schimmerte still und friedlich das Wasser der Serpentine.
Emilys Finger krampften sich um die schwarz lackierte, hölzerne Rückenlehne der Parkbank. Tränen traten in ihre Augen, die sich vor Angst weiteten, als sie die kleinen Rauchfähnchen bemerkte, die plötzlich über der Haut tanzten.
Der Schweiß verdampfte regelrecht. Sie hatte das Gefühl, innerlich zu kochen, und nahm ihre Umgebung nur noch verschwommen und gedämpft war.
Warum riecht es nach verbrannten Haaren?, fragte sich ein Teil ihres Bewusstseins, bis auch der letzte Rest ihres Verstandes von den unerträglichen Schmerzen in Besitz genommen wurde.
Ein Schatten trat neben sie, legte eine Hand auf ihre Schulter – und zuckte zurück, als hätte der ältere Mann gerade erfahren, dass sie tatsächlich eine hochansteckende Seuche in sich trug. Sein vierbeiniger Gefährte wich winselnd vor Emily zurück, fletschte die Zähne und begann zu knurren.
Sie warf den Kopf in den Nacken und stieß ein qualvolles Brüllen aus. Ihr Rücken bog sich wie im Krampf durch, während sich die Finger noch fester um die Rückenlehne krallten.
Der Gestank nach verbranntem Horn wurde intensiver, der Schmerz überwältigend. Ihre Augäpfel begannen zu kochen, und die nackte, unbedeckte Haut schlug Blasen.
Sie vernahm die aufgeregten Stimmen mehrerer Menschen, sah, wie jemand mit einer Decke oder Jacke auf sie zukam, und warf sich nach vorne. Emily kippte über die Rückenlehne auf die Sitzfläche der Bank, wälzte sich darüber und fühlte weder den Stoß, mit dem ihr Beckenkamm auf das Holz schlug, noch den Aufprall auf dem harten, sandigen Boden.
Die Menschen um sie herum schrien, als sich Emily instinktiv weiterrollte. Über den betonierten Rand hinweg, direkt in das kalte, spiegelglatte Wasser der Serpentine hinein.
Sofort sank ihr erhitzter Leib tiefer, und trotz ihrer Schmerzen schloss Emily die Augen und genoss das Gefühl der Kälte um sie herum. Wie ein Stück glühendes Eisen in die Esse, war sie in den See gefallen und hätte sich nicht gewundert, wenn das Wasser um sie herum gezischt und gebrodelt hätte.
Zum Glück fiel das Ufer an dieser Stelle steil ab. Emilys Arme fanden den schlammigen Grund, und ohne es bewusst zu steuern, begannen ihre Gliedmaßen mit Schwimmbewegungen, trieben den Körper voran in tiefere Gewässer, weiter hinaus. Nur weg von dem grellen, schmerzenden Licht.
Emily hielt nicht nur den Mund krampfhaft geschlossen, sondern auch die Augen, von denen immer wieder stechende Schmerzen in ihr Gehirn stießen. Die Sehnerven produzierten weiße Flecken, die vor Emilys inneren Augen zerplatzten, zerfaserten und wieder neu entstanden.
Der Grund des Sees führte unter ihren Händen schräg hinab, und je weiter sie sich von der Oberfläche in die Tiefe vorarbeitete, umso wohler fühlte sie sich.
Bis sie den unwiderstehlichen Druck in ihren Lungen nicht mehr ignorieren konnte. Sie brauchte Luft!
Doch sie wusste, dass dort oben auch die Schmerzen und diese grässliche Hitze auf sie lauerten.
Nein, sie wollte nicht mehr nach oben. Sie wollte hierbleiben. Für immer. Zumindest bis die Dunkelheit hereinbrach. Erst dann würde sie wieder an Land kommen – um ihren Hunger zu stillen. Erst jetzt, nachdem sie Linderung erfahren hatte, spürte sie dieses nagende, brennende Bedürfnis nach Nahrung, das jedoch sofort von dem Drang zu atmen überlagert wurde. Ohne es eigentlich zu wollen, stieß sich Emily mit beiden Beinen von dem schlammigen Grund des Sees ab und schoss empor an die Oberfläche des Sees.
Ihr Kopf durchbrach kaum den Wasserspiegel, da kehrten Hitze und Schmerz mit tausendfacher Potenz zurück, setzten ihren Körper buchstäblich in Flammen. Emily öffnete die Lider, unter denen die verflüssigten Glaskörper ihrer verdampften Augen herausquollen. Ihre Schreie waren so laut und animalisch, dass die beiden Retter, die hinter ihr ins Wasser gesprungen waren, reflexartig zurückzuckten.
Rasch besannen sie sich und schwammen zu ihr herüber, griffen nach den Armen, mit denen sie wild um sich schlug, und zogen sie mit sich zum Ufer.
Mit sich überschlagender Stimme brüllte Emily ihre Angst und ihren Schmerz hinaus. Diese Bastarde sollten sie loslassen. Diese … diese Schafe. Diese …
Die beiden jungen Männer erreichten mit ihr das Ufer, wo mehrere Menschen hockten und ihre Hände helfend ausstreckten. Gerade befanden sie sich in Reichweite der Menge, da wandten sich zwei Frauen würgend ab, während der ältere Mann, der nur seinen Hund hatte Gassi führen wollen, vor Schock erstarrte.
Emilys Arme platzten auf wie Würstchen, die zu lange im Kochtopf gelegen hatten. Das rohe Fleisch darunter begann zu kochen, und entsetzt ließen die beiden Retter von ihr ab, als Emily vor ihren Augen in Flammen aufging.
Weißer Qualm stieg aus dem See, als sie lichterloh brennend zurück ins Wasser kippte.
Aber da war es längst zu spät. Auch wenn die Flammen auf ihrer Haut erloschen, brannte das Feuer in ihrem Leib weiter und verwandelte Organe, Fleisch und Knochen in eine stinkende Schlacke, die sämig aus ihren Körperöffnungen in das kalte Wasser quoll.
Bis die verkohlte, brüchige Haut schließlich auseinanderbrach und von Emily nichts weiter übrig blieb als ein ölig schimmernder, qualmender Fleck auf dem Wasser sowie die verrußte Kleidung, die lautlos auf den Wellen schaukelte.
Kapitel 2
Warum tue ich mir so eine Scheiße eigentlich immer wieder an?
Die Privatdetektivin Jane Collins rutschte seufzend auf dem Fahrersitz tiefer und drehte den Kopf auf die Seite, so dass der Passant ihr Gesicht nicht sehen konnte und annehmen musste, dass sie schlief.
Ein Wunder, dass der Typ nicht sowieso schon spitzgekriegt hatte, dass sie ihm mittlerweile seit vier Tagen an den Hacken klebte.
Sie strich sich eine Strähne des weizenblonden Haares aus dem Gesicht, das sie der Mode entsprechend im Nacken kurz und vorne als wuschelige Bobfrisur trug. Kaum war der gut fünfzigjährige Mann an ihr vorbeiflaniert, da öffnete die Detektivin die Tür des Golfs und stieg aus. Sie wollte die Zielperson ab sofort zu Fuß verfolgen.
Die Sneakers waren dafür ideal geeignet. Auch wenn die verwaschene Jeans mit den wieder in Mode gekommenen Löchern eng und figurbetont war, konnte sie sich darin schnell bewegen.
Über dem weißen Top trug Jane eine marineblaue Sportjacke und setzte außerdem Sonnenbrille und Käppi auf. Die Jacke verbarg auch das Gürtelholster mit der Waffe. Jane rechnete zwar nicht damit, dass dieser Auftrag gefährlich werden könnte. Im Gegenteil, einen langweiligeren Job hatte sie schon lange nicht mehr gehabt. Aber das gebrannte Kind scheut bekanntlich das Feuer, und Jane Collins hatte in ihrem bewegten Leben einfach schon zu viel erlebt und durchmachen müssen, sowohl beruflich als auch privat, als dass sie auf die Beretta verzichten wollte.
Oscar Peabody verhielt sich bislang überaus unauffällig und wechselte vor Jane die Straßenseite, wobei er einen Kiosk ansteuerte, wo er die Times und einen Coffee to go kaufte.
Die Zeitung in der einen, den Kaffeebecher in der anderen Hand, steuerte er die Underground-Station Earl’s Court an. Jane musste sich beeilen, um nicht den Anschluss zu verlieren. In dem Gedränge des morgendlichen Pendlerverkehrs war es nur allzu leicht, die Zielperson aus den Augen zu verlieren oder im Umkehrschluss einen ungebetenen Verfolger abzuhängen.
Drei Tage lang verhielt sich Oscar Peabody verdächtig unauffällig, so dass sich Jane letztlich entschlossen hatte, eine Nachtschicht einzulegen. Zum Glück war ihr Auftraggeber nicht pingelig und trug sämtliche Spesen und ließ darüber hinaus ein fürstliches Honorar springen.
Nicht, dass Jane darauf angewiesen wäre. Als Alleinerbin des nicht unbeträchtlichen Vermögens ihrer alten Freundin Lady Sarah Goldwyn hatte Jane Collins schon vor Jahren ausgesorgt.
Ihr gehörte jetzt nicht nur eine Villa in Mayfair, sondern eben auch das Geld, das die mehrfache Witwe im Laufe ihres langen Lebens angehäuft hatte. Wie oft sie verheiratet gewesen war, hatte sie vermutlich am Ende selbst nicht mehr gewusst. Doch jeder ihrer Ehemänner war gut betucht gewesen, und da Jane Collins nicht unter Verschwendungssucht litt, konnte die Detektivin gut von dem Erbe leben.
Der Job als Privatdetektivin, den sie früher als Beruf ausgeübt hatte, war mehr eine liebgewonnene Beschäftigung, die ihr half, ihrem Leben Sinn und Struktur zu geben. Abgesehen davon blieb Jane dadurch nicht nur fit, sondern auch aufmerksam. Und das war für sie überlebenswichtig. Als ehemalige Hexe, die durch eine Verkettung unglücklicher Umstände für mehrere Jahre dem Satan diente, stand sie auf der Abschussliste ihrer einstigen Schwestern und deren Fürsten ganz weit oben.
So diente ein Auftrag wie der jetzige durchaus auch der Ablenkung. Denn wie konnte man besser die Banalität des Alltags spüren, als einem notorischen Blaumacher auf den Fersen zu sein?
Er hatte seinem Arzt tatsächlich die Diagnose Burnout aus den Rippen geleiert und strich nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Lohnfortzahlung ein.
Außerdem lag der Verdacht nahe, dass Oscar Peabody noch einen kleinen Nebenverdienst hatte, indem er Interna hochdekorierter Kunden seiner Bank weiterverkaufte. Der Handel mit Daten gehörte schließlich mittlerweile zu den lukrativsten Geschäftszweigen in der freien Wirtschaft.
Jane sollte Anhaltspunkte oder Beweise dafür sammeln, dass Peabody alles andere als ausgebrannt war. Im besten Falle ertappte sie ihn in flagranti, während er die gut gehüteten Bankgeheimnisse seiner ihm anvertrauten Kunden an zwielichtige Finanzhaie verschacherte.
Sie würde also an dem Burschen dranbleiben, Fotos schießen und so viele Informationen beschaffen wie möglich. Was ihre Auftraggeber und deren Versicherungsagenten daraus machten, war Jane letztendlich egal.
Sie rief sich innerlich zur Ordnung, um gedanklich nicht immer wieder abzuschweifen, und sah gerade noch, wie Peabody einen Zug bestieg, der vor wenigen Sekunden eingefahren war.
Jane sprang zwei Türen weiter in den Zug, stets damit rechnend, dass ihre Zielperson blitzschnell wieder nach draußen springen würde. Doch Peabody war die Ruhe in Person. Von dem Trubel um ihn herum unbeeindruckt, ergatterte er einen Sitzplatz, schlürfte seinen Kaffee und versuchte irgendwie mit einer Hand die Zeitung zu entfalten, um darin zu lesen.
Jane wechselte den Waggon und ging das Risiko ein, dass Peabody sie sah, in der Hoffnung, dass er sie nicht erkannte. Aber die Detektivin war sich sicher, dass er sie auf dem Weg hierher nicht bemerkt hatte, zumal sie jeden Tag ihr Outfit wechselte.
Jane blieb stehen und drückte sich in die Türnische, vor der eine Clique junger Frauen stand, die alle eifrig mit ihren Smart- und iPhones beschäftigt waren.
Der süßliche Vanille-Geruch ihrer Parfums vermischte sich mit den Ausdünstungen schwer arbeitender Menschen. Unwillkürlich atmete Jane flacher und hielt sich an der Schlaufe über ihrem Kopf fest, als der Zug mit einem Ruck stoppte.
Oscar Peabody erhob sich, ließ die Zeitung achtlos auf seinem Sitz liegen und ging, den Pappbecher mit dem lauwarmen Kaffee in der Hand, auf die mittlere Tür des Waggons zu, die sich zischend öffnete.
Jane ließ die Mädchen-Clique vor sich aus dem Zug gehen und folgte ihnen langsam. Zum Glück war sie nicht als Erste ausgestiegen, denn dann wäre sie Peabody direkt in die Arme gelaufen. So sah sie gerade noch, wie er den Becher in einen überquellenden Mülleimer warf, der an der Wand vor dem Treppenaufgang hing.
Sie folgte dem Mann die Stufen hinauf und ließ sich vom Strom der Menschen aus der U-Bahn-Station Gloucester Road treiben. Wieder einmal musste sie feststellen, dass man sich nirgendwo besser verstecken konnte als in der Menge.
Peabody fuhr mit der Rolltreppe nach oben und wandte sich nach rechts. Dort führten zwei Treppen ans Tageslicht. Jane beschleunigte ihre Schritte und befand sich gut dreißig Yards hinter Peabody, als sie das laute Brüllen eines Mannes ablenkte.
Ruckartig wandte sie den Kopf und sah am oberen Ende der Treppe, die auf die Courtfield Road führte, einen Mann aus dem grellen Sonnenlicht in den Schatten wanken.
Die Passanten um ihn herum schrien auf und sprangen erschrocken zur Seite.
Das Brüllen steigerte sich zu einem infernalischen Kreischen, und Jane blieb wie angewurzelt stehen. Da wo die Strahlen der Sonne die nackte Haut des jungen Mannes trafen, qualmte sie und schlug Blasen. Das konnte Jane selbst auf die Distanz erkennen.
Den Atem anhaltend, beobachtete sie, wie kleine Flammen über die Haut des Unglückseligen huschten, und noch ehe er die oberste Stufe der Treppe erreichte, standen Kopf und Hände in lodernden Flammen. Dann bekam er das Übergewicht und rollte als um sich schlagende, brennende Fackel in die Tiefe.
Die Menschen auf der Treppe drückten sich an die gekachelten Wände. Eine Frau presste ihr schreiendes Baby an sich, während der in Flammen stehende Mann an ihr vorbeirollte.
Als dieser vor Jane auf den Boden der U-Bahn-Station aufschlug, war er längst tot. Die Bewegungen, die der brennende Körper noch machte, stammten von der unerträglichen Hitze, die seinen Körper verformte. Jane starrte wie hypnotisiert auf die Leiche, die binnen weniger Sekunden komplett verbrannte, bis nur noch ein stinkender, schwarzer Brei übrig blieb, der einen penetranten Gestank nach verkohltem Fleisch, verbranntem Haar und geschmolzenem Plastik verströmte.
Oscar Peabody war längst verschwunden.
Kapitel 3
»Das wird dir gefallen, Mark«, sagte Ines mit einem ernsten Blick, der ihren lockeren Ton Lügen strafte, während sie das Telefon zurück in die Station stellte.
Mark Benecke, Forensiker mit dem Spezialgebiet Entomologie, also Insektenkunde, hob den Kopf und blickte seine Mitarbeiterin und Ehefrau in Personalunion über das binokulare Mikroskop hinweg mit gerunzelter Stirn an.
Während er die Brille wieder aufsetzte, die er jedes Mal abnahm, wenn er am Mikroskop arbeitete, murmelte er: »Hoffentlich. Wäre mal wieder Zeit für was Ausgefallenes.«
Ines ging auf den langen Labortisch zu und strich sich eine Strähne ihres flammroten Haares zurück, bevor sie die Arme vor der Brust verschränkte.
»Spontane menschliche Selbstentzündung. Ausgefallen genug?«
Mark richtete sich auf seinem Drehhocker auf und bekam glänzende Augen. »SHC? Wie geil ist das denn?«
Ines verzog die Lippen und schaute ihren Mann unter hochgezogenen Augenbrauen an, dessen Stirn sich sofort in Falten legte, wobei sich sein Blick schlagartig verfinsterte.
»Ähm, ich meine, ganz üble Sache. Wo? Wer? Wie?«
»Berliner Charité, Psychiatrie, geschlossene Abteilung. Alisa Rubens, fünfundvierzig Jahre alt. Und das ›Wie‹ ist unser Job.« Ines grinste säuerlich und fuhr fort. »Die Frau brach zu Hause schreiend zusammen, brüllte, dass sie innerlich verbrennen würde, und verkroch sich schließlich unter ihrem Bett. Sie wurde in die Charité eingeliefert und ziemlich schnell in die Geschlossene weiterverlegt. Dort hat sie sich schlagartig beruhigt, nachdem man sie in ein abgedunkeltes Einzelzimmer verlegte. Als am nächsten Tag das Essen gebracht wurde und ein Pfleger das Fenster öffnen wollte, griff sie ihn an. Erst nachdem man sie fixiert und ihr jeweils zehn Milligramm Diazepam und Benperidol injiziert hatte, fing sie sich wieder.«
»Faszinierend!«, lautete Marks vorläufiger Kommentar.
Ines nickte. »Pass auf, es geht noch weiter. Nachdem sich Alisa Rubens beruhigt hatte und eingeschlafen war, konnte der Pfleger endlich das Fenster öffnen, und keine fünf Minuten später war von ihr nichts weiter übrig als ein Häufchen Asche. Auch das Flügelhemd, das sie trug, ist komplett verbrannt. Das Laken darunter ist dagegen nur angesengt. Matratze und Fixierriemen sind unversehrt geblieben.«
»Hat diese Alisa zuvor schon aggressives Verhalten gezeigt?«
Ines schüttelte den Kopf. »Soviel ich weiß, nicht. Solche Anfälle hat sie laut Aussage ihrer Familie noch nie gehabt. Ich denke, ausgefallener geht es nicht mehr.«
Mark schnaubte abfällig. »Zumindest ist das der erste dokumentierte Fall von SHC in Deutschland in den letzten fünfzig Jahren.« Er erhob sich. »Ist Nico schon da?«
Ines presste die Lippen aufeinander und hob die Augenbrauen. »Sie hat doch gerade eben ›Jode Morje‹ gesagt.«
Mark riss erstaunt die Augen auf und schaute sich um.
»Und wo steckt sie jetzt?«
Ines machte eine Kopfbewegung zum Nebenraum. »Nebenan. Macht sich was zu essen. Hat ja heute auch schon zwei Stunden für unsere Kölner Polizei malocht.«
»Dann werd’ ich sie mal über den neuen Job ins Bild setzen. Hoffentlich hat sie Zeit für einen kleinen Trip nach Berlin.«
»Tu das, ich such euch schon mal die schnellste Bahnverbindung raus.« Ines wandte sich von dem Labortisch ab und einem kleineren Schreibtisch zu, auf dem ihr Laptop stand.
»Dank dir, Häschen.« Mark verschwand im Nebenraum, in dem sich eine kleine Küche befand, auf deren Arbeitsfläche einsam und verlassen ein Glas Erdnussbutter stand. Er runzelte die Stirn, denn von Tina war nichts zu hören oder zu sehen. Mark nahm das Erdnussbutterglas und wollte es in den Schrank zurückstellen.
»Finger weg, Bene.« Die Stimme war in seinem Rücken aufgeklungen, scharf wie ein Rasiermesser, so dass er augenblicklich erstarrte, das Glas langsam auf die Platte zurücksinken ließ und sich dann im Zeitlupentempo umdrehte.
Tina stand keine zwei Schritte vor ihm und bedachte ihn mit einem strengen Blick aus ihren rehbraunen Augen. »Kann ich nicht mal kurz für kleine Mädchen, ohne dass du mir gleich mein Frühstück klaust?«, protestierte die sportliche Mitdreißigerin, die ihr blondes Haar im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte.
»Öhm, ich dachte du wärst fertig.«
Tina Baumjohann, genannt Nico, drückte sich an Mark vorbei. Aus dem Hängeschrank holte sie einen flachen Teller, zog die Besteckschublade auf und nahm sich ein Messer heraus.
»Was gibt’s denn so Dringendes, dass du dein Mikroskop unbeaufsichtigt stehen lässt, um mir mein Frühstück zu stibitzen?«
»Ich wollte nur für Ordnung sorgen«, verteidigte sich Mark. »Wie war es denn bei der Polizei?«
Tina zuckte die Achseln, während sie zwei Scheiben Vollkorntoast in den Toaster steckte und den Hebel herunterdrückte. Dann drehte sie sich um und antwortete: »Das Übliche. Alleinstehender Rentner, den es auf dem Klosett erwischt hat. Lag schon eine Weile in seiner Wohnung. Kein schöner Anblick.«
»Also bist du sozusagen frei?«
Tina kniff leicht die Augen zusammen. »Worauf willst du denn eigentlich raus, Bene? Gibt’s ’nen interessanten Job für uns?«
Mark hob beide Hände und machte mit Daumen und Zeigefinger die Pistolengeste. »Exakt!«, rief er.
Hinter Tina schnellten die Toastscheiben aus dem Röster. Sie drehte sich um und bestrich beide Scheiben dick mit Erdnussbutter.
»Und um was geht es?«, fragte sie, während sie eine Banane schälte und anschließend in kleine Scheiben schnitt, die sie dekorativ auf den Toastscheiben drapierte.
Mark beobachtete blinzelnd die Akribie, mit der seine Kollegin zu Werke ging, und war für einen Moment derart abgelenkt, dass er vergaß zu antworten. Daher drehte sich Tina um und wiederholte ihre Frage.
»Sorry«, meinte Mark und deutete auf den Toast mit Erdnussbutter und Bananenscheiben. »Wie kannst du am frühen Morgen schon so was essen? Ist mir ein Rätsel, wie du bei dieser Ernährung so schlank bleiben kannst.«
Tina griente und klappte die beiden Toastscheiben zusammen. »Hoher Grundumsatz. Also?«
»Also was?« Mark zeigte sich irritiert.
Tina verdrehte die Augen. »Worum geht es bei dem Auftrag?«, fragte sie und biss in ihr Erdnussbutter-Sandwich.
»SHC!«, rief Mark mit leuchtenden Augen.
»Hmpf«, machte Tina.
*
»Wir können froh sein, dass die Charité in Berlin liegt und nicht in irgendeinem kleinen Popeldorf in der Walachei«, sagte Mark, als er und Tina gut sechs Stunden später aus dem Taxi stiegen.
Jetzt standen sie mit ihrem spärlichen Reisegepäck, in dem sich größtenteils die Utensilien für ihre Arbeit befanden, vor dem imposanten Bau der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité am Hindenburgdamm in Berlin-Steglitz.
Tina warf dem Kriminalbiologen einen amüsierten Seitenblick zu. »Wenn du die Wahl gehabt hättest, ständen wir vermutlich eher in dem walachischen Popeldorf als hier in Berlin.«
Mark seufzte und betrat vor seiner Mitarbeiterin die Eingangshalle der Klinik. »Du kennst mich einfach zu gut, Nico.«
Die psychiatrische Abteilung war in einem gigantischen kastenförmigen Bau untergebracht, der für Mark den Eindruck machte, als hätte ein Riesenbaby wahllos Bauklötze aufeinandergeschichtet. Die Psychiatrie war erst vor knapp zwei Jahren in dieses Gebäude eingezogen, und auch wenn insgesamt weniger Platz vorhanden war, so war die Ausstattung doch deutlich komfortabler.
Mark kannte die Charité von früheren Besuchen, und er hatte auch beruflich schon öfter in Berlin zu tun gehabt. Als freiberuflicher Kriminalbiologe und forensischer Entomologe, der als internationale Kapazität auf seinem Fachgebiet galt, kam er nicht nur deutschlandweit gut herum. Aber die Psychiatrie der Charité-Klinik war selbst für ihn Neuland.
Gemeinsam mit Tina begab er sich zum Empfangstresen, der sogenannten Informationszentrale, hinter der eine schlanke Frau mit langen blonden Haaren und blutrot geschminkten Lippen breit lächelnd fragte, was sie für die Neuankömmlinge tun könne.
Mit ihrer schwarzen Weste über der weißen Bluse sah sie eher aus wie die Rezeptionistin in einem Hotel, und vermutlich hielt sie das Pärchen, beziehungsweise einen Teil davon, für neue Patienten.
Kein Wunder, denn weder Tina noch Mark legten bei ihrem Job sonderlich viel Wert auf Etikette. In ihren Augen waren Kostüm oder Anzug und Krawatte nicht mehr als Blendwerk, das nicht selten über mangelnde Kompetenz hinwegtäuschen sollte. Oder über mangelndes Selbstbewusstsein.
Von beidem besaßen die zwei Kriminalbiologen mehr als genug, so dass sie es sich leisten konnten, in Jeans und T-Shirt aufzutreten. Während Tina etwas farbenfroher daherkam und zur Bluejeans ein paar rote Chucks trug, war Mark mal wieder komplett in Schwarz gekleidet. Wobei auf seinem T-Shirt noch das Konterfei eines bekannten Einwohners von Entenhausen zu sehen war, der als Matrose seinen Lebensunterhalt bestritt und einen erheblichen Sprachfehler besaß. Auf Marks kahlgeschorenem Kopf saß, wie immer, wenn er unterwegs war, ein schwarzes Basecap.
Vermutlich stufte die Rezeptionistin instinktiv ihn als den Problemfall ein.
Um der freundlichen Dame ihre Illusionen nicht zu schnell zu rauben, überließ er Tina das Reden, die gar nicht erst mit der Verlautbarung ihrer Profession herausrückte, sondern stattdessen nur sagte, dass sie einen Termin mit der zuständigen Oberärztin Dr. Nadia Reza hätten.
Die Dame am Empfang versprach, die Ärztin anzupiepen, und bat Tina und Mark, noch einen Moment auf den bequemen Schalensitzen Platz zu nehmen.
Lange brauchten sie nicht zu warten, bis eine zierliche Frau mit dunkler Haut angerauscht kam. Die langen, schwarzen Haare trug sie im Nacken zusammengebunden. Mit einer Körpergröße von knapp ein Meter sechzig reichte sie Mark gerade mal bis zum Brustbein, doch sie strahlte eine Energie aus, mit der man vermutlich die gesamte Klinik mit Strom betreiben konnte.
Sie trug einen weißen Kittel mit dem Charité-Emblem auf der linken Brust und ein strahlendes Lächeln, das es schwermachte, das Alter der Frau zu schätzen. Sie wirkte wie Anfang dreißig, doch in Anbetracht ihrer Position war sie vermutlich schon einige Jahre älter.
Die Begrüßung fiel kurz, aber herzlich aus, und wenig später saßen sich die drei in Nadias Büro an einem niedrigen Tisch in einer gemütlichen Sitzecke gegenüber und tranken frisch gebrühten Kaffee aus einer privaten Espresso-Maschine, die auf einer kleinen Anrichte stand.
Da sie sich von Beginn an sympathisch waren, waren sie gleich zum unkomplizierten Du übergangen, und so erfuhren Tina und Mark nun aus erster Hand, was vorgefallen war. Der Krankenpfleger, der mit dabei gewesen war, als Alisa Rubens verbrannte, war zurzeit krankgeschrieben. Mitanzusehen, wie ein Mensch bei lebendigem Leib verbrannte, verkraftete man nicht so leicht.
»Waren Sie ebenfalls dabei?«, wollte Tina wissen, und Nadia lehnte sich in ihrem Schwingsessel zurück, wobei sie die Beine übereinanderschlug. Ihre Hand zitterte leicht und beantwortete einen Teil von Tinas Frage, bevor die Ärztin den Mund aufmachen konnte.
»Ich kam dazu, als Alisa Rubens schon nicht mehr lebte. Martin lehnte kreidebleich an der Wand und stammelte sinnloses Zeug vor sich hin. Er hat es gerade noch geschafft, den Notruf auszulösen. Doch das Opfer, Frau Rubens, muss so unglaublich schnell verbrannt sein, dass es schon zu spät war. Wir stehen vor einem Rätsel. Daher habe ich mich ja auch dafür eingesetzt, dass ihr hinzugezogen werdet. Ich weiß, dass ihr bereits für die Charité gearbeitet habt und einige beachtliche Erfolge vorweisen könnt. Außerdem habe ich die Artikel gelesen, die du über das Phänomen der spontanen Selbstentzündung geschrieben hast.« Dabei nickte sie Mark zu, der seinen Kaffee in kleinen Schlucken genoss.
»Habt ihr denn so was schon mal erlebt?«, fragte dieser und stellte die leere Tasse vor sich auf den Tisch.
Nadia schüttelte den Kopf und strich sich mit der freien Hand über die Augen. »Nein. Soweit ich weiß, ist dieser Fall einzigartig. Zumindest unter diesen Umständen. Bislang haben wir allerdings von einer kollegialen Unterstützung anderer Kliniken abgesehen, damit nichts nach außen dringt und es womöglich noch zu einer Massenhysterie kommt. Solange die Ursache für die spontane Selbstentzündung von Frau Rubens nicht gefunden wurde, darf dieser Fall nicht an die Presse gelangen.«
Tina nickte verständnisvoll. »Sicherlich wurde aber die Polizei verständigt, oder?«
»Natürlich. Das ist bei jedem ungeklärten Todesfall und vollendeten Suizid Vorschrift. Andernfalls würden wir uns strafbar machen.«
»Du hältst also einen Suizid für denkbar?«, fragte Mark.
Nadia wiegte den Kopf. »Ich erwähnte es lediglich der Vollständigkeit halber. Bislang können wir auch eine Selbsttötung nicht ausschließen. Obwohl unklar ist, wie es Alisa Rubens geschafft haben soll, einen so wirkungsvollen Brandbeschleuniger hineinzuschmuggeln. Ganz zu schweigen davon, wo und wie sie diesen besorgt haben könnte.«
Mark nickte wissend. »Ich weiß, worauf du hinauswillst. Selbstmörder, die sich anzünden, übergießen sich mit Benzin und stecken es dann mit einem Streichholz oder Feuerzeug in Brand. Dabei wird der Leichnam aber nie vollständig und restlos vernichtet. Die Haut ist verkohlt, stellenweise auch nur gut durchgebraten, aber die Organe sind oft noch perfekt erhalten. Und in dem von dir geschilderten Szenario, wo das Opfer sogar noch fixiert war, hätte sich das Feuer niemals so schnell ausbreiten können.«
»Was sagt denn die Polizei dazu?«, wollte Tina wissen.
Nadia warf der blonden Frau einen langen Blick zu. »Die haben den Tatort abgesperrt und versiegelt und einige Proben von dem … von der … äh, Leiche mitgenommen und gemeint, dass dies etwas für einen Spezialisten wäre, den sie einbestellen müssten. Die Beamten wirkten nicht minder ratlos wie wir.«
»Ein Spezialist?«, echote Mark und konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. »Wer soll das sein? Fox Mulder?«
Doch Nadia zuckte nur die Achseln. »Keine Ahnung. Er wollte eigentlich schon hier sein.«
»Na gut«, sagte Tina und stellte ihre leere Tasse nun ebenfalls geräuschvoll auf den Tisch. »Da wir nicht nur zum Plauschen hier sind, wäre es sicherlich am sinnvollsten, wenn wir uns den Tatort mal näher anschauen.«
»Wir müssen aber auf jeden Fall das Eintreffen des Spezialisten abwarten.«
Tina verzog die Lippen. »Dann hoffen wir, dass er bald erscheint. Wir haben nicht die Zeit, um tatenlos herumzusitzen.«
Die Ärztin wirkte verlegen und wusste nicht so recht, was sie sagen sollte. Zum Glück meldete sich in diesem Moment der Pieper. Nadia warf einen raschen Blick auf das Display, murmelte eine kurze Entschuldigung in Richtung der beiden Kriminalbiologen und rief die angegebene Nummer zurück.
Sie lächelte, als sie auflegte. »Er ist da«, sagte sie nur.
Gemeinsam gingen sie den Weg zurück in die Eingangshalle, in der ein schlanker, hochgewachsener Mittfünfziger mit graumeliertem Haar lässig am Empfangstresen lehnte und mit der Rezeptionistin plauderte. Nadia lief so schnell auf den Mann zu, dass ihr weißer Kittel flatterte, und streckte noch im Gehen ihre rechte Hand aus.
»Schön, dass Sie doch noch so schnell gekommen sind«, rief sie mit einer Stimme, aus der die Erleichterung deutlich herauszuhören war. »Ich bin Dr. Nadia Reza.«
Der Neuankömmling lächelte und ergriff ihre Hand. »Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Harry Stahl. Ich arbeite für das BKA.«
*
»Und was genau machen Sie hier?«, fragte Harry den Forensiker, der sich ihm als Mark Benecke vorgestellt hatte, während sie hinter Dr. Nadia Reza durch die Gänge der Charité zu der Station eilten, auf der das unerklärliche Phänomen aufgetreten war.
»Komisch, dasselbe wollte ich Sie eigentlich fragen«, meinte Mark Benecke und kassierte prompt einen Ellenbogenstoß von der sportlichen jungen Frau namens Tina Baumjohann.
Harry Stahl runzelte die Stirn und wusste nicht recht, wo er zuerst hinschauen sollte. Auf das Donald-Duck-T-Shirt oder auf die kunstvolle Tätowierung, die sich aus dem Kragen am Hals des Forensikers emporschlängelte. Gewiss entsprach das Erscheinungsbild dieses Mannes nicht seiner Vorstellung eines Experten für forensische Entomologie, der zugleich noch als internationale Kapazität galt. Seine Kollegin wirkte da irgendwie … seriöser.
Vielleicht wirst du auf deine alten Tage auch einfach ein wenig spießig, dachte er.
»Wir wurden von Dr. Reza im Auftrag der Charité engagiert«, erwiderte Tina, wobei ihrer Stimme deutlich die Skepsis anzuhören war. Sie lächelte entwaffnend, als sie fortfuhr: »Aber es ist schon außergewöhnlich, dass das LKA Berlin einen Spezialisten aus Wiesbaden einfliegen lässt, oder?«
Harry konnte gar nicht anders, als das charmante Lächeln zu erwidern. Die junge Frau erinnerte ihn irgendwie an eine gewisse Privatdetektivin aus London. »Nun, eingeflogen bin ich nicht direkt. Daher hat es ja auch so lange gedauert. Aber wie Sie sicherlich wissen, wird bei ungeklärten Todesfällen immer die Polizei hinzugezogen, und dieser Fall ist so unaufgeklärt, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann.«
»Was macht Sie denn zu so einem, äh, Spezialisten?«, wollte Mark wissen.
Harry überlegte einen Moment, bevor er antworte. »Nun, ich denke, zum größten Teil die Offenheit für alles Außergewöhnliche. Wenn ich zu einem Fall hinzugezogen werde, ziehe ich keine vorschnellen Schlüsse, sondern betrachte lediglich die Fakten. Alles ist möglich, wenn …«
»… man das Unmögliche erst einmal eliminiert hat?«, fragte Mark und wich einer Gruppe von Patienten in Sportkleidung aus, die sich Richtung Ausgang begab.
»Darum geht es«, meinte Harry. »Für mich gibt es das Unmögliche gar nicht. Ich halte erst einmal alles für denkbar, so ungewöhnlich es scheinen mag. So wie in diesem Fall.«
»Und womit rechnen Sie in diesem Fall?«, fragte Mark, als sie vor einer doppelflügeligen Tür hielten. Die Ärztin wollte schon öffnen, doch Harry gab ihr mit einer schnellen Handbewegung zu verstehen, noch einen Moment zu warten.
»Nun, betrachten wir doch einmal die Fakten. Eine Frau, die deutliche Symptome einer psychotischen Krise zeigt, wird in die Charité eingeliefert. Sie hat eine Art Anfall gehabt und geglaubt, sie würde innerlich verbrennen. Erst als sie auf die geschlossene Abteilung der Psychiatrie in einen abgedunkelten Raum verlegt wird, beruhigt sie sich, wird aber zunehmend aggressiver. Als der Pfleger versucht, das Fenster zu öffnen, greift die Frau ihn an und wird fixiert. Das Fenster wird geöffnet, und kaum trifft sie das Licht der Sonne«, Harry klatschte laut in die Hände, »geht sie in Flammen auf.«
Tina und Mark wechselten einen schnellen Blick und schauten auch Dr. Reza ein wenig ratlos an.
»Woran denken Sie spontan bei dieser Beschreibung?«
»Vampire!«, rief Mark, und Harry grinste triumphierend, während Dr. Reza ihn skeptisch beäugte.
»Ähm, das ist ein Scherz, oder?«
Harry Stahl deutete mit dem ausgestreckten Finger auf die immer noch verschlossene Stationstür. »Da drin ist ein Mensch auf grausame Weise gestorben. Glauben Sie mir, Doktor: Mit so etwas treibe ich keine Scherze. Öffnen Sie jetzt bitte die Tür.« Er warf Tina und Mark einen Blick über die Schulter zu.
»Sie dürfen natürlich gerne mitkommen.«
»Wie nett«, kommentierte Mark nur und zuckte zusammen, als Tinas Ellenbogen erneut seine Rippen traf. »Autsch, das gibt einen blauen Fleck.«
*
Harry Stahl lehnte mit verschränkten Armen vor dem gekippten Fenster und beobachtete die beiden Sachverständigen, die stumm und effizient ihre Arbeit verrichteten. Mark trug ein Stirnband mit einer batteriebetriebenen Lampe und kroch auf dem Boden herum, während Tina Proben entnahm und eintütete.
Nicht nur von der mittlerweile erkalteten Asche, die als Einziges von der bedauernswerten Frau übriggeblieben war, sondern auch von dem Laken, der Matratze und den Fixierriemen.
Harry beobachtete Mark eine geraume Weile, bis er sich schließlich leicht nach vorne beugte und fragte: »Was suchen Sie eigentlich da unten?«
Mark rollte sich auf den Rücken und ließ sich von Tina auf die Beine ziehen. »In erster Linie Spritzspuren.«
»Spritzspuren?«, fragte Harry verblüfft. »Sie meinen Blutspritzer.«
Mark wiegte den Kopf. »Blut, Sperma, Urin, alles, was der menschliche Körper eben so produziert.«
Harry runzelte die Stirn. »Sagen Sie mal, was glauben Sie eigentlich, was hier vorgefallen ist? Ich denke, es geht um spontane Selbstentzündung.«
»Eben! Daher müssen wir ausschließen, dass hier kein Tötungsdelikt vorliegt, bei dem jemand nur den Anschein erwecken wollte, dass die Frau an SHC gestorben ist. Ihnen als Polizist muss ich doch keinen Vortrag darüber halten, was Mörder alles so anstellen, um ihre Spuren zu verwischen.«
»Meinen Sie, die Frau könnte einem profanen Mord zum Opfer gefallen sein, vielleicht sogar, nachdem sich jemand an ihr vergangen hat?«
»Bevor wir uns mit dem Außergewöhnlichen auseinandersetzen, müssen wir erst einmal die naheliegenden und gewöhnlichen Alternativen ausschließen. Sagen Sie mal, was für eine Art Polizist sind Sie eigentlich?«
Harry grinste. »Einer der besonderen Art.«
Mark ging nicht weiter darauf ein, sondern widmete sich wieder seiner Arbeit, und nachdem diese beendet war, fragte Harry nur: »Fertig?«
Mark richtete sich auf. »Wir schon.«
»Gut, dann können wir uns ja auf den Weg machen.«
»Moment mal. Wollen Sie nicht noch irgendetwas hier machen?«
Harry schaute Mark verdutzt an. »Zum Beispiel?«
Der Kriminalbiologe grinste und zuckte zugleich mit den Achseln. »Keine Ahnung. Irgendwelche Beschwörungsformeln rufen oder mit einem silbernen Kreuz in der Asche herumwühlen?«
Harry Stahl schmunzelte. »Nein, das überlasse ich lieber einem englischen Kollegen. Ich wollte mir lediglich einen Eindruck vom Ort des Geschehens verschaffen.«
»Und dafür sind Sie jetzt extra nach Berlin gekommen?«, fragte Tina, während sie die beschrifteten Proben in einen Koffer einsortierte.
»Nicht nur. Außerdem möchte ich mich mit der Familie des Opfers unterhalten. Sie lebt ein wenig außerhalb von Berlin. Wenn Sie möchten, dürfen Sie mich gerne begleiten.« Harry machte eine einladende Geste Richtung Tür.
Mark grinste. »Sie fangen an, mir zu gefallen, Mulder.«
Kapitel 4
Suko stoppte den Dienstrover einige Yards vor den leuchtend gelben Absperrbändern der Spurensicherung, die in der morgendlichen Brise flatterten. Wir stiegen aus dem Wagen und schritten nebeneinander auf die Kollegen der Mordkommission zu.
Die Gestalt unseres Freundes Chiefinspektor Tanner war unverkennbar. Wie immer trug er seinen knittrigen Trenchcoat und den unvermeidlichen speckigen Filzhut, der vermutlich mehr Jahre auf dem Buckel hatte als ich.
Ein wenig wunderten Suko und ich uns darüber, dass die Absperrung direkt vor dem Wasser des Sees errichtet worden und zum Ufer hin offen geblieben war. Ein Polizeiboot schaukelte auf den Wellen und sorgte dafür, dass kein Kanufahrer einen bestimmten Bereich durchquerte.
Zwei Ambulanzwagen standen unweit der Absperrung und betreuten mehrere Zivilisten, bei denen es sich vermutlich um Augenzeugen handelte.
Innerhalb der Absperrung sahen wir zwei in weiße Plastikoveralls gekleidete Mitarbeiter der Spurensicherung sowie den Polizeiarzt, der vor dem offenen Zinksarg hockte, in dem in der Regel das tote Opfer abtransportiert wurde. Nur dass wir keinerlei Leichnam sehen konnten. Möglicherweise trieb dieser noch im Wasser.
Ein uniformierter Polizist machte Tanner auf uns aufmerksam. Der nickte dem jungen Kollegen dankend zu und kam in unsere Richtung geschlendert, wobei er sich den Filzhut in den Nacken schob und den kalten Zigarrenstummel aus dem Mundwinkel nahm. Er reichte uns nacheinander die Hand.
»Ich sage euch, ich verfluche mehr und mehr den Tag, an dem ich euch kennengelernt habe.«
Suko neigte den Kopf schräg zur Seite. »Ach komm schon, Tanner. So schlimm kann es doch nicht sein.«
Unser alter Freund schnaubte. »Schlimm ist gar kein Ausdruck. Und wenn ich nicht wüsste, womit ihr euch tagtäglich herumprügelt, hätte ich diesen Fall längst zu den Akten gelegt.«
Ich runzelte die Stirn. »Handelt es sich um ein Gewaltverbrechen oder nicht?«, wollte ich wissen.
Tanner hob in einer hilflosen Geste die Schultern. »Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nur, dass hier ein Mensch auf höchst sonderbare Weise ums Leben gekommen ist.«
Suko und ich sahen uns überrascht an. Schließlich forderte mein Partner den Chiefinspektor auf, von Beginn an zu berichten.
»Eigentlich war es der Notarzt, der uns angerufen hat. Der ist von den Leuten hier alarmiert worden.« Tanner deutete auf einen älteren Mann, zwei Frauen mittleren Alters und zwei junge Burschen, die von den Sanitätern versorgt wurden.
»Sie alle berichten einvernehmlich, dass eine Joggerin plötzlich zu schreien und zu qualmen begann, woraufhin sie sich in die Serpentine warf. Die beiden Jungs dort sind sofort hinterhergesprungen. Sie mussten die Frau mit Gewalt ans Ufer zerren, und dort«, Tanner wischte sich den Schweiß von der Stirn, »dort ist sie dann in Flammen aufgegangen.«
Wir mussten ziemlich dumm aus der Wäsche schauen, denn Tanner konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. »Ich würde ja hundert Pfund für eure Gedanken zahlen, aber ich kenne euch lange genug, um zu wissen, was da in euren Oberstübchen vor sich geht.«
»Ach ja?«, fragte ich herausfordernd. »Dann klär uns mal auf.« Ich stemmte die Fäuste in die Hüfte und reckte das Kinn vor, um meinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Vampire«, erwiderte Tanner lakonisch, und ich ließ Schultern und Arme sinken.
»Treffer, versenkt, würde ich sagen«, antwortete Suko. »Doch so ganz gefällt mir die Theorie noch nicht.«
Tanner schaute abwechselnd zwischen uns hin und her. »Warum nicht?«
»Weil Vampire in der Regel nicht am helllichten Morgen joggen gehen«, erwiderte ich trocken und deutete auf die Zeugen. »Am besten, wir sprechen mal mit den Leuten, die versucht haben, die arme Frau aus dem Wasser zu ziehen.«
Suko nickte bestätigend, und gemeinsam stiefelten wir auf den Rettungswagen zu. Die beiden Jungs saßen nebeneinander auf den Stufen der Seitentür und schauten mit leeren Blicken auf den mit Laub bedeckten Weg.
Erst als unsere Schatten über sie fielen, hoben sie synchron die Köpfe. Tränen standen in ihren Augen.
Ich ging neben den beiden in die Hocke und sah, dass sie Becher mit Kaffee oder Tee in den Händen hielten, doch sie zitterten so stark, dass sie unmöglich in der Lage waren zu trinken.
»Guten Tag, mein Name ist John Sinclair«, begrüßte ich die beiden Jungs mit leiser Stimme und zeigte ihnen meinen Ausweis. Suko stellte sich ebenfalls vor, und auch er präsentierte seine Legitimation.
Die beiden jungen Männer hießen Justin und Michael, stammten aus Cornwall und studierten hier in London.
»Wir sind gerade durch den Park gelaufen, als wir sahen, wie der Alte da die Frau ansprach«, der dunkelhaarige Justin deutete auf den älteren Mann, der einen kleinen Hund auf dem Arm hielt, an dem er sich festklammerte wie an einem Rettungsanker, den er nie mehr loslassen wollte. Sehr zum Verdruss des Tieres.
»Wir sahen es im Vorbeilaufen und dachten, er würde sie belästigen, weil sie plötzlich anfing zu schreien.«
Der blonde Michael nickte. »Wir blieben stehen und wollten schon dazwischengehen, als sie plötzlich eine Art Krampf bekam. Sie … sie klammerte sich an der Bank dort fest und bog den Kopf ganz weit nach hinten.«
Tränen traten Michael in die Augen, als die Erinnerung ihn übermannte. »Sie … sie schrie so laut, wie ich noch nie einen Menschen schreien gehört habe.« Er verstummte und senkte den Blick. Auch Justin blickte stur in seinen Pappbecher.
»Was ist dann passiert?«, fragte Suko behutsam.
Michael hob den Blick, und die Tränen rannen jetzt frei und ungehindert über seine Wangen.
»Dann sprang sie über die Bank und rollte sich ins Wasser. Wir sind sofort hinterher, aber … aber … es war … als wollte sie gar nicht gerettet werden.«
»Wie das?«, fragte ich.
»Sie schlug und biss um sich.« Er nickte heftig. »Ja, sie schnappte richtig mit den Zähnen nach uns. Aber das war nicht das Schlimmste«, flüsterte Michael.
»Sondern?«
»Ihre Haut …«, hauchte er. »Ihre Haut war … sie war so heiß. Wir konnten sie kaum halten und … und …«
»Trotzdem habt ihr sie zum Ufer gezerrt«, sagte Suko.
Michael starrte meinen Freund an. »Ja, ja, das wollten wir. Aber plötzlich fing sie an zu brennen.« Seine Stimme überschlug sich, und er begann zu schluchzen. »Und ihre Augen … oh Gott.«
»Ich denke, es reicht jetzt«, schaltete sich der Notarzt ein und schob uns zur Seite. »Wir werden die beiden ins Krankenhaus bringen und dort noch eine Nacht überwachen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an das St.-Thomas-Hospital.«
Damit waren wir abgespeist. Auch der ältere Herr mit seinem Hund konnte uns nicht viel mehr erzählen, außer, dass die Frau schon zuvor gequalmt und eine enorme Hitze verströmt hatte. Das konnte tatsächlich auf eine Vampirin hindeuten. Bissmale hatte der Zeuge jedoch keine gesehen, aber das wollte nichts bedeuten. In so einer Stresssituation merkte man sich nicht jedes Detail.
Wir aber wollten uns noch die Überreste der Toten ansehen. Der Polizeiarzt, ein hagerer, älterer Mann mit Glatze und tief in den Höhlen liegenden Augen, kam uns entgegen. »Bevor Sie fragen, sage ich Ihnen lieber gleich, dass ich so etwas noch nie zuvor erlebt habe. Die Taucher sind noch auf der Suche, aber bislang haben wir nichts gefunden, was eine Identifikation ermöglichen würde.«
»Schon gut, Doktor. Wir wollen uns die Überreste trotzdem mal anschauen.«
»Bitte sehr«, sagte der Arzt und machte eine einladende Geste in Richtung Zinksarg.
Als wir zum Ufer gingen, schaute ich in den fast wolkenlosen Himmel. Es würde wirklich ein wunderschöner Tag werden, doch irgendwie kam er mir schon jetzt deutlich trüber vor als noch vor einer Stunde. Verdammter Job, dachte ich, als ich neben dem Sarg in die Hocke ging und die Kette über den Kopf streifte, an der mein silbernes Kreuz baumelte.
Lichtreflexe huschten über das polierte Silber, verursacht von den Strahlen der Septembersonne. Ich befühlte den Talisman, der einst von dem Propheten Hesekiel in babylonischer Gefangenschaft hergestellt und von den vier Erzengeln geweiht worden war.
Sollte sich in den Überresten der jungen Frau eine schwarze Magie manifestiert haben, würde mein Kreuz sie wie einen Detektor spüren und sich erwärmen. Doch das Metall blieb kühl. Ich senkte den Blick und nahm erst jetzt den Inhalt des Sarges bewusst wahr.
Bis zuletzt hatte ich mir diesen Anblick ersparen wollen, obwohl er im ersten Moment nicht besonders spektakulär war. Es war ein Haufen schwarzer, feuchter Asche. Allein der Gedanke, dass dies heute Morgen, als Suko und ich gut gelaunt zur Arbeit gefahren waren, noch ein lebender, atmender Mensch mit Wünschen, Träumen und Hoffnungen gewesen war, schnürte mir die Kehle zu.
Es kostete mich Überwindung, doch ich musste das Kreuz mit der Asche in Berührung bringen, um auf Nummer sicher zu gehen. Es reichte, wenn ich das untere Ende kurz hineintunkte, doch wieder geschah nichts.
Suko, der stumm und regungslos am gegenüberliegenden Ende des Sargs kauerte, reichte mir ein Taschentuch, mit dem ich das Kreuz säubern konnte. Ich hatte nicht ernsthaft mit einer Reaktion des Kreuzes gerechnet. Selbst wenn es sich um eine Vampirin gehandelt hatte, die durch das Licht der Sonne verbrannt war, wären damit sämtliche bösen Energien ausgemerzt worden.
Suko und ich erhoben uns und schlenderten zu Tanner zurück, der nervös auf seinem erkalteten Zigarrenstummel kaute.
Ja, er wirkte schon ein wenig spleenig in seiner Aufmachung und seinem Gebaren. Wie eine lebendig gewordene Figur aus einer Fernsehserie, doch dieser Eindruck täuschte gewaltig. Die Mörder, die er bereits hinter Gitter gebracht hatte, konnten davon ein Lied singen.
»Und, was herausgefunden?«, wollte er wissen.
Ich schüttelte den Kopf, was ihm als Antwort genügen musste, denn mir brannte etwas anderes auf der Seele. »Wer war sie?«
Tanner hob die Schultern. »Keine Ahnung. Es gibt natürlich noch keine Vermisstenmeldung. Selbst wenn sie heute Mittag nicht zum Essen kommt, wird vermutlich keiner der Angehörigen die Polizei benachrichtigen. Die Leute gucken fern und wissen, dass sie mit dem Hinweis abgespeist werden, dass eine Person erst achtundvierzig Stunden vermisst sein muss, ehe dein Freund und Helfer aktiv wird.«
»Und von den Zeugen kannte sie vermutlich auch niemand«, warf Suko ein.
Jetzt war es an Tanner, den Kopf zu schütteln.
Ich seufzte. »Dann müssen wir ein Bild veröffentlichen.«
Tanner schnaubte. »Woher nehmen und nicht stehlen?«
Ich deutete auf die beiden Rettungswagen, von denen der mit den beiden Jungs gerade abfuhr. »Einer von den Zeugen wird doch sicherlich Aufnahmen mit dem Handy gemacht haben, oder?«
»Mann, wenn wir dich nicht hätten, John.«
Ich winkte ab. »Dann hättet ihr einen anderen. Da wir hier sind, gibt es vermutlich keine Hinweise darauf, was dieser Frau das Leben gekostet haben könnte, oder?«
»Woran denkst du da, John?«, wollte Tanner wissen.
»An Napalm, beispielsweise. Das wurde im Vietnamkrieg eingesetzt. Widerliches Zeug, das praktisch nicht zu löschen ist. Du konntest ins Wasser springen und das Feuer erlosch, doch sobald du wieder an Land gekommen bist, entflammte das Napalm von Neuem.«
Der Chiefinspektor verzog das Gesicht. »Bislang nicht. Nein. Aber woher sollte das Napalm auch kommen? Außerdem passt das nicht zu den Beobachtungen der Zeugen. Auf die hat die junge Frau den Eindruck gemacht, krank zu sein.«
Ich nickte. »Stimmt auch wieder. Gut, wir sind dann hier fertig. Es hilft alles nichts, wir müssen die Identität der Frau feststellen. Kommst du später noch ins Büro?«
»Warum sollte ich?«
»Weil ich mich so über deine Gesellschaft freuen würde.« Als ich Tanners säuerlichen Gesichtsausdruck bemerkte, sprach ich schnell weiter. »Außerdem hilft es manchmal, wenn jemand Außenstehendes einen rationalen Standpunkt vertritt.«
Der Chiefinspektor blieb skeptisch. »Hm, der Hinweis auf das Napalm war in meinen Augen schon ziemlich rational.«
Suko trat an ihn heran und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wir bestellen uns Mittagessen bei Luigi, und John lädt uns ein.«
Auf Tanners zerknautschtem Gesicht ging die Sonne auf. »Ihr könnt mit mir rechnen.«
Kapitel 5
Familie Rubens lebte in der Gemeinde Eichwalde, die mit knapp 6500 Einwohnern einen eher ländlichen Charakter besaß. Der ideale Wohnort für Familien mit Kindern, fand Harry und sah sich um, während er den Opel Insignia langsam durch die idyllische Ortschaft rollen ließ.
»Sagen Sie mal, geht das auch schneller?«
Die Frage kam von Mark. Harry nickte nur und beobachtete die Einwohner von Eichwalde weiter durch das Seitenfenster, ohne den Insignia zu beschleunigen. »Sicher.«
Mark seufzte. »Da bin ich ja zu Fuß schneller.«
Harry machte mit der Hand eine Geste zum Bürgersteig hin. »Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Ich nehme mal nicht an, dass ich halten muss, weil Sie auch während der Fahrt aussteigen können.«
Mark grinste boshaft. »Kein Wunder, dass die Polizei private Forensiker hinzuziehen muss. Wenn alle Ermittler so eine läppische Arbeitsauffassung haben.«
Harry wandte den Kopf und schaute den Wissenschaftler böse von der Seite her an. »Hören Sie mal, junger Freund …«
»So jung ist der gar nicht mehr«, meldete sich in diesem Moment Tina von der Rückbank her.
»Aber sicherlich jünger als ich.«
»Wer ist das nicht?«, fragte Mark.
»Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht«, mischte sich in diesem Moment das Navi in die Konversation ein.
»Gott sei Dank«, meinte Tina und ließ offen, ob sie das Erreichen des Ziels meinte oder die Einmischung durch die elektronische Stimme.
Harry stoppte den Insignia vor einem kleinen, weiß verputzten Einfamilienhaus, auf dem ein hohes, mit dunklen Ziegeln gedecktes Satteldach thronte.
Bevor er ausstieg, öffnete er das Handschuhfach und nahm ein Gürtelholster mit einer halbautomatischen Waffe darin heraus. Marks Augen wurden groß, als er das sah. »Was wollen Sie denn damit? Die Angehörigen erschießen?«
Harry gab keine Antwort und stieg stattdessen aus. Gedeckt von der offenen Autotür, brachte er das Holster an seinem Gürtel an und zog dann das dünne Sommerjackett darüber, damit man die Waffe nicht auf den ersten Blick sah.
Ein Plattenweg führt von der Straße zur Eingangstür und teilte den sorgfältig gestutzten Rasen, auf dem sich wahllos Spielzeug verteilte, in zwei Hälften. Links neben dem Haus sah Harry eine hohe Gartentür aus Lattenholz, die bündig mit der dichten Hecke abschloss, die das Grundstück eingrenzte.
Tina und Mark folgten dem Beamten vom Bundeskriminalamt, der vor der Haustür stehen blieb.
»Und die örtlichen Kollegen haben die Rubens’ wirklich nicht über den Tod ihrer Ehefrau und Mutter informiert?«, fragte Tina ungläubig.
Harry schüttelte den Kopf, während er die Türklingel betätigte. »Sie haben niemanden erreicht, und als ich hörte, was vorgefallen war, wollte ich selbst vorbeischauen und diesen Part im Bedarfsfall übernehmen.«
»Im Bedarfsfall?«, echote Mark. »Was erwarten Sie denn hier zu finden?«
»Glauben Sie, Alisa Rubens ist zu einem Vampir geworden, hat ihre Familie gebissen und ist dann in die Charité eingeliefert worden?«, fragte Tina, und ihrer Stimme war anzuhören, dass sie immer mehr der Ansicht war, dass der angebliche Experte vom BKA selbst ein Fall für die Psychiatrie war.
Harry betrachtete nachdenklich die Haustür und zuckte die Achseln. »Keine Ahnung, aber zu diesem Zeitpunkt kann ich nichts ausschließen.« Er ging ein paar Schritte zurück und blickte sich um. Das Haus der Rubens’ lag etwas außerhalb und wurde durch die Hecke zu den Nachbarn abgeschirmt. Dazwischen lag eine Fläche von der Größe eines Fußballfeldes brach.
»Wollen Sie damit andeuten, dass Frau Rubens ihre Familie zuvor in den Keller gesperrt hat, damit diese über die Polizisten herfallen kann?« Mark schüttelte den Kopf und warf Tina einen bedeutungsvollen Blick zu, der Bände sprach.
Harry ging nicht weiter auf die Bemerkungen des Forensikers ein. Einerseits konnte er dessen Skepsis nur zu gut verstehen, andererseits hatte er bereits hinlänglich Erfahrungen mit Untoten gesammelt. Harry ging den schmalen Plattenweg, der parallel zur Hauswand verlief, in Richtung Gartentür. Dabei passierte er schmale Blumenbeete, in denen kleine Stiefmütterchen wuchsen. Die perfekte Vorstadtidylle.
Harry probierte die Klinke der Tür und stellte fest, dass sie nicht verschlossen war. Er warf einen Blick zur Haustür hinüber, wo die Kriminalbiologen gespannt auf seine Reaktion warteten. Ohne ein Wort zu sagen, öffnete Harry die Gartentür und ging hindurch, Tina und Mark folgten dem Sonderermittler zögernd.
Hinter der Lattenholztür führte der Plattenweg weiter, und Harry passierte hohe Kunststofftonnen für Restmüll, Papier und Kompost, ehe er auf den weitläufigen Hof hinaustrat. Dort standen auf dem frisch gemähten Rasen ein Trampolin, ein Grill und die obligatorischen Gartenmöbel.
Am hinteren Ende des Grundstücks sah Harry eine kleine Holzhütte. Langsam ging er darauf zu, die Hand vorsorglich auf den Griff der Beretta gelegt. Der Schweiß brach ihm aus allen Poren, als er den beißenden Gestank wahrnahm.
Hinter sich hörte er, wie Mark zischend ausatmete. »Jesus!«
Auch Tina hatte längst bemerkt, was hier geschehen sein musste. »Oh, mein Gott«, lautete ihr Kommentar.
Nur Harry Stahl sagte nichts. Er schluckte und versuchte vergebens, den Kloß in seinem Hals zu lösen. Obwohl er schon so viel erlebt hatte, spürte er, wie seine Hände anfingen zu zittern.
Vor dem Gartenhäuschen, in dem sich vermutlich Werkzeuge, Rasenmäher, Fahrräder und dergleichen befanden, lag ein dunkler Haufen Asche, über dem immer noch kleine Rauchfähnchen hinwegzogen. Obwohl die Leichen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren, konnte Harry deutlich sehen, dass dies einmal ein Mann gewesen war, der sich schützend über einen kleinen Menschen gebeugt hatte, der in seinen Armen gestorben war.
Harry blieb wie angewurzelt stehen und bemerkte erst, dass Tina und Mark neben ihn getreten waren, als der Forensiker ihn mit leiser Stimme ansprach.
»Was geht hier vor, Harry?«, fragte Mark, der wohl in Anbetracht des grauenvollen Fundes zum unverbindlichen Du übergegangen war.
Harry schüttelte langsam den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Irgendetwas Schreckliches geht hier vor, und wir müssen es stoppen.«
Tina räusperte sich. »Glaubst du denn, das hier war kein Einzelfall?« Harry wandte den Kopf und blickte die Frau scharf an. »Du etwa?«
»Dann schlage ich vor, dass du mal die Datenbanken des BKA anzapfst, um herauszufinden, ob es noch mehr solcher Fälle in Deutschland oder Europa gegeben hat.«
Kapitel 6
Auf dem Weg ins Büro sprachen Suko und ich über den neuen Fall, und natürlich dachten wir beide an die Vampirin Justine Cavallo, die uns schon seit Jahren das Leben schwer machte.