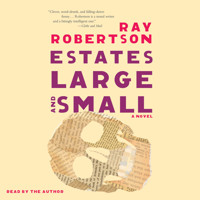13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diederichs
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Zeiten entgleisender Depressionen im öffentlichen wie im privaten Raum, schöpft Ray Robertson aus Literatur, Philosophie und seiner Biografie, um die Wertschätzung der Existenz zu rehabilitieren. Mit Verve und Humor rühmen seine Kapitel immerwährende Freuden, für die es sich zu leben lohnt – darunter naheliegende wie Freundschaft und Liebe, und näherliegende wie Rauschzustände und Besitztümer. Eine durch und durch reanimierende Kollektion.
- Philosophie, todernst und urkomisch
- Das Überlebensbuch für erschöpfte Egos
- Eigenes Vorwort für die deutsche Ausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ray Robertson
WARUM NICHT?
15 Gründe, doch am Leben zu bleiben
Aus dem Englischen von Reinhard Kreissl
Diederichs
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Why not? Fifteen Reasons to Live © 2011 Biblioasis, Emeryville/Ontario
Der Verlag dankt dem Canada Council for the Arts für die Gewährung eines Übersetzungskostenzuschusses.
© 2012 Diederichs Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Weiss | Werkstatt | München
Layout und Herstellung: Julia Schubert, München
ISBN 978-3-641-08522-3V002
www.diederichs-verlag.de
Mens sana in copore sano
JUVENAL
Du sagst, du willst mir einen Rat geben? Hast du dir denn schon selbst einen Rat erteilt? Hast du deine Probleme denn schon gelöst? Hast du daher Zeit, anderen Leuten Hilfestellung zu geben? Ich würde mich hüten, andere zu behandeln, wenn ich selbst krank bin. Wir reden hier wie zwei, die im selben Krankenzimmer liegen, über unsere Krankheit und tauschen uns über die passende Kur aus. Also hör mir zu, als würde ich zu mir selbst sprechen.
SENECA
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Es ist ganz offensichtlich: man hat nicht die Spur einer Chance.
Der Planet stirbt, die guten Jobs verschwinden, der mörderische Imperialismus feiert fröhliche Urstände, die Starken beuten die Schwachen aus, schlechte Kunst und Dummheit, wohin man schaut. »Lieber einen Stein als Kopfkissen als eine Illusion«, heißt es bei Robinson Jeffers. Suchen Sie sich also einen bequemen Felsbrocken und ab ins Bett.
Gute Nacht bedeutet aber nicht auf Nimmerwiedersehen. Ehrlichkeit ist eine Kardinaltugend, Verzweiflung und Passivität sind es nicht, auch wenn es heißt, diese sei die Folge jener. Wenn man sich schmerzliche Wahrheiten eingesteht – sei es über den eigenen oder den Zustand der Welt – dann ist das nur der erste Schritt beim Aufbau eines glücklichen Lebens, das diesen Namen wirklich verdient. Aber auch nicht mehr – ein erster Schritt eben. Man muss sich ab und zu dem Fegefeuer unschöner Wahrheiten aussetzen, aber man sollte sich dann nicht immer an der Stelle kratzen, wo die Brandblasen jucken. Wer so handelt, wird weder emotional noch intellektuell jemals erwachsen werden.
Als ernsthafter und selbstgrüblerischer junger Student – gibt es überhaupt andere?! – war Nietzsches Parabel »Von den Drei Verwandlungen« im Zarathustra (vom Kamel das sich zum Löwen und letztlich zum Kind verwandelt) eine Erleuchtung. Was natürlich nicht weiter verwunderlich ist. Was könnte einem selbst ernannten Außenseiter aus der unteren Mittelklasse in der Hölle der Vororte besser gefallen als Nietzsches Ermunterung »… sich von Eicheln und Gras der Erkenntnis nähren und um der Wahrheit willen an der Seele Hunger leiden«? Es ist schlichtweg heroisch, wenn man in der erstickenden Gemütlichkeit und verschlafenen Selbstgefälligkeit des Konformismus sich solch rückhaltlose Aufrichtigkeit zur ethischen Maxime erhebt.
Aber eine von Nietzsche inspirierte Heldenhaftigkeit ist mehr als ein Martyrium im Angesicht der widerlichen Wirklichkeit. Akzeptiert man die Verantwortung der Wahrheitssuche (und akzeptiert dann auch die gefundenen Wahrheiten), so übernimmt man damit zwei weitere Verpflichtungen: man muss sich von den schalen und oberflächlichen Wertorientierungen lösen, die einem in die Wiege gelegt wurden, und das »Recht sich nehmen zu neuen Werten – das ist das furchtbarste Nehmen für einen tragsamen und ehrfürchtigen Geist«. Furchtbar ist dieses Nehmen, weil der Rückzug in den machtlosen Nihilismus auch bedeutet, sich einer nichtswürdigen Existenz hinzugeben, die das letzte Ziel der Entwicklung der Persönlichkeit verfehlt: Das Leben zu feiern! Aber um zu dieser Haltung dem Leben gegenüber überhaupt vorzudringen, um das Leben zu feiern, statt es nur spöttisch zu kommentieren, muss man wieder zum Kind werden.
»Unschuld«, so Nietzsche, »ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens: seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene.« Sich der Dinge voll bewusst werden; weg mit falschen Werten, die keine Erfüllung beinhalten – dem Konsumdenken, dem religiösen und politischen Fundamentalismus, den technisch oder pharmakologisch unterstützten Fluchten – dann konzentriert sich die Existenz irgendwann auf jenen Kern an Werthaltungen und Erfahrungen, Vorstellungen und Handlungen, die dem eigenen Leben wirklich Sinn verleihen. Warum nicht? 15 Gründe, doch am Leben zu bleiben ist meine Aufstellung der Dinge, die für mich den Sinn des Lebens ausmachen.
Es gibt zweifelsohne mehr als die hier aufgezählten Gründe, und zweifelsohne wird nicht alles, was ich in den folgenden fünfzehn Essays hochhalten werde, allen Lesern gefallen. Hierauf kann ich nur aus Thoreaus Walden zitieren: »Ich sollte nicht so viel von mir selbst sprechen, wenn es nur einen anderen gäbe, mit dem ich so vertraut bin. Dummerweise bin ich aufgrund meiner mangelnden Erfahrung auf dieses eine Thema beschränkt.«
Auch meine Lektüre ist begrenzt. Ich halte mich für einen halbwegs belesenen Menschen (gut bewandert in der Philosophie, schwach in Geschichte; ziemlich vertraut mit der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, halte auch viel von Shakespeare und den alten Römern, aber jenseits der englischen Romantik wird’s literarisch dünn bei mir). Bestimmte Autoren werden hier immer wieder auftauchen, was einfach nur Zeugnis ihrer Bedeutung für mein Leben ablegt. Als Philosophiestudent in den ersten Semestern in Toronto wurde einem deutlich vermittelt, was man von den herablassend als »Weisheitsliteratur« bezeichneten Texten zu halten habe, die nicht in den Kanon der analytischen Sprachphilosophie passten – nämlich nichts. Die Philosophie, wie sie der griechische Stoiker Seneca verstand – »Soll ich dir sagen, was die Philosophie für die Menschheit bereithält? Ratschläge … Eure Aufgabe ist es den Unglücklichen zu helfen« –, hielt man bestenfalls für eine liebenswerte Kuriosität und schlimmstenfalls für laienhaften Pragmatismus minderer intellektueller Güte. Das war einer der Gründe, die mich von der Philosophie zur Literaturwissenschaft wechseln ließen: gute Romane schienen mir wie eine Art Übungsprogramm, wo man in Prosa seine Ideen auf ihren Wert und ihre Alltagstauglichkeit testen konnte.
Die Autoren, auf die ich mich zeit meines Lebens für spirituelle und intellektuelle Geistesnahrung verlassen habe und auf die ich im Folgenden immer wieder zurückgreifen werde, sind – egal ob sie als Dichter, Denker, Künstler oder römische Staatsmänner gelten – Philosophen in einem sehr grundlegenden Sinne.
»Das Ziel der Philosophie ist der Zustand des Glücks«, schrieb Seneca. »Sie zeigt uns den Unterschied zwischen dem nur scheinbaren und dem wahren Bösen. Sie befreit den menschlichen Geist von leeren Gedanken, vermittelt ihm das Fundament der Größe und hilft ihm den falschen Schein zu erkennen. Sie sorgt dafür, dass wir zwischen wahrer und aufgeblasener Größe unterscheiden lernen.«
Wenn ich als Westentaschenintellektueller erscheine, weil ich Emily Dickinson, William Blake, Cicero oder Jonathan Richman als unerschütterliche Wahrheitssucher betrachte, dann kann ich daran auch nichts ändern. Sein Leben mit der Suche nach den Dingen zu verbringen, die es lebenswert machen, scheint mir keine ganz schlechte Art, die Zeit totzuschlagen. Abgesehen davon hat man mich schon Schlimmeres genannt.
Camus hatte nur zum Teil recht als er schrieb, dass es »nur ein wirklich ernsthaftes philosophisches Problem gibt, nämlich die Frage des Selbstmords. Das Urteil darüber, ob das Leben lebenswert ist oder nicht, berührt die Grundfrage jeder Philosophie.« Der physische Selbstmord bezeichnet nur eine von mehreren Arten, das Leben zu zerstören. Physisch zu existieren und geistig zu sterben – wofür wir jeden Tag auf den Gesichtern in der U-Bahn, am Arbeitsplatz, aber auch bei unseren Freunden und Liebsten den Beleg finden können – entspricht nicht den Möglichkeiten des menschlichen Lebens. So muss und so soll man nicht leben.
»Der Tod ist nicht das größte Übel«, meinte Sophokles. »Schlimmer ist es, sterben zu wollen und nicht sterben zu können.« Warum nicht? 15 Gründe, doch am Leben zu bleiben ist kein Buch gegen das Sterben; wenn es gelungen ist, dann beschäftigt es sich mit der viel wichtigeren Frage: Warum sollte man nicht einfach leben?
ARBEIT
Arbeit allein adelt.
THOMAS CARLYLE
Die erste Regel beim Schreiben ist auch die erste Regel des Lebens: Machen, nicht reden. Flannery O’Connor sagte, dass die Leser nichts glauben, was ihnen der Autor erzählt – er muss es ihnen zeigen. Niemand musste mir erklären, wie meine Eltern ihren Lebensunterhalt verdienten. Es war schwer, schmutzig und erniedrigend. Das sah ich am Ende des Tages an ihren erschöpften Gesichtern, ihren trüben Augen, den schlaffen Gliedern. Ich roch die verschwitzen Arbeitsklamotten. Ich hörte es in ihren müden Stimmen.
Aber schlimmer als die körperlichen Folgen waren die Schäden, die ihre Seelen nahmen.
Wenn meine Mutter ein paar Tage freihatte und endlich zu Hause war, griff sie zum Telefon und rief eine Arbeitskollegin an, und sie unterhielten sich über ihre Arbeit – was sonst?!
Mein Vater war ebenso wie meine Mutter darauf erpicht, dass ich gut in der Schule war, denn beide wollten nicht, dass ich so endete wie sie (stattdessen sollte ich eines Tages einer dieser Anzugträger werden, die alle in der Fabrik hassten und denen sie misstrauten). Allerdings konnte er nicht verstehen, dass ich einen ruhigeren Ort als den Küchentisch brauchte, um meine Hausaufgaben für die Highschool zu machen, auch verstand er nicht, warum ich die Überstunden ablehnte, die mir mein Chef im Kaufhaus Sears anbot. Wie konnte er auch? Er arbeitete seit seinem dreizehnten Lebensjahr und konnte nicht nachvollziehen, dass das Gedudel aus dem Radio und das Geklapper von Kochtöpfen nicht gerade die ideale Umgebung waren, um sich in die Mysterien der Algebra zu vertiefen, oder dass sich die paar Kröten, auf die ich ohne Überstunden verzichtete, später als lohnende Investition erweisen würden.
Selbst mit vierzehn Jahren und bereits selbst mit einem kleinen Nebenjob beschäftigt, war mir klar, dass ein Leben voller repetitiver, nervtötender Arbeit nicht das Gelbe vom Ei war. Das westliche Ontario hat eine fruchtbare Erde und schwüle Sommer und daher gab es jedes Jahr im Juli und August eine große Nachfrage nach »Maispflückern«. Schüler wurden busweise auf die Felder gekarrt, wo sie für einen Hungerlohn durch die Felder gingen und die Blüten von den Maiskolben pflückten. Morgens war es kühl und neblig und unsere Arbeitskleidung – große Plastikabfalltüten, in die Löcher für den Kopf und die Arme geschnitten waren – hielten weder die Feuchtigkeit noch die Kälte ab, und am Nachmittag brannte die Sonne unerbittlich herab. Aber für viele Jugendliche war das die erste Möglichkeit, selbst Geld zu verdienen, und das regte die Fantasie an – zumindest bei mir: Träume von Schallplatten, neuen Klamotten, die mir meine Mutter nicht kaufen wollte, und viel, viel Fastfood. So wurden die endlos langweiligen Tage erträglich.
Manchmal wachte ich in der zweiten Woche meiner Arbeit aus Träumen auf, in denen ich Mais gepflückt hatte, nächtliche Schichten von acht Stunden, Pflücken, Pflücken, Pflücken. Dank einer Klimaanlage war es in meinem Schlafzimmer angenehm kühl, aber während ich mich zur Arbeit anzog, sah ich die Sonne heraufziehen, die bald für unerträgliche Hitze sorgen würde. Ich musste in knapp einer Stunde auf dem Schulhof sein, wo uns der Bus abholte, und so war ich bereits am Morgen erschöpft.
Zwar war Philip Larkin kein Fabrikarbeiter wie mein Vater und auch keine Küchenkraft im Altenheim wie meine Mutter oder Ferienjobber auf dem Maisfeld wie ich, sondern Bibliothekar, aber er formulierte treffend, was ich beim Anblick meiner Eltern und beim Ausblick auf meine eigene Zukunft empfand.
Warum muss die hässliche Kröte Arbeit
Auf meinem Leben hocken?
Kann ich nicht meinen Grips als Mistgabel nehmen
Und einfach das Vieh verscheuchen?
Sechs Tage jede Woche
Quält sie mich mit ihrem Gift.
Alles nur, um die paar Rechnungen zu zahlen.
Da stimmt was nicht.
Unsere Familie hatte kein Monopol auf das von den Mühen der Arbeit geprägte Unglück. Wie wir wissen, hat William Blake niemals unser Kaff Chatham in Ontario besucht, aber wenn man sein Gedicht London liest, könnte man meinen, er sei hier gewesen: »Ich wandere durch verkaufte Gassen / wo die verkaufte Themse fließt / und wo aus jedem dieser blassen Gesichter / Weh und Schwäche sprießt.« Aber es waren nicht nur die bleichen Gesichter derjenigen, die gegen ihren Willen in der Tretmühle lebten, die einen so bedrückten. Jeden Freitag blühten sie auf, wieder eine Woche vorbei und zwei ganze freie Tage vor sich, aber bald – allzu bald – verwelkte das frische Versprechen eines freien Wochenendes beim nüchternen Blick auf den unvermeidlichen Sonntagabend. Aber wie viel Freude brachten schon die kurzen Verschnaufpausen der Wochenenden, die alljährlichen Sommerferien, die Geschenke unterm Christbaum, der nachmittägliche Einkaufsbummel? Wie groß solche Ablenkungen auch waren, wenn man freihatte, in die Ferien fuhr oder Weihnachtsgeschenke bekam – es war nie so toll, wie man es sich ausgemalt hatte. Wenn man gestern sein ganzes Geld in irgendwelchen Glitzerkram investiert hatte, am nächsten Morgen war der Glanz weg. Man hatte oft den Eindruck, die Menschen wären zwar glücklich, wenn auch nicht so ganz, und trotteten dann irgendwie erleichtert zurück an die Arbeit, über die sie nur wieder die ganze Zeit meckerten.
»Nichts ist für den Menschen so unerträglich wie ein Zustand vollständiger Ruhe«, meinte Pascal, »ohne Leidenschaften, ohne Beschäftigung, ohne Ablenkung, ohne Anstrengung. Dann empfindet er seine Nichtigkeit, seine Einsamkeit, Hilflosigkeit, Leere und Unangemessenheit.« Haben die Menschen die Wahl zwischen Langweile und Sorge, wählen sie meist die Letztere. Ich hasste dieses Gefühl – und ich hätte es nie zugegeben – aber Mitte August wollte ich dann wieder zurück in die Schule gehen. Jedes Mal schwor ich mir zu Beginn der Sommerferien, dass ich mich nie wieder so langweilen würde – alles war besser als Geografie oder Mathematikhausaufgaben – aber die schwüle Hitze des August ließ in mir das Bedürfnis wachsen, regelmäßig irgendwo hinzugehen und etwas zu tun zu haben. Auch wenn das bedeutete, sich mit der Kontinentaldrift zu beschäftigen und Integrale zu berechnen.
Als ich dann regelmäßig arbeitete – ich war vom Maispflücker über den Tellerwäscher zum Aushilfsverkäufer bei Sears aufgestiegen –, konnte ich die Befriedigung nicht mehr leugnen, die sich einstellt, wenn man etwas getan hat, auch wenn die Tätigkeit selbst, abgesehen vom wöchentlichen Gehaltscheck nichts Positives an sich hat. In seinem einfachen, aber sehr bewegenden Gedicht The Blacksmith fängt Henry Wadsworth Longfellow dieses elementare Gefühl der existenziellen Befriedigung gut ein:
Jeder Morgen bringt neue Aufgaben,
jeden Abend sind sie erledigt;
manches begonnen, manches geschafft,
so kommt die Nachtruhe verdient.
Fröhliche Menschen haben Spaß an ihrer Arbeit. Natürlich muss man auch Glück haben: Mein Vater wurde von seinem Vater im Alter von zwölf Jahren losgeschickt, um von Haus zu Haus zu gehen, und Äpfel zu verkaufen. Er konnte die Schule nicht besuchen. Er hatte nicht die Möglichkeiten, die mir aufgrund der Opfer, die meine Eltern für mich brachten, offenstanden. Meine Eltern hatten für mich gespart und so konnte ich, ohne Schulden zu machen, auf die Universität gehen. Emotionale Befriedigung war für meinen Vater kein Kriterium, als er kurz nach der Hochzeit mit meiner Mutter bei Ontario Steel zu arbeiten begann. Dort konnte man damals als ungelernte Arbeitskraft am meisten verdienen und das war ausschlaggebend. Matisse hätte ihm wahrscheinlich zugeflüstert: »Hol dir dein Glück durch ein befriedigendes Tagwerk, lichte den Nebel, der uns umgibt.« Aber ich glaube nicht, dass die Frau von Matisse hochschwanger war und er nicht wusste, wie er die Kaution für seine Wohnung aufbringen sollte, als er diesen funkelnden Sinnspruch von sich gab.
Selbst Arbeit, die nicht zu hundert Prozent erbaulich, erhebend und befriedigend ist, kann erfüllend sein. Flaubert, der große Ästhetiker des modernen Romans, betete darum, »lieber wie ein Hund zu sterben als einen einzigen unvollkommenen Satz zu produzieren«. Doch scheinen seine aufmunternden Predigten mit der Aufforderung an seine Freunde, hart zu arbeiten, eher therapeutischer als ästhetischer Natur.
»Arbeite, arbeite, schreibe – schreibe, solange es geht, solange die Muse bei dir ist. Sie ist das beste Schlachtross, sie lehrt dich, das Leben in Anstand zu meistern. Die Bürde des Daseins fällt von uns ab, wenn wir etwas schaffen.« Und an anderer Stelle: »Brüte nicht vor dich hin. Versenke dich in ausführliche Studien: nur wer ausdauernd arbeitet, kann auf Dauer zufrieden sein; die Ausdauer ist Opium für die Seele. Ich habe Zeiten grausamer Langeweile durchlebt, schwebend durch die Leere, voll schaler Ablenkung. Man hält sich selbst aufrecht durch Ausdauer und Stolz. Versucht es selbst.« Und schließlich: »Ich setze meine gemächliche Arbeit fort wie ein guter Arbeiter, der die Ärmel aufkrempelt und an seinem Amboss schwitzt, egal ob es regnet oder schneit, bei Hagel und Gewitter.«
Auch Baudelaire begriff die Arbeit als eine Art Schutz gegen die Krankheit des alltäglichen Trotts (einschließlich der inneren Leiden, die damit einhergehen). So klingt das in seinem Prosagedicht Um ein Uhr morgens:
Unzufrieden mit allen und unzufrieden mit mir, möchte ich mich in der Stille und Einsamkeit der Nacht gerne von meiner Schuld befreien und wieder ein wenig stolz auf mich werden. Ihr Seelen, die ich geliebt, ihr Seelen, die ich besungen habe, stärkt mich, steht mir bei, haltet fern von mir die Lüge und die verderblichen Dünste der Welt; und Du, Herr mein Gott, schenke mir die Gnade, ein paar schöne Verse zu machen, die mir selbst den Beweis liefern, dass ich nicht der letzte der Menschen bin, dass ich nicht geringer bin als jene, die ich verachte.
Nicht nur sind Baudelaires und Flauberts Einlassungen zweckorientiert, beide Autoren empfehlen darüber hinaus Arbeit als Mittel gegen Lethargie, als Form der Gegenwehr gegen die Widrigkeiten des grobstofflichen Lebens. Im folgenden Zitat ermuntert Flaubert seine Angebetete, Louise Colet, auf öffentliche Anerkennung zu verzichten und sich stattdessen zur Selbstfindung auf ernsthafte literarische Tätigkeit zu konzentrieren. Aber genauso hätte er den Sportler, der trotz Schmerz weitermacht, den Lehrer, der trotz Krankheit seine Unterrichtsstunden abhält, oder die Pflegerin, die ihren Patienten trotz eigenen Leids Trost spendet, als Beispiel nehmen können.
Ich sage dir, wann du stolz sein kannst. Wenn du des Abends zu Hause sitzt in deinem ältesten Nachtgewand, Henriette [Colets Tochter] dir auf die Nerven geht, der Ofen nicht richtig zieht und du dir Sorgen darüber machst, wo das Geld herkommen soll. Du willst schweren Herzens und innerlich verwirrt ins Bett gehen; unruhig läufst du in deinem Zimmer auf und ab, starrst auf das Feuer und du siehst, dass es nichts gibt, was dir helfen könnte, kein Mensch dir zur Seite steht und alle dich verlassen haben. Und dann – irgendwo vergraben unter deiner Erniedrigung als Frau – spürst du das Wirken der Muse, tief in dir beginnt etwas zu singen, etwas Fröhliches und Feierliches, wie ein Schlachtruf, eine Herausforderung, die du dem Leben ins Gesicht wirfst, ein aufwallendes Selbstbewusstsein deiner eigenen Stärke, der Schein künftiger Arbeit glüht am Horizont. Die Tage, an denen dir das widerfährt, sind die Tage, auf die du stolz sein kannst.
Lässt man die Versuche, meine Schlagtechnik beim Eishockey zu verbessern, indem ich wie ein Wilder gegen das Garagentor ballerte, oder mein verzweifeltes Hanteltraining zur Stärkung meines Bizeps beiseite, so hatte ich meine erste Erfahrung mit Flauberts Tagen des Stolzes im zarten Alter von achtzehn Jahren, als ich kurz davorstand, den Abschluss an der Highschool nicht zu schaffen. Nachdem ich zuerst Physik und dann Mathematik hingeschmissen hatte – oder besser gesagt hatten diese Fächer mich hingeschmissen – blieb mir nur noch eine Möglichkeit: ein Fernstudium in Amerikanischer Geschichte. Das Problem war, dass dieser Kurs im Januar begann und mir nur fünf Monate blieben, um das Lernpensum von zehn Monaten zu bewältigen, und ich brauchte diesen Abschluss, um meine Zulassung an der Universität zu bekommen. So saß ich also jeden Abend, nachdem ich meine anderen Hausaufgaben erledigt hatte, da und las und schrieb und schrieb und las, bis mein rechter Zeigefinger taub war. Fußball und Hockey hatte ich schon lange aufgegeben, aber mit meinem Zeigefinger hätte ich ziemlich angeben können, wie früher, als ich trotz kaputter Schulter oder gebrochener Rippe zum Spiel antrat. Stattdessen rieb ich mir den Finger und lächelte.
Zwar wusste ich jetzt alles über die Doktrin des Manifest Destiny und die Boston Tea Party und hatte auch die Prüfung geschafft, aber es sollte noch sieben Jahre dauern, bis ich den ersten Satz meines ersten Romans niederschrieb. Dennoch hatte ich eine wichtige Lektion des literarischen Lebens gelernt: so etwas wie eine Schreibhemmung, den berühmten »writer’s block«, gibt es nicht. (Es handelt sich hier um eine eingebildete Krankheit, die sowohl Profis erfasst, die nichts zu sagen haben, als auch Laien, die nicht wissen, wie sie etwas sagen sollen.) Wer etwas zu sagen hat, soll es sagen. Wenn nicht, dann möge er schweigen. Wenn man nichts hat, worüber man schreiben kann, bedeutet das nicht, dass man unter eine Blockade leidet – es bedeutet, dass man das Schreiben sein lassen sollte. Oft vergessen Schriftsteller und andere, die in der glücklichen Lage sind, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass sie sich an einen Schreibtisch setzen, dass sie, wie Mordecai Richler es formulierte, »nicht eingezogen wurden, sondern sich freiwillig gemeldet haben«. Man könne daher mit weitaus »weniger Selbstmitleid, weniger Lamentieren über Lohnschreiberei und die Einsamkeit des Autors vor dem schrecklichen leeren weißen Blatt« auskommen. Richler zählt neben mir zu den wenigen anerkannten kanadischen Schriftstellern, die aus der Arbeiterklasse kommen, und hat aus dem aufgeblasenen Gerede von der »künstlerischen Empfindung« die Luft gelassen, als er sagte, »mein Vater, ein erfolgloser Schrotthändler, arbeitete wesentlich härter als ich und die Arbeit verschaffte ihm weniger Befriedigung als mir. An schlechten Tagen ist es gut, sich daran zu erinnern.«
Wenn man das Glück hat, seine Berufung gefunden zu haben, dann vermittelt das eine Befriedigung, wie nichts anderes sie einem geben kann – zumindest habe ich noch keine Alternative entdeckt. »Gesegnet ist der, der seine Arbeit gefunden hat«, heißt es bei Thomas Carlyle; »er braucht keine weiteren Segnungen.« Wenn ich arbeite – versunken, völlig auf mich konzentriert – dann ist der einzige Begriff, der darauf passt, der des Absorbiertseins. Man setzt sich an den Schreibtisch, spielt ein bisschen mit den Textstellen vom Vortag, nimmt den Wasserkessel vom Ofen, brüht sich die ersten Tassen entkoffeinierten Tee auf und schaut zum Fenster raus, liest ein Gedicht von Emily Dickinson, um sich wieder der Verantwortung für die Sprache gewahr zu werden, unterdrückt die Verlockung, die E-Mails zu lesen, und stellt fest, dass man ja Plätzchen zum Tee besorgt hatte, man kramt weiter herum und diesmal geht das Herumkramen bruchlos über in die nächste Zeile Text – eine neue Zeile – wie der Haken, den ein Bergsteiger in die Felswand schlägt, um den nächsten Schritt nach oben vorzubereiten – zur nächsten Zeile – und so weiter, Zeile für Zeile. Schaut man dann auf die Uhr, dann will man es nicht glauben: man hat anderthalb Stunden gearbeitet, aber es fühlt sich an wie zwanzig Minuten. Super.
Die Schlusszeilen von Raymond Carvers Gedicht Arbeit erfassen die geradezu alchemistische Verwandlung, die man in der Vertiefung in das Tun durchläuft: »Die Fülle vor der Arbeit / Das unglaubliche Verstehen danach.« Es ist nicht nur eine befriedigende Erfahrung; auch das Endprodukt, geadelt durch die volle Konzentration und liebevolle Hingabe, ist einfach eine Bereicherung. »Freude bei der Arbeit macht das Ergebnis perfekt«, wie Aristoteles feststellte. Carlyle ging noch einen Schritt weiter und meinte: »Man kann ein gutes Paar Schuhe nur machen, wenn man es mit Hingabe tut.« Keith Richards nahm seine Gitarre mit aufs Klo. Und das hört man an den Stücken, die von den RollingStones in ihrer künstlerischen Hochphase produziert wurden.
Nicht jeder kann (oder will) ein Dichter, Autor oder Gitarrist sein – die Welt braucht ebenso dringend Kellner, Bauern und Bankangestellte, Lehrer und Klempner. Walt Whitmans Gedicht Ich höre Amerika singen ist in seiner Emphase einer Welt, in der jeder Mensch seine eigene Würde entdeckt, sicherlich naiv und zu optimistisch, nichtsdestotrotz ist es anregend.
Ich höre Amerika singen, ich lausche der Vielfalt der Lieder,
Den Liedern der Handwerker, die jeglicher singt, um heiter zu bleiben, und stark,
Sein Lied singt der Zimmermann, wenn er sein Brett misst, oder den Balken,
Sein Lied singt der Maurer, wenn er an die Arbeit geht, oder sie wieder verlässt,
Der Bootsmann singt an Bord, was zu ihm passt, der Schiffsjunge singt auf dem Oberdeck des Dampfers,
Der Schuhmacher singt an der Werkbank hockend, der Hutmacher singt im Stehen,
Das Holzfällerlied, des Pflügers Gesang erklingen morgens auf dem Weg hinaus, in der Mittagspause, oder bei Sonnenuntergang,
Das köstliche Singen der Mutter, der jungen Hausfrau beim Tagwerk, oder des Mädchens beim Nähen und Waschen,
Ein jeder singt, was zu dem Tage passt.
Auch wenn Whitmans Worte nicht die Lebensrealität der Menschen beschreiben, so sind sie doch ein aufwühlender – und notwendiger – Appell an ein besseres Leben.