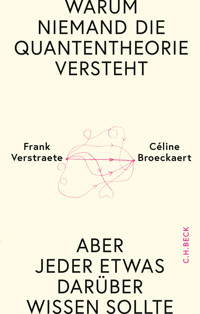
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Seit über hundert Jahren krempelt die Quantentheorie die Welt um: Ohne sie gäbe es weder die Kernspaltung noch die Halbleitertechnik. Sie lässt uns zuverlässige Vorhersagen über physikalische Systeme treffen, weswegen wir entsprechende Dinge erfinden können: Nahezu jedes Stück moderner Technologie vom Magnetresonanztomographen bis zum Mobiltelefon wird von Quantenphysik gestützt, was sie zu einem Grundpfeiler unserer Welt macht. Höchste Zeit also, dass auch wir als Laien tiefer in dieses Wissenschaftsfeld vordringen und uns mit seinen Grundprinzipien vertraut machen. Der weltweit anerkannte Quantenphysiker Frank Verstraete entblättert für uns zusammen mit seiner Frau, der Autorin und Künstlerin Céline Broeckaert, Schicht um Schicht die Quantenwelt. Die beiden nehmen uns mit auf eine faszinierende Reise durch die schönste aller Theorien. Die Fortschritte in der Physik sind ein ständiges Pingpong zwischen Theorie und Experiment, zwischen Denken und Überprüfen. Und letztlich sind es immer die Experimente und nicht der Verstand oder das Bauchgefühl, die entscheiden, ob eine neue Theorie notwendig ist. Ein Wissenschaftler schert sich nicht darum, wer etwas zuerst entdeckt hat. Die Frage, die ihm den Schlaf raubt, lautet: Welches wissenschaftliche Gesetz kann das erklären, was ich mit eigenen Augen sehe? Und kann dieses Gesetz das Ergebnis zukünftiger Experimente vorhersagen? Das ist die Grundlage der wissenschaftlichen Methode und die einzig richtige Weise, Wissenschaft zu betreiben. Letztendlich beruht auch unsere Intuition «üblicherweise» nur auf unserer alltäglichen Erfahrung mit dem relativ Großen, dem Sichtbaren sozusagen, sie ist jedoch unzuverlässig, sobald wir uns in die Welt des mikroskopisch Kleinen begeben. Ein Atom, das, grob gesprochen, aus einem Kern mit ihn umkreisenden Elektronen besteht, ist etwas völlig anderes als eine Miniaturversion einer Sonne mit sie umrundenden Planeten. Was natürlich nicht bedeutet, dass ein gutes Verständnis des Makroskopischen nicht hilfreich sein kann, um mehr Einblick in das Mikroskopische zu gewinnen und umgekehrt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Frank Verstraete & Céline Broeckaert
Warum niemand die Quantentheorie versteht
Aber jeder etwas darüber wissen sollte
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Motto
Vorwort des Physikers
Vorwort der Autorin
Wie Sie dieses Buch lesen sollten
Die Struktur des Buches
Teil 1 «Wiskunst» – Mathematik als Kunst des sicheren Wissens
Kapitel 1: Die unwahrscheinliche Effektivität der Mathematik – Kapitel 1 Kurz gefasst:
1.1 Wie Aristoteles von seinem Sockel gestoßen wurde
1.2 Mathematik ist die Sprache der Natur
1.3 Den Löwen erkennt man an seinen Klauen
1.4 Algebrakadabra
Kapitel 2: Symmetrie – Kapitel 2Kurz gefasst:
2.1 Die Ordnung des Chaos
2.2 Wenn die Symmetrie bricht
2.3 Gruppen: die Struktur hinter den Symmetrien
2.4 Trommeln und Atome
Teil 2 Quantenphysik
Kapitel 3: Die (Un-)Wahrscheinlichkeiteines Teilchens – Kapitel 3Kurz gefasst:
3.1 Den Nagel auf den Kopf getroffen
3.2 Licht: Welle und Teilchen
Der photoelektrische Effekt
3.3. Die ersten Atommodelle
3.4 Über Teilchen und Wellenpakete
3.5 Das Doppelspaltexperiment
3.6 Heisenbergs Mikroskop
Kapitel 4: Die erste Quantenrevolution – Kapitel 4 Kurz gefasst:
4.1. Verschönerte Wellen
4.2 Informationswellen
4.3 Doppelspalt: die Theorie
4.4 Quantentunneln
4.5 Matrixmechanik
4.6 Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit ist Schönheit
4.7 Der Spin wird zum Qubit
Das Experiment von Stern und Gerlach
Das Qubit
Kapitel 5: Quantenphilosophie – Kapitel 5 Kurz gefasst:
5.1 Quantenquatsch
5.2 Verschränkungen
5.3 Niels versus Albert
5.4 Das
EPR
-Paradoxon
5.5 Schrödinger lässt die Katze aus dem Sack
5.6 Hunde, die bellen, beißen nicht
5.7 Kontextualität
Kapitel 6: Eins, zwei, viele – Kapitel 6 Kurz gefasst:
6.1. Die Ununterscheidbarkeit von Teilchen
6.2. Hotel Hilbert
Hartree und Fock
Richard Feynmans Diagramme
6.3 Atome und Moleküle
Die Mendelejew-Tabelle
Das Atommodell
Bahnen füllen: Moleküle
6.4 Die feste Materie
6.5 Quantenfarbe
6.6. Über Bose, Einstein und Laser
Das Bose-Einstein-Kondensat
Der Laser
Kapitel 7: Pudding und Quark – Kapitel 7 Kurz gefasst:
7.1 Subatomare Physik: die Experimente
Marie Curie
Ernest Rutherford
Die Entdeckung des Atomkerns
Die erste künstliche Kernreaktion und die Entdeckung des Protons
Die Entdeckung des Neutrons
Das Alter der Erde
Die erste kontrollierte Kernreaktion
Enrico Fermi
Lise Meitner und Otto Hahn
Robert Oppenheimer
7.2 Subatomare Physik: die Theorie
Die schwache und die starke Kernkraft
Feldtheorien und Eichtheorien
Die Quantenelektrodynamik
Yang und Mills
Quantenchromodynamik
Das Standardmodell
Die Theorie von Allem?
7.3 Wir sind alle aus Sternen gemacht
Kapitel 8: Mehr ist Anders(on) – Kapitel 8 Kurz gefasst:
8.1 Emergenz
8.2 Renormierung
8.3 Supraleitung
8.4 Die Entdeckung der Perfektion
Kapitel 9: Die Zweite Quantenrevolution – Kapitel 9 Kurz gefasst:
9.1 Quantenmetrologie
9.2 Quantensimulation
9.3 Quanteninformation
9.4 Quantenkomplexität
9.5 Quantencomputer
9.6 Wenn Quanten spinnen
9.7 Quantenphysik 2.0: verschränkte Teilchen
Epilog
Dank
Glossar
Ergänzende Literatur
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
Motto
Der Atome Räume, niemand kann sie sehen. Zu schwach sind unsere Träume, keine Vision kann sie verstehen. Quantenphysik war uns einst neu, heut zeigt sie uns den Weg. Und mit aller Unsicherheit und Scheu liefert sie den Beleg: Der Mensch, der über seine Grenzen schaut, sieht nicht nur, was in Stein gemeißelt steht, sieht, was ihm fremd und unvertraut.
Vorwort des Physikers
Dieses Buch ist das Ergebnis eines Zusammenpralls der Kulturen. Eines Zusammenpralls der Vorstellungen der Wissenschaft, die die Welt «mathematisiert» und ihr dadurch nach und nach ihre Geheimnisse entlockt, mit der Schönheit und Verwunderung, die uns bei der Entdeckung einer transzendenten Kunst zuteilwerden. Dem Enthüllen symmetrischer Muster in unserer materiellen Welt mit der Einfachheit und Pracht von Schuberts Musik. Der Unvorhersehbarkeit eines Quantensystems mit den widerstreitenden Emotionen von Narziss und Goldmund.
Der Punkt ist: Es gibt überhaupt keinen Zusammenprall. Die Schrödingergleichung gehört ebenso zum Kanon unserer Kultur wie Beethovens 9. Sinfonie. Wenn wir verstehen, wie die Quantenmechanik unserer Welt Farbe verleiht, ist das ebenso erhebend, wie wenn wir die Farbenpracht in Klimts Gemälden genießen. Und wenn wir verstehen, wie Symmetrie ein zentrales Ordnungsprinzip bildet und uns davor bewahrt, zu einer Erbse zusammenzuschrumpfen, ist das ebenso überwältigend, wie wenn wir der Erhabenheit des Grand Canyon gewahr werden. Im Wesentlichen strebt die Physik an, was Michelangelo vorschwebte, als er den Marmorblock begutachtete, aus dem er letztlich den David zum Vorschein brachte: die Natur so zu betrachten und zu beschreiben, dass alles Überflüssige abgeschlagen werden kann und nur die reine Essenz übrig bleibt.
Einen großen Unterschied gibt es jedoch: Obwohl sich die zeitgenössische Kunst und die vor Hunderten oder Tausenden Jahren entstandene Kunst nicht in ihrem Wert unterscheiden und gleich starke Emotionen wecken, bauen sie nicht wirklich aufeinander auf. Die Kunst erfindet sich ständig neu und ist der Originalität verpflichtet (oder auch nicht). Das gilt nicht für die Physik: Hier baut eine Theorie auf der anderen auf. Es ergibt sich eine natürliche Progression: Die Newton’sche Theorie hatte gegenüber der Relativitätstheorie das Nachsehen, und diese wiederum gegenüber der Quantenfeldtheorie; die Quantenwelt des Subatomaren stellte für die großen Geheimnisse der Chemie und aller Materie ebenso wie für die Funktionsweise der Sterne eine wahre Offenbarung dar; die Alchemie entwickelte sich zu einer experimentellen Wissenschaft, die Quecksilber in Gold verwandeln kann. Gerade deshalb ist es so faszinierend, die Geschichte der Quantenphysik zu erzählen: wie einzelne Forscher auf den Ideen anderer aufbauten, um so eine wahre Revolution zu entfesseln, die alle Aspekte unserer Wissenswelt bis in ihre Grundfesten beeinflusst hat. Und dabei deutlich zu machen, wie es uns einige wenige Grundbegriffe der Quantenphysik ermöglichen, unzählige Naturphänomene zu verstehen.
Das Leitprinzip dieses Buches lautet: Die Quantenphysik ist keineswegs unverständlich. Im Gegenteil. Es gibt eine Reihe grundlegender Ideen wie Symmetrie, das Ausschließungsprinzip oder die Unschärferelation, anhand derer jeder mit unserer atomaren Welt Fühlung aufnehmen kann. Mit einer atomaren Welt, die die Grundlage zahlreicher technologischer Anwendungen bildet, die jeder von uns täglich in Anspruch nimmt. Die Komplexität und die kontraintuitiven Eigenschaften der Physik dürfen nicht dazu führen, dass man sie mystifiziert. Das ist genau das Gegenteil dessen, was ein allgemein verständliches Buch leisten sollte. Und von den Lesern darf man auch nicht erwarten, dass sie jeder einzelnen Überlegung folgen können. Das ginge nur in mathematischer Sprache. Die Philosophie dieses Buches lautet daher auch: Die Leser sollten sich auf die Ideen konzentrieren können, denn diese sind intuitiv viel verständlicher und wichtiger als die präzisen logischen Deduktionen. Wir wollen und können die Mathematik der Quantenphysik in einem Buch ohne Formeln gar nicht erklären. Und wir halten dies auch nicht für notwendig. Wir möchten vielmehr erreichen, dass die Leser Neuartiges sehen und fühlen. Und die Welt nach der Lektüre dieses Buches aus einer frischen Quantenperspektive betrachten.
Die Quantenphysik funktioniert, und wir stehen am Vorabend einer zweiten Quantenrevolution, die unsere Technologie tiefgreifend verändern wird. Jeder, der sich für die Funktionsweise und die Schönheit unserer Welt interessiert, sollte zumindest die Grundbegriffe der Quantenphysik kennen. Das ist die Mission dieses Buches.
Vorwort der Autorin
In der Schule konnte mir nie jemand erklären, worin der Sinn von Mathe liegt. «Warum müssen wir das lernen? Damit kann ich später doch ohnehin nichts anfangen.» Immer die gleiche Leier, Sie kennen das sicher. Nach dem Unterricht zog ich frustriert und voller Wut von dannen, um aus dem Poster an der Wand über meinem Bett Trost zu schöpfen: Do not worry about your difficulties in mathematics, I assure you that mine are greater. Gezeichnet: Albert Einstein. Wer von uns nicht mit einer göttlichen Mathematikbegabung gesegnet war, guckte sich die Lösungen bei seinem Banknachbarn ab. Und wenn es Richtung Schulferien ging, war alles vergeben – und auch wieder vergessen. Ich selbst sammelte die nötigen Punkte mit Buchbesprechungen, Essays und Referaten; dabei konnte ich wenigstens mein Sprachtalent zur Geltung bringen.
Frustrierend fand ich vor allem, dass ich nicht begriff, warum ich keinen Zugang zu dieser Mathematik fand. Heute weiß ich, dass sich Mathematik gar nicht so sehr von der normalen Sprache unterscheidet, sie verwendet lediglich eine andere Ausdrucksform. Mathematik hat ihre eigenen Regeln und ihre eigene Poesie; sie ist ein ideales Übungsfeld für unser Abstraktionsvermögen, für unsere Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, problemlösend zu denken (oder denken zu lernen) und Zusammenhänge herzustellen. Auf diese Weise konnte Newton beispielsweise auch mit der gleichen Formel erklären, warum sein Apfel nicht weit vom Stamm fiel und die Planeten in Bahnen um die Sonne kreisen.
Ist es denn wirklich so unverzichtbar zu wissen, wie alles miteinander zusammenhängt? Eigentlich nicht. Ist es von unschätzbarem Wert? Unbedingt. Unser Punkt ist: Quantenphysik ist ebenso wie Literatur, Musik, Theater, Film und tutti quanti ein unbestreitbarer Teil unserer Kultur, denn Kultur ist gleichbedeutend mit Wissen. Sie ist die Übersetzung der Art und Weise, wie wir uns als Menschen entwickeln, wie wir mit unserer Geschichte umgehen, wie wir uns zum unendlich Großen und unendlich Kleinen verhalten, zu allem, was wir tun, und zu allem, worauf wir keinen Einfluss haben. Aus der Kultur entlehnen wir unsere Identität. Und wer an Identität denkt, denkt an Geschichte. Hinter jedem Wendepunkt in der Geschichte steht nicht nur ein starker Mann oder eine starke Frau, sondern auch eine starke Idee. Fast alle dieser Ideen sind aus neuen Erkenntnissen in den Naturwissenschaften hervorgegangen (man denke nur an die Aufklärung, die Industrialisierung, die Automatisierung, die Globalisierung und die Digitalisierung). Insgeheim hoffen wir also, dass sich, vielleicht auch dank dieses Buches, viele junge Menschen nach ihrer Schulzeit für ein naturwissenschaftliches Studium entscheiden. Vor allem auch junge Frauen. Nicht nur wegen ihres Geschlechts, aber natürlich auch wegen ihres Geschlechts, versteht sich. Denn Mädchen und Frauen sind unglaublich gut in Mathematik und Naturwissenschaften. Dieses Buch liefert dafür den eindeutigen Beweis.
Unwillkürlich muss ich hierbei an meine Abschlussarbeit zur Übersetzung von René Chars Feuillets d’Hypnos ins Italienische denken. Ich hatte das Buch zwar schon einmal irgendwo gelesen, aber wie der Übersetzer habe ich anfangs nur wenig davon verstanden. Sein Französisch schien mir vor allem unnötig schwierig. Und doch gingen mir Chars Aphorismen nicht aus dem Kopf. Irgendwie konnte ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass er in jedem seiner Texte bis zum Wesentlichen vordrang. Bis ich, nach Monaten der Suche und des unablässigen Bemühens um Verständnis, von einem Aha-Erlebnis ins nächste fiel. Das war es also, was er meinte! Durch ganz banale Alltagsbegebenheiten stellte ich plötzlich Zusammenhänge her, die ich vorher nicht gesehen hatte, und ich entdeckte, was er genau sagen wollte. Nicht alles, aber vieles rückte sich dadurch für mich zurecht. Vieles wurde mir klar. Unbewusst hatte ich mir diese Aphorismen zu eigen gemacht, und nun begann ich mehr und mehr, die Dinge durch diese Brille zu sehen. Bis ich schließlich zum Kern der Sache vordrang. Und genau das ist es auch, was wir mit diesem Buch zu erreichen hoffen.
Zu behaupten, dass mir seit dem Schreiben dieses Buches im Supermarkt mathematische Formeln durch den Kopf gehen, wenn ich nach einem Becher Quark greife, wäre albern. Aber wenn ich dann mit dem Quarkbecher an der Selbstbedienungskasse stehe, erinnere ich mich doch an das Kapitel über Laser. Wenn ich eine SMS nach Hause schicke, dass ich etwas später komme, entsinne ich mich des Kapitels über Transistoren. Und wenn ich daran denke, dass meine Mutter seit mehr als zwanzig Jahren krebsfrei ist, freue ich mich riesig, dass es MRT-Scanner gibt und ich meine Mutter auf dem Bildschirm meines Computers sehen kann, während wir von Kontinent zu Kontinent zoomen. Alles wird noch bedeutsamer, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und ganz gleich, ob wir das nun einem Poeten oder einem Professor für Quantenphysik zu verdanken haben, was zählt, ist der Wert und die Bedeutung, die wir allem, was uns umgibt, zuerkennen. Sie lehrt uns, anders zu denken, und lässt uns wachsen.
Zu guter Letzt noch ein Wort zu meiner Zusammenarbeit mit Frank. Ich dachte, dass ich ganz anders denken würde als der Professor, viel gefühlsmäßiger, jedenfalls nicht in dieser geradlinigen Schwarz-Weiß-Manier, die den Naturwissenschaften und der Mathematik (scheinbar) zu eigen ist. Ich arbeite, lebe und denke vor allem intuitiv. Für mich besteht das Leben aus einer einzigen Abfolge von Überraschungen und Begegnungen, mit viel Raum für Zufall. Während ich dem Professor zuhörte, stellte ich fest, dass wir uns gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Eigentlich sind wir uns in unserem Denken ähnlich und beide von der gleichen Sehnsucht nach Schönheit beseelt. Frank lebt nicht weniger als ich mit einer Leidenschaft für die Dinge, die unser Leben bereichern und spannend machen. Wir sind beide gleichermaßen chaotisch und kreativ, und tun das, was wir tun, aus dem Drang und der Lust heraus, alles, was uns ausmacht und was wir lieben, mit anderen zu teilen. Wir bringen das allerdings auf völlig verschiedene Weise zum Ausdruck. Gerade das macht die Zusammenarbeit so schön, und so notwendig. Sie zwang uns, einander noch besser zuzuhören, uns noch intensiver (in den anderen) hineinzuversetzen und uns noch stärker um gegenseitiges Verständnis zu bemühen. Ein Gespür füreinander zu entwickeln und einander zu ergänzen, ist wichtig. Gerade indem wir die richtigen Fragen stellen und die richtigen Bezüge herstellen, ergänzen wir uns so gut. Ist der Professor zu dumm, etwas erklären zu können? Bin ich nicht gescheit genug, es zu verstehen? Mag sein! Doch offensichtlich besteht zwischen uns ein Unterschied: Frank denkt und spricht mathematisch, ich denke und spreche niederländisch.
Gleichzeitig ist alles relativ. Es gibt die Mathematik, es gibt die Quantenphysik, es gibt Formeln und Verschränkungen, aber es gibt andere Dinge im Leben, die viel komplizierter sind. In unserem Alltag müssen wir lernen, Konflikte auszutragen und Worte für Gefühle und Gedanken zu finden. In ähnlicher Weise suchen auch wir in diesem Buch nach Worten und wollen die Dinge erfassen. Was wir hier niedergeschrieben haben, sollte nicht nur richtig und verständlich sein, sondern auch schön. Wissen ist vermittelbar, aber es darf durchaus auch inspirierend sein. Ich hoffe, dass Sie diese Botschaft erreicht und vor allem, dass Sie nicht verärgert und frustriert die Flucht ergreifen. Sollte das Thema nach dieser Lektüre doch noch nicht völlig klar geworden sein, dann seien Sie versichert, dass das völlig normal ist. Wir hoffen, dass Ihnen das Lesen zumindest Freude bereitet. Und sollten Sie nicht alles auf Anhieb verstehen: Dann warten Sie einfach, bis sich dieses Aha-Erlebnis einstellt!
Juni 2023, Gent & Cambridge & Nyons
Céline Broeckaert & Frank Verstraete
Wie Sie dieses Buch lesen sollten
Was hier nun folgt, ist kein Physikbuch. Es ist ein Buch über Quantenphysik. Das Wesen der Quantenphysik liegt nicht in der Mathematik. Viel wichtiger sind die Ideen, die ihr zugrunde liegen. Deshalb haben wir unsere Darstellung so weit wie möglich ent-ziffert, also von Formeln und Mathematik befreit. Sie müssen nicht alles in diesem Buch verstehen. Verbeißen Sie sich nicht in die Komplexität einzelner Passagen. Die Quantenlogik ist sehr kontraintuitiv, und manchmal ist es unmöglich, sie zu erfassen. Sie ist keine Voraussetzung, um das große Ganze zu begreifen oder die Schönheit der Naturgesetze zu würdigen. Seien Sie versichert, selbst Quantenphysiker verstehen die Quantenphysik nicht ganz. Was sie aber lernen, ist, mit ihr zu arbeiten und zu leben. Lassen Sie sich von den Wellen davontragen. Stellen Sie sich vor, Sie würden Musik hören. Jedes Kapitel entwickelt eine Variation auf das Quantenmotiv. Musik versteht man auch nie ganz, aber man kann sie dennoch genießen.
Die Struktur des Buches
In diesem Buch geht es um die Quantenphysik und ihr Entstehen zu Beginn des 20. Jahrhunderts; darum, wie sie sich zu der größten Revolution entwickelt hat, die es bei unseren Versuchen, die gesamte Materie auf der Erde und im Weltall zu ergründen, je gegeben hat; darum, wie sehr sie einen Großteil unserer modernen Technologie prägt. Doch wie jeder Bereich der Wissenschaften ist auch die Quantenphysik ein Kapitel in einer Geschichte ohne Ende und ohne wirklichen Anfang. Wie weit muss man in der Geschichte zurückgehen, um den ersten Ansatz zu dieser Wissenschaft zu finden? Wir haben uns dafür entschieden, mit unserer Darstellung im 16. Jahrhundert zu beginnen, mit Simon Stevin von Brügge, dem Ersten, der wissenschaftliche Dogmen über Bord warf, weil ihn Experimente auf andere, kontraintuitive Wahrheiten verwiesen. Die Quantenphysik ist aus dem Wissen entstanden, das seit Stevin wie ein Staffelstab von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Um auf diese Weise Gestalt anzunehmen und sich allmählich in unzähligen alltäglichen Anwendungen unverzichtbar zu machen. Das ist der rote Faden.
Neben dem Haupttext enthält das Buch zwei weitere markierte Textformen:
Bemerkenswertes: Das sind die eingerückten Passagen. Sie lassen hier und da etwas frischen Wind durch die Lektüre wehen.
Für Aficionados: Das sind die blauen Passagen. Für jene, die doch ein wenig tiefer schürfen möchten und sich gerne von Zahlen und Formeln verzaubern lassen. Gehen Sie getrost davon aus, dass diese Texte nicht notwendig sind, damit Sie dem Haupttext folgen können.
Teil 1
«Wiskunst» – Mathematik als Kunst des sicheren Wissens
Kapitel 1
Die unwahrscheinliche Effektivität der Mathematik
Kapitel 1 Kurz gefasst:
+Eine Theorie steht oder fällt mit Experimenten.
+Mathematik ist die Sprache der Natur (und ist unwahrscheinlich effektiv).
+In der Physik geht es um Konzepte und Ideen (nicht um Mathematik).
+Protagonisten: Simon Stevin, Galileo Galilei, Isaac Newton, William Hamilton
1.1 Wie Aristoteles von seinem Sockel gestoßen wurde
Simon Stevin
Alles begann mit einem scheinbar banalen Experiment zweier Männer, die im 16. Jahrhundert auf den Glockenturm von Delft gestiegen waren. Ihr Fallversuch läutete eine nie da gewesene und alles umwälzende wissenschaftliche Revolution ein. Dabei wurde nicht nur Aristoteles von seinem Sockel gestoßen, sondern auch der jahrtausendealte und unverbrüchliche Glaube erschüttert, dass schwere Gegenstände schneller herabfallen als leichtere.
Die Szene in Delft spielte sich wie folgt ab: Zwei visionäre Köpfe, Simon Stevin van Brügge (1548–1620, Brügger Bürger, Mathematiker, Physiker, Ingenieur avant la lettre und meisterhafter Zweifler) und sein Freund Jan Cornets de Groot («der fleißigste Erforscher der Geheimnisse der Natur»[1]) machten sich im Jahr 1586 auf den Weg zur Turmspitze der Nieuwe Kerk. Sie waren mit zwei Bleikugeln ausgerüstet, «von denen eine zehnmal größer und schwerer war als die andere». Die Kugeln ließen sie «aus 30 Fuß Höhe» gleichzeitig hinabfallen. Über das, was dann mit ihren Bleikugeln geschah, notierte Stevin, «die leichtere Kugel ist nicht zehnmal länger unterwegs als die schwerere, beide fallen gleichzeitig auf die Erde».
Ihr dritter Mann, der mit beiden Beinen unten auf dem Boden geblieben war und dem man mit dem schlichten Akt des Beobachtens zugleich die wichtigste Aufgabe zugeteilt hatte, stellte mit eigenen Augen und Ohren fest, dass die beiden Bleikugeln tatsächlich gleichzeitig auf einer Holzplanke auftrafen. Eindeutig war nur ein einziger Aufschlag zu hören. Stevin ließ es nicht bei dem Experiment in Delft bewenden, er zog seine Schlüsse daraus. Als er schweißgebadet die Treppe wieder hinabgestürmt war, stand sein Urteil fest: «Das von Aristoteles aufgestellte Prinzip der Proportionalität ist falsch.» Das Experiment ließ keinen Zweifel zu. Seit Aristoteles, also seit fast zweitausend Jahren, waren die Wissenschaftler von einer falschen Annahme ausgegangen. Es war definitiv und für immer bewiesen: Schwerere Objekte fallen genauso schnell herab wie leichtere.[2] Hier beginnt unsere Geschichte. Seit Stevin wurde über einen Zeitraum von gut drei Jahrhunderten der Weg für die Entwicklung der modernen Physik geebnet. Die Vernunft wurde aufgeklärt und der Geist so geformt, dass sie geradewegs auf die Geburt der Quantenphysik zusteuerte.
Stevin, der «da Vinci der Niederlande», nutzte die Gelegenheit, um geschickt auf das Gewicht eines Experiments hinzuweisen: Wie schön, logisch – oder romantisch, wenn man so will – eine Theorie auch erscheinen, und wie sehr sie auch der Intuition entsprechen mag, wenn sie sich nicht bewährt, ist sie wertlos. Damit wurde die Welt der Ideen freundlich ersucht, sich der empirischen Forschung, der Realität, zu stellen. Heute scheint das kaum noch einer Erwähnung wert zu sein, damals jedoch stellte das einen gewaltigen Bruch mit der Tradition dar. Das erklärt auch, warum es anfangs einen heftigen Widerstand gegen solche aufmüpfigen Standpunkte gab. Man muss allerdings einräumen, dass man solche Versuche erst durchführen konnte, als man über die notwendigen Instrumente dafür verfügte. Die Tatsache, dass die Wissenschaft im 17. Jahrhundert einen rasanten Aufschwung erfuhr, war eine logische Folge von Erfindungen wie dem Teleskop und dem Mikroskop. Je präziser man messen konnte, desto häufiger führten Experimente zu neuen Erkenntnissen und untergruben die früheren Theorien.
Das wird sich wie ein Leitmotiv durch dieses ganze Buch ziehen. Die Fortschritte in der Physik sind ein ständiges Pingpong zwischen Theorie und Experiment, zwischen Denken und Überprüfen. Und letztlich sind es immer die Experimente und nicht der Verstand oder das Bauchgefühl, die entscheiden, ob eine neue Theorie notwendig ist. Ein Wissenschaftler schert sich nicht darum, wer etwas zuerst entdeckt hat. Die Frage, die ihm den Schlaf raubt, lautet: Welches wissenschaftliche Gesetz kann das erklären, was ich mit eigenen Augen sehe? Und kann dieses Gesetz das Ergebnis zukünftiger Experimente vorhersagen? Das ist die Grundlage der wissenschaftlichen Methode und die einzig richtige Weise, Wissenschaft zu betreiben. Letztendlich beruht auch unsere Intuition «üblicherweise» nur auf unserer alltäglichen Erfahrung mit dem relativ Großen, dem Sichtbaren sozusagen, sie ist jedoch unzuverlässig, sobald wir uns in die Welt des mikroskopisch Kleinen begeben. Ein Atom, das, grob gesprochen, aus einem Kern mit ihn umkreisenden Elektronen besteht, ist etwas völlig anderes als eine Miniaturversion einer Sonne mit sie umrundenden Planeten. Was natürlich nicht bedeutet, dass ein gutes Verständnis des Makroskopischen nicht hilfreich sein kann, um mehr Einblick in das Mikroskopische zu gewinnen und umgekehrt.
Wollen wir in die Welt der Quantenphysik eintauchen, müssen wir uns also Stevins radikale Geisteshaltung zu eigen machen. Aus dieser Geisteshaltung heraus haben die Pioniere der Quantenphysik, dreihundertfünfzig Jahre nach Stevin, die gesamte Welt der Physik durcheinandergewirbelt. Da es gewisse Experimente und Mysterien gab, die sich mit der klassischen Physik beim besten Willen nicht enträtseln ließen, entwickelten Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger auf eine ganz unvoreingenommene Weise eine neue Theorie, die sehr wohl Antworten bot. Und so führte der rasante Aufschwung, den die Wissenschaft damit nahm, zu einer Menge neuer Fragen, großem Erstaunen, kühnen Hypothesen und schließlich zu den Grundgesetzen der Quantenphysik. Diese Quantenphysik sollte die Menschheit davon überzeugen, dass Teilchen eigentlich auch Wellen sind und sich zudem überall und nirgends gleichzeitig befinden. In Abhängigkeit davon, wie man sie betrachtet und was man misst.
Fernerhin sollte schnell deutlich werden, dass es der Quantenphysik nicht an Paradoxien mangelt. Dafür hat sie uns allerdings auch einiges zu bieten: eine Theorie, die das Verhalten der Materie und aller kleinsten Teilchen erklärt, die uns in die Lage versetzt, die Welt neu – oder besser gesagt: anders – zu entdecken, und die sich für die technologische Revolution des 20. Jahrhunderts als essenziell erweisen sollte.
Niemand anderes als Simon Stevin konnte und durfte am Beginn dieses Buches stehen. Er ist der Urvater der wissenschaftlichen Methode. Und er hielt das Niederländische (und in einem weiteren Sinne: die Umgangssprache) hervorragend dafür geeignet, Wissenschaft zu betreiben. Entsprechend greifen auch wir auf die Umgangssprache zurück, um unser selbst gestecktes Ziel zu erreichen, die Quantenphysik von ihrem geheimnisvollen Charakter zu befreien und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Zu guter Letzt haben wir mit Stevin begonnen, weil der Protagonist des nächsten Kapitels, Galileo Galilei, diesem Sohn Brügges unverkennbar einiges zu verdanken hat. Ehre, wem Ehre gebührt.
Im Dunkeln tappen
Es war einmal ein Mann, der stockbetrunken im Schein einer Straßenlaterne auf der Suche nach seinen Schlüsseln über die Straße torkelte. Ein Passant, der das bemerkte, half ihm brüderlich bei seiner Suche. Da diese ergebnislos verlief, fragte ihn der Passant, ob er denn sicher sei, dass er seine Schlüssel an dieser Stelle verloren habe. Woraufhin der Betrunkene achselzuckend lallte: «Nein. Aber hier gibt es wenigstens Licht.»[3] Mit anderen Worten: Die Natur mag uns noch so viele Geheimnisse bieten, unsere Aufgabe besteht darin, die Gesetze, die Schlüssel, zu finden, mit denen wir sie alle entziffern können. Dort zu suchen, wo Licht scheint, ist ein völlig logischer Reflex, denn nur dort können wir etwas sehen. Es wird aber immer deutlicher werden, dass wir bei dieser Suche auch im Dunkeln tappen müssen.
1.2 Mathematik ist die Sprache der Natur
Es war einmal ein junger Mann, der gern studierte, aber nicht gern zur Kirche ging. Während dieser Galileo Galilei (1564–1642) eines Tages im Dom von Pisa dem äußeren Anschein nach brav Psalmen vor sich hin murmelte, zog eine, mit einer Kette an der Decke befestigte, Lampe, die hin und her schwang, seine Aufmerksamkeit auf sich.[4] In Ermangelung eines Chronometers nutzte er seinen Herzschlag, um zu messen, wie lange das Objekt seiner Neugierde brauchte, um von einem äußersten Punkt zum anderen zu schwingen. Mit diesem glänzenden Pendelversuch gelang es Galilei, das kontraintuitive Gesetz zu entschlüsseln, das sich hinter einem schwingenden Objekt verbirgt: Wie groß der Ausschlag eines Pendels auch immer sein mag, die Zeit, die für eine Schwingung benötigt wird, bleibt immer gleich.
Galileo Galilei wäre nicht Galileo Galilei gewesen, hätte er sich nicht in hohem Maße von seinem Zeitgenossen inspirieren lassen. Mit seinem «Fall-Experiment 2.0» ging der Begründer der modernen Wissenschaften jedoch noch einen Schritt weiter als Stevin. Er richtete seine wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf das Konzept der Zeit und die Zeitintervalle. Das Problem war: Er fand keine Erklärung dafür. Das Einzige, worauf er zurückgreifen konnte, um den Mechanismus hinter etwas so Abstraktem wie der «Zeit» zu erfassen, war die Mathematik. (Notabene: Der niederländische Begriff «wiskunde» für Mathematik ist wie der Begriff «naturkunde» für Physik und «meetkunde» für Geometrie von Simon Stevin eingeführt worden, er leitet sich von «wis const», der «Kunst des Weisen», ab: der Kunst all dessen, was auf Zahlen und gesichertem Wissen beruht.)
In einer sternenklaren Nacht, irgendwo zwischen den Zypressen des idyllischen Pisa, wurde Galilei in seiner Vermutung bestärkt, dass ihm allein die Mathematik weiterhelfen könne. Neben einem schiefen Turm sitzend, blickte er verträumt durch seine ebenso revolutionäre Erfindung, das Teleskop. Was wäre, dachte er plötzlich, wenn ich jetzt eine andere Zivilisation zu Gesicht bekäme? In welcher Sprache sollte ich diese Menschen dann in Gottes Namen ansprechen? Mit Stevins Niederländisch würde das nie und nimmer funktionieren. E allora …? Matematica! Und obwohl er damit immer noch nicht die Formel für seine schwingenden Objekte hatte, war die Einsicht, dass die Mathematik der Schlüssel zur Beschreibung der Natur (und zur Kommunikation mit Außerirdischen) war, an sich mindestens ebenso revolutionär. «Das Buch [lies: die Natur] [ist] in der Sprache der Mathematik geschrieben […], und ohne dieses [Wissen] ist es unmöglich, auch nur ein einziges Wort [des Buches] zu verstehen.»
Die Quintessenz davon ist: Die Naturgesetze existieren unabhängig von uns. Nicht der Mensch hat die Mathematik erfunden, um die Natur zu erklären, die Mathematik ist einfach die Sprache der Natur. Experimente zwingen die Wissenschaftler dazu, das Vokabular dieser Sprache hin und wieder zu erweitern. Das erklärt auch, warum der Ausgang eines Experiments objektiv und unveränderlich ist und immer und überall zu demselben Resultat führt. Auf der Erde wie auf dem Mars. Denn ein mathematisches Modell der Welt ermöglicht es uns, Vorhersagen zu treffen und diese Vorhersagen wiederum durch Experimente zu falsifizieren.[5] Das ist, per Definition, Physik.
Galilei «mathematisierte» die Physik und entkoppelte sie von Philosophie und Religion, womit er sich den Zorn der Kirche und anderer Skeptiker zuzog. Die Quantenphysik wurde Jahrhunderte später zu einer extremen Anwendung dieser Methode. Einzig dank der (sehr) abstrakten Mathematik lässt sich fast alles in der Natur vorhersagen und erklären. Alles auf der Welt wird durch mathematische Funktionen beschrieben. Der Klang, der an unsere Ohren dringt: Funktionen! Das Licht, das auf den Augapfel fällt: Funktionen! Die Flugbahn, die ein Teilchen in der Zeit zurücklegt: Funktionen! Die Wärme, die sich in einem viel zu kleinen Café staut: Funktionen! Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer Messung eine bestimmte Lösung erhält: Funktionen! Der Einfluss des Flügelschlags eines Schmetterlings im Regenwald des Amazonas auf das Wetter in Gent: Funktionen! Funktionen beschreiben die Welt. Alles existiert in funktionaler Abhängigkeit von etwas anderem. Und das, obwohl wir die Mathematik und ihre Resultate nur in Worten verstehen und erhärten können. Denn letztlich geht es in der Physik um Ideen, nicht um Mathematik. Und hinter jeder starken Idee steht ein Mensch – sagen wir ruhig: ein Riese. Der nächste Riese in unsere Reihe ist Isaac Newton.
1.3 Den Löwen erkennt man an seinen Klauen
Man schrieb das Jahr 1665. Eine Pandemie legte Europa lahm, die Universitäten schlossen ihre Pforten, und Isaac Newton (1642–1727), Anfang zwanzig und Student in Cambridge, begab sich notgedrungen im elterlichen Landhaus Woolsthorpe, etwa hundert Kilometer nördlich der Stadt, in Quarantäne. Während dieser Zeit der Isolation erlebte Newton ein wahres annus mirabilis. Nie zuvor hatte jemand in so kurzer Zeit so viele neue Begriffe eingeführt und so viele Erkenntnisse in der Physik gewonnen wie Newton – ein Mann, der nie über London hinausgekommen war, nicht einmal, um das Meer zu sehen (trotz seiner immensen Faszination für Wellen); ein Mann, dem nie die Liebe einer Frau vergönnt war, nicht einmal die seiner Mutter, und vielleicht auch wegen seiner Mutter, die ihn als Dreijährigen bei seiner Großmutter zurückließ, die ihn aufzog. Dem Vernehmen nach hatte Newton selbst auch einen fiesen Charakter, was hier aber eigentlich nichts zur Sache tut.
Das größte Problem innerhalb der Physik, über das sich die Wissenschaftler damals den Kopf zerbrachen, war die Methode, mit der die Umlaufbahnen der Planeten beschrieben werden konnten. Oder besser gesagt: die Ermangelung einer Methode zu ihrer Beschreibung. Mit der damaligen Mathematik gelang das überhaupt nicht. Too bad, dachte sich Newton, und erfand dann selbst eine neue Mathematik (irgendjemand musste es ja tun): die Infinitesimalrechnung, besser bekannt als Differential- oder Integralrechnung. Wenn man die Position und die Geschwindigkeit von Teilchen und die Kräfte zwischen ihnen kennt, kann man mit der Infinitesimalrechnung herausfinden, wie alles irgendwann ausgesehen hat und irgendwann aussehen wird. Denn letztendlich kann man in der Welt alles aus Bewegung oder Veränderung herleiten. Alles beeinflusst sich gegenseitig, und alles verändert sich in Abhängigkeit von der Zeit: die Zeit, die tickt, das Gras, das wächst, die Planeten, die kreisen, die Elektronen, die rotieren, und die Katzen, die springen. Mit der Infinitesimalrechnung löste Newton das größte Problem der Physik seiner Zeit. Mit ein und derselben Formel gelang es ihm, sowohl die Bahnen der Planeten zu beschreiben als auch zu erklären, warum der sprichwörtliche Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Beide Phänomene ließen sich mit exakt denselben Gesetzen erklären. Und das war ziemlich spektakulär, denn vor seiner Zeit war die Wissenschaft von allem, was sich über unseren Köpfen abspielte, eine völlig andere als jene, die sich mit dem Leben auf der Erde befasste. Selbst die cleveren Pendel- und Fallexperimente von Stevin und Galilei konnten dank der Infinitesimalrechnung (endlich!) in mathematische Begriffe gefasst werden. Und so tat Newton das, was Galilei selbst nicht geschafft hatte: Er verwendete die Mathematik, um das Verhalten von beschleunigten Körpern zu beschreiben.
Isaac Newton
Newton versus Leibniz
Schon neun Jahre waren seit dem Druck von Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (im Volksmund «die Principia» genannt) vergangen, als ein Wettbewerb unter den klügsten Wissenschaftlern der Welt ausgeschrieben wurde. Die Männer hinter diesem Versuch, mit dem herausgefunden werden sollte, wer denn nun wirklich der große Rechenmeister war, waren die Mathematiker Johann Bernoulli und Gottfried Wilhelm von Leibniz. Es wurde eine wahre Rätselaufgabe formuliert, die innerhalb von sechs Monaten gelöst werden sollte. Die Frage lautete: Welche Form muss die Bahn einer Kugel annehmen, damit sie möglichst schnell von Punkt A zu einem tiefer gelegenen Punkt B rollt? Als Newton das Rätsel in die Hände bekam, muss sich in ihm eine wahre Sturzflut genialer Eingebungen gelöst haben, denn innerhalb von zwölf Stunden hatte er die Antwort gefunden. Der Argwohn, den er gegenüber Leibniz (seinem großen Rivalen) hegte, bewog Newton allerdings dazu, seine Lösung anonym einzureichen. Vergeblich. Gemäß der Devise «Zeige mir, wie du schreibst, und ich sage dir, wer du bist» wurde das mathematische Genie sofort in seiner Genialität erkannt. Bernoulli hätte es nicht treffender ausdrücken können: We know the lion by his claw. Obgleich sich die Rivalität zwischen Leibniz und Newton auf den ersten Blick wie ein banaler Streit darüber ausnahm, «wer der Erste war», war der Gegenstand der Diskussion keineswegs trivial. Schließlich ging es hier darum, wer der Entdecker der Infinitesimalrechnung war, einer der einschneidendsten wissenschaftlichen Entdeckungen überhaupt. Mittlerweile sind sich die Historiker darin einig, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt: Newton und Leibniz haben die Infinitesimalrechnung unabhängig voneinander entdeckt. Newton war aber wohl der Erste.
Besondere Beachtung verdient der Umstand, dass Newtons Naturgesetze und die Infinitesimalrechnung ein deterministisches Universum voraussetzten. Damit folgte der Wissenschaftler dem philosophischen Modell seines Beinahe-Zeitgenossen Descartes. Dieses Modell lässt keinen Zufall zu und lehnt auch jegliche Willkür ab. Für Newton war das Universum so vorhersehbar wie seine Küchenuhr. Nach zwei Uhr folgt halb drei, sechzig Minuten ergeben eine Stunde, und ein Zeitraum von vierundzwanzig Stunden umfasst morgen ebenso wie gestern einen ganzen Tag. Dasselbe galt in seinen Augen auch für das Universum: Wenn man die Position und die Geschwindigkeit aller Teilchen (Sterne, Planeten, Monde, Äpfel …) zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, kann man mit Gewissheit und bis auf die Millisekunde genau bestimmen, wo sie sich zu einem x-beliebigen Zeitpunkt befinden werden und wo sie sich in einer dunklen Vergangenheit herumgetrieben haben.
Aus alldem können wir ohne Scheu oder Übertreibung schließen, dass Newton das Fundament der gesamten klassischen Physik gelegt hat. Leider wird sich irgendwann herausstellen, dass Newtons klassische Physik zur Beschreibung der allerkleinsten Teilchen nicht ausreicht. In diesem Bereich werden die Gesetze der Quantenphysik zum Tragen kommen. Die klassische Physik versagt zudem bei der Beschreibung des Allergrößten und all dessen, was sich der Lichtgeschwindigkeit annähert; dort wird Einstein mit seiner Relativitätstheorie eingreifen. Auch Newtons deterministisches Weltbild wird einen ordentlichen Knacks abbekommen. Denn in der Quantenphysik spielt der Zufall eine bedeutende Rolle. Hier existiert alles aufgrund von Zufall und Wahrscheinlichkeit. Paradoxerweise nutzte die Quantenphysik Newtons Infinitesimalrechnung dazu, seine eigenen Theorien zu untergraben. Und erstaunlicherweise war dazu keine neue Mathematik erforderlich. Die Formeln der Infinitesimalrechnung wurden einfach grundlegend anders interpretiert, nämlich in Form von Wellenfunktionen und Wahrscheinlichkeiten, zwei Begriffen, die sich, wie die nächsten Kapitel zeigen werden, wie ein roter Faden durch diese Geschichte ziehen werden.
Was die Quantenphysik eindeutig noch mit der Infinitesimalrechnung gemeinsam hat, ist, dass auch sie von einer «unwahrscheinlichen Effektivität» oder «unheimlichen Nützlichkeit» zeugt. Ursprünglich erfunden, um zu beschreiben, wie Elektronen um einen Atomkern kreisen, entpuppt sie sich am Ende als viel breiter anwendbar als erwartet. Eugene Wigner (1902–1995) hat sich über diese «unvernünftige Wirksamkeit» der Mathematik in den Naturwissenschaften auf sehr schöne Weise verwundert: «Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass uns hier ein Wunder gegenübersteht, das in seiner überraschenden Natur durchaus mit dem Wunder vergleichbar ist, dass der menschliche Geist tausend Argumente aneinanderreihen kann, ohne in Widersprüche zu geraten, oder mit den beiden Wundern der Existenz von Gesetzen der Natur und der Fähigkeit des menschlichen Geistes, sie erahnen.»
Simon Stevin hatte mit dem Niederländischen auf die Sprache gesetzt, um Wissenschaft zu betreiben. Galilei tauschte die Umgangssprache gegen die Mathematik ein. Mit Newtons Infinitesimalrechnung erreichte die Mathematik schließlich einen absoluten Höhepunkt.
Newton war, kurz gesagt, der erste echte Wissenschaftler. Oder anders formuliert: Er war der letzte der Zauberer. Vor seiner Zeit war jeder nach eigenem Gutdünken vorgegangen, man hatte alles Mögliche kombiniert und mit viel Geduld und Spekulieren für alles (nicht wirklich für alles) eine Erklärung gefunden. Plötzlich waren es dann doch die Planeten, die um die Sonne kreisten und nicht umgekehrt. Aber niemand konnte erklären, warum das so war. Das Warum kam nicht über den Status bloßer Vermutungen hinaus. Galilei und Stevin hatten zwar die «wissenschaftliche Methode» eingeführt, doch Newton kam das Verdienst zu, ihr eine klare Ausgestaltung zu geben. Das erforderte natürlich neue Erkenntnisse, einen neuen Ansatz und einen neuen Werkzeugkasten. Und es blieb eine Aufgabe für viele Generationen nach ihm. Der Astronom und Mathematiker Sir Hamilton – unser nächster Riese – war mehr als bereit dazu, diese Herausforderung anzunehmen.
Der Apfel
«[Newton] est notre Christophe Colomb. Il nous a menez dans un nouveau monde, et je voudrois bien y voïager (Newton ist unser Christoph Columbus. Er hat uns in eine neue Welt geführt, und ich würde gerne dorthin reisen.)» Wer an Newton denkt, denkt unwillkürlich an den Apfel. Die Geschichte mit dem Apfel entspringt jedoch dem kreativen Geist des Schriftstellers, Philosophen, begeisterten Newton-Anhängers und Urhebers des obigen Zitats: François-Marie Arouet, alias Voltaire (1694–1778). Obwohl Voltaires kleine Geschichte vom Fall des Apfels mehr Fantasie als Wahrheit enthält, wusste er sie geschickt einzusetzen, um Newton menschlicher erscheinen zu lassen und seine Theorien einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Apropos, sollte man sich fragen, woher es rührt, dass einige Werke Voltaires gelegentlich erstaunlich wissenschaftlich fundiert sind: Der Grund dafür liegt in den Umarmungen von Emilie du Châtelet (1706–1749). Jahrelang lebten Voltaire und du Châtelet in der besten aller möglichen Welten; sie verbrachten ihre Tage mit Liebe, Literatur, Theater, Studium und Forschung. Warum verdient nun Emilie du Châtelet besondere Anerkennung? Weil sie als Naturwissenschaftlerin und Mathematikerin die erste wirkliche Gelehrte der Neuzeit war. Weil sie es verstand, auf der Grundlage ganz einfacher Annahmen die komplexesten Probleme anzugehen. Weil die männliche Dominanz in den Wissenschaften sie nicht daran hinderte, sich in Newtons Kreisen zu bewegen. Vor allem aber, weil sie Newtons Principia ins Französische übersetzte. Und sie übersetzte sie nicht einfach nur, sondern ergänzte den Text durch eigene Kommentare und gab ihm den letzten Schliff, vor allem, was das Gesetz von der Erhaltung der Energie anbetraf. Du Châtelet zeigte, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann; Energie kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Zudem löste sie eine Kontroverse zwischen Newton und Leibniz auf, indem sie entdeckte, dass sich die kinetische Energie nicht proportional zur Geschwindigkeit (Newtons Version), sondern proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit (Leibniz’ Version) verhält. Newton mag im Streit um die Entdeckung der Infinitesimalrechnung den Sieg davongetragen haben, doch dieses Mal lag das Recht auf Leibniz’ Seite. Etwa ein Jahrhundert später sollte du Châtelets Verständnis von Energie einen zentralen Platz in den Arbeiten von William Hamilton und Joseph-Louis Lagrange einnehmen, zwei weiteren Architekten der Fundamente der Quantenphysik.
Du Châtelet war bereits über vierzig, als sie schwanger wurde, wobei es sich bei dem Vater ihres Kindes nicht um Voltaire handelte. Aufgrund ihres Alters machte sie sich zunehmend Sorgen über den Verlauf der Schwangerschaft, was sie dazu veranlasste, ihre Übersetzungsarbeit in aller Eile fertigzustellen. Das Kind kam gesund zur Welt, du Châtelet starb kurz darauf, Voltaires Welt brach zusammen. Doch bevor er sein Land verließ, nahm er noch all seinen Mut (und sein Ehrgefühl) zusammen, um ihre Principes mathématiques de la philosophie naturelle d’Isaac Newton posthum veröffentlichen zu lassen. Bis heute ist dies die maßgebliche französische Ausgabe. Den Epikureern unter uns empfehlen wir zu guter Letzt noch du Châtelets Discours sur le bonheur (1779). Und nicht zu vergessen: Auf der Venus wurde ein Krater nach ihr benannt. Wir ziehen es jedoch vor, unsere Wertschätzung in einem Buch zum Ausdruck zu bringen.
1.4 Algebrakadabra
Eines Tages verliebte sich Sir William Rowan Hamilton (1805–1865). Aber das war nicht einfach nur eine Liebelei, o nein. Er verliebte sich, wie es sich für einen Astronomen gehört: to the moon and back – bis zum Mond und wieder zurück. Es ereignete sich an einem gewöhnlichen Wochentag, dem 16. Oktober des Jahres 1843, als er sein Arbeitszimmer verließ und in der exquisiten Gesellschaft seiner Geliebten spazieren ging. Während sie unbeantworteten Fragen wie jener, was heute Abend auf den Tisch kommen solle, nachgingen, kam er auf Höhe einer Brücke über den Royal Canal plötzlich zu einer derart genialen Erkenntnis, dass er es in seiner Euphorie für nötig befand, nicht etwa den Namen seiner Geliebten, sondern seine brandneue Eingebung in einen Stein dieser Brücke zu ritzen: das äußerst poetische i222⋅ j ⋅ k = -1.
«Quaternions! Eat that, my love! So erweitert man komplexe Zahlen in die vier Dimensionen! Weg mit der Kommutativität!» Seine Geliebte nickte still und mühte sich, ihre Enttäuschung zu verbergen. Ungeachtet dessen, legte Hamilton mit dieser Gravur bravourös den Grundstein für die lineare Algebra und die Matrizenmechanik. Dass bis auf den heutigen Tag jedes Jahr am 16. Oktober viele Menschen den Hamilton Walk beschreiten, zeigt, wie unendlich viel die wissenschaftliche Welt Hamilton zu verdanken hat.
Hamiltons Brücke über den Royal Canal
Bevor wir fortfahren, machen wir einen notwendigen Abstecher in die Welt der komplexen Zahlen und Quaternionen. Was die Mathematik und die Quantenphysik manchmal so komplex macht, ist der Umstand, dass darin hauptsächlich mit komplexen Zahlen gearbeitet wird. «Normale» Menschen rechnen mit reellen Zahlen, wie 9 oder 14 oder -65, wie 3,14 oder -√2. Das Quadrat reeller Zahlen ergibt immer ein positives Ergebnis. Denn die Multiplikation einer Zahl mit sich selbst führt notwendig zu einem positiven Ergebnis. Wem mathematisches Denken vertrauter ist, der verwendet neben den reellen Zahlen auch imaginäre Zahlen, wie z.B. die Zahl i, die immer die Quadratwurzel aus -1 ist (also i ⋅ i = -1, und 10 ⋅ i ist die Quadratwurzel aus -100).
Komplexe Zahlen bestehen aus zwei Komponenten: Sie sind immer eine Kombination aus einer reellen und einer imaginären Zahl. Das mag seltsam erscheinen, es macht aber das Leben derer, die mit komplexen Problemen arbeiten, wesentlich einfacher. Bis zur Quantenphysik sah man darin eine weitere mathematische Kuriosität aus der Trickkiste der Mathematik, um Differentialgleichungen (Gleichungen, die beschreiben, wie sich etwas in Abhängigkeit von der Zeit verändert) schneller und effizienter lösen zu können. Mit dem Aufkommen der Quantenphysik haben die komplexen Zahlen ihre Rolle als bloße mathematische Trickserei endgültig verloren; sie sind völlig unverzichtbar geworden. Der entscheidende Punkt ist: Die Natur lässt sich nur durch komplexe Zahlen beschreiben.
Zurück zu unserem zentralen Thema: Hamilton. Er ging noch einen Schritt weiter und legte mit seinen Quaternionen die mathematische Basis für die Quantenphysik. Und diese mathematische Basis ist zugegebenermaßen nun einmal komplex. Hamiltons Quaternionen bestehen nicht aus zwei Komponenten, wie «normale» komplexe Zahlen, sondern aus vier Komponenten. Neben der 1 (einer reellen Zahl) und dem i (einer komplexen Zahl) kommen noch das j und das k hinzu. Die wichtigste Eigenschaft der Quaternionen besteht darin, dass sie nicht kommutativ sind. Mit anderen Worten: i ⋅ j ist nicht gleich j ⋅ i. Ein Schwimmbecken mit Wasser volllaufen zu lassen, um anschließend hineinzuspringen, ist nicht dasselbe, wie in ein Schwimmbecken zu springen, um es anschließend volllaufen zu lassen. Erlaubt ist nur: i ⋅ j = -j ⋅ i. Darüber hinaus sind Quaternionen assoziativ: a ⋅ (b ⋅ c) = (a ⋅ b) ⋅ c. Mit anderen Worten: Das Vertauschen von Zahlen ist nicht erlaubt, wohl aber das Verschieben von Klammern ohne Änderung des Ergebnisses. Ein Ei zu kochen und zu schälen – und es danach zu essen, ist nichts anderes, als ein Ei zu kochen – und es danach zu schälen und zu essen. Durch diese duale Eigenschaft von Quaternionen (nicht kommutativ, aber assoziativ) eröffnete sich eine völlig neue Welt; sie bildete die Grundlage dafür, was später zur Quantenphysik werden sollte.[6]
Schon sehr bald wurde deutlich, dass diese Art, mit Zahlen wie 1, i, j und k zu arbeiten, doch etwas kompliziert war. Das musste einfacher gehen. Und es ging auch einfacher, nämlich indem man die Berechnung in Form von Matrizen vornahm. Eine Matrix lässt sich mit einem großen Schachbrett vergleichen, dessen horizontale Reihen und vertikale Spalten mit komplexen Zahlen gefüllt sind. Das sieht beispielsweise so aus:
Mit dem Übergang zu Matrizen wurde es möglich, nicht-kommutative Strukturen auf weitere, viel interessantere Systeme anzuwenden. Während man mit der Newton’schen Theorie beschreiben kann, wie sich ein einzelnes Teilchen in Abhängigkeit von den auf es ausgeübten Kräften entwickelt, kann man dies mit Matrizen für sehr viele Teilchen (alias: ein Vielteilchensystem), die allesamt Kräfte aufeinander ausüben, leisten. Die Zahlen in der Matrix beschreiben, in welchem Ausmaß sich die Teilchen gegenseitig anziehen oder abstoßen, und sie sagen voraus, wie sich all diese Teilchen im Laufe der Zeit entwickeln werden. Eigenfrequenzen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Jede Matrix hat ihre jeweiligen Eigenfrequenzen, die die Eigenschaften (die Schwingungen) eines Vielteilchensystems darstellen. Denn jedes System schwingt. Und genau diese Schwingungen bestimmen, wie sich die Teilchen bewegen.
Feld-Wald-und-Wiesen-Quaternionen
Wofür sind all diese abstrakten Konstruktionen nun konkret von Nutzen? Quaternionen und Matrizen sind für die superschnelle Bildverarbeitung auf Handys, Playstations und allem anderen, was zu unserer Bildschirmkultur gehört, verantwortlich. Wenn heute einem fleißigen Studenten der Sinn danach steht, den Hamilton-Spaziergang über den Royal Canal mithilfe einer VR-Brille virtuell zu simulieren, könnte er unseren Blick in kürzester Zeit von einer Seite dieser inzwischen weltberühmten Brücke auf die andere lenken. Etwa, weil dort gerade ein äußerst seltenes Exemplar eines irischen Zilpzalps vorbeifliegt. Will unser Computergenie dafür sorgen, dass das Bild in der VR-Brille auch bei heftigen Bewegungen immer gleich scharf bleibt, muss es die digitalen Rotationen in Quaternionen kodieren, da die Mathematik der Quaternionen einen wesentlichen Bestandteil der (allerschnellsten) Bildverarbeitungsalgorithmen bildet. Mit anderen Worten: Matrizen sind aus der modernen Informationsverarbeitung nicht mehr wegzudenken. Der berühmte PageRank-Algorithmus von Google basiert auf der Ermittlung der «Eigenfrequenzen» einer sehr großen Matrix. Sie bilden aber auch die Grundlage der Algorithmen, die in Hedgefonds, beim neu entwickelten KI-Chatbot ChatGPT, bei der Vorhersage von schönem Wetter oder der Suche nach allen Wegen, die uns über Google Maps nach Rom führen, verwendet werden.
Das einfachste Beispiel für ein klassisches Vielteilchensystem ist eine Saite (einer Gitarre, eines Klaviers, einer Mandoline). Das mathematische Modell einer Saite geht davon aus, dass eine Saite aus einer unendlichen Anzahl von Teilchen besteht, die sich gegenseitig beeinflussen. Die C-Saite wird beispielsweise mittels einer C-Saiten-Matrix beschrieben, deren «Eigenfrequenzen» (die verschiedenen Töne) bestimmen, wie die Saite klingt. Wenn man die C-Saite anschlägt, erklingen zwangsläufig auch höhere Töne, die alle ein Vielfaches der Frequenz des Grundtons sind. Jede Saite hat also ihre eigene Matrix und ihre Eigenfrequenzen. Eine Saite kann daher nur eine sehr begrenzte (diskrete) Anzahl von Tönen erzeugen. In der Physik nennt man diese «Begrenzung» Quantisierung. Schlägt man eine Saite an, erklingen all diese verschiedenen Töne gleichzeitig, einige etwas stärker als andere. Dies bringt uns zum nächsten zentralen Begriff: der Superposition.
In der folgenden Abbildung zupft eine unschuldige Hand an der C-Saite. A und B zeigen an, wo die Saite befestigt ist. Der Ton, den man hört, besteht aus einer Summe (oder: einer Superposition) verschiedener Töne. Diese Superposition wird von der Form (der Funktion) der Saite in dem Moment bestimmt, in dem man sie anschlägt. Die Eigenschaft, dass jede Funktion als eine Superposition verschiedener Wellen ausgedrückt werden kann, bildet die Grundlage der Fourier-Analyse, eines der wichtigsten Werkzeuge der Mathematik. Der französische Mathematiker Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830) entwickelte diese Analyse, um beschreiben zu können, wie sich Wärme in Materie fortbewegt. Nebenbei bemerkt: Seine eigene Wärme zu kontrollieren, war für Fourier ziemlich schwierig. Ihm war immer kalt. Daher bestand seine Kleidung grundsätzlich aus mehreren Schichten, je mehr dicke Pullover er anhatte, desto besser. Aber auch das nutzte alles nichts. Die letzten Tage seines Lebens verbrachte er in einem schwarzen Pappkarton. Einzig dort schien er seine eigene Wärme doch noch einigermaßen regulieren zu können.
Die Dreiecksform der Saite ist eine Superposition (Summe) aus einem Grundton (a) und mehreren Obertönen (b, c, d, …), die alle Vielfache dieses Grundtons sind.
Die Klangfarbe eines Instruments wird durch die Amplituden der Obertöne (die Stärke, mit der bestimmte Frequenzen im Klang vertreten sind) und den Zeitpunkt bestimmt, an dem die verschiedenen Schwingungen ihr Maximum erreichen (die sogenannte Phase). Im Prinzip ist jede Kombination (oder Superposition) von Amplituden und Phasen dieser Töne möglich. In der Abbildung hat der Grundton die Frequenz eins. Der Oberton b hat die dreifache Frequenz und klingt neunmal schwächer als der Grundton. Der Oberton c hat die fünffache Frequenz und klingt fünfundzwanzigmal schwächer, und der Oberton d mit der siebenfachen Frequenz klingt neunundvierzigmal schwächer als der Grundton.
Mit dieser technischen Erklärung greifen wir ein wenig vor, aber aus gutem Grund. Denn wie sich zeigen wird, besteht die wichtigste Erkenntnis der Pioniere der Quantenphysik, Heisenberg und Schrödinger, gerade darin, dass sich das Verhalten eines einzelnen Quantenteilchens (z.B. eines Elektrons) mit der gleichen Mathematik und den gleichen Formeln beschreiben lässt, mit denen sich viele klassische Teilchen (z.B. eine Saite) beschreiben lassen. Warum ist das so? Einen einzelnen Wassertropfen auf Grundlage einer ganzen Welle definieren? Wie lässt sich das interpretieren? Ganz einfach: indem man sein Bauchgefühl ausschaltet und die Quantenlogik einschaltet. Dann wird deutlich, dass die möglichen Energieniveaus eines Quantenteilchens quantisiert sind (daher: Quantenphysik), dass ein Quantenteilchen sowohl einen Teilchen- als auch einen Wellencharakter hat. Ein Quantenteilchen existiert, ebenso wie eine Saite, als Superposition von Wellen, was obendrein bedeutet, dass es sich auch noch an verschiedenen Orten gleichzeitig befinden kann.
Kurz gesagt: Quantenteilchen werden anhand von Wellengleichungen beschrieben, den sogenannten Wellenfunktionen der Quantenphysik. Die Entwicklung dieser Wellenfunktion ergibt sich aus der Hamilton-Funktion (benannt nach Sir William Rowan Hamilton), einer unendlich großen Matrix, die allen Berechnungen in der Quantenphysik zugrunde liegt. Keine Sorge, wenn sich das jetzt alles unnötig schwierig und vage anhören mag, in den folgenden Kapiteln werden wir noch ausgiebig auf diesen Wellen surfen und sie im Detail unter die Lupe nehmen.
Fußnoten
1 Beschreibung von Simon Stevin. Aus: Anhang van de weeghconst, inde welcke onder andere weerleydt worden etliche dwalinghe ghedaenten.
2 Voraussetzung ist jedoch, dass von bestimmten Details, die vom Wesentlichen ablenken, abstrahiert wird. Die Objekte, die hinabfallen, müssen schwerer sein als Luft, sie dürfen aber auch nicht zu schnell fallen, damit der Luftwiderstand keine zu große Rolle spielt. Mit einem Heliumballon würde es gar nicht funktionieren, der fällt gewissermaßen nach oben. Im luftleeren Raum hingegen fällt ohnehin alles gleich schnell zu Boden.
3 Giorgio Parisi, La chiave, la luce e l’ubriaco, 2006.
4 Heutige Biographen stellen die Authentizität dieser Anekdote infrage, da die bewusste Lampe möglicherweise erst zwei Jahre später (1585) in der Kathedrale aufgehängt wurde.
5 In der Physik kann man nicht beweisen, dass eine Theorie richtig ist. Man kann lediglich nachweisen, dass sie falsch ist. Genau das meinen wir mit «falsifizieren». Dass ein Experiment funktioniert, garantiert nicht, dass auch die Theorie richtig ist. Sie kann in diesem einen Fall einfach zufällig zutreffen.
6 Für die Quanten-Aficionados: Achtzig Jahre später werden die Quaternionen in Form der berühmten Pauli-Spin-Matrizen wieder auftauchen, die den Spin eines Elektrons beschreiben.





























