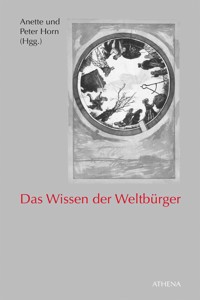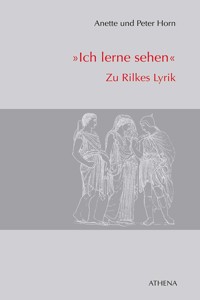Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: wbv Media GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Beiträge zur Kulturwissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Benn hat in seinen Essays und z. T. auch in seinen Gedichten immer wieder betont, dass nicht das Inhaltliche, sondern die Form das Eigentliche an einem Gedicht ist. Er selbst hat seine denkerischen Bemühungen nur als »eine Art Materialbeschaffung für die Lyrik, die immer mein eigentliches literarisches Anliegen war«, eingestuft. Im Gegensatz zu vielen Forschungsbeiträgen zu Benns Werk wird hier Benn in erster Linie als Lyriker wahrgenommen und bewusst werden die Biografie und die Essays nur insoweit herangezogen, als sie zum Verständnis der Lyrik beitragen, denn jenseits der textimmanenten Interpretation muss doch auch der geschichtliche, biografische und gedankliche Kontext berücksichtigt werden. Lyrik vermag letztlich nur sich selbst zu offenbaren, die Dinge mystisch bannen durch das Wort. Sie ist Ausdruck einer zur Lust der Fantasie erschaffenen Welt. Die Sprache der Wissenschaft, auch der Literaturwissenschaft, ist nach Benn unzulänglich und begrenzt und unfähig, das Geheimnis und den Zauber der Lyrik zu erschließen. Ein Sprechen über Lyrik kann keinen Aufschluss über das geben, was Lyrik in ihrem Wesen ist. Wenn hier dennoch Benns Gedichte interpretiert werden, dann mit der Erkenntnis, dass die Rezeption des Eigentlichen in der Lyrik nur über ästhetische und assoziative Kanäle geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anette und Peter Horn
Was aber neu ist, ist die Frage nach dem Satzbau
Die Gedichte Gottfried Benns
ATHENA
Beiträge zur Kulturwissenschaft
Band 39
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
E-Book-Ausgabe 2017
Copyright der Printausgabe © 2017 by ATHENA-Verlag, Copyright der E-Book-Ausgabe © 2017 by ATHENA-Verlag, Mellinghofer Straße 126, 46047 Oberhausen www.athena-verlag.de
Umschlagabbildung: Gottfried Benn in seiner Berliner Wohnung. Photographie. 1955. akg-images / Imagno / Franz Hubmann
Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (Print) 978-3-89896-647-4 ISBN (ePUB) 978-3-89896-821-8
This material is based upon work supported financially by the National Research Foundation. Any opinion, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and therefore the NRF does not accept any liability in regard thereto.
We gratefully acknowledge that the University of Witwatersrand supported our research.
Vorwort
»Stil ist der Wahrheit überlegen, er trägt in sich den Beweis der Existenz«.[1]
In der Kunst »ist das Höhere das Manipulierte, das Angefertigte, der Stil«.[2]
In der Forschung wird Benn zwar einerseits in erster Linie als Lyriker wahrgenommen und seine Prosa als zweitrangig angesehen; andererseits beschäftigen sich die meisten Bücher über Benn entweder vor allem mit seiner Biografie, oder, wenn sie sich mit seinem Werk auseinandersetzen, bevorzugen sie doch die Prosa, Erzählungen und Essays, und analysieren ihn »als Prophet artistisch-weltanschaulicher Positionen.«[3] (Vgl. Reents 2009: 320) So wird z. B. in Wellershoffs Buch die Lyrik eher nebenbei behandelt, und bei Buddeberg nur in einem von zwölf Kapiteln. Reinhard Alter (1976) geht zwar kurz auf einige Gedichte ein, interessiert sich aber auch mehr für Benns Theorie, und vor allem für seine Politik. Auch Wodtke (1970) geht fast ausschließlich von der Biografie aus, die Gedichte werden eher stiefmütterlich behandelt.[4] Zu Recht hat man darauf hingewiesen, dass Benns Denken weitgehend abhängig ist und dass er selbst seine denkerischen Bemühungen nur als ›eine Art Materialbeschaffung für die Lyrik, die immer mein eigentliches literarisches Anliegen war‹ (VI: 50) eingestuft hat. Gerigk (2012: 82) betont daher zu Recht, das Selbstverständnis Gottfried Benns, wie er es in seinem Essay Probleme der Lyrik und in seiner ›Berliner Novelle‹ Der Ptolemäer formulierte, reiche ganz offensichtlich an die anschauliche Höhe seiner Lyrik nicht heran. Zudem wird selbst Benns Prosa im Allgemeinen fast nur vom Inhaltlichen, nicht vom Sprachlichen und Ästhetischen her gewürdigt. (Vgl. Seidler ebd.) Ob die Beschäftigung mit dem Benn’schen Denken der geeignete Zugang zu seiner Dichtung ist, ist daher die Frage. Willems (1981: 29, 49ff.) ist der Auffassung, literarisches Reden sei für Benn »Arbeit an der Lebendigkeit des Ichs, an der Bewußtheit seines Bewußtseins« und Benn verstehe Dichtung als Arbeit an der Existenz, und eine Dichtung der Existenz ist eine Dichtung, die sich gerade nicht um die Transzendenz kümmern will. Die vorliegende Arbeit wird daher bewusst die Biografie[5] und die Essays nur insoweit heranziehen, als sie zum Verständnis der Lyrik beitragen, denn jenseits der textimmanenten Interpretation muss allerdings doch der geschichtliche, biografische und gedankliche Kontext berücksichtigt werden.
Die werkimmanente Interpretation versuchte Dichtung autonom aus dem Text und ohne Bezug auf die historische Situation des Autors zu begreifen, und ihn so von seiner geistigen Umgebung abzuschneiden. Staiger (1955: 13) betonte, dass die Dichtung aus keiner Verkettung von Ursache und Folge, also auch nicht aus historischen Zusammenhängen abgeleitet werden könne, und dass jegliche geschichtliche Forschung immer und ausschließlich ein Weg zur Annäherung an die Welt des Dichters bleiben werde. Staiger schreibt, wenn wir Literaturwissenschaft betreiben, »dann müssen wir uns entschließen, sie auf einem Grund zu errichten, der dem Wesen des Dichterischen gemäß ist, auf unsere Liebe und Verehrung, auf unserem unmittelbaren Gefühl«. Eine der Forderungen an die Interpretation war die Benjamins (1977: 105), dass der Kritiker die innere Form, dasjenige, was Goethe als Gehalt bezeichnete erfassen müsse. Adorno in Parataxis (1981: 450f.) lobt an der werkimmanenten Kritik: »In der Literaturwissenschaft bereitete die Wiederentdeckung jenes Prinzips ein genuines Verhältnis zum ästhetischen Gegenstand überhaupt erst vor, wider eine genetische Methode, welche die Angabe der Bedingungen, unter denen Dichtungen entstanden, der biografischen, der Vorbilder und sogenannten Einflüsse, mit der Erkenntnis der Sache selbst verwechselte.«
Sowohl in seiner Prosa als auch in seiner Lyrik arbeitet Benn mit Vorliebe mit einander entgegengesetzten Begriffen. Decker (2008: 364) verweist auf die bei Benn typische Ambivalenz, »die Verschmelzung eines jeglichen mit den Gegenbegriffen«. In Epilog und Lyrisches Ich macht Benn selbst auf die ›Einerseits‹ – und ›Andererseits‹-Struktur seines Denkens aufmerksam (III: 130). Und Lethen (2006: 243) schreibt, im Roman des Phänotyp (IV: 392f.) habe Benn die Legierung von ›Gegenbegriffen‹ als eine Schreibtechnik erläutert, mit der er dem ›Zeitzerbrochenheitsempfinden‹ seiner Generation zum Ausdruck verhelfen wollte. Und so wundert es einen nicht, wenn Benn in einem Brief vom 19.V.48 an Oelze über die Statischen Gedichte, die ›harmonischer‹ sind, schreibt: »Nicht mein Fall. Halte nichts davon. Gehalten an die Prosa des entschieden potenteren u. störrigen neueren Prosagehirn fallen sie als Produktion ab.« (Oelze 1945–1949: 133) In seiner schönsten Lyrik überwindet der Schöpfer den Analytiker Benn. Da gelingt ihm die größte Aufgabe des Geistes: die Wunde zum Blühen zu bringen. Schärf (2006: 117) sieht daher Benns literarische Leistung darin, dem psychologischen und mentalen Zerfall eine Sprache gegeben zu haben, deren Genauigkeit kaum zu übertreffen sein dürfte.
Warum drücken wir etwas aus?
Benn hat in seinen Essays und z. T. auch in seinen Gedichten immer wieder betont, dass nicht das Inhaltliche, sondern die Form das Eigentliche an einem Gedicht ist. Benn reklamiert für seine Dichtung »ein mittelmeerisches Prinzip –, das heißt, formensichernd denken« (IV: 361). Form ist schwere Arbeit: In dem Gedicht Der junge Hebbel schreibt Benn: »Ich schlage mit der Stirn am Marmorblock / die Form heraus.« Ähnlich wie der Bildhauer den Marmorblock bearbeitet, bearbeitet der Dichter mit der Stirn den Satz. Dagegen wertet er das Inhaltliche ab, bewusst provokativ gegen die politischen Schriftsteller der Rechten und der Linken, die den Dichter zur politischen Stellungnahme oder ideologischer Propaganda verpflichten wollen.[6] Das Inhaltliche, meint er, ist in unserem Kulturkreis bereits hinreichend »gesprochen und durchgearbeitet«, oder wie er in Satzbau sagt: ›Alle haben den Himmel, die Liebe und das Grab, / damit wollen wir uns nicht befassen‹ (I: 238; vgl. VII/I: 283) – die immer wiederkehrenden Themen der Natur, der Liebe und des Todes sind seiner Meinung nach in der Lyrik des Abendlandes mehr als ausreichend besungen worden. Zwar zitiert Benn immer wieder Elemente der Wahrnehmung, des Wissens, und vor allem der kulturellen Tradition und des Mythos, aber diese Elemente werden in das Gedicht montiert, ohne dass dadurch eine zusammenhängende Geschichte entsteht. Die alten Mythen werden noch beschworen, aber in einem abstrakten Sprachraum, in dem sie ihre Gültigkeit und Glaubhaftigkeit verloren haben. (Wodtke 1963: 176f.) Dennoch, für Benn sind Mythen keine bloßen Fantasien. Im Mythos ist immer ein Kern wirklicher Erfahrung. Der Leser erfährt die Bruchstücke des formalen Mythos in den Gedichten als imaginären Weltersatz, der alles enthält, was über die Welt gesagt werden kann und daher absolut ist. (Pellmann 1995: 151) Man könnte sagen, Benns Verweise seien abstrakt, da er solche Mythenzitate aus den Bindungen der Sprache und einer durch Sprache referierte Wirklichkeit loslöst, und damit auch die kommunikative Funktion der Sprache verlässt. Aber Kunst für Benn ist Form und hat nichts mit Inhalten oder Bekenntnissen zu tun.
In Kunst und Drittes Reich (1941) notiert Benn, auch gegen die Anfeindungen der Nationalsozialisten (die er allerdings 1933/34 für eine kurze Zeit unterstützte): »Singen – d. h. Sätze bilden, Ausdruck finden, Artist sein, kalte einsame Arbeit machen, dich an niemanden wenden, keine Gemeinde apostrophieren, vor allen Abgründen nur die Wände auf ihr Echo prüfen, ihren Klang, ihren Laut, ihre koloraturistischen Effekte, […] der tiefe substanzielle Verfall. Dies verlieh andererseits der neuen Kunst ein großes Gewicht: hier wurde im Artistischen die Überführung der Dinge in eine neue Wirklichkeit versucht. […] Die entscheidenden Dinge in die Sprache des Unverständlichen erheben; sich hingeben an Dinge, die verdienten, daß man niemanden von ihnen überzeugt.« (IV: 278f.)[7]
Deswegen ist Benn auch von den üblichen Fragen in Interviews und von Lesern irritiert. In einem Brief an Oelze vom 3.III.49 beschwert sich Benn: »Immer wieder die Fragerei: ›wie meinen Sie das, ich verstehe das nicht – –‹ usw. Kunst oder Geist ist nicht zu verstehen, sie hinterlassen Eindrücke u. streuen Keime aus.« (Oelze 1945–1949: 187)
Benn verweigert dem Leser Beschreibung und Erzählung und Informationen über Ort, Zeit und Handlung. Die Rezeption des Eigentlichen geht über ästhetische und assoziative Kanäle. Wenn die Zeichen keine eindeutige Bedeutung mehr haben, sind sie umso stärker interpretierbar und der Leser kann sie im Kontext des von ihm Erlebten und Gewussten deuten. Die Frage ist, ob es dann einen endgültigen Textsinn überhaupt geben kann, ob die durch die Lektüre angeregte Imagination des Lesers überhaupt noch einen Bezug zu seinem Leben herstellen kann, oder ob die Lektüre nur ein rauschhaftes Erlebnis ist, ähnlich dem des Künstlers selbst, wie Benn es immer wieder beschrieben hat.[8] Am ehesten hat das Lesen des Gedichts noch einen Bezug zum rhythmisch bewegten Körperlichen.
Gegen die Vorstellung einer Lyrik nur als Form macht Buddeberg (1961: 86) allerdings zu Recht geltend, dass man nicht völlig darauf verzichten kann, dass das Wort Sinnträger ist. Und Friederike Reents (2009: 64) will ›Unverständlichkeit‹ als wesentliches Merkmal von Kunst nicht anerkennen und Benns textimmanente Warnung an etwaige Interpreten nicht akzeptieren, dass der Interpretationsversuch hier abgebrochen werden müsste. Zwischen diesen Extremen müssen wir uns also bewegen.
Schwierig, schwer verständlich und oft beinahe unverständlich sind manche Gedichte allerdings. Benn selbst gibt zu: »Die Lyrik ist so kompliziert heute, daß sie ja kaum jemand verstehen kann.« (VII/I: 290) Im Fernsehinterview vom 3. Mai 1956 sagt Benn: »Sie sagen schwierig, Herr Koch, aber jedes Gedicht von Rang wird schwierig sein. Denken Sie an Mallarmé, an Valéry, an Eliot, an Dylan Thomas. Die Gedichte sind nicht nur schwierig, sondern sie sind so dunkel, dass man tagelang drüber nachdenken kann und erfährt doch nichts daraus. […] ich will Ihnen sagen, […] dass ein Lyriker ganz für sich lebt, in sich drin, in den Worten, zu denen er ja ein ganz anderes Verhältnis hat wie [sic!] der Prosaist. Ein Gedicht bekommt ja immer etwas Sphinxhaftes, das sich schwer deuten läßt, und es entsteht eigentlich nur ganz allein. Darum hat ja auch Rilke wahrscheinlich immer ganz allein gelebt.« (VII/I: 345) Theweleit (1994: 175) schränkt das allerdings ein: »Was auf den ersten Blick das Schwierige an solchen Zeilen scheint, beruht fast immer auf der Unkenntnis von ein paar entlegenen Wörtern«.
Im Roman des Phänotyps schreibt Benn über Dichtung: »Das unmittelbare Erleben tritt zurück. Es brennen die Bilder, ihr unerschöpflicher beschirmter Traum. Sie entführen. Der körperliche Blick reicht nur über den Platz bis an die Burgen, – aber die Trauer reicht weiter, tief in die Ebene hinein, über die Wälder, die leeren Hügel, in den Abend, das Imaginäre, sie wird nicht mehr heimkehren, dort verweilt sie, sie sucht etwas, doch es ist zerfallen, und dann muß sie Abschied nehmen unter dem Licht zerbrochener Himmel –, diese aber entführen, führen weit und führen heim.« (IV: 406)
Was den Lyriker vom Romancier unterscheide, sei, so Benn in Lyrik, dass er keine ›Stoffe‹ braucht: »Wenn der Romancier Lyrik macht, braucht er Vorwände dafür, Stoffe, Themen, das Wort als solches genügt ihm nicht.« (IV: 356) Benn betont immer wieder, dass der schöpferische Mensch einsam ist und dass Geschichte für ihn nichts bedeutet. Meyer (1979: 402) verweist auf das Gedicht Qui sait (I: 76), wo Benn aus der überschauenden Distanz durch parodistisch-satirische Wortmontage und antwortlose rhetorische Fragen die Absurdität der Geschichte bewusst macht. Wer weiß, welchen Sinn das alles hat: ›Aber der Mensch wird trauern – / solange Gott, falls es das gibt, / immer neue Schauern / von Gehirnen schiebt / von den Hellesponten / zum Hobokenquai, / immer neue Fronten – / wozu, qui sait?‹
Politik und Staat sind ihm gleichgültig, solange sie ihn nicht zerstören. »Wer gähnt noch nicht, wer ist noch nicht entflohn? Wer sieht noch nicht das Kasuistische der Schlachten, die Rhythmik der Katastrophen und der Kriegshistorie zirkuläres manisch-depressives Irresein? Fades Da capo! Die Idee der Geschichte!« (III: 98) Das ist alles ephemer, es wird in kurzer Zeit nicht mehr als eine halbe Seite eines Geschichtsbuchs oder auch nur eine Fußnote zum Text ausmachen. Dafür hat er nur Verachtung übrig: »DER INHALT DER GESCHICHTE: Um mich zu belehren, schlage ich ein altes Schulbuch auf, den sogenannten kleinen Plötz: […] Ich schlage eine beliebige Seite auf, es ist die Seite 337, sie handelt vom Jahre 1805. Da findet sich: 1 × Seesieg, 2 × Waffenstillstand, 3 × Bündnis, 2 × Koalition, einer marschiert, einer verbündet sich, einer vereinigt seine Truppen, einer verstärkt etwas, einer rückt heran, einer nimmt ein, einer zieht sich zurück, einer erobert ein Lager, einer tritt ab, einer erhält etwas, […] –, alles dies auf einer einzigen Seite, das Ganze ist zweifellos die Krankengeschichte von Irren.« (IV: 298f.) Benn würde die Beschreibung der Sinnlosigkeit der Geschichte des Gegenrevolutionärs Louis de Bonald sicher unterschreiben, wenn der sagt: der Weg der Menschheit durch die Geschichte gleicht einer Herde von Blinden, geführt von einem Blinden, der sich an einem Stock weitertastet. (Zit. Schmitt 2009: 60)
Schmiele (1979: 369ff.) stellt das Gedicht dem Erleben gegenüber: »Denn das Gedicht ist. Das Erleben dagegen, aus dem es aufsteigt, läßt sich, als das Ungestaltete, Amorphe, Ungreifbare und Flüchtige, ebenso gut als Erleben des Seins wie als Erleben des Nichts ansehen.« Wobei bei ihm sowohl das ›Sein‹ als auch das ›Nichts‹ undefiniert bleiben. Benn, so meint Schmiele, verleihe den Dingen durch diese Behandlung von Sprache und Wirklichkeit eine neue, träumerische Existenz, eine zweite, nun eigentliche Wirklichkeit, in der ihr zeiterlöstes Sein aufleuchte. Die Frage bleibt dabei offen, was das ›Sein‹ als Gegenbegriff zur Wirklichkeit bei Benn ist.
Friederike Reents (2009: 61) sieht in Benns Werk den Versuch, Kunstwerke für unentschlüsselbar zu erklären, und eine textimmanente Absage an jeglichen Interpretationsversuch. Benn selbst fordert, nimm dem Text nicht seinen Glanz, indem du versuchst ihn zu enträtseln, und damit entzauberst. Der Text selbst setzt eine Grenze, über die man nicht hinaus interpretieren darf, oder wie Rilke am 23. April 1923 an seine Frau schrieb: »Wo ein Dunkel bleibt, da ist es von der Art, dass es nicht Aufklärung fordert, sondern Unterwerfung.« Das erinnert an Susan Sontags Essay: Against interpretation (1961), in dem sie gegen die Hermeneutik der Kunst eine Erotik der Kunst fordert. Man könnte sagen, Benns Auffassung von Dichtung nähere sich der von Nietzsche, Schopenhauer und Heidegger an, die Dichtung als ethisch-metaphysischen Dienst am Sein verstehen. Hillebrand (1979b: 409) sieht hier vor allen den Einfluss Nietzsches und sagt, dass der Einfluss Nietzsches am stärksten in Verbindung mit einer provokativen Betonung der formalen Beschaffenheit der Kunst in Erscheinung trete. (Vgl. auch Horn, A. 1994: 135–152; Horn A. 2000)
Über Benns Gedichte schreibt Emmerich (2006: 67): »Der Leser gerät in ihren Sog nicht nur durch die faszinierend montierten fremdartigen Einzelwörter, es ist ihr Zusammenklang, es sind Rhythmus und Reim, die ihn suggestiv einspinnen.« Natürlich ist deshalb Benns Gedicht nicht völlig ohne Inhalt. »Inhalt erhält die absolute Dichtung sowohl in ihrem literarischen internen Raum als auch durch dessen Struktur.« (Pellmann 1995: 144) Als Anhänger Nietzsches weiß Benn, dass es in der Sinnlosigkeit des Seins und dem Nihilismus der Moderne nur die Sprache ist, die das Bild, das wir uns von der Welt machen, zusammenhält. Aber gerade dieses Bild von der Welt will er auch immer wieder sprengen. Gegen die Darwinisten unter den Biologen und unter den Soziologen negiert er den Begriff der ›Entwicklung‹ und setzt daher eher auf Substantive als auf Verben. Deren Suggestion, dass sich etwas bewegt, verändert, tätig ist, ist ihm verdächtig. Er bevorzugt in seinen Gedichten Substantive: »Worte, Worte – Substantive! Sie brauchen nur die Schwingen zu öffnen und Jahrtausende entfallen ihrem Flug.« (III: 133; IV: 180; VI: 26) Er vertritt gegen Darwin die Auffassung, dass »der Mensch nicht abstammt, sondern von Anfang an war, und daß er eine neue Schöpfungssituation darstellt. Das Wesen dieser Situation ist Bewußtsein und Geist.« (VI: 38)
SATZBAU (I: 238)
Gegen inhaltliche Fragen erhebt Benn den ›Satzbau‹ zum zentralen Anliegen des Dichters. Benn sagt in dem Interview, Wozu Dichter in dürftiger Zeit: »diese Frage nach dem Satzbau ist eine Spezialfrage meiner Generation. Uns ist eben die Frage des formalen Aufbaus […] besonders ins Bewußtsein getreten.« (VII/I: 283) Entschieden stellt er fest: »Unsere Ordnung ist der Geist, sein Gesetz heißt Ausdruck, Prägung, Stil. Alles andere ist Untergang.« (VI: 37) Nicht was oder worüber einer dichtet, sondern wie – in welcher Sprache und in welcher Anordnung der Wörter und in welcher sprachlichen Struktur er das tut, – wird zur eigentlichen Aufgabe des Dichters: ›Was aber neu ist, ist die Frage nach dem Satzbau / und die ist dringend‹. Die Frage ist also: ›warum drücken wir etwas aus?‹ Was ihm wichtig ist, ist das ›Wort als Ausdrucksfaktor‹, wie er in den Gedicht Der Stadtarzt (I: 86) schreibt; er weiß aber selbstironisch, das ist ›gänzlich anomal‹.
Benn stellt sich die Frage: ›Warum reimen wir oder zeichnen ein Mädchen / direkt oder als Spiegelbild / oder stricheln auf eine Handbreit Büttenpapier / unzählige Pflanzen, Baumkronen, Mauern‹. Es ist auffällig, dass Benn, der Dichter, seine Beispiele fast ausschließlich aus dem Bereich der bildenden Kunst nimmt, aber auch, wie er etwas Alltägliches, die Mauern, verfremdet und unheimlich ›als dicke Raupen mit Schildkrötenkopf / sich unheimlich niedrig hinziehend / in bestimmter Anordnung‹ darstellt. Benn selbst räumt ein, die Frage nach dem Grund, warum ein Mensch Gedichte schreibt, ist ›Überwältigend unbeantwortbar!‹ Am Geld kann es nicht liegen, meint er selbstironisch, denn der Beruf des Lyrikers ist wenig einträglich: ›Honoraraussicht ist es nicht, / viele verhungern darüber.‹ In Summa Summarum (III: 162) rechnet Benn vor, wie wenig er selber als Dichter verdient hat: in 15 Jahren 975 Mark und meint: »Wer einen Gedichtband veröffentlicht hat, soll nicht erwarten, dass ihn die Nation dafür erhält.« (VII/II: 258) Auch das Bewusstsein und die Rationalität spielen eine geringe Rolle bei der Produktion von Lyrik und Kunst im Allgemeinen: ›Nein, / es ist ein Antrieb in der Hand, / ferngesteuert, eine Gehirnlage‹, etwas Unterbewusstes wie eben die Hand vom Gehirn nur unterbewusst gesteuert wird. Etwas Archaisches oder Mythisches zudem, ›vielleicht ein verspäteter Heilbringer oder Totemtier.‹ Ähnlich spricht er in Ach, das ferne Land (I: 177) über: ›frühe Mechanismen, / Totemfragmente / in die weiche Luft‹ als Antrieb zur Herstellung von Kunst. Die Produktion von Gedichten ist also jedenfalls ›auf Kosten des Inhalts ein formaler Priapismus‹, eine Reaktion, die nicht bewusst kontrolliert werden kann und die schmerzhaft ist, aber der Schmerz ›wird vorübergehn‹. Noch einmal betont er: ›aber heute ist der Satzbau / das Primäre.‹ Und er beruft sich dabei explizit auf Goethe: »›Die wenigen, die was davon erkannt. –‹ (Goethe) / wovon eigentlich? / Ich nehme an: vom Satzbau.« Benn beruft sich auch in Probleme der Lyrik und Altern als Problem für Künstler auf Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre, wo es heißt: »auf ihrem höchsten Gipfel scheint die Poesie ganz äußerlich« (VI: 15, 146). Benns Überzeugung ist also, der Satzbau, Rhythmus und Klang machen das Gedicht aus, und nur wenn der prosaische Inhalt so verändert wird, wird er zum Gedicht.[9] In Provoziertes Leben heißt es daher: »Im Rhythmus lag letzten Endes das Weltgeschehen« (IV: 313). Und in Probleme der Lyrik schreibt Benn: »Lyrik wird daraus nur, wenn es in eine Form gerät«, warnt aber gleichzeitig: »eine isolierte Form, eine Form an sich gibt es ja gar nicht« (VI: 21).[10] In Doppelleben schreibt er aber kategorisch: »Aber was Sie nicht ausdrücken, das ist nicht da.« Auch in Probleme der Lyrik ist er überzeugt, dass »es in der Kunst nichts Äußeres gibt« (VI: 17). Und in Natur und Kunst (IV: 360) dekretiert Benn: »Oberstes Gesetz wird die Anordnung, das Inhaltliche der Fakten bleibt am Rande«. Ulrike Draesner (2006), selbst eine bedeutende Lyrikerin, hat in diesem Zusammenhang einen wesentlichen Aspekt von Benns Poetik hervorgehoben: »Benns Gedichte sind eindringliche Rhythmus- und Klangmaschinen. Sie setzen radikal an, lösen alte Formen, beginnen, das Ich zu sezieren, in Bilder zu heben. Ihre Stärke, über Jahrzehnte, wird sein: sie bleiben in Bewegung.« (Zit. Schütz 2007: 152) Benn selbst sagt in Probleme der Lyrik, dass »in der Lyrik das Mittelmäßige schlechthin unerlaubt und unerträglich ist« und dekretiert: »Lyrik muß entweder exorbitant sein oder gar nicht« (VI: 19).[11] Das Gedicht muss ›faszinierend montiert‹ sein, ›interessieren‹, ›erregen‹.
Man könnte Benns Verfahren des (oft versteckten) Zitierens und Montierens als eine Form der Intertextualität auffassen.[12] In Schöpferische Konfession (III: 109) beschreibt Benn das so: »Mich sensationiert eben das Wort ohne jede Rücksicht auf seinen beschreibenden Charakter rein als assoziatives Motiv und dann empfinde ich ganz gegenständlich seine Eigenschaft des logischen Begriffs als den Querschnitt durch kondensierte Katastrophen.« In Probleme der Lyrik zitiert er Mallarmé: »Ein Gedicht entsteht nicht aus Gefühlen, sondern aus Worten« (VI: 23).[13] Das Gedicht – so im Vortrag in Knokke – »entsteht nicht in einem weinerlichen Gemüt bei Sonnenuntergangsstimmung, es entsteht durch Bewußtheit, es ist ein Kunstprodukt, es wird gemacht.« (VI: 76) Fritz Martini (1970: 494) beschreibt Benns rauschhaft mythische und von Benn ›hyperämisch‹ [= bluterfüllt] genannte Sprache als ein Benennen, das ein Element des magischen Hervorrufens enthalte. Es sei zugleich Montage und Intuition. In diesen heterogenen Namen liege eine intellektuelle Symbolik, aber auch die Annäherung zum Bildhaften, Imaginativen. Jeder Name beschwöre eine ganze Welt. Unverbunden stehen die Worte nebeneinander. Darin liege der Ausdruck ihrer Spontaneität und Simultaneität. Das Wort sei aus den zeitlichen Zuordnungen herausgenommen und in ein Zeitloses hineingerückt, und so stehen Substantiva in ihrer Zerstreuung explosiv wie Absoluta da.
Raddatz (2006: 233) betont dementsprechend: »Der ästhetische Kodex des Nicht-Bedeutens entsprach dem moralischen Gebot des Nicht-Benennens.« Bei Benn, so Schärf (2006: 309), existiert der Phänotyp als ein Entgrenzungsphänomen in Bildräuschen, die durch endogene Steigerungen erzeugt werden. Das ist in Kürze auch Benns Programm des provozierten Lebens. Man muss mit sich experimentieren, vielleicht durch Drogen den Oberbau des Bewusstseins lockern, damit der Grundstock der Psyche wieder frei wird.[14] Die Faszination durch die Sprache, den ›Satzbau‹, führt zur Souveränität als Ziel des Dichtertums. Die Faszination ist das »eigentliche Kriterium der Macht: der Wille zur Form als die Antwort auf die machtpolitische Frage: ›Wer spricht?‹.« (Schärf 2006: 53)
Friederike Reents (2009: 331) meint aber, so neu, wie Benn behauptet, sei die Frage nach dem Satzbau, also der Form, bei Benn nicht, und Schärf (2006: 32) sagt zu Recht, der Satzbau sei eigentlich als linguistische Größe zu verstehen. Benn mache aber daraus eine Fundamentalkategorie des künstlerischen Ausdruckswillens. Schärf kritisiert Benn daher: »Das Raunen vom Satzbau hat Anfang der fünfziger Jahre als Zitat einer genuin modernistischen Poetik auch schon etwas von Satire.« Aber vielleicht missversteht er, was Benn mit ›Satzbau‹ meint, – nicht Grammatik sondern das Bauen von faszinierenden Sätzen aus Wörtern mit einer Aura.
Mit Benns Haltung hatten vor allem politisch engagierte Dichter, sowohl rechts als auch links Probleme: Reichel (1979: 336) z. B. kritisiert an Benn, er drücke nur sich selbst aus, der expressive Stil montiere willkürlich, die Bilder verhüllen, die Worte sind ambivalent, das Gedicht gebe keine unmittelbare Information mehr ab. Reichel (1979: 336) nennt das Benns ›Formalismus‹: Benn verfahre nach dem Rankengesetz des ›freien Spiels‹, kenne deshalb nur den musikalischen, rhythmischen, assoziierten Zusammenhang, und ziele auf Faszination durch artistischen Ausdruck bei völliger Zweckfreiheit. Reichel findet, unter diesen Umständen sei das Gedicht keine Mitteilung, sondern Monolog.[15] Das allerdings ist gerade Benns Absicht, Gedichte zu schreiben, die Monologe sind. Auch Meyer (2007: 191) charakterisiert Benns Beziehung zu seinen Lesern und der Gesellschaft als nicht kommunikativ, sondern monologischer Art. Die Einsamkeit solle nicht in einem intersubjektiven modus vivendi aufgehoben werden, sondern sie solle im Einsamen die Reflexion auf das eigene Selbst und kreative Impulse auslösen. Benn sieht sich als einen, der sich selbst begegnet ist, im Sinne der Aussage: »Die ganze Menschheit zehrt von einigen Selbstbegegnungen, aber wer begegnet sich selbst? Nur wenige und dann allein.« (VI: 40) Diese Selbstbegegnungen sind schmerzhaft: »wir müssen in ein dunkleres Reich hinab – vielleicht ist es nur der Drang, qualvolle innere Spannungen, Unterdrücktheiten, tiefes Leid in monologischen Versuchen einer kathartischen Befreiung zuzuführen.« (VI: 45)
Benn nennt das dabei angewandte Verfahren auch Vermittlung. Dieter Wellershoff[16] hat diese Tatsache erkannt, und beschreibt sie wie folgt: »In der Formel ›Süden, Hirt und Meer‹ bedeuten aber die einzelnen Worte nicht jeweils etwas anderes. Wer Benn so additiv zu lesen versucht, mißversteht ihn, setzt wieder den unangemessenen Maßstab der Begriffssprache voraus. Hier gehen die Worte, die sich gegenseitig rufen, ineinander über, überdecken sich, fließen zusammen zu einem Bedeutungsfeld. Man muß solche Worthäufungen auffassen als eine einzige Beschwörungsformel, die einen unmittelbaren Erlebniskomplex zu bannen versucht.« (Zit. Pellmann 1995: 38)
Die Frage ist allerdings, worin die Ursprünglichkeit eines Künstlers bestehen könnte, wenn sie für alle Künstler und notwendigerweise und immer durch Sprachkonvention und konventionelle Metaphorik verstellt und unmöglich gemacht wird. Und was genau ist die Urspünglichkeit der Dinge jenseits von Sprache und Metapher? Pellmann (1995: 70) sieht Sprache als das erstrangige menschliche Erkenntnismittel zur Erschließung der Welt. »Daß diese Zugänglichmachung immer nur annähernd und symbolisch geschieht, ist grundlegend; die Entschlüsselung der Welt bleibt stets auf der Ebene der Darstellung und Bedeutung.«
Das Gedicht selbst ist im Parlando-Stil geschrieben, fast prosaisch. Die erste und zweite Strophe enden in einer Frage: ›warum drücken wir etwas aus?‹ Und ›Warum reimen wir … in bestimmter Anordnung?‹ Die dritte und vierte Strophe enden mit einer bestimmten abschließenden Antwort, der Aussage: ›aber heute ist der Satzbau / das Primäre‹ und ›Ich nehme an: vom Satzbau‹. Das Gedicht führt also selbst den ›Satz-Bau‹ als Gestaltungselement vor.
EIN WORT (I: 198)
Das schöpferische Wort ist für Benn der Schlüssel zur Welt: »Im Anfang war das Wort, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht – sicher nicht das Wort, mit dem man einkauft u. politisch redet, das beschwörende, das schöpferische Wort, es hält die Erde zusammen.« (VII/II: 10) Benn geht es wesentlich um »das Gesetz eines Aufbaus des Seins vom Formalen aus« (IV: 36).[17] »Die Formen – darauf allein kommt es an, das ist seine Moral.« (V: 150) Buddeberg (1962: 32) meint, bei Benn werde die ›Chiffre, ihr gedrucktes Bild, die schwarze Letter‹ als auslösendes Moment des schöpferischen Prozesses angerufen. Für Benn ist nicht nur Klang und Rhythmus sondern auch das Bild der gedruckten Wörter auf der Seite ein wesentlicher Bestandteil der Ästhetik des Gedichts.
Steinhagen (1969: 154) meint das Gedicht Ein Wort stellt das dichterisch geformte ›Wort‹, also im Grunde das Gedicht selbst, im Augenblick seiner Entstehung dar. Es geht Benn um Wort und Satz, und die sind im Gedicht ›linguistisch‹ verschlüsselt, sind ›Chiffren‹. Dieses Verschlüsselte[18] und daher nicht unmittelbar Verständliche tritt dennoch plötzlich in Erscheinung, ist erkanntes Leben, jäher Sinn. Das Erkennen geschieht unvermittelt in einem sinnschaffenden Augenblick. Erzählt wird im Gedicht kein Ablauf, keine Geschichte, alles ist ›statisch‹, steht still, die ›Sonne steht‹, die ›Sphären schweigen‹. Das Gedicht ist eine ungeheure Konzentration von Energie: ›und alles ballt sich zu ihm hin.‹
Alle Kunst geht von der tragischen Situation des Menschen aus: Der Mensch ist verloren in einer ungeheuren Leere und einer dunklen Sinnlosigkeit, er ist ›im leeren Raum um Welt und Ich.‹ (I: 198)[19] Nur durch das dichterische Wort wird dieses ›Dunkel, ungeheuer‹ für einen kurzen Augenblick erhellt, durch ›Ein Wort – ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, / ein Flammenwurf, ein Sternenstrich –‹, aber dann tritt ›wieder Dunkel, ungeheuer‹ ein. Pellmann (1995: 134) sieht hier einen zeitgenössischen Mythos im Entstehen: »Das Ich am Ende des Gedichtes und seine existenzielle Leere, sein Dunkel, es wird zum Ausgangspunkt der Bildung von Mythos, denn es erlebt die Dinge entleert, bedeutungslos; die Welt und seine eigene Identität sind leer.«[20] Und Schärf (2006: 328) sieht das Wort als magischen Gegenstand inmitten der Dunkelheit und Leere des Universums.
Es geht hier, wie Benn in Ausdruckswelt schreibt, um die »Gebilde der Kunst, die nur sich selber sagen« (IV: 341), aber ein Leuchten verbreiten. In Schöpfung (II: 66), einer Vorform von Ein Wort geht Benn vom Schöpfungsmythos aus, wo in ›six days‹ der Mensch, ›das erste Ich‹, zu sich kommt und ›das erste Wort‹ spricht, nachdem er vorher nur einer der ›Schluck- und Schreiverdammten‹, der wortlosen Tiere war. Das geschieht als der Mensch sich ›Aus Dschungeln, krokodilverschlammten‹ befreit: ›Ein Wort, ein Ich, ein Flaum, ein Feuer, / ein Fackelblau, ein Sternenstrich – / woher, wohin – ins Ungeheuer / von leerem Raum um Wort, um Ich.‹
Das Gedicht Ein Wort ist für Benns Verfahren typisch und referiert die wesentlichen Elemente und Probleme des mythischen Wortes. (Pellmann 1995: 134) Nicht alles Inhaltliche wird vernichtet, es bleibt doch der Raum, ja die Räumlichkeit der Welt übrig, letzten Endes auch die der Worte. »Der Wortraum nimmt die Stelle des tatsächlichen Existenzraumes ein, das Ich lebt in den Worten und Formen.« (Ebd.) Was übrig bleibt, ist allerdings ›leer‹ und ›dunkel‹. Nur die Dichtung wirft blitzartig Licht ins Dunkel, die Dichtung schafft Sinn in der Sinnlosigkeit. Bedeutung wird nur durch die Worte geschaffen, diese Bedeutung erscheint als jäher Sinn, neue Lebenszusammenhänge zeichnen sich flüchtig darin ab. Übrig bleibt die rauschhafte Entgrenzung und die chiffrenhafte Eröffnung neuer mythischer Bedeutungsräume und das Ich inmitten seiner Formen und Worte. »Wort und Raum, absolute, konsequente Form und die ich-immanente Bedeutungsbildung sind die Folge davon.« (Ebd.)
Kreatives Schaffen impliziert – so die Akademierede von 1932 – eine »antihistorische Tendenz«. In Zum Thema: Geschichte stellt Benn ein Verstehen der Geschichte grundsätzlich in Frage: »Wir wissen nicht im Entferntesten, was gespielt wird, universal gesehen, wer oder was wir überhaupt sind, woher und wohin« (IV: 302). Allerdings müsse der Lyriker sich orientieren, wo die Welt heute halte. Das geschichtliche Bewusstsein, das Benn hier im scheinbaren Widerspruch zu seinem Ahistorismus vom Dichter fordert hat lediglich den Zweck, die stofflichen Gegebenheiten zu vergegenwärtigen, die der Dichter zur Formung seiner denaturierten Welt braucht. »Für jedes neue Gedicht ist eine neue Balance zwischen dem inneren Sein des Autors und dem äußeren, dem historischen, dem sich mit dem Heute umwölkenden Geschehen.« (VI: 83) Mit dem Nazistaat, in dem Aufsatz Der neue Staat und die Intellektuellen (1933), wird für ihn ausnahmsweise Geschichte für eine kurze Zeit sinnvoll, und so widerspricht er sich selber: »es gab niemals eine Qualität, die außerhalb des Historischen stand. […] Immer prägte die Geschichte den Stil, immer war dieser Stil die Verwirklichung eines neuen historischen Seins«.[21] Aber diese positive Sicht der Geschichte dauert nicht lange: Schon 1934 spricht Benn wieder über die Ausdruckswelt. Dieser Begriff fasst Benns Auffassung vom Dichter zusammen. Was Benn Ausdruckswelt nennt, besteht zu großen Teilen aus der Rekonstruktion der nietzscheschen Artistik als frei montierende Satzbaukunst. (Schärf 2006: 324)
Dyck (2006: 210) behauptet über Benn in den dreißiger Jahren, die große Klammer seiner Gedanken dieser Jahre bildete die Frage nach der Geschichte, ihrem Sinn, ihrem Verlauf. Er stellte sich die Frage: Womit konnten eigentlich die weißen Völker ihren Herrschaftsanspruch legitimieren? Wer machte Geschichte? Eben jene Vertreter der weißen Rasse, die im Weinhaus Wolf am Nebentisch saßen und sich durch nichts auszeichneten als durch »Genuß, wippiges Lachen, Niederkämpfen der Konkurrenz, wirtschaftliche Triumphe«.
Es geht Benn aber vor allem um den Rausch als einen »aufs höchste gesteigerten, meist als beglückend erlebten emotionalen Zustand.« (Reents 2009: 151) In Zur Problematik des Dichterischen verweist Benn in diesem Zusammenhang auf indische Lehren: »Es geht eine Lehre durch die Welt, uralt, die Wallungstheorie. In Indien sehr zu Hause, Brahman bedeutet die Ekstase, die Schwellung des Gemüts […] er halluziniert, erblickt das Reale, er betet, bekommt Macht über die Götter« (III: 244). Benn behauptet weiter: »Wir tragen die frühen Völker in unserer Seele, und wenn die späte Ratio sich lockert, in Traum und Rausch, steigen sie empor mit ihren Riten, ihrer prälogischen Geistesart und vergeben eine Stunde der mystischen Partizipation.« (III: 271) Ulrich Meister (1983: 43) folgert daher, es sei sinnvoll, in diesem Zusammenhang von Mythopoiesie zu sprechen und nicht von Mythus. Denn es geht weder um die Nacherzählung bestehender Mythen noch um die Schaffung neuer, sondern um ein ästhetisches Verfahren, das die Bestände des Mythus als Reservoir für dichterische Themen verwendet, als Erlebnisäquivalente und Evokationen nutzen kann. Pellmann (1995: 70) erinnert daran, dass Mythos Sprache ist und fragt daher, welche sprachlichen Funktionen der Mythos übernimmt oder sogar in die Sprache als mögliches Subsystem einbringt.[22]
GEDICHT (I: 281)
Benn insistiert auf dem gedruckten typografischen Bild als einem wesentlichen Bestandteil des Gedichts: »Ein modernes Gedicht verlangt den Druck auf Papier und verlangt das Lesen, verlangt die schwarze Letter, es wird plastischer durch den Blick auf seine äußere Struktur, und es wird innerlicher, wenn sich einer schweigend darüber beugt.« (VI: 41) Und Buddeberg (1962: 32) ergänzt: »›Die Anordnung der Worte auf dem Papier, der von sprachlichen Zeichen freigelassene Raum‹ ist zu bedenken. […] plötzlich wird die ›Chiffre, ihr gedrucktes Bild, die schwarze Letter‹ als auslösendes Moment des schöpferischen Prozesses angerufen.« (Siehe IV: 179)
Das Gedicht entsteht hier einmal ausnahmsweise aus ›aus stillem trauernden Gefühl‹,[23] und die Motivation für seine Herstellung sind ›Zwänge‹ und ›Dränge‹, also etwas nicht Willentliches, Gewolltes, sondern etwas, zu dem man gezwungen wird – »vielleicht ist es nur der Drang, qualvolle innere Spannungen, Unterdrücktheiten, tiefes Leid in monologischen Versuchen einer kathartischen Befreiung zuzuführen« (VI: 45).[24] Bei der Formgebung kommt aber ›Kalkül‹ ins Spiel, das ist aber nicht alles, bei dem Spiel um Bild und Wort.
Das Benn’sche Gedicht entsteht »aus Einzelnem, aus Potpourri«, es entsteht gleichzeitig aus Asche und Flammen, als ein Potpourri aus scheinbar unzusammenhängenden Einzelheiten, und letztlich aus dem Nichts: ›Es strömt dir aus dem Nichts zusammen‹. Von dieser Asche und den Flammen heißt es: ›du streust und löschst und hütest sie‹. Auch hier finden wir wieder die für Benn typische Verschmelzung der Gegensätze: er hütet und löscht die Flammen gleichzeitig, das aber heißt, er kontrolliert die Emotion, die in das Gedicht eingeht, er bewahrt sie, aber er verhindert gleichzeitig, dass sie ihn zerstört.
Der Dichter weiß, er ›kann nicht alles fassen‹, er muss auswählen, aber die Auswahl ist weitgehend zufällig, muss aber andererseits in eine Form gebracht werden, umzäunt werden. Der Dichter »muß sein Gedicht abdichten gegen Einbrüche, Störungsmöglichkeiten, sprachlich abdichten, und er muß seine Fronten selbst bereinigen.« (VI: 36) Er muss das immer Unvollständige gelassen akzeptieren, auch wenn er seinem Werk gegenüber, weil es notwendigerweise unvollständig ist, misstrauisch bleibt.
Auch wenn das Gedicht ein Spiel zu sein scheint, ist es doch harte Arbeit, ›So Tag und Nacht bist du am Zuge, / auch sonntags meißelst du dich ein / und klopfst das Silber in die Fuge‹ bis er schließlich erkennt, dass das Gedicht ›das Sein‹ geworden ist, ›dann läßt du es‹.
Auch wenn er hier von ›Sein‹ spricht, ist Benn nicht an metaphysischen Konzepten interessiert. Schärf (2006: 15) erinnert daran dass Benn an Philosophie als einer Tätigkeit oder gar Disziplin nicht interessiert war. Metaphysiker war er allein als Künstler. Dennoch erklärt er: das fertige Gedicht ist das Sein, auch wenn es »Nichts und darüber Glasur (VI: 146): Form ohne Inhalt, Form als Inhalt« (ebd.: 14) ist.
Gibt es die Realität?
Wie verhält sich das Gedicht als Sprache nach Benns Auffassung also zu unserem Erleben, zu unserer Wirklichkeit? Benn schreibt: »Es gibt drei Themen, die das Jahrhundert bis heute durchziehen: die Wirklichkeit, die Form und der Geist« (IV: 181). Homscheid (2005: 91) meint, dass bei Benn die Wirklichkeit eine kontrapunktische Gegenwelt zum Geist ist, wobei die äußere Wirklichkeit von Benn als wahnhaft und nicht existent geschildert wird, während die innere Wirklichkeit des Künstlers als letzte metaphysische Instanz für ihn die wahrhaft signifikante Größe sei.[25] Gürster (1979: 12, 16) erinnert daran, dass unsere Soziologie und unsere Psychologie auf dem Vertrauen beruhen, dass die Wirklichkeit eine gesetzmäßig zusammenhängende Einheit ist, die mit dem Denken erkannt und durch das Denken beherrscht werden kann. Es gibt aber diese letzten Dinge der Wissenschaft nicht, lautet die melancholische Entdeckung des Arztes Benn. Selbst die strengen Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft schützen uns nicht vor dem Zufall, denn das Zufällige, das die Wissenschaft eliminiert zu haben glaubt, bricht von allen Seiten herein. In Probleme der Lyrik schreibt Benn zwar: »Doch will ich alles Tiefsinnige vermeiden und empirisch bleiben«. Und: »Lassen wir das Höhere, bleiben wir empirisch.« (VI: 16, 32) Aber eben diese ›empirische‹ Wirklichkeit gibt es seiner Meinung nach gar nicht. Die ›empirische‹ Wirklichkeit ist auch nur ein Wahn. Je mehr man die ontologische Unabhängigkeit der Außenwelt akzeptiert, desto mehr stirbt das Selbst ab und wird ein dünner phänomenologischer Nebel, der einen Ort von noumenalen Objekten und Ereignissen bedeckt. Andere Subjekte (›jedes DU‹) verfälschen die Form, die das Selbst angenommen hat. (Vgl. Graver 1986: 55) Allerdings gebraucht Benn das Wort Wirklichkeit nicht in einem eindeutigen Sinn. In Bezug auf Wirklichkeit denkt Benn ähnlich wie Nietzsche. In Die fröhliche Wissenschaft sagt Nietzsche (1954: Bd. 2, 77): »Es gibt für uns keine ›Wirklichkeit‹«. Dort greift er auch die Sicherheit der Realisten an, die sich in ihrer Nüchternheit »gegen Leidenschaft und Phantasterei gewappnet« fühlen. Sie glauben, so wie ihnen die Welt erschiene, so sei sie »wirklich beschaffen: vor euch allein stehe die Wirklichkeit entschleiert.« (Ebd.) Benn selbst sieht sich »entfremdet früh dem Wahn der Wirklichkeiten« und »ermüdet von dem Trug der Einzelheiten«. Er kommt zu dem Schluss: »es geht nirgends etwas vor; es geschieht alles nur in meinem Gehirn. Da fingen die Dinge an zu schwanken, wurden verächtlich und waren kaum des Ansehens wert.« (III: 26) Zugespitzt behauptet er: Mit dem Begriff ›Wirklichkeit‹ beginne das ›prämorbide‹ Stadium der europäischen Kultur. (Vgl. Decker 2008: 361) Dieser oberflächlichen Welt stellt er das »tiefe Ich« entgegen. Als Dichter muss er ›aus der Tiefe selbst‹ sein ›Schweigen nehmen‹. Er muss ›Abwärtsführen / Zu Nacht und Trauer und den Rosen spät.‹ (Abschied, I, 221) Michelsen (1979: 121) sagt daher: »In der unentrinnbar anmutenden Situation des Doppellebens hat sich Benns Grundthese gebildet, daß Kunst mit dem Wirklichen gar nichts zu tun habe.«
Benn interessierte sich daher auch für Hans Vaihingers Schrift Philosophie des Als Ob (1911), in der Vaihinger die These vertritt, dass die Begrifflichkeit von Naturwissenschaft und Philosophie falsch und fiktional seien (Homscheid 2005: 90). Vaihinger (1922: 10) schreibt: »Man mag das Verhältnis von Sein und Denken fassen, wie man will – jedenfalls lässt sich vom empirischen Standpunkt aus behaupten, dass die Wege des Denkens andere sind, als die des Seins; die subjektiven Prozesse des Denkens, die sich auf irgendeinen äusseren Vorgang oder Prozess beziehen, haben mit diesem selbst nur selten eine nachweisbare Ähnlichkeit.« Das Sein ist nicht logisch und wir dürfen »die Wege und Umwege des Denkens nicht mit dem wirklichen Geschehen verwechseln.« (Ebd.: 11) Wobei dann die Frage unweigerlich auftaucht, was an dem Geschehen ist dann »wirklich«?
Was die Wirklichkeit so problematisch und zuletzt für Benn unbefriedigend und unverbindlich macht, ist, dass sie nur eine Anhäufung unverbundener Tatsachen ist. In Ithaka sagt der Professor »Wir sind doch nicht Thomas von Aquino« (VII/I: 8) und lehnt Spekulationen über das Empirische und Wissenschaftliche hinaus ab, wird aber gerade deswegen von den jungen Medizinern angegriffen. Die Gestalt des Dr. Rönne wirft ihm vor: »sie haben es nicht vermocht, auch nur das Atom eines Gedankens aufzubringen, der außerhalb der Banalität stände« (VII/I: 10). Lutz wirft ihm vor, er verkünde eine Wissenschaft, deren Erkenntnismöglichkeit mit dem Ignorabimus schließt. Zu diesem Wirklichkeitsverlust, nicht nur der Gestalt Rönne, hat bei Benn sicherlich die zweimalige Erfahrung des Kriegs wesentlich beigetragen: »Das Geschehen lief ab. Es gab keine realen Möglichkeiten mehr, etwas zu bewirken, etwas aufzuhalten, etwas zu erreichen, etwas zu erhoffen. Die geschichtliche Welt war absurd geworden«. Benn war überzeugt, die geschichtliche Lage radikaler erfahren zu haben und illusionsloser zu sehen als die politischen Dichter und die Emigranten. Einen Sinn findet er nicht, es ist ein wüstes, kumulatives Geschehen, fatal und sinnlos. (Wellershoff 1958: 143ff.) Illusionslos schreibt Benn in DerRadardenker: »das Leben hat keine andere Bedeutung, als daß man alle vierundzwanzig Stunden einen Tag älter wird« (V: 73).[26] So ähnlich sah das seiner Meinung nach auch Shakespeares (1974: 1337) Macbeth: ›Life’s but a walking shadow, a poor player, / That struts and frets his hour upon the stage, / And then is heard no more.‹ Aus diesem Grunde bezweifelt er das rationale Denken: »Offenbar ist es mit dem intentionalen Denken vorbei. Es wird zwar weiter betrieben, es herrscht sogar ein Überangebot an Gesinnungen und Ideologien auf dem Meinungsmarkt, aber verpflichtend ist keine mehr. Nur Gewalt kann sie äußerlich verpflichtend machen« (Wellershoff 1958: 167). In Das moderne Ich (III: 105) charakterisiert Benn den modernen Menschen so: »Bewußtsein, fladenhaft, Affekte, Zerebrismen: Bewußtsein bis zur Lichtscheu, Sexus inhärent […] Erloschenes Auge. Pupille steht nach Innen, nirgends mehr Personen, sondern immer nur das Ich; Ohren verwachsen, lauschend in die Schnecke, doch kein Geschehnis, immer nur das Sein […] ohne Glauben und ohne Lehre, ohne Wissenschaft und ohne Mythe, nur Bewußtsein, ewig sinnlos, ewig qualbestürmt.« Die Frage nach der Wahrheit stellt sich Benn nicht mehr. Aber wahrscheinlich erfasst Reichel (1979: 322) etwas Wichtiges, wenn er meint, die von den Naturwissenschaften hervorgerufene Krise in Benns Verhältnis zur Wirklichkeit äußert sich spezifisch als Verlust des inneren Zusammenhangs der Welt. Aufgrund bestimmter quantentheoretischer Erkenntnisse mit ihrer Aufhebung des Determinismus der klassischen Physik kommt Benn – durch falschen Analogieschluss – zu der Auffassung, dass es auch im Sozialen und Gesellschaftlichen keine Eindeutigkeit und Kausalität gibt.
In Probleme der Lyrik unterscheidet Benn scharf zwischen »dem Denker und dem Dichter, dem Gelehrten und dem Künstler.« (VI: 29) Der Künstler »steht allein, der Stummheit und der Lächerlichkeit preisgegeben. Er verantwortet sich selbst.« (VI: 30) Daher kritisiert Reichel (1979: 323) Benn: »Erkenntnisekel und Wissenschaftsfeindlichkeit auf der einen, Irrationalismus und Selbstüberschätzung auf der anderen Seite lassen ihn im Denker den Dilettanten, im Künstler dagegen den Weisen sehen.«[27]
WIRKLICHKEIT (I: 267)
Da es keine Wirklichkeit gibt, sieht Benn die Kunst als Wirklichkeitserzeugung.[28] Das Gedicht Wirklichkeit versucht, wie wohl kein zweites, den ›transzendenten‹ Sinn und den ›Ausdruck‹ zu korrelieren. In dem Gedicht sagt Benn noch einmal: ›Eine Wirklichkeit ist nicht vonnöten, / ja es gibt sie garnicht‹. Benn insistiert immer wieder auf dieser Erkenntnis: »diese sogenannte Wirklichkeit, die stieß ihr [der Bewegung des Expressionismus] auf. Es gab sie ja gar nicht mehr« (VI: 215). Buddeberg (1961: 55) meint daher, dass ihm »eine kontinuierliche Psychologie abhanden gekommen« war. Schärf (2006: 98) sieht, die Formulierung, daß es diese Wirklichkeit nicht gäbe, als zentral in Benns Denken. »Es handelt sich dabei nicht um eine wohlfeile Zurückweisung des Realismuspostulats, nachdem wir in einer objektiv gegebenen äußeren Wirklichkeit leben. Vielmehr geht es Benn um eine Grunderfahrung des modernen Ich, um eine Auflösung seiner Einheit in unterschiedliche und inkompatible Zustände.« »Nicht die Wirklichkeit ist von der Sprache, sondern die Sprache von einer Wirklichkeit zertrümmert worden.« (Michelsen 1979: 122)[29] Das zeigt sich schon in Benns früher Prosa: »Die Unfähigkeit des Rönne, Wirklichkeit zu ertragen, ist nur die andere Seite seines Unvermögens, weiterhin noch ›Wirklichkeit zu erfassen‹. Beides setzt die Kontinuität des Ich-Bewußtseins voraus.« (Buddeberg 1961: 3) Einzige Voraussetzung für die Herstellung einer dichterischen Wirklichkeit ist für Benn, dass ›ein Mann / aus dem Urmotiv der Flairs und Flöten / seine Existenz beweisen kann.‹ Der Dichter hat ein ›Flair‹, ein Naturtalent, mit dem er sich seine Welt aus den Tönen der dionysischen Flöten und der von ihnen provozierten Ekstase erschafft. Der Künstler malt nicht die Wirklichkeit ab. Benn sagt, es geht nicht um Wirklichkeiten wie ›Olympia oder Fleisch und Flieder‹, nicht Erinnerungen an Griechisches, nicht das Fleisch des Körpers oder der getöteten Opfertiere und nicht der Duft der Blumen müssen abgemalt werden, alle Kunst kommt aus einer Art ›Trance‹, der Künstler ist ›von innen angestrahlt‹ und singt in der ›Galeere‹ ›Kettenlieder‹: vom Dichter (Cervantes) sagt Benn ›Angekettet fuhr er die Galeere[30] / tief im Schiffsbauch, Wasser sah er kaum, / Möwen, Sterne – nichts: aus eigener Schwere / unter Augenzwang entstand der Traum.‹[31] Da der Dichter im Bauch der Galeere fast nichts sieht, entsteht der Zwang, seinen inneren Augen etwas zu bieten, einen Traum. Dem Grauen der Existenz setzt er einen ›Fetisch‹ entgegen, eine Art Götzenbild, von dem er sich Linderung seiner Leiden erhofft, und seine Leiden verkörpert er in einer ›Pieta‹, seine Spiele finden auf einem gemalten ›Teetisch‹, auf dem es aber keinen ›Tee zum Trinken‹ gibt. Buddeberg (1961: 183) sieht die Irrealität dieser Wirklichkeit im letzten Vers ganz nahe, und entdeckt in diesen Versen die Ferne jeder menschlichen Beziehung, denn gemeinsam ›trinken‹, so meint sie, seit alters Handlung und Sinnbild der Kommunikation, der Kommunion, wird unmöglich.
Hähnel (1998: 24) schlägt daher vor, zu den Anfängen zurückzukehren, um die Frage nach einer zentralen poetologischen Suchbewegung zu beantworten. Damit meint er, wir müssen die Unerkennbarkeit der historischen und sozialen Welt voraussetzen und alle teleologischen Erklärungsmodelle radikal verwerfen. »Diese Unerkennbarkeit, ebenso der antiteleologische Impetus beziehen sich auf die mittels gesellschaftlicher und kulturkritischer Analytik gewonnene (im Wesentlichen ästhetische) Perspektivierung menschlichen Daseins«. Auch Schärf (2006: 168) ist der Auffassung: »Absolut nichts, so Benn, vermöge der Dichter mit den sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Jetztzeit in eine kausale Beziehung zu setzen. Denn die Kräfte, die diese Zeit bestimmen, Wissenschaft, technologischer Fortschritt, die kapitalistische Wirtschaft und die den Bedürfnissen der Besitzenden angepasste Politik, – sie alle berührten das Wesen des Dichterischen nicht.« Zynisch meint Benn in Der Ptolemäer: »Die Welt wird von den Reichen gemacht, und sie wird schön gemacht. Der Name des Stückes ist Aprèlude.« (V: 22)
Daher, so meint Schärf (2006: 355), als Künstler spalte sich der Dichter von aller Politik ab, zugleich bleibe er auf einen transzendenten Raum bezogen, aus dem er seine Energien bezieht und in den er im Gegenzug neu spirituelle Impulse einspeist. Und so kommt Schärf (2006: 214) zu der Einsicht: »Benn zielt auf eine Ethik der Form, die die leere Transzendenz an die Stelle aller Inhalte treten lässt.« In einem Brief an Oelze vom 23.III.49 beklagt sich Benn: »Die Leute wollen aus Büchern u. Arbeiten immer etwas in die Hand bekommen, eine Moral, eine Ansicht, eine Sentenz, eine ›Synthese‹. Gerade das aber will ich nicht. […] Das Wesen des Produktiven ist ein anderes als das der Soziologie, der Politik, der Geschichte.« (Oelze 1945–1949: 189) Wellershoff (1958; 49) meint deswegen, Benn sei unerschöpflich in höhnischen Angriffen gegen jede Art von sozialem Optimismus, der sich zutraut die Welt wohnlich und vernünftig einzurichten. Benns eigensinniges Beharren auf der Unheimlichkeit und Grauenhaftigkeit der Welt diffamiere alle Gedanken an Änderung, Besserung als Oberflächlichkeit. In dem Rundfunkdialog Können Dichter die Welt ändern? sagt Benn entschieden: »der Dichter hat keine Wirkung auf die Zeit, er greift in den Lauf der Geschichte nicht ein«. (VII/I: 172) Gegen die Befürworter einer sozial verantwortlichen Literatur argumentiert er: »Soziale Bewegungen gab es doch von jeher. Die Armen wollen immer hoch und die Reichen nicht herunter.« (VII/I: 176) Das sieht er als ein gewissermaßen ewiges gesellschaftliches Gesetz und sieht keine Möglichkeit das zu ändern. In Soll die Dichtung das Leben bessern? (VI: 240) sagt Benn daher: »Die Dichtung bessert nicht, aber sie tut etwas viel Entscheidenderes: sie verändert. Sie hat keine geschichtlichen Ansatzkräfte, wenn sie reine Kunst ist, keine therapeutischen und pädagogischen Ansatzkräfte, sie wirkt anders: sie hebt die Zeit und die Geschichte auf, ihre Wirkung geht auf die Gene, die Erbmasse, die Substanz – ein langer innerer Weg.« Wie das allerdings genau vor sich geht, hat Benn nicht verraten.
Auch Nietzsche (KSA I: 773) polemisierte gegen die liberale Weltanschauung: »Diesem Zweck entsprechen sie durch die allgemeinste Verbreitung der liberal-optimistischen Weltbetrachtung, welche ihre Wurzeln in den Lehren der französischen Aufklärung und Revolution, d. h. einer gänzlich ungermanischen, ächt romanisch flachen und unmetaphysischen Philosophie hat.« Benn wendet sich in harten Worten gegen den Glauben der Aufklärung, der Mensch sei gut, alle Menschen seien gleich, »gleich wertvoll, gleich stimmfähig, gleich anhörenswert in allen Fragen, nur keine Entfernung vom Durchschnittstyp.« (III: 398) Benns Beharren auf der Grauenhaftigkeit dieser Welt diffamiert alle Gedanken an gesellschaftliche Veränderungen als oberflächliche Hirngespinste eines geschichtsphilosophischen Materialismus aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, der völlig veraltet und reaktionär wie die Ideen des Kommunismus sei. Dyck (2006: 67) sieht Benn daher in einer großen Nähe zu den Vertretern der sogenannten Konservativen Revolution. Schärf (2006: 133) meint Benn habe den Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlich fundierter Weltbeherrschung und imperialen Machtanspruch, als Grund alles Übels herausstellt und das sei die Haltung des Antimodernismus, und deswegen sei Benn zu einem Feind der Demokratie geworden.
Wer Bist Du – (I: 104)
In dem Gedicht Wer bist Du spricht Benn 1924 von der grundsätzlichen Erfahrung der Mythenvergänglichkeit. Die zerbrechliche Künstlichkeit der Mythen und ihre Beziehung zu einem ästhetischen Rauscherlebnis treten augenscheinlich hervor (Pellmann 1995: 8). Die ›Mythen / zerrinnen‹. ›Chimären,[32] Leda-iten‹ sind nur für einen Augenblick, den Augenblick des anbetenden Kniefalls da. In Benns Gedichten erscheinen die Mythen nur noch als Versatzstücke, die als Erinnerungen in die Lyrik einmontiert werden können und an die Zeit erinnern, als die Mythen noch glaubwürdige Erklärungen der Welt waren. In diesem Sinn zitiert das Gedicht Ulysses als einen nun nicht mehr gültigen Mythos des Menschen, der von den Göttern verfolgt durch die Welt irrt. Aber auch wenn der Mythos nicht mehr gültig ist, hat er doch eine Funktion im Gedicht: Er spiegelt eine Erfahrung des lyrischen Ichs.
Ulysses, der von Polyphem gefragt wurde, ›Wer bist du?‹, antwortete ›Οὖτις‹, ›Niemand‹. Auf diese Weise entkommt er schließlich, als Polyphem, von Ulysses geblendet, die anderen Riesen zur Hilfe ruft. Polyphems Vater, Poseidon, der Gott des Meeres will sich an Ulysses rächen, aber Ulysses erreicht dennoch seine Heimat: ›Ulyss, der nach den Qualen / schlafend die Heimat fand.‹ Nach langer Seereise sah Odysseus die Küste des Phaiaken-Landes. Unter Verzicht auf sein zerstörtes Boot schwamm er zur Küste. Auf einem der Schiffe der Phaiaken wurde er dann reichbeschenkt pfeilschnell nach Ithaka gebracht und schlafend an der Küste der Insel abgesetzt.
Die Frage ist: ›Wer bist du‹? Wie definieren wir uns selbst, wenn die Mythen nicht mehr gelten? Einerseits nennen wir uns »Niemand«. Andererseits malen wir uns wie die dionysisch Trunkenen unsere Schläfe ›mit Blut der Beeren‹ rot, um anzudeuten, dass wir den Rausch wollen. Der wehrhafte Mann andererseits wird mit dem Lorbeer gekrönt: ›und die – des Manns Erwehren – / die nun als Lorbeer loht‹. Benn beschwört dann Medusa, ›mit Schlangenhaar die Lende / an Zweig und Thyrsenstab, / in Trunkenheit und Ende / und um ein Göttergrab –‹. In der antiken Kunst erscheint der Thyrsos[33] als Attribut häufig bei den Mänaden, gelegentlich auch bei Satyrn und Silen, dem Gott Dionysos selbst oder seiner Gattin Ariadne. Medusa bekam ihr Schlangenhaar als Pallas Athene sie in einem ihrer Tempel mit Poseidon beim Liebesspiel ertappte. Aus Rache verwandelte sie sie in ein Ungeheuer mit Schlangenhaaren, langen Eckzähnen, Schuppenpanzer, glühenden Augen und heraushängender Zunge. Der Anblick ließ jeden Mann zu Stein erstarren. Aber auch die Dichtung entstand später auf diese Weise: Als Perseus die Medusa enthauptet hatte, entsprang ihrem Körper das erste geflügelte Pferd namens Pegasos, da Medusa von Poseidon geschwängert worden war, nachdem er die Gestalt eines Pferdes angenommen hatte.
Unklar bleiben im Denksystem Benns die ›Götter‹, und daher die Aussage: »Die Götter haben sich verhüllt, sich in Schweigen gehüllt, das Sein tritt in eine verwirrende Identität mit dem Nichts.« Alles was vom Mythos in diesem Gedicht geblieben ist, ›sind hohle Leichen‹, leere Wände, ›die Wand aus Tang und Stein‹. Aber der künstlerische Schein – ›was scheint‹, – bleibt für immer – ›ist ewiges Zeichen‹. Es ist Spiel aber gerade das Spiel ›spielt die Tiefe rein‹, ein Spiel ›in Schattenflur, in Malen, / das sich der Form entwand –:‹ Benn sieht ein: »Wir können nicht zurück zur mystischen Realität der Primitiven oder zum Symbolerlebnis des mittelalterlichen Menschen.« (VII/II: 160) Aber die Kunst kann an diese Realität erinnern, sie in Worten neu erschaffen.
Benns Rückgriffe auf antike Mythen sind vor allem Rückgriffe auf das Unbewusste, das in ihnen gespeichert ist. Benn selbst sagt, er sei »mythen-monoman, religiös faszinär«. (III: 131) Allerdings sind die antiken Mythen durch das Christentum und durch die Säkularisierung und durch ihre ›Profanierung‹ in der Aufklärung ihrer Gültigkeit als Welterklärung beraubt. Benn begreift durchaus, dass »bestehende Einstellung und Vorstellung« nicht einfach fortbestehen. (Willems 1981: 88) Pellmann (1995: 8) meint, damit sei auch das Ende der antiken Mythen und ›Götter‹, der Verlust ihrer Relevanz für die Bennsche Dichtung bezeichnet. Selbst der Form, dem sie tragenden dinglichen Gefäß, entziehen sie sich. Buddeberg (1962: 63f.) stellt fest, dass in der Mehrzahl der Fälle die mythischen Geschehnisse, die griechische Landschaft und die griechischen Namen isoliert stehen. Sie erwecken eine oft nur klangliche Assoziation, Wörter, die wirklich Griechisches decken, aber Wörter, die losgelöst aus ehemaligen Zusammenhängen in seine Dichtung eingehen. Pellmann (1995: 31) unterstreicht die Problematik des Mythos in der Moderne und meint, auch Benn erkenne die Künstlichkeit des antiken Mythos und verwende nur einen gebrochenen antiken Mythos. Schließlich erfinde er explizit eigene säkularisierte und moderne Mythen durch und in der Sprache. Deswegen habe Benns Mythos seinen Sinn in sich selbst, er sei nach außen hin durch seine literarisierte Autonomie abgeschlossen. Pellmann (1995: 165) sieht den Mythos schon seit den zwanziger Jahren bei Benn in verschiedenen Variationen auftauchen, z. B. in ›Ikarus‹ der gebrochene antike Mythos, oder als künstlicher mythischer Topos [z. B. der Südkomplex]; als Alltagsmythos in ›Mythe aus Philadelphia‹; als Mythenbricolage in ›Banane‹; oder als rauschhafter, regressiver oder biologisch-anthropologisch orientierter Mythos im Rönne-Komplex.[34]
STAATSBIBLIOTHEK (I: 85)
Das Geschäft, dem sich der Dichter in der Bibliothek hingibt, in »dem ungeliebten Beruf abgetrotzten Lektürestunden« (Emmerich 2006: 68), scheint ihm ein wenig anrüchig. Es geht, wie er in den Vorbemerkung zu den Essays, 1951 schreibt, um »Materialbeschaffung für die Lyrik« (VI: 50) und für seine Essays. Er sucht Zitate für seine Bricolage.[35] Der Dichter ist – wie Schärf (2006: 69) sagt – eine vom Typus des positivistischen Wissenschaftlers abgespaltene Schattengestalt. Benn selbst insistiert in Probleme der Lyrik: »Der Lyriker kann gar nicht genug wissen« (VI: 36) Also »stürzte [er] sich geradezu in Bibliotheken und Museen, durchblätterte Zeitungen und Zeitschriften, griff Werbesprüche und Schlagerzeilen auf und montierte Versatzstücke davon in sein einem ›Fieberparadies‹ gleichendem Werk.« (Reents 2009: 338) Die ›Staatsbibliothek‹ ist ihm daher ein verrufenes Lokal, eine ›Kaschemme‹, eine Art Bordell für geschriebene Sätze – ein ›Satzbordell‹ –, ein Gefängnis für Bücher, die das Resultat wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit sind, ein Sumpfgebiet, eine ›Maremme‹, und deshalb ein ›Fieberparadies‹, wo ›die Katakomben / glühn im Wortvibrier‹.[36]
Benn selbst beschreibt die Stunde der Lyrikproduktion als Bricolage so: »Bei der Lektüre eines, nein zahlloser Bücher durcheinander, Verwirrungen von Ären, Mischung von Stoffen und Aspekten, Eröffnung typologischer Schichten: entrückter, strömender Beginn.« (VI: 25) Stierle (1971: 457) versteht die Bricolage als die Tätigkeit, Altes, das unbrauchbar geworden ist, aus seinen ursprünglichen Zusammenhängen herauszunehmen und durch einfallsreiche Kombination einer neuen Intention dienstbar zu machen. Der Bricoleur erschafft nicht aus dem Nichts, sondern indem er auf ein Arsenal von Vorhandenem zurückgreift und dieses umfunktioniert. Kennzeichen des Mythos als Bricolage, ›Bastelarbeit‹, ist es vor allem, dass er kein Referenzzentrum und Bezugszentrum mehr aufweist (vgl. Lévi-Strauss 1968: 29f.), was ihn – als Zeichen genommen – zu einem strukturierten, selbstreferenziellen, sich selbst deutenden und zunehmend interpretierenden Zeichenkomplex bzw. Makro-Zeichen macht. (Boehm 1983: 530f.; Pellmann 1995: 164) Der Dichter arbeitet im Dunkel des Untergrunds, der Katakomben, wo auch die Opferrituale stattfinden: ›und die Hetakomben[37] / sind ein weißer Stier‹. In diesem Spiel geht es um ›reinen Lustgewinn‹. Die Zeit bleibt stehen – ›wenn die Stunde stockt‹ – weil ihn im ›Vergang der Zeiten‹ in diesem Spiel ›im Satz der Seiten / eine Silbe lockt‹. Etwas, was der Vergänglichkeit widersteht, den ›Zweckgewalten‹, lockt ihn, überwältigt ihn rauschhaft, ›rauscht in Sturzgestalten /löwenhaft den Sinn.‹
Im 20. Jahrhundert – im ›Säkularen‹ – erlebt der Dichter ›tausendstimmig Blut‹, und er entdeckt einen neuen Himmel, der allerdings Opfer fordert, ›Beil und Wunde‹, in dem aber auch Nietzsches Adler wieder auflebt. Der griechische chthonische Gott Hades, und die nach ihm benannte Unterwelt, der Ort, an dem auch die ›Mütter‹[38] wohnen, – dem ›Mutterhort‹ – gewähren dem Dichter in der ›Schöpfungsstunde / traumbeladenes Wort.‹ Der Dichter erlebt »Wortschöpfungslust […] Rausch und Ekstase«. (Emmerich 2006: 68)
Ein Gedicht ist immer die Frage nach dem Ich
Die Krise des Wirklichkeitsbegriffs ist gleichzeitig eine Krise des Ichs. Die Frage ist: Kann das Ich überhaupt als einheitliches Phänomen verstanden und beschrieben werden? Ist es ein Erlebnis-Ich, ein Körper-Ich, ein Gedanken-Ich oder wie viele und welche anderen Zustände und Selbsterscheinungsweisen des Ich gibt es? (Schärf 2006: 99) Ein berühmter Satz des von Benn immer wieder zitierten Heraklit ist: εἶμέν τε και οὐκ εἶμέν. Wir sind zwar, wir sind aber auch nicht. (III: 111; vgl. auch VII/I: 185) Wenn Nietzsche sagt: »Das Ich ist ja nur eine Fiktion, es gibt das Ego gar nicht« (KSA 12: 398), dann antwortet Benn: »Wer träumt den Traum? – Das Ich ist eine späte Stimmung der Natur« (III: 242). Benn selbst sagt: »Die Einheit der Persönlichkeit ist eine fragwürdige Sache.« (IV 135f.; V: 143) Und im Sinne von Hans Vaihinger: »wir denken etwas anderes als wir sind.« (IV: 135f.) Ob Denken und Sein, Kunst und derjenige, der sie macht, überhaupt zusammengehören, lässt Benn offen.
Der Status des Ichs wird gerade in der Moderne problematisch, wie Theweleit (1994: 151) feststellt: Schon um 1900 ist ›das Ich‹ medial ›abgeschafft‹, als auch durch Medien neu geschaffen, anders, physiologischer. »Gerade einer Technik, dem Kino, wird die Kraft zugeschrieben, den Körper zu de-idealisieren, ihn zu verfleischlichen; das Ich-Gespenst wird zum Körper im Kino.« Lethen (2006: 264) meint, dass auch Benn den ›Menschen tierischer‹ gemacht hat. Benn selbst zitiert Thomas Mann zustimmend: »alles Transzendente ist tierisch, alles Tierische transzendiert