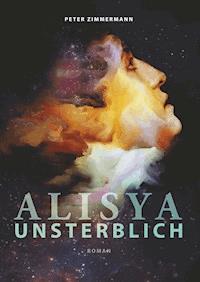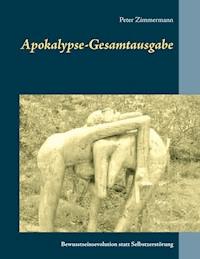Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor Tom Wasers Tür steht unerwarteter Besuch. Patrick, Toms bester Freund aus der Gymnasialzeit, ist zur Beerdigung seiner Mutter in die Schweiz zurückgekehrt. Es gäbe viel zu bereden nach fünfundzwanzig Jahren: Wie Tom einst den kleinen Achermann vom Haken nahm, Prügel einsteckte und dafür Patricks Freundschaft gewann. Wie sie an Konzerten mit Tickets handelten, im Kellerclub LSB gegen die Welt antanzten und die Rohbauten Nidwaldens besetzten. Ob Tom in New York studiert hat und Patrick Arzt geworden ist. Doch da lauert etwas Unausgesprochenes zwischen ihnen, und das Surren von Patricks Handprothese erinnert Tom an seine Schuld, erinnert ihn an Jasmin und an die Schweine mit den eitrigen Wunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Zimmermann
WAS DER IGEL WEISS
Roman
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
1
Im Winter sind die Ufer der Aare verlassen. Der Fluss, der die Berner Altstadt zur Halbinsel macht, wirkt erschöpft. Auf den Treppen, die zum Wasser führen, dort, wo sich an Sommertagen aufgeheizte Körper in Badehosen stauen, vermodert Laub.
Ich sitze auf der Bank vor dem Kanu Klub, den Kragen hochgeschlagen, die Zehen in zu großen Schuhen auf und ab wippend, und blicke zur anderen Seite. GENTECH SABOTIEREN! ist da zu lesen, mit schwarzer Farbe auf eine Betonwand gesprayt. Ich zähle die Anarcho-Zeichen, die zwischen den Buchstaben stehen. Dann schiebe ich den Ärmel meines Mantels nach hinten, sehe auf die Uhr und gebe mir noch eine Viertelstunde.
»Ich komme nach Bern«, hat er gesagt.
»Patrick?«
»Randweg 48. Stimmt das?«
»Ja.«
»In zwei Stunden bin ich bei dir.«
»Okay«, habe ich mit zittriger Stimme gesagt, habe aufgelegt, mich angezogen und die Wohnung verlassen.
Die kalte Luft tut gut. Enten gleiten lautlos im Wasser. Den Kopf in den Nacken gelegt, mustere ich die Pfeiler der Brücke, die über mir ragt, als gehörte sie zu einer anderen Welt. Schließlich stehe ich auf, strecke meine Glieder, nehme die Stufen in Angriff, die nach oben führen, und gehe zurück nach Hause.
Ich ziehe den Vorhang zur Seite und beobachte, wie der Typ vom Original Kebab Abfallsäcke in einen Container wirft. Schnee fällt. Ein Auto mit Zuger Nummernschild nähert sich, es hält nicht an. Ich höre das Wasser brodeln, das ich aufgesetzt habe. In der Küche öffne ich den Kühlschrank und halte einen Karton Milch unter meine Nase. Sie riecht sauer. Ich schließe die Augen.
Die Netzstation. Am Boden die fauligen Wasserpfützen. Patrick, der in der Ecke kauert.
Ich schütte die Milch in den Ausguss, löffle Zucker in den Kaffee. Dann setze ich mich an den Küchentisch, rauche eine Zigarette, reibe mit dem Daumen über den Zündstein des Feuerzeugs, bis die Haut zu schmerzen beginnt.
Das Geräusch der Klingel lässt mich zusammenzucken. Ich stecke den Hausschlüssel in einen der Handschuhe, die ich zum Trocknen auf den Radiator gelegt habe, und öffne das Fenster. »Hallo«, rufe ich.
Patrick blickt nach oben, blinzelnd. Schneeflocken wirbeln um seinen Kopf. Ich schwenke den Handschuh hin und her, lasse ihn fallen, doch Patrick macht keine Anstalten, ihn zu fangen, er steht bloß da und schaut zu, wie das Ding vor seinen Füßen auf den Gehsteig klatscht.
Ich habe ihn mir anders vorgestellt, in englischem Anzug und mit kariertem Schal um den Hals. Er trägt einen braunen Rollkragenpulli unter einer abgewetzten Lederjacke, Jeans und Turnschuhe. Sein Haar ist licht geworden, hat sich zurückgezogen, um einer erstaunlich glatten Stirn Raum zu geben. Die Augen schimmern in kräftigem Blau, dunkler, als ich es in Erinnerung hatte. Die Narben im Gesicht sind kaum zu sehen.
»Komm rein«, sage ich, Patrick nickt, und diese Bewegung, die wortlose Geste eines fast zwei Meter großen Hünen, rückt die Verhältnisse zurecht: Nicht ich bin es, der ihm Einlass gewährt, er ist es, der meine Wohnung betritt, ohne die Schuhe abzustreifen und ohne mich anzusehen. Mit drei Schritten ist der Raum erobert. In der Mitte des Wohnzimmers dreht er sich um. Will er mir die Hand geben? Ich wende meinen Blick ab und zeige zur Küche, wo die beiden einzigen Stühle stehen, die ich besitze. Patrick geht voran, öffnet den Kühlschrank, um ihn gleich wieder zu schließen, hebt den Versandkatalog hoch, der auf der Herdplatte liegt, und wirft ihn unter den Küchentisch, wo sich das Altpapier stapelt.
»Bist du gekommen, um aufzuräumen?«, frage ich.
»Du hast deinen Humor bewahrt, Tom. Das ist gut.« Jetzt blickt er mir direkt in die Augen, und ich fühle mich dreißig Jahre zurückversetzt, in unser Klassenzimmer: Wir standen hinter den Pulten, und als uns Pater Konrad die Regeln erklärte, die an der Schule galten, stieß mir Patrick mit dem Finger in die Seite. Ich drehte den Kopf, erwartete eine Bemerkung. Aber mein neuer Mitschüler sah mich nur ausdruckslos an.
»Möchtest du Kaffee?«, frage ich, registriere ein Grunzen und löffle Pulver in eine Tasse. Ich schraube den Deckel wieder auf die Dose, und in diesem Moment streckt mir Patrick die Hand entgegen.
»Schön, dich wiederzusehen«, sagt er.
Ich höre ein Surren, reiche ihm die Hand, erwarte kühles Metall. Stattdessen umschließt weiches Silikon meine Finger. Es ist kein echter Händedruck. Ich kriege die Prothese nicht richtig zu fassen, unterdrücke den Impuls, neu anzusetzen.
»Myoelektrisch«, sagt er. »Hab ich seit zwei Jahren. Die ist um Welten besser als der Scheiß, den sie mir früher über den Stumpf gezogen haben.«
Endlich löst sich der Griff der Prothese, ich zupfe meinen Ärmel zurecht, und wir setzen uns hin. Ich sollte fragen, ob er Schmerzen hat. Wie er zurechtkommt. Doch ich rühre bloß in der Tasse. Patrick greift nach der Dose und liest vom Etikett: »Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern.« Was ich gegen echten Kaffee einzuwenden habe, will er wissen.
»Ich mag den am liebsten.«
»Meine Mutter ist gestorben.« Er stellt die Dose zurück auf den Tisch. »Gestern war Beerdigung.«
»In Zug?«
»Ja.«
Ich zünde mir eine Zigarette an, halte ihm das Päckchen hin, er winkt ab.
»Tut mir leid«, sage ich und atme den Rauch durch die Nase aus. Die Schwaden verteilen sich im Raum. »Wann fährst du zurück?«
»Morgen.«
»Du wohnst in London?«
»Etwas außerhalb.« Mit der gesunden Hand wischt er Krümel vom Tisch, sein Blick geht ins Leere.
Ob er weiß, was Isabelle macht oder was aus Emil geworden ist? Ich könnte ihn daran erinnern, wie Georg auf den Stuhl gestiegen ist, damals, mitten im Unterricht, und die Nidwaldner Hymne gesungen hat. Patrick würden weitere Episoden einfallen, Geschichten, die sich anfühlen wie um die Schulter gelegte Decken. Doch dann würden wir unweigerlich auf Jasmin zu sprechen kommen und auf alles andere.
»Bist du verheiratet?«, frage ich.
»Geschieden.«
»Kinder?«
Er schüttelt den Kopf.
Ich presse den Stummel in den Aschenbecher, bis er abknickt, greife nach der Schachtel.
»Hast wieder angefangen«, sagt Patrick.
»Ja.«
»Und Milch trinkst du auch?« Er reckt das Kinn in Richtung Spüle, wo ich den leeren Karton habe stehen lassen.
»Manchmal.« Ich fummle eine weitere Zigarette aus der Schachtel, drehe sie zwischen den Fingern. »Bio«, füge ich an. »Und ich esse kein Fleisch.«
»Bravo.« Er beugt sich nach vorn, nimmt einen Schluck Kaffee, nachdem er mit spitzen Lippen in die Tasse gepustet hat. Er schlürft, lauter als es nötig wäre. »Das passt«, sagt er. »Das passt gut zu dir, dieser Kompromiss, diese, wie soll ich sagen, Ausgewogenheit einer vernünftigen Lebensführung. Moralisch und lobenswert. Kann man nicht dagegen sein.«
Patricks Stimme klingt fremd. In sein Schweizerdeutsch hat sich ein Akzent eingeschlichen, die Aussprache ist verwaschen, das »R« rollt nicht sauber, als gäbe er sich beim Reden wenig Mühe.
»Ich fand schon immer, dass Radikalität nicht deinem Wesen entspricht«, sagt er und lehnt sich zurück. Im schwachen Licht der Küchenlampe sieht seine Haut ungesund aus, die Wangen sind schlaff. Und doch: Wie er mich ansieht, den Atem angehalten, die Augen weit offen, gleicht er einer Katze vor dem Mäusebau. Ich stehe auf, gehe zur Spüle und presse die Luft aus der Milchpackung.
»Weshalb bist du hier?«, frage ich.
»Ich hab Hunger. Hast du was da?«
»Nein.«
»Na schön. Lass uns essen gehen.«
Er beißt in den Döner, blassrote Soße tropft auf den Tisch. Fettgeruch hängt in der Luft, in der Ecke brummt ein Getränkeschrank. Ich habe eine Brasserie empfohlen, dreihundert Meter von meiner Wohnung entfernt, aber Patrick fand, er habe keine Lust, durch Schneematsch zu stapfen, nur um eine verschmorte Aubergine vorgesetzt zu bekommen.
»Der Krebs hat zügig gearbeitet«, sagt er. Im September, kurz nach der Diagnose, Stufe vier, Metastasen überall, habe er seine Mutter das letzte Mal gesehen und Pläne für ein Treffen an Weihnachten geschmiedet, an dem die ganze Familie hätte teilnehmen sollen. Doch am Ende, vorige Woche, sei alles sehr schnell gegangen. Von Beginn an habe sie sich geweigert, einen Darm-Bypass legen zu lassen. Einen künstlichen Ausgang habe sie ebenfalls abgelehnt, da sei die Scheiße in ihren Bauchraum gequollen.
Ich rücke meinen Stuhl zurecht, der zu nahe am Tisch steht. Patrick hat es sich auf der Bank bequem gemacht, hinter ihm hängt ein Aquarell an der Wand. Ein Zweimaster nähert sich einer Insel, von Möwen begleitet, das Schiff schimmert im Licht einer gelben Sonne. Der Typ, der vorhin die Abfallsäcke nach draußen gestellt hat, ist nicht zu sehen, uns bedient eine Frau, die so klein ist, dass sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um Döner und Falafel über die Ladentheke zu reichen. Ob es schmecke, fragt sie, während sie den Senfspender mit einem Lappen sauber wischt.
»Wunderbar!«, ruft Patrick. Bisher hat er nur seine gesunde Hand gebraucht, den Kebab jeweils auf den Tisch gelegt, bevor er nach dem Bierglas gegriffen hat. Nun aber höre ich das surrende Geräusch, starre auf die Prothese. Langsam umschließen die künstlichen Finger das Glas. Als er es endlich anhebt, um der Frau zuzuprosten, ist sie im Nebenraum verschwunden. Patricks Mundwinkel spannen an und erzeugen die Idee eines Lächelns.
»Mutter war furchtbar stur. Hat keinen Rat angenommen«, sagt er.
Ich erinnere mich an ihren müden Blick, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, versuche, ein anderes Bild wachzurufen, denke an Geburtstagsfeiern im Garten der Bischoffs, daran, wie mich Patricks Mutter an einem Sommerabend nach Hause fuhr, weil sie nicht wollte, dass ich mit dem Fahrrad ins Gewitter geriet. So muss es gewesen sein: Der Wagen stoppt, Regen prasselt auf die Windschutzscheibe, ein Duftbäumchen riecht nach Vanille, und Frau Bischoff dreht den Kopf, um sich zu verabschieden. Doch da sind wieder die Schatten unter ihren Augen.
»Solche Entscheidungen muss man akzeptieren«, höre ich mich sagen.
»Muss man das?«
Wir trinken Aare-Bier, Amber, schon die dritte Flasche. Sticker der Young Boys kleben an den Wänden, auf Stühlen, am Fenster, als wäre der Laden deren Stammlokal. Über dem Getränkeschrank hängt ein Foto von Charlie Chaplin.
Ja, das müsse man, will ich sagen, um eine allgemeine These zur Autonomie von Patienten nachzuschieben. Da öffnet sich die Tür, und unter dem ausgestreckten Arm eines vielleicht achtzehnjährigen Burschen schlüpft ein Mädchen in den Laden. Während sie den Schnee von der Jacke klopft und zur Theke trippelt, bleibt der Junge, zwischen dessen Lippen ein Joint hängt, im Eingang stehen. Kalte Luft umstreicht meine Knöchel. Ich ziehe die Socken hoch.
»Willst du da Wurzeln schlagen?«, fragt Patrick, worauf ihm der Junge einen Blick zuwirft, der sonst für Eltern reserviert ist, einen Schritt zurücktritt und die Tür schließt. Das Mädchen ist höchstens fünfzehn, die Augen glasig, die Haare zerzaust. Sie kommt mir bekannt vor. Begegnen mir Schüler außerhalb des Klassenzimmers, ist da oft nur ein vages Wiedererkennen. Minuten später fällt mir ein Name ein, manchmal auch nicht. Die Gesichter sehen alle gleich aus, heutzutage. Das Mädchen scheint mich nicht zu kennen, sie lächelt uns an, danach sieht sie aus dem Fenster und versichert sich, dass ihr Begleiter noch immer draußen steht. Sie öffnet den Getränkeschrank, fischt eine Cola und ein Red Bull aus dem Regal und lässt sich auf einen Stuhl fallen.
Patrick wartet, bis sie still sitzt, und erzählt weiter: Von Stents, die man hätte legen können, von lebensverlängernder Chemotherapie, ebenfalls verweigert, von den Krämpfen, die immer massiver wurden. Einmal habe seine Mutter mitten im Gespräch zu schreien begonnen, zwei Minuten lang, und dann habe sie aufgelegt.
»Das war Absicht«, sagt er. »Sie hat gespürt, dass sie einen Anfall kriegt, und zum Hörer gegriffen.«
»Wie kommst du auf so was?«
»Ich weiß es eben.«
Die Tür schwingt auf, ich höre, wie der Junge auf den Boden spuckt, er kommt herein, streift sich die Kapuze vom Kopf und bleibt neben dem Mädchen stehen. Bald darauf sind die Döner fertig, und die beiden schlurfen zur Theke. Während er einen Zwanziger aus der Hosentasche kramt, dreht sie sich zu uns um, pflückt einen Salatstreifen aus dem Fladenbrot, schiebt ihn in den Mund und sagt, sie wolle draußen essen.
»Mir war klar, dass es diese Weihnachtsfeier nicht geben würde«, sagt Patrick, nachdem die Tür ins Schloss gefallen ist. »Darmverschluss.« Er blickt nach oben, als müsste er sich an etwas erinnern. »Willst du wissen, wie so was geht?«
»Nicht wirklich.«
»Du kennst mein Interesse fürs Medizinische«, sagt er. Die Prothese summt, ich kann nicht sehen, was geschieht, Patrick hat den rechten Arm in den Schoß gelegt.
»Ich wusste, sie schafft es nicht bis Weihnachten,« sagt er schließlich, schwenkt die Bierflasche und gießt den Rest in sein Glas. Schaum steigt hoch, ein wenig davon kriecht über den Rand. »Und doch bin ich in London geblieben.«
»Wegen der Arbeit?«
»Natürlich nicht!« Seine Stimme überschlägt sich, ich drehe den Kopf zur Seite, die Bedienung starrt uns an. »Was meinst du?«, fährt er fort. »Ist das eine akzeptable Hypothese: Dass ich es nicht hätte ertragen können, sie sterben zu sehen? War ich feige? Ein, wie heißt das schon wieder? Ein Drückeberger. Was denkst du?«
»Ich möchte mir kein Urteil anmaßen«, sage ich. Es fühlt sich an, als spräche ich vor Publikum. »Sie hat es bestimmt verstanden.«
»Hat sie?«
»Worüber sprechen wir, Patrick? Was willst du hören?«
»Ach, vergiss es.« Er schiebt sich den letzten Bissen Döner in den Mund, knüllt die Alufolie zusammen und schnippt die Kugel weg. Danach kippt er das Bier in einem Zug hinunter und bestellt zwei Raki ohne Wasser.
»Erzähl mir von dir«, sagt er und gibt mir zu verstehen, dass ich die Gläser holen soll. Ich räume die Papierservietten weg, bücke mich nach der Alukugel und sage, da gebe es nicht viel zu erzählen.
»Du hast Philosophie studiert?«
»Ja.«
»Und?«
»Bin Lehrer geworden.«
»Ach so. Ja, das ergibt keinen Gesprächsstoff.« Er lacht, während ich die Schnapsgläser von der Theke nehme. Ich rieche daran, meine Nase zieht sich zusammen.
»Ist ein guter Job«, sage ich, nachdem ich mich wieder hingesetzt habe.
»Selbstverständlich.«
»Der Lehrplan lässt mir viele Freiheiten, ich kann den Stoff selber bestimmen.«
»Was bedeutet, dass die Inhalte ständig wechseln.« Patrick zwinkert mit dem rechten Auge, so wie früher.
»Nicht wirklich. Was sich bewährt, behalte ich bei.«
»Hast dich eingerichtet.«
»Wenn man so will.«
»Im Speck, sozusagen.« Patricks Lachen verändert sich, er beginnt zu glucksen, als hätte er sich verschluckt. »Wobei«, sagt er und trinkt den Schnaps leer. »Wenn ich deine Bude anschaue, also, ich weiß nicht. Was machst du mit all der Kohle, die du kassierst?«
»Die lege ich zur Seite«, sage ich und lasse den Satz wie eine Frage klingen.
»Wofür denn?«
»Keine Ahnung. Ich gebe halt auch viel weg, Greenpeace und so.«
Patrick schaut mich an, als hätte ich zwei und drei falsch zusammengezählt.
Er will nicht wissen, was ich arbeite, er will wissen, wie ich schlafe. Darum ist er hier. Vielleicht sollte ich zu ihm sagen: In der Nacht setzt sich ein Mahr auf meine Brust, ich erwache und kann mich nicht bewegen. Der Mahr hockt bloß da, stinkt nach Schwefel und nimmt mir den Atem. Vielleicht sollte ich zu Patrick sagen: Die Träume sind schlimm, und wenn ich erwache, sind die Laken feucht vom Schweiß. Aber so ist es nicht. Nur selten. Also schweige ich und halte seinem Blick stand.
»Möchtest du sehen, wie sie funktioniert?«, fragt er und hebt den rechten Arm. Ich nicke, worauf Patrick verschiedene Griffe zeigt, Lateral Pinch, Tripod Pinch, Opposition Grip, er kennt die deutschen Bezeichnungen nicht. »Kann ich alles damit machen.«
Die Bedienung hat das Radio eingeschaltet, Kaufhauspop dringt aus der winzigen Box, die oben in der Ecke hängt. Der Motor der Prothese ist kaum zu hören.
»Hätte man mal früher erfinden müssen«, sagt Patrick, zieht die Hand aus und legt sie auf den Tisch. Er braucht dafür keine zehn Sekunden, und es wirkt wie ein Akt der Gewalt. Ich betrachte die Prothese und da taucht das Bild wieder auf: Patrick kauert am Boden. Er hält die Zange in die Höhe. Er holt zum Schlag aus.
Ich hebe meinen Kopf in der Erwartung, einen vernarbten Stumpf zu sehen, doch über Patricks Arm ist eine rosafarbene Hülle gezogen, aus deren Ende ein Metallstab ragt.
»Das ist der Silikonliner«, sagt Patrick. »Damit das Ding auch hält.«
Mein Mund ist trocken, die Hülle verschwimmt vor meinen Augen. Ich lasse mir nichts anmerken.
»Okay«, sage ich und schaue zu, wie er aufsteht, einen kleinen Spray aus der Hosentasche nimmt, etwas Flüssigkeit auf das Silikon sprüht und die Prothese wieder anzieht wie einen großen Handschuh. Sie rastet ein und Patrick sieht sich um, als hätte er ein Tor erzielt, so wie damals im Sportunterricht, ohne zu jubeln, doch mit gereckter Brust. Er winkt in Richtung Theke und bestellt zwei weitere Raki. Schließlich lässt er sich schnaufend auf die Bank fallen.
»Ich möchte dir mal was sagen, Tom. Technologie ist ein Segen. Es gibt Leute, die erzählen diese Robocopscheiße, von gefährlichen Cyborgs und künstlicher Intelligenz, die uns beherrschen wird. Verfluchen das Internet, wünschen sich die Steinzeit zurück. Gehörst du auch zu denen?«
»Nein.«
»Gut. Ich will nicht zurück in die Steinzeit. Da wäre ich längst ein toter Mann, so viel ist klar. Und weißt du, was ich denen sage, den Zivilisationskritikern, diesen Schwachköpfen?«, fragt er und lässt die Prothese langsam den Mittelfinger strecken.
Ich schlucke, dann muss ich lachen.
»Ein Wunder der Technik, sag ich doch!«, ruft er. Die Hand nimmt ihre Ausgangsposition ein: Innenfläche nach oben, die Finger gestreckt. Patricks Augen leuchten. Die Stimmung scheint gekippt zu sein. Wir sind wieder vierzehn, grün hinter den Ohren, tausend Einfälle im Kopf, einer alberner als der andere. Ich überlege, wie ich die Idee weiterspinnen könnte, suche nach einer absurden Funktion, zu der die Prothese fähig wäre, doch mir fällt nichts ein.
»Hast du mit solchen Leuten zu tun?«, frage ich.
»Mit welchen?«
»Zivilisationskritikern.«
»Nein, warum?« Patricks Lachen ist bereits wieder verschwunden. Er stiert auf die leeren Gläser, als hätte er vergessen, worüber wir gesprochen haben. Für einen Moment frage ich mich, ob er den Verstand verloren hat.
Dieses Mal bringt die Frau den Schnaps an den Tisch. Patrick legt die linke Hand auf ihren Unterarm.
»Kennt ihr euch?«, fragt er, schaut mich an und danach wieder sie.
Die Frau zieht ihren Arm weg und schüttelt den Kopf.
»Bist noch nie hier drin gewesen, Tom?«
»Nein.«
»Das ist schade.« Zur Frau sagt er: »Darf ich vorstellen? Tom. Er wohnt gegenüber.«
Sie runzelt die Stirn, dann nickt sie mir zu.
»Aysel«, sagt sie.
»Das ist ein schöner Name. Ich bin Patrick.«
Aysel blickt über die Schulter zur Theke, rückt einen Stuhl zurecht, der am Nachbartisch steht, und fragt, ob alles gut sei.
Patrick spielt den Verblüfften. »Wie, alles gut?«, fragt er.
»Essen. Schnaps.«
»Ja, alles gut«, sage ich.
»Siehst du? Musst öfters hier essen!« Patrick lehnt sich zurück, breitet die Arme aus, schlägt die Beine übereinander. »Weißt du, Aysel, Tom ist ein furchtbar netter Kerl. Wir waren früher mal beste Freunde. Blutsbrüder, oder? Wenn du ihn gekannt hättest, damals. Wenn er vor fünfundzwanzig Jahren in Bern gelebt hätte. Gab es da diesen Laden schon?«
»Fünfundzwanzig Jahre? Haben wir gerade aufgemacht. Mein Mann und ich.«
»Der Laden gehört dir?«
»Ja, gehört meinem Mann.«
»Sehr schön. Gut. Was wollte ich sagen? Genau! Tom war ein toller Bursche. Nicht so abgefuckt wie der Typ vorhin, der mit dem Joint. Tom war richtig Straight Edge, stimmt’s?«
Mein Magen zieht sich zusammen. Er wird es ihr erzählen. Er wird aussprechen, was geschehen ist. Ich hebe die Hand, was keinen Sinn macht, weil uns Aysel bereits anschaut, und frage, ob wir bezahlen können.
»Vorne«, sagt sie, löst sich aus ihrer Erstarrung und hastet zur Theke. Ich stehe auf und folge ihr, fasse in die Gesäßtasche meiner Hose und merke, dass ich vergessen habe, meinen Geldbeutel einzustecken.
»Ein wirklich toller Bursche!«, ruft Patrick. »Aber weißt du was? Wenn er hier gelebt hätte, wenn er damals schon dein Nachbar gewesen wäre, hätte er womöglich deinen Laden abgefackelt. Kannst du dir das vorstellen? Der hätte in der Nacht das Fenster eingeschlagen und Feuer gelegt. Aber nicht wegen dem, was du denkst. Tom ist kein Rassist! Sondern wegen dem Ding da hinten.« Patrick drückt seinen Rücken gegen die Lehne, damit er den rotierenden Fleischspieß besser sehen kann, auf den er zeigt.
»Gibt viele Rassisten«, sagt Aysel und öffnet die Kasse. »Aber ist nie etwas passiert mit uns.«
»Nein, das haben Sie falsch verstanden«, sage ich zu ihr. Es ist zwecklos. Ich drehe mich zu Patrick. »Das hätte ich niemals gemacht.«
Er schweigt und starrt mich an. Was will die Katze hören? Was erwartet sie? Eine Zeit lang stehe ich da und weiß nicht, wohin mit mir. Dann erkläre ich ihm, dass ich kein Geld dabeihabe.
»Ist ja nicht weit zu dir«, sagt er.
2
Eines Morgens hob Georg den Achermann hoch, einfach so, ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Anlass gegeben hätte, und hängte ihn an einen Kleiderhaken vor unserem Klassenzimmer. Achermann war eins fünfzig und wog so gut wie nichts. Die Regenjacke, in der er steckte, hielt der Belastung stand. Verzweifelt versuchte er, den Reißverschluss zu öffnen. Schließlich gab er auf und ließ die Arme hängen. Georg verzog keine Miene, er sah aus, als hätte er bloß einen herrenlosen Rucksack aus dem Weg geräumt. Einige lachten. Vielleicht habe auch ich gelacht, das ist gut möglich.
Es war die Zeit, in der sich die Verhältnisse klärten, ein dreiviertel Jahr nachdem wir das Gebäude mit der roten Fassade zum ersten Mal betreten hatten. Anja und Isabelle verbrachten die Pausen im Innenhof. Umringt von Jungs aus der Neunten, pflegten sie ihre Sonnenbrillen in Zeitlupe vom Kopf zu nehmen, in den Ausschnitt zu stecken und unerreichbar zu sein. Andere Mädchen trugen Bücher auf den verschränkten Armen, wann immer man sie antraf, traten ohne Not zur Seite, um Platz zu machen. Die Normalen und Braven, die Bockigen, die Eifrigen, sie alle hatten einander und ihren Platz im Gefüge gefunden. Auch die Jungs. Ab und zu hatte es eine Rauferei gebraucht, nun wussten wir, wer wo hingehörte. Achermann ganz nach unten und Georg, der den Unihockeyball so hart schlagen konnte wie kein Zweiter, an die Spitze. Nichts tat er lieber, als nach dem Sportunterricht mit einem Tuch um die Hüften in der Umkleide zu stehen und Reden zu halten: Der FC Luzern habe die Finalrunde verpasst, weil der Trainer eine Pfeife sei. Die Schweiz brauche eine starke Armee und er, Georg Weber, werde Oberleutnant wie sein Vater. Niemand widersprach.
Die Schule thronte am Hang des Stanserhorns. Dahinter der Wald, wo sich im Herbst der Nebel verfing. Deo et Juventuti stand in schwarzen Buchstaben über dem Haupteingang geschrieben. An das Gebäude schloss das Kloster der Kapuziner an, die das Gymnasium über hundert Jahre lang geführt hatten. Kurz bevor ich eintrat, war die Schule dem Kanton übergeben worden, aber viele der Ordensleute blieben als Lehrer tätig. Manchmal trugen sie Hemd und Hose, für gewöhnlich standen sie im braunen Habit vor uns, mit weißem Strick um den Bauch, ein Anblick, an den ich mich ebenso schnell gewöhnte wie an die Gerüche, die im Gebäude herrschten. Das Treppenhaus zu betreten, fühlte sich an, als würde man in eine Höhle geraten, besonders wenn es draußen geregnet hatte und der Schmutz von fünfhundert Schuhsohlen auf den Stufen lag. In den Fluren müffelten Spannteppiche und im neu renovierten dritten Stock, wo sich unser Klassenzimmer befand, roch es nach Leim. Der Raum war groß. Zwölf Pulte in drei Reihen, ganz hinten stand ein abgewetztes Sofa. An den Wänden hingen geometrische Lehrsätze, die unsere Vorgänger auf braunes Packpapier gezeichnet hatten. Am ersten Tag hatte Pater Konrad drei Töpfe mit Kakteen auf die Fensterbank gestellt und erklärt, man müsse ein Schulzimmer mit Pflanzen bestücken, um sich darin behaglich zu fühlen. Konrad war unser Klassenlehrer, unterrichtete Mathematik und gebrauchte Wörter wie behaglich und bestücken, die er mit rauchiger Stimme aussprach. Während Pater Zyrill oder Madame Dubois bei der kleinsten Störung einschritten und die Übeltäter umsetzten, lächelte Konrad bloß, hielt den Zeigefinger sanft an die Lippen, egal wie laut wir schwatzten.
Ich saß neben Georg, ganz außen in der dritten Reihe. Das waren die besten Plätze, wir hatten den kürzesten Weg zum Sofa. Dort schlugen wir in den Pausen die Beine übereinander und breiteten die Arme aus. Für andere blieb nichts frei.
Einem Fisch gleich hing Achermann am Kleiderhaken und begann zu schluchzen.
»Voll fies«, sagte ein Mädchen, unternahm jedoch ebenso wenig wie die anderen. Vielleicht hatte ich gelacht, wie immer, wenn Georg etwas Überraschendes tat, aber je länger ich Achermann dort hängen sah, desto weniger konnte ich es ertragen. Also ging ich zu ihm hin, sodass er sich an meiner Schulter festhalten und hochziehen konnte. Ihm schien das Manöver noch peinlicher zu sein, als am Haken zu hängen. Ohne mich anzublicken, stieg er von meinem Rücken und rannte die Treppe hinunter. Georg hingegen sah mich an, mit diesem boshaften Grinsen, das er so gut draufhatte, den einen Mundwinkel hochgezogen, den Rest des Gesichts unbewegt.
»Ein Retter in der Not«, sagte er.
»Ja, okay.«
»Was okay?«
»Lass ihn in Ruhe. Er hat dir nichts getan.«
»Was geht dich das an?«
Eine einfache Frage und ich kannte die Antwort: Nichts geht es mich an. Georg hätte mich angestarrt und ich wäre seinem Blick ausgewichen. Dann hätte es geklingelt und die Sache wäre vergessen gewesen. Ich hatte es schon oft gesagt: Vergiss es, kein Problem.
»Wichser«, murmelte ich.
Er zog die Augenbrauen hoch. »Wie meinen?«, fragte er.
War Georg wütend, wechselte er in einen besonderen Slang, eine Mischung aus Zitaten und Wendungen, die er irgendwo aufgeschnappt hatte. Es war seine Art, die Sprache zu verlieren, ein Warnsignal.
Er sei ein Wichser, wiederholte ich, und diesmal sah ich ihm in die Augen. Er kam auf mich zu, krallte die Finger in mein T-Shirt und drückte mich gegen die Wand. Sein Atem roch wie die Pfützen in alten Autoreifen.
»Pass er auf. Will er Schläge?«
»Wichser, Wichser!«, schrie ich, und ein wenig Spucke traf Georgs Gesicht. Mit der einen Hand hielt er mich noch immer fest, mit der anderen strich er über seinen Mund. Hinter ihm sah ich die anderen im Halbkreis stehen, eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude in den Gesichtern. Wo blieb Pater Konrad? Sonst saß er Minuten vor dem Unterricht am Lehrerpult und sortierte seine Unterlagen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, vielleicht kam er in diesem Moment den Flur entlang. Nichts. Ich richtete meinen Blick wieder auf Georg, sah seine Nase zucken, als hätte sich eine Fliege daraufgesetzt, und mir wurde klar, dass ich aus der Sache nicht mehr rauskommen würde. Ansatzlos wie ein geübter Boxer drosch er mir die Faust unter die Rippen. Ich ging in die Knie und rang um Luft. Der Schmerz war heftig. Noch heftiger war die Wut, die in mir aufstieg, der blinde Zorn des Unterlegenen. Ich wollte schreien, es ging nicht. Also atmen. Einmal, zweimal, tief. Ich hob den Kopf. Georg stand nur einen Meter von mir entfernt, die Eier auf der Höhe meiner Augen. Ich ballte die Faust, jetzt war er dran. Alle Kraft, die ich besaß, legte ich in diesen Schlag, doch ich war zu langsam, mein Arm zu kurz. Georg wich zurück, zögerte einen Moment. Dann rammte er mir das Knie ins Gesicht. Wofür auch immer ich zu kämpfen glaubte: Es war vorbei.
Anja, unsere Klassensprecherin, half mir auf die Beine, mit ernster Miene, als gehörte das zu ihren Aufgaben. Emil verglich meine Kampfkunst mit der eines Faultiers auf Valium, wofür er ein paar Lacher erntete. Dann kam Isabelle die Treppe hoch, hängte ihren Regenschirm an einen Haken, sah mich an, blickte zu Georg und sagte, wir seien Kinder.
Die nächste halbe Stunde verbrachte ich auf der Toilette. Meine Oberlippe schwoll an, aus der Nase kam Blut. Nachdem ich es eine Weile lang auf mein Shirt hatte tropfen lassen, tastete ich den Nasenrücken ab. Danach drehte ich den Hahn auf, hielt den Kopf unter das Wasser, rieb mir das Gesicht, blickte in den Spiegel und sah, dass immer noch Blut aus den Nasenlöchern trat. Also setzte ich mich in eine der Kabinen, formte Klopapier zu Kügelchen und steckte sie mir in die Nase.
Mein Großvater hatte einmal mit bloßen Händen einen Hund erschlagen. Als Kind war ich tausendmal auf seinen Schoß geklettert, um die Geschichte erzählt zu bekommen: Früher Nachmittag, die Tour ist beinahe zu Ende, noch zwei Briefe sind zu verteilen. Großvater öffnet das Tor, geht durch den Garten, und da steht diese riesige Bordeauxdogge vor ihm, den Kopf geduckt, die Stirn so breit wie die eines Stiers. Großvater bewegt sich nicht. Er wartet. Er weiß, die Lage ist ernst, und er formt die Hände über dem Kopf zu einer gewaltigen Faust. Das Tier knurrt, von den Lefzen tropft der Sabber. Die Muskeln spannen an, der Hund rennt los und springt. Oh, das hätte er nicht tun sollen! Dieses Geräusch, als die Wirbelsäule splitterte, vergesse er sein Lebtag nicht, hatte Großvater gesagt, die Finger zusammengeschoben, und die Knöchel knacken lassen.
Ich riss Papier von der Rolle, rieb mir die Augen trocken, betrachtete meine schwachen Hände, krampfte sie zu Fäusten und hämmerte gegen die Kabinenwand. Weshalb hatte ich nicht einfach den Mund gehalten?
»Alles klar da drin?«
Ich hatte niemanden hereinkommen gehört. Vor Schreck atmete ich ein, als wäre ich aus einem Albtraum erwacht. Ein Krächzen drang aus meiner Kehle.
»Du meine Güte! Sorry«, sagte die Stimme. Es klang nicht wie eine Entschuldigung, wer immer da draußen stand, er würde so schnell nicht wieder verschwinden. Ich öffnete die Kabinentür und sah Patrick am Pissoir stehen. Er blickte mich über die Schulter an.
»Geht’s dir gut?«, fragte er.
Ich nickte.
»Coole Sache.« Patrick zog den Reißverschluss hoch und zeigte auf das Blut an meinem Shirt.
»Okay.«
»Hast den Kürzeren gezogen.«
»Ja.«
»Ich dachte, ihr seid Freunde, Georg und du?« Patrick drückte sich an mir vorbei, um sich die Hände zu waschen.
»Sind wir nicht.«
»Und warum hängst du ständig mit ihm rum?«
»Wir sind keine Freunde«, sagte ich.
»Wie ein Hündchen. Immer bei Fuß.« Er blickte in den Spiegel, kniff die Augen zusammen. »Zeig mal.« Patrick drehte sich um und legte einen Finger auf meinen Nasenflügel. »Tut das weh?«, fragte er.
»Es geht.«
»War die immer schon schief?«
»Wie, schief?« Ich musterte mein Gesicht im Spiegel.
»Nur ein Witz. Keine Sorge, sie ist nicht gebrochen.«
»Das weiß ich selber.«
Patrick. Der athletische Junge, der am Sporttag in Straßenkleidern angetreten war. Er hechtete beim Hochsprung unter der Latte hindurch, brauchte eine halbe Minute, um die hundert Meter zu laufen, warf den Speer mit dem schwächeren rechten Arm. Drei Sportlehrer standen danach um ihn herum, gestikulierten, einer zupfte an Patricks Shirt. Am Ende ließen sie ihn gewähren. Auf der Rangliste, die am nächsten Tag am Anschlagbrett hing, fehlte Patricks Name, mehr geschah nicht.
Hinter seinem Rücken nannten wir ihn den Außerirdischen, weil auf seinem Etui ein E.T.-Sticker klebte. Von Angesicht zu Angesicht hätten wir uns das nicht getraut, nicht einmal Georg. Patrick war eins siebzig, einen Kopf größer als wir alle, und unter seinem Bett vermuteten wir Hanteln. In Mathematik schrieb er Bestnoten, was wir wussten, weil Emil einen heimlichen Blick auf Pater Konrads Unterlagen geworfen hatte. Patrick saß allein an einem Pult, immer wenn ich nach der letzten Lektion des Tages meine Schultasche packte und aus dem Fenster sah, war er bereits unten auf dem Vorplatz und schwang sich aufs Fahrrad.
Nachdem wir am ersten Schultag das Klassenzimmer verlassen hatten, tippte ich ihm von hinten auf die Schulter. Er wandte sich um, eine Strähne fiel ihm ins Gesicht. Ich fragte ihn, weshalb er mich während Konrads Ansprache in die Seite gestoßen habe. Patrick zuckte mit den Schultern und sagte: »Nur so.« Ich sah ihn an, aber da kam nichts mehr und ich beschloss, dem seltsamen Jungen aus dem Weg zu gehen.
Er riss am Stoff des Handtuchautomaten und wischte sich die Hände trocken, während ich noch einmal meine Nase abtastete und den Wassertropfen wegstrich, den sein Finger hinterlassen hatte.
»Was machst du eigentlich hier?«, fragte ich.
»Was wohl?«
»Hat Konrad was gesagt?«
»Der hat nichts mitgekriegt. Er denkt, du hast verschlafen.«
Patrick stieß die Tür auf, und wir gingen hinaus in den Flur, wo ich mich hinsetzte. Er blieb stehen, die Hände in den Hosentaschen, und starrte an die Decke.
»Ich find’s gut, dass du Achermann verteidigt hast«, sagte er.
»Verteidigt?«
»Du weißt schon.« Er runzelte die Stirn. »Der Tritt mit dem Knie war echt krass«, sagte er. »Du solltest Konrad erzählen, was geschehen ist.«
»Nein.«
»Solltest du aber.«
»Tu ich aber nicht.« Ich versuchte aufzustehen, doch mir fehlte die Kraft. Ich verlor das Gleichgewicht und klatschte mit dem Hintern auf den Teppich. Patrick streckte mir die Hand entgegen und zog mich hoch. Sie fühlte sich gut an, diese Hand, groß und kräftig, wie die eines Erwachsenen. Die Pausenglocke erklang. Patrick sagte, er habe seine Sachen noch im Klassenzimmer.
»Kommst du mit?«, fragte er. »Haben wir Bio?«
»Ja.«
»Stimmt! Jetzt fällt es mir ein: Wir behandeln das Sozialverhalten von Gorillas.«
Alle anderen hatten sich bereits gesetzt, als wir das Biologiezimmer betraten. Pater Zyrill sah uns an, als hätte er soeben einen Schüler verspiesen. Ich murmelte eine Entschuldigung und schloss die Tür. Der Raum war bestuhlt wie ein Hörsaal, mit einem breiten Gang in der Mitte. Rechts war ein Platz frei geblieben, links drei, die nebeneinander lagen. Ich wollte Patrick folgen, doch er hatte die rechte Seite gewählt, und mir blieb nichts anderes übrig, als mich neben Achermann in die vorderste Reihe zu setzen. Zyrill erklärte, wie sich Bakterien vermehren. Zellteilung. Knospung. Später gab es einen Lehrfilm auf Super 8. Der Projektor ratterte, und ich drehte den Kopf zu Achermann, worauf dieser ein Stück von mir wegrutschte. Ich hatte nichts anderes erwartet, vermutlich hatte ihm niemand erzählt, was nach seiner Flucht geschehen war. Ich blickte wieder nach vorne, schwarze Punkte flimmerten vor braunem Hintergrund. Die Konturen der Zellwände, von denen Zyrill sprach, konnte ich nicht erkennen.
Andrea lag auf dem Boden ihres Zimmers, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Neben ihr ruckelte der Discman. Die Woche zuvor hatte sie ihre Stereoanlage verschenkt. So leise Musik zu hören, wie unsere Eltern es gerne hätten, mache überhaupt keinen Sinn, hatte sie gesagt, die Kabel von den Boxen getrennt und alles in eine Schachtel geworfen. Seither war sie nur noch mit Kopfhörer im Ohr anzutreffen, ständig hielt sie den Discman in der Hand, selbst wenn wir auf dem Sofa im Wohnzimmer saßen und fernsahen. Bloß zum Essen hatte sie ihn nicht dabei, sie wusste, wo die Grenze lag.
Andrea summte leise, die Augen geschlossen. Ich kniete mich neben sie, vorsichtig zog ich die CD-Hülle mit meinem Lieblingscover aus dem Stapel, den sie aufgeschichtet hatte. Es zeigte eine aufgeplatzte Erdkugel. Die oberen Schichten lösten sich wie Fleisch vom Knochen und gaben einen Totenschädel frei. Unzählige Male hatte ich versucht, die dunklen Augenhöhlen des Schädels abzuzeichnen, das diffuse Blau der Erdkugel wiederzugeben. Es war mir nicht gelungen. Mit der Hülle fächelte ich Luft über das Gesicht meiner Schwester.
»Lass das!«, sagte sie und tat, als würde sie eine Fliege verscheuchen.
»Was hörst du?«
»Genesis.« Träge zupfte sie den einen Kopfhörer aus dem Ohr. Dann schoss sie hoch. »Was ist denn mit dir passiert?«
»Nichts.«
»Hat dich wer verprügelt?«
»Nein.«
»Sondern?«
»So war das nicht«, sagte ich und erzählte, was geschehen war, während Andrea ein Feuerzeug aus der Tasche ihrer Shorts fischte, nach dem Päckchen Parisienne griff, das auf dem Nachttisch lag, und sich eine Zigarette zwischen die Lippen klemmte. Wir gingen zum offenen Fenster, Andrea legte den Discman auf die Brüstung.
»Und jetzt?«, fragte sie. »Was hast du vor?«
»Nichts.«
Auf der Stirn meiner Schwester waren die zwei Furchen zu sehen, die entstanden, wenn sie nachdachte. »Wir schrotten dem Typ das Fahrrad«, sagte sie. Die Zigarette in ihrer Hand tanzte wie eine Libelle.
»Quatsch.«
»Doch! Oder warte …« Sie öffnete den Mund, schnappte nach Luft. Aber dann legte sie bloß den Arm um meine Schulter und schwieg. Die Regenwolken vom Morgen hatten sich verzogen. Über dem Stanserhorn hing die Sonne und wärmte unsere Gesichter. Andrea nahm einen letzten Zug und warf den Stummel auf den Parkplatz der Nachbarn.
»Willst du?«, fragte sie und zeigte auf den Kopfhörer, der vor ihrer Brust baumelte.
Sie ließ den Arm auf meiner Schulter liegen. Wir sahen Gleitschirmflieger als ferne Punkte in der Luft schweben, rochen das feuchte Gras der Wiese, die sich bis hinunter zum See erstreckte, und hörten das neue Album von Genesis, verbunden durch ein neongelbes Kabel.
»Andrea, du hast geraucht.« Unsere Mutter stand im Türrahmen und rümpfte die Nase. Sie hatte eine Papiertüte in der Hand.
»Hab ich nicht!« Andrea wandte sich um, der Kopfhörer ploppte aus meinem Ohr.
»Ich kann es riechen«, sagte Mutter. Sie stellte die Tüte auf den Nachttisch.
»Ich hab nicht im Zimmer geraucht!«
Mutter sah mich an. »Tom?«
Seit Wochen stritten sich die beiden über die Definition von drinnen und draußen, mir fiel dazu nichts ein.
»Sorg dich lieber um ihn«, sagte Andrea, aber da hatte sich Mutter schon die Hand vor den Mund geschlagen.
»Bin gegen eine Tür gerannt«, sagte ich. »Ist nicht schlimm.«
Im Bad klebte sie mir ein Pflaster quer über die Nase. Ich wusste nicht, wozu das gut sein sollte, ließ sie jedoch gewähren. Sie beruhigte sich schnell wieder. Nachdem sie die Abdeckung der Klebestreifen im Papierkorb entsorgt und sich die Hände gewaschen hatte, fasste sie mich an den Schultern und schob mich zurück in Andreas Zimmer.
»Schaut, was ich gekauft habe!« Mutter hob die Tüte hoch, mit der sie hereingekommen war, und holte vier Figürchen hervor, Eulen mit riesigen Augen und rosa Flügeln. Einen nach dem anderen stellte sie die Vögel auf den Nachttisch. »Sie ändern die Farbe, wenn das Wetter wechselt.«
»Echt?«, sagte Andrea und blickte an die Decke.