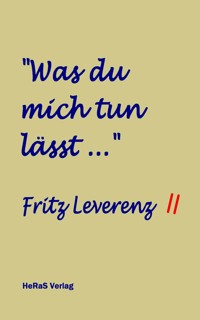
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Erstes Buch: Nach Kündigung seiner Lehrertätigkeit Ende der neunzehhundertsiebziger Jahre in Köpenick wird mir; dem Autor, angeboten, Schüler, die ihre zehn Schuljahre ohne Abschluss beendet haben, auf dem Weg in einen Beruf in den theoretischen Fächern zu unterrichten. Ich erkannte, dass ich relativ eigenständig arbeiten konnte und sagte zu. - Ich sitze allein im leeren Raum. Nur Ruhe brauche ich jetzt, mich selbst wiederzufinden; um erneut Geduld zu sammeln. Was ist es, was man vergibt mit seiner Güte und Geduld? Ist es seelische Materie, die man abbaut? Woher nimmt man neue Kräfte? Doch nur aus ehrlichen Gesprächen, aus wohlwollenden Kritiken, aus Offenheit und Vertrauen. Und viele Lehrer kehren dem Ort, an dem dies fehlt, den Rücken. Wer noch die Kraft besitzt zu fliehen, flieht. - Zweites Buch: Die Eisengießerei Birkenwerder hatte wegen zu geringer Wirtschaftlichkeit 1969 schließen müssen. "Jetzt, am Morgen, herrscht in der Gießerei die dämmrige, samtene Ruhe des Waldes. Die Luft riecht nach Kohlenstaub und frisch aufbereitetem Formsand, den die Arbeiter der Nachtschicht aufbereitet und zu mannshohen schwarzen Hügeln neben die Arbeitsplätze geschaufelt haben. Da, wo tags zuvor ein kompaktes Stück gegossen worden ist, dampft noch immer der Boden, und der Sandhaufen strahlt Wärme aus. Am frühen Nachmittag, wenn das Gießen beginnt, kann man den Geruch der Schwefelgase schmecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Fritz Leverenz
Was du mich tun lässt ...
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ERSTES BUCH
„Was du mich tun lässt ...“
Der Hausmeister und seine Frau
Beim Inspektor für Berufsbildung und dem Vorsitzenden der „PGH Bäckerei“.
Im VEB Pentacon Friedrichshagen
Januar
Ende eines Winters
November
Dezember
März
Im Briesetal
Der Friedhof
Bildbeschreibung
Sportplatz
Rauchen
Im Naturkundemuseum
Hefterbemalung
Inkonsequenz oder Sanktionen?
Lebensläufe
Gespräch mit Mautz und Schertz
Letzter Schultag
Ein heißer Tag, eine Kohlenstaubnacht
ZWEITES BUCH
Impressum neobooks
ERSTES BUCH
Fritz Leverenz
„Was du mich tun lässt …“
Für Mike
©HeRaS Verlag, Rainer Schulz, Berlin 2024
www.herasverlag.de
Layout Buchdeckel Rainer Schulz
ISBN 978-3-95914-094-2
„Was du mir sagst, das vergesse ich.
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“
KONFUZIUS
„Was du mich tun lässt ...“
Mein Schulweg
Seit zehn Wochen ist der Weg an der Müggelspree entlang mein neuer Schulweg. Schon fallen die letzten Blätter. Es riecht nach Herbst. Und wie gut erinnere ich mich beim Gehen über das feuchte Laub an vergangene Stimmungen, nicht an Bilder, sondern an Stimmungen. Ungewisse Sehnsucht erfüllt mich bei diesem Geruch und den Farben des Laubes in der niedrigstehenden Sonne, die in diesen Tagen den Eindruck erweckt, zu jeder Tageszeit sei Nachmittag. Vor allem die leuchtendgelben Blätter des Ahorns ziehen mich an. Als ließen sie im Herbst die farbigen Strahlen frei, welche sie den Sommer über eingefangen haben. - Das immerfeuchte Gras hingegen, weiß überzogen mit nebelfeinen Tröpfchen, erinnert bereits an frühe Wintermorgen. -
Im Sommer hatte ich meine Lehrerstelle bei der Abteilung Volksbildung gekündigt und hing, beruflich sozusagen in der Luft und es war unsicher, woher ich ab September den Unterhalt für meine Familie beziehen sollte.
Die zuständige Schulrätin im Rathaus Köpenick, bei der ich die Kündigung vertraglich abschließen wollte, riet mir (immerhin!), besorgt um meine soziale Absicherung, den Anteil der Stundenzahl beizubehalten, der mir eine Rente sicherte. Sie schlug mir vor, ich könnte ja diese Anzahl der Stunden im neu eingerichteten Fach „Wehrerziehung“ ableisten. Dieses Angebot war mir suspekt. In meiner Notsituation aber griff ich ihren Vorschlag auf und sagte nach kurzer Bedenkzeit schließlich zu. Sie überreichte mir den Lehrplan für das neue Fach und die drei dazugehörigen Lehrbücher, die im Wesentlichen zwei Themen über das militärische Grundwissen enthielten, sowie ein Thema, das den Zweck des ganzen Lehrgangs begründen sollte: Die „Wehrwürdigkeit“ der sozialistischen Gesellschaft. Da es noch wenig Erfahrungen mit dem neuen Fach gäbe, wären in den Sommerferien Probestunden zu den drei Themen im großen Saal des Rathauses vorgesehen. Die ausgewählten Lehrer erhielten noch genauen Bescheid.
Das militärische Grundwissen war mir noch aus meiner Dienstzeit bei den Luftstreitkräften geläufig und mit ideologischen Zwängen würde ich schon fertig werden. Um den Hospitanten gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, bereitete ich mich auf das Thema „Wehrwürdigkeit“ vor. Ich stellte mir vor, wie unsensibel z. B. engstirnige gediente Militärs vor den Jugendlichen argumentieren würden und war besorgt. Einige Tage später äußerte ich meine Sorgen auch in einer Zusammenkunft mit dem künftigen Leiter des neuen Faches, einem mir bekannten Lehrer. Wir unterhielten uns über verschiedene Themen und schließlich fragte er: „Sie sind doch auch der Meinung, dass dieses Fach für die Stärkung unserer Republik bedeutend ist.“ Offenbar hatte er meine unausgesprochene Ablehnung dieses Faches bemerkt.
„Wenn ich das Fach richtig interpretiere, geht es darin um größere Akzeptanz unserer Gesellschaft“, sagte ich. „In diesem Fall, denke ich, wäre es wichtiger, das Selbstvertrauen der Jugendlichen zu stärken als mit dem ‚Schwänzchen Wehrerziehung‘ zusätzlich den Lehrplan aufzublähen.“
Zum Ende der Sommerferien ging ich mit meinen Vorbereitungsunterlagen zum Rathaus. Ich war nervös. Mein Thema, bei dem es weniger auf Wissen und mehr auf Argumente ankam, vor engstirnigen Hospitanten auszubreiten, von denen ich so einige aus meiner Lehrerzeit in unguter Erinnerung hatte, bereitete mir Magenschmerzen.
„Wohin möchten Sie?“, fragte der Pförtner und trat aus seiner Loge. „Mein Name ist Leistenbrink, und ich möchte zum Probeunterricht in den Rathaussaal.“
Er schaute auf eine Liste und suchte meinen Namen: „Leistenbrink, Leistenbrink, - Tut mir leid. Ihr Name ist durchgestrichen. Außerdem finden die Probestunden heute in Räumen der EOS in Friedrichshagen statt.“
„Gestrichen? - Das kann ja wohl nicht sein. Mich hat niemand informiert.“ Ich war schockiert und empört. „Dann bitte zum Schulrat!“, sagte ich und wandte mich der Treppe zu. Der Pförtner griff zum Telefon. Kaum im oberen Stockwerk angelangt, kam mir auf dem Flur der stellvertretende Schulrat entgegen. Ein netter älterer Herr, der etwas hinkte. „Herr Leistenbrink?“
„Ja. Ich möchte gern den Schulrat sprechen.“
„Ich weiß.“ Er lächelte, als er mich aufgeregt sah.
„Herr Leistenbrink, regen Sie sich bitte nicht auf! - Sie hatten Bedenken zu dem Fach geäußert …“ Er sprach gedämpft und in aller Ruhe.
„Darf man keine Bedenken äußern?“, fragte ich.
„Doch, doch, Herr Leistenbrink, - aber wir haben uns gedacht, diese Aufgabe ist vielleicht doch nicht das Richtige für Sie.“ Er hielt inne, ehe er fortfuhr: „Wir haben einen anderen Vorschlag: Es gibt etliche Schüler im Stadtbezirk, die ihre zehn Schuljahre absolviert, aber das Ziel der zehnten Klasse nicht erreicht haben: von der erreichten sechsten bis zur nicht bestandenen zehnten Klasse. Diesen Schülern nun bieten wir in der Köpenicker Industrie und im Handwerk eine fachliche Ausbildung zum ‚Teilfacharbeiter‘ an. Ihnen würden wir die theoretische Ausbildung übertragen. - Trauen Sie sich zu, zwei solcher Klassen in Sport, Staatsbürgerkunde, Arbeit und Recht und Deutsch zu unterrichten? Bezahlt werden sie von der Abteilung Berufsbildung und der Abteilung Volksbildung.“
Ich erkannte, dass ich relativ eigenständig arbeiten konnte und sagte zu. Und so unterrichte ich seit September an zwei Tagen in der Woche im Seitengebäude der EOS.
Die Jugendlichen erhalten die Chance, innerhalb eines Jahres einen Teilberuf zu erlernen. In der „Erwachsenenbildung“ können sie später ihren Facharbeiterabschluss vervollständigen. Leider erkennen nur wenige von ihnen, so habe ich den Eindruck, in dieser Arbeit einen hoffnungsvollen Anfang, weil sie sie nicht selbst wählen konnten.
Der Hausmeister und seine Frau
Unser Unterrichtsraum befindet sich in den Nebenräumen eines ehrwürdigen Gebäudes der Zwanzigerjahre, eines ehemaligen Gymnasiums, der jetzigen Erweiterten Oberschule in Berlin-Friedrichshagen. Vor Unterrichtsbeginn muss ich vom Hausmeisterehepaar die Schlüssel holen.
Er ist füllig, Mitte Dreißig mit rundem Kopf, rundem Gesicht, dünnem glatten blonden Haar. Meistens sitzt er recht bequem mit hellblauem Perlonkittel bekleidet in seinem Kabäuschen neben dem Haupteingang an einem ausgedienten Lehrertisch, umgeben von Kartons mit Waschmittel, Scheuertüchern, Putzmittel aller Art, Stapeln von Kisten und Kasten, ein Kühlschrank „Kristall 120“ gefüllt mit den restlichen dreikantigen Milchtüten, vor sich eine breite „Mercedes“-Schreibmaschine, auf der hin und wieder seine Frau die Milchbestellung tippt.
Frage ich ihn nach Schlüsseln, brummt er einige unverständliche Laute, so, als hätte ich ihn aus dem Schlaf gerissen; mitunter auch rasch zustimmend, damit der lästige Fragesteller die Ruhe seiner hochgeborenen Behäbigkeit nicht allzu lange störe. Tritt er persönlich aus dem Zimmerchen, um einen Raum auf- oder zuzuschließen, oder Mittagessen aus dem oberen Stockwerk zu holen, bin ich erstaunt, ihn gehen zu sehen und bestaune seine zwei durchaus beweglichen Beine, die er tatsächlich besitzt, sie aber mit störrischem Gesichtsausdruck bewegt, als wäre er zornig auf sie, dass sie keine Räder seien oder ein fliegender Teppich.
Ein wenig mehr als nur drei Worte spricht er über seine Hunde; über den ersten, einen ganz jungen Welpen, „der wohl von Ihren Lehrlingen vergiftet worden ist“, und über den jetzigen, einen schwarzen Schäferhund, der das einzig wache Element an dem Hausmeister zu sein scheint und die Türklappe ausfüllt, vor der er wie eine alte Frau liegt, die gelangweilt aus dem Fenster schaut.
Das Sagen im Haus aber besitzt eindeutig seine Frau. Sie ist ebenfalls Anfang Dreißig. „Ich bin das zweite Mal verheiratet“, verrät sie, als wir uns mal allein unterhalten. Schülern gegenüber zeigt sie sich energisch und unnachgiebig bis zur Anmaßung: Sie sind für sie grundsätzlich Wesen, die gegen die Schulordnung, und das ist die Steigerung: gegen die Hausordnung verstoßen. Bei dieser Einschätzung betrachtet sie mich eindringlich. „Das Rauchen werden Sie Ihren Lehrlingen wohl auch nie abgewöhnen, was? Ich sah sie nämlich wieder rauchend aus dem Haus kommen; und sie rauchten auch innerhalb des Schulgrundstücks.“
Ich erzählte ihr von einigen Schicksalen der Lehrlinge. Doch ganz gleich, mit welchen Problemen man zu ihr kommt, erst einmal zählt sie einem seine tausend Ecken und Kanten auf, die sie entdeckt hat, bis man einsichtig das Haupt senkt. Dann eventuell zuckt ein Mundwinkel freundlich auf, und sie gönnt ihrem Gesicht und dem Bittsteller ein Lächeln. Offenbar hat sie sich eingeprägt, Freundlichkeit sei Schwäche und Güte ein Fehler. -
Einige der etwa vierzig Jugendlichen, die ich im Laufe von vier Jahren unterrichtete und an die ich mich noch gut erinnere, erwähne ich unter veränderten Daten in diesen Skizzen. -
Da sitzen sie vor mir, eine Armlänge vom Lehrertisch entfernt: Manuela, ein zierliches Mädchen mit längerem dunklem krausen Haar und dunklen Augen. Sie schreibt fleißig mit, aber unkonzentriert, denn sie schwatzt, sowie ich den Kopf drehe.
Neben ihr Regina, mit blondem strähnigem Haar, wässrig blauen Augen. Mit dem Rücken zu mir. Hinter ihr zwei weitere Mädchen. Als ich Regina zum wiederholten Male bitte, nach vorn zu sehen, entgegnet sie halb im Ernst: „Hier komme ich nicht mehr her, in diese Puffschule.“
Ein wenig bin ich erschrocken, darf es mir aber nicht anmerken lassen. Ich beuge mich zu ihr vor, stütze mich auf den Tisch und frage sie ungerührt: „Glaubst du, du verkündest Neuheiten mit deinen Kraftausdrücken, oder möchtest du eventuell auf deine Welterfahrenheit aufmerksam machen? - Doch, bei wem wohl? Oder möchtest du etwa abstoßend wirken?“
Sie schweigt. Die beiden Mädchen hinter ihr stecken beschämt die Köpfe zusammen.
An der Balkontür sitzt Frank, er lernt Modellbauer; ein ruhiger schmaler, sehniger Junge mit braunem Haar und braunen Augen, mit einem ewigen stillen Lächeln. Er arbeitet gut mit. Fehlte sechs Wochen. Vorgestern rief mich seine Mutter an, und ich bin verwundert, als ich erfahre, er hätte geschwänzt. -
Rosita, ein dralles pausbäckiges dunkelhaariges Mädchen folgt dem Unterricht still, schreibt säuberlich mit. Sie lernt Verkäuferin in einer Bäckerei.
Zur Bildbeschreibung hat sie das Bild von van Gogh: „Fischerboote am Strand von Les Saintes-Marie-de-la-Mer“ gewählt.
Madeleine, ihr dunkelblondes Haar modisch frisiert, spricht andauernd und unauffällig mit den beiden Jungen hinter ihr. Sie lernt Friseurin.
Ich komme mit den Jugendlichen vom Sportunterricht aus der Turnhalle. Da stehen sie vor dem verschlossenen Unterrichtsraum – die beiden Lehrmeister. Sie hatten sich nicht angekündigt. Beide etwa Mitte Zwanzig. Er hellblaue Augen, unbewegtes Gesicht, ruhig, mit beinahe starrem Blick die Jugendlichen und mich beobachtend. Sie, schwarzhaarig, auffällig geschminkt, mit hängenden Mundwinkeln, mit abfälligem Blick schaut sie an meinem Gesicht vorbei.
Die Jugendlichen bleiben auf der Außentreppe und im Vorraum stehen während die beiden sich als: „Frau Klett“ und „Herr Ranke“ vorstellen, „Lehrmeister im WAW. (Wärmeapparaturenwerk)“ Sie begrüßen mich dienstlich, Freundlichkeit vermeidend, sodass ich den Grund ihres Kommens bereits ahnen darf: Kontrolle meines Unterrichts. „Wir möchten gern hospitieren.“
Wieder bin ich unangenehm an meine frühere Lehrerzeit erinnert: Man misstraut mir.
Schon bevor der Unterricht beginnt, verabreichen wir uns gegenseitig unsere konträren Auffassungen von Erziehung und Unterricht. Frau Klett beklagt sich, während ihr Kollege mich mit wässrigen Augen fixiert, die Disziplin der Lehrlinge im Betrieb werde zusehends schlechter. Und sie sieht auch gleich die Ursachen dafür in meiner Unterrichtsführung: „Bei ihnen dürfen sie machen, was sie wollen. Sie essen, trinken und reden im Unterricht, und denken, im Betrieb dürfen sie auch so auftreten, und ihre Zensuren nach Wunsch eintragen, oder bei Arbeiten die ‚Muttersprache‘ oder den Hefter benutzen.“
Ziemlich hilflos sitze ich da. Was soll ich einwenden? Was sie vorbringt, entspricht ja den Tatsachen – nur – ihre Begründung für mein Vorgehen liegt völlig daneben. Ich versuche den beiden zu erklären, dass ich die Jungen und Mädchen nach acht oder zehn verkorksten Schuljahren nicht in wenigen Monaten komplett umkrempeln könne, da ihre Lernmotivation am Boden liege, und sie selbst in dem Beruf, den sie jetzt gezwungen sind zu erlernen, keine hoffnungsvolle Perspektive sehen.
Sie setzen sich beide nach hinten an die Wand, während die Jugendlichen noch immer auf dem Flur standen oder auf den Stufen sitzen. Zigarettenqualm dringt durch die Türritzen. Sie rauchen, obwohl das Rauchen im Haus verboten ist. Als ich rausgehe, sie in den Raum zu bitten, sehe ich den Inhalt einer Schultasche über den Flur verstreut. Einer der Jungen verbeißt sich das Weinen: „Ich hebe das nicht auf.“
Andreas kommt provokant lächelnd auf mich zu und tritt scheinbar unabsichtlich auf ein Stullenpaket, das auseinanderglitscht.
Der Unterricht verläuft beinahe so, wie immer: die meisten reden, wie es ihnen beliebt mit den Nachbarn oder dazwischen, wenn ihnen so nebenher eine Antwort einfällt. Sie essen und trinken – halb versteckt; lesen im „Eulenspiegel“, auch die vier Jugendlichen aus dem WAW. Während ich innerlich zitternd, äußerlich ruhig, ermahnend mein Thema der Rechtschreibung an die Tafel bringe, Fragen stelle, durch die Reihen gehe, und ermahne. Die Jugendlichen sollen Geduld sehen, und dass es so etwas durchaus gibt. Mit ihren kleinen Betrügereien, dem Abschreiben, sollen sie selbst fertig werden; das muss in ihnen arbeiten, sie formen, ohne von mir verhindert zu werden. Sie sollen aber auch erkennen, dass ich es merke, dass ich vielleicht gütig bin, doch nicht doof; dass Güte nicht Schwäche bedeutet, dass Grobheit, Ungeduld, Unfreundlichkeit und Strenge nicht Stärke ist.
Und die beiden Hospitanten sitzen da und verstehen nicht; sie sehen mich blamiert, unwürdig behandelt, und ich bin es doch nur in ihren Augen. Und doch bin ich am Ende des Unterrichts wie betäubt und ratlos – und mir ist, als müsste ich weinen.
Ich bleibe ernst. Entlasse die Klasse. Die beiden Beobachter verabschieden sich steif und schweigend. „Ich sehe ja ein“, sage ich, „dass jede Geduld ihre Grenzen hat. Künftig werde ich bei grober Verletzung der Disziplin, den betreffenden Lehrling des Unterrichts verweisen, in den Betrieb schicken und umgehend telefonisch den Lehrmeister von diesem Schritt unterrichten.“
Dann sitze ich allein im leeren Raum. Nur Ruhe brauche ich jetzt, mich selbst wiederzufinden; Zeit für mich, um erneut Geduld zu sammeln. Was ist es, was man vergibt mit seiner Güte und Geduld? Ist es seelische Materie, die man abbaut? Woher nimmt man neue Kräfte? Doch nur aus ehrlichen Gesprächen, aus wohlwollenden Kritiken, aus Offenheit und Vertrauen. Und viele Lehrer kehren dem Ort, an dem dies fehlt, den Rücken. Wer noch die Kraft besitzt zu fliehen, flieht.
Beim Inspektor für Berufsbildung und dem Vorsitzenden der „PGH Bäckerei“.
Auf dem Rückweg vom Kreisturnrat, Helmut N., im Rathaus Köpenick, von dem ich Manuskripte hole, die ich ihm zu lesen gegeben hatte, besuche ich den Inspektor für Berufsbildung Hans M. der wenige Zimmer entfernt sein Büro hat. Er brüht Kaffee in einem metallenen Elektrotopf, der vor zwei oder drei Jahren den Tauchsieder in öffentlichen Institutionen und Büros abgelöst hatte.
Kurze Zeit später tritt der Vorsitzende der „PGH Bäckerei“ in den Raum. Ein kräftiger breitschultriger Mann mit schwarzem Haar, den Schnauzbart über die Mundwinkel herabgezogenem, heiter-redselig. Wir hatten uns mit ihm verabredet, um über die theoretische und praktische Arbeit seiner Lehrlinge zu sprechen. „Mir geht es vor allem um Regina“, sagt er. „Als Verkäuferin kann sie nicht bleiben. Sie ist in Mathematik zu schwach, und verrechnet sich oft beim Geldherausgeben.“
„Wollt ihr sie umsetzen?“, fragt der Inspektor, „eventuell in die Backstube?“
„Ja, da möchte sie hin, weil dort ein junger Bäcker arbeitet. Aber ich denke, wir werden sie entlassen müssen. Sie weiß nicht so recht mit der Arbeit bei uns etwas anzufangen. Sitzt bei den Fahrern, die Obst anliefern, völlig fremden Männern, die eben mit ihrem Lastzug aus Thüringen ankommen, nach wenigen Minuten im Fahrerhaus. - Auch insgesamt werden die Noten der Teilfacharbeiterlehrlinge von Jahr zu Jahr schlechter.“
„Gebt ihr eine Chance bis zum Sommer“, meint der Inspektor, „bis dahin sehen wir uns nach einem anderen Betrieb für sie um.“
Frank fehlte sechs Wochen, ein großer sechzehnjähriger Junge. Gestern bringt ihn seine Mutter zur Schule – eine kleine, ärmlich gekleidete Frau. Frank steht neben uns, schweigend. Sein rechtes Auge sieht nach rechts. Er trägt Brille. Ich sehe ihm in die Augen, als würde ich einer Fliege ins Auge sehen, weiß nicht, wohin ich blicke – in die Leere, in die Ferne, ins Nichts?
Ich spreche zu ihm, als stehe er hinter einer durchsichtigen Wand. Bin mir nicht sicher, ob er mich hört. Seine Stimme klingt leer, als käme sie von jemand hinter ihm. Nur seine Brillengläser funkeln lebendig. Er weiß nicht zu sagen, weshalb er gefehlt hat.
„Frank“, sage ich, „du bist immerhin schon sechzehn, alt genug, dich selbst zur Schule zu begleiten.“ Hat er mich gehört?
Die Mutter spricht von ihm, als wäre nicht sie zwei Köpfe kleiner als er, sondern er noch ihr „Kleiner“, den sie in den Kindergarten begleitet: „Er möchte so weitermachen wie in der Schule. Da hatte er auch immer gebummelt. Aber wir müssen ihn zur Schule zwingen.“
Ich schweige und denke: ‚Jetzt immer noch?‘ und verspreche ihr, mit ihm zu reden.
Nach der ersten Pause fehlt er. Er muss eine unermessliche Furcht vor der Schule haben.
Einmal kommt er noch zum Unterricht: Acht Wochen später. Er sitzt in der Turnhalle auf der Bank, da er keine Sportkleidung dabei hat, und sieht zu. Nach den zwei Sportstunden ist er fort. Dann sehe ich ihn nicht mehr.
Später höre ich von einem Lehrling, man habe ihm den Lehrvertrag gekündigt.
Erst zwei Jahre später erfahre ich vom PGH-Vorsitzenden, Frank arbeite in einer Schuhmacherwerkstatt – zu zweit mit einem älteren Kollegen und erarbeite bereits sechshundert Mark monatlich.
Im VEB Pentacon Friedrichshagen
Während ich vorgestern ungehindert ins Schraubenwerk zum Betriebsleiter und zum Lehrausbilder gelangte, das Pförtnerhaus war unbesetzt, die Toreinfahrt weit offen, vergehen heute etliche Minuten, ehe ich im VEB Pentacon in Friedrichshagen von der gestrengen Pförtnerin einen Besucherschein erhalte und passieren darf. Die Toreinfahrt ist geschlossen und die separate Tür für Fußgänger öffnet sich erst nach meinem Sturmklingeln mit einem Summton.
Ich betrete einen kleinen von mehreren Fabrikgebäuden umstandenen gepflasterten Innenhof, zu dem zwei Zufahrtsstraßen führen. Mein Besuch währt eine knappe Stunde.
Der Lehrausbilder, ein kleiner dunkelhaariger aufgeweckter Mann Mitte vierzig, und, wie ich von ihm erfahre, „Facharbeiter mit Auftrag, die ‚Teifis‘ zu betreuen“, empfängt mich zuvorkommend und führt mich, mich unentwegt mit Daten zu allen Details überhäufend, durch den Betrieb. Wir betreten zuerst die Werkhalle, in der die Lehrlinge zur Zeit arbeiten, währenddessen er mir laut und lebhaft die charakteristischen Merkmale jedes Lehrlings, zuerst der neuen, dann der ehemaligen auftischt. Der Maschinenlärm verschluckt Teile unseres Gesprächs, sodass ich oft nachfrage.
Uwe steht mit Schirmmütze aus blaukariertem Stoff, die fast seinen gesamten Kopf verdeckt (wie ich sehe, tragen alle Lehrlinge eine solche gewaltige Schirmmütze – wie ich erfahre, als Haarschutz). Er sitzt auf einem Hocker an einer langen Werkbank mit Bohrmaschine, vor sich ein kleines Plastegehäuse, in das er Löcher zu bohren hat.
„Es fällt ihm schwer, einen Arbeitsgang zu beschreiben, dieser gelingt ihm dann auch nicht“, sagt mir der Lehrausbilder.
Neben Uwe sitzt ein Lehrling des vorigen Lehrgangs.
„Er arbeitet den ganzen Tag unentwegt, doch bringt er kaum etwas fertig.“
Sein Name ist mir entfallen, an sein Verhalten erinnere ich mich umso deutlicher. Ein stiller, sehr verunsicherter Junge. Die geringste Bewegung, die er tat, führte er aus wie der gestörte Mechanismus eines Roboters. Jede Antwort, die ich aus ihm hervorlockte (er hatte sich nie zu Wort gemeldet), tat er holpernd mit zuckenden Gesichtsmuskeln; mechanisch, als nähme er selbst (was sein Gesicht ja verriet) nicht Anteil daran. Im theoretischen wie im Sportunterricht, verbal wie motorisch, waren seine Bemühungen stets von Lachern oder spöttischen Kommentaren seiner Mitschüler begleitet. Noch jetzt, da ich ihn sich mühend an der Bohrmaschine sehe, schmerzen mich diese Auftritte. Ich vermied sie, so gut ich konnte, nahm ihn vor Grobheiten in Schutz. – Geduld! - Geduld! -, ihn in seiner Existenz zu bestätigen, ihn nicht zu hetzen. Und immer begleitete seine „Befehlsausführungen“ ein stereotypes Lächeln. Er gehörte nicht in diesen Unterricht, nicht unter diese meist groben Jungen und Mädchen. Und – wie rührend automatisch er jede Anordnung ausführte. Mitunter ertappte ich Olaf und Andreas oder andere dabei, wie sie ihm irgendeine sinnlose Aufgabe stellten, die er auch sogleich ausführte. Olaf drückte ihm einen Besen in die Hand: „Hier, du sollst draußen die Treppe fegen!“ Er tat alles, wie ihm geheißen mit einem wie gefrorenem Lächeln und einem Blick in die Leere. Beim Fußballspiel lief er einfach hierhin oder dorthin, sah jeden mit großen Augen an, und sein Fuß traf nie den Ball. -
Franky kommt an seine Werkbank, legt eine technische Zeichnung ab, nach welcher er ein Werkzeug einzurichten hat. Betrachtet sie mit einem gelangweiltem Gesichtsausdruck, pocht minutenlang mit dem Bleistift auf das Blech, ohne sich schlüssig zu werden.
„So geht das den ganzen Tag“, meint der Lehrausbilder „Franky bringt die Norm nicht. Ist zufrieden mit dem Geld, das er verdient, und mehr interessiert ihn nicht. Wir kriegen ihn nicht zum schnelleren Arbeiten.“
„Ein Fehler von ihm?“, frage ich, „wenn er sich mit weniger Geld, also auch mit weniger Leistung von sich zufrieden gibt? Vielleicht ist das gerade DIE Menge, die er momentan zu geben in der Lage ist, ohne sich selbst aufzugeben.“ -
An der Maschine gegenüber arbeitet Timor an einer Drehbank. Er begrüßt mich mit müdem verlegenen Lächeln.
„Vielleicht schaffen wir es, dass Timor selbständig an einer solchen Drehbank arbeiten kann“, sagt der Lehrausbilder und lenkt meine Aufmerksamkeit auf einige offensichtlich wertvolle Bohrautomaten und -maschinen, an denen mir außer ihrer frischen grünen Farbe nichts Außergewöhnliches auffallen will.
Im hinteren Teil der Halle beginnt die Fertigung von Filmentwicklungsautomaten und Film- und Fototrockenmaschinen. Gussgehäuse aus Aluminium stehen gestapelt, davor Kisten voller Gummiwalzen. Der Lehrausbilder erzählt pausenlos Details, die in den komplettierten Maschinen zusammengehören, sich in meinem Kopf aber weiterhin als Details benehmen, ihn mit Exportzahlen durchschwirren und Bemerkungen zu technischen Daten, Klagen über Mangel an Arbeitskräften und Facharbeiternachwuchs. Er versteht es temperamentvoll, mich mit Einzelheiten zur Produktion derart zu belegen, dass ich nicht anders kann, als ehrfurchtsvoll dreinzuschauen und zu nicken. Außer einer schüchternen Bemerkung, die Aluminiumgehäuse stammen sicher aus einer Gießerei in Lichtenberg, in der ich vor Jahren während meiner Studienzeit mal gearbeitet habe, mein Beruf sei Former, kam ich nicht zu Wort. Er überspielt meinen Einwurf mit flüchtigem Nicken. Er hat ein staunendes Opfer gefunden und nutzt die Gelegenheit.
Als nächstes führt er mich in die Abteilung, in der Plasteplatten verschiedener Stärken gebogen und verformt zu Behältern und phantasievollen Gebilden zusammengeschweißt oder verklebt werden. Es riecht aufdringlich nach Klebstoffen. Frauen schweißen mit heißer Luft aus der Düse eines dünnen Schlauches und grauem Kunststoffschweißdraht Einzelteile zu einem Werkstück zusammen.
In einem flachen Nebengebäude, der Schlosserei, fegt ein großgewachsener schüchterner junger Mann, der auf meine Frage kein Wort hervorbringt, Metallspäne vom Boden. Der Lehrausbilder zeigt mir voller Stolz Metallbiegemaschinen, die unter den Fenstern stehen, zwei Punktschweißgeräte: „zwei äußerst nützliche Werkzeuge!“, sowie die Bastelarbeit des Meisters dieser Werkstatt, kunstgewerbliche Arbeiten aus Blech, mit denen unter anderem auch das Ferienheim ihres Betriebes ausgeschmückt worden sei: Schilf mit „Schmackeduzien“, einem Reiher, durchzogen von Wellen.
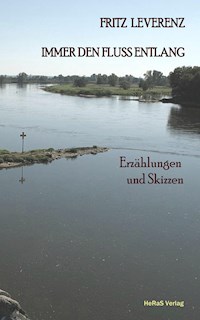
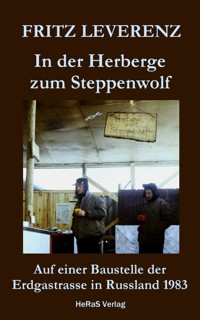
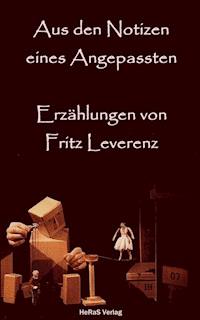

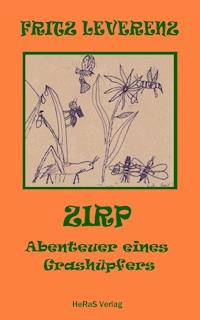

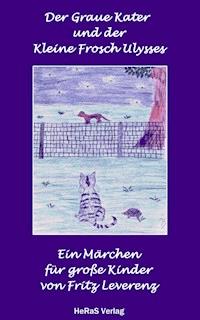







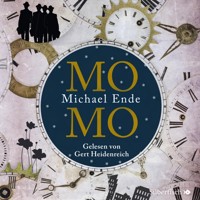



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










