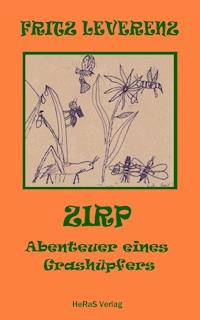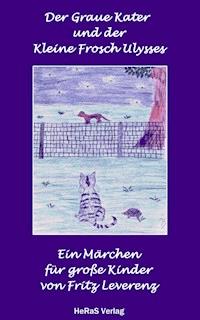Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Den Titel "Aus den Notizen eines Angepassten" entnahm ich meinen gleichlautenden Lesungen 1992 in Köpenick im "Club 17" sowie im "Bürgerhaus Grünau". Der Titel impliziert den Widerspruch, unter dem Schreibende in der DDR gearbeitet und gelebt haben. Denn wer das Leben unter der Anpassung beschreibt oder davon erzählt, widersetzt sich ihr zugleich. Die Einschätzung, ein "typisch angepasster DDR-Bürger" zu sein durch den Personalrat, dessen Leiter kurz darauf aufgrund einer IM-Tätigkeit vom Dienst freigestellt wurde, brachte mich 1992 auf den Gedanken, aus meinen Notizen zur DDR-Zeit zu lesen. Mir geht es dabei nicht um die simple Anpassung, die so gern undifferenziert und oberflächlich, als willfährig und widerstandslos ergeben gedeutet wird - (auf der einen Seite die Willfährigen, Bleibenden, auf der anderen Seite die mutigen Ausreisenden und die mutigsten Mauerüberwinder.) Diese beiden Darstellungen interpretieren am Leben vorbei, erklären weder den DDR-Alltag, noch den weitgehend gewaltlosen Umsturz. Deshalb ja meine Notizen seit vierzig Jahren, deshalb meine kurzen und hoffentlich nicht zu schlecht erzählten Texte, in denen ich zeigen möchte, dass die sogenannte "Anpassung" bei den allermeisten Menschen in der DDR ein oft stiller Widerstand in unzähligen, scheinbar nebensächlichen Alltäglichkeiten gewesen war, der in der Summe mit der Opferbereitschaft der Flüchtlinge und der Ausreisenden letztendlich zu der relativ stillen, und größtenteils friedlich verlaufenden Maueröffnung geführt hatte. Und diese Allermeisten haben es verdient, gerecht beurteilt und in der Deutung der DDR-Geschichte nicht unterschlagen zu werden. Im Interesse eines gesunden Nebeneinander in Deutschland dürfen wir die einen nicht gegen die anderen aufwiegen und schon gar nicht ausspielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritz Leverenz
Aus den Notizen eines Angepassten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Am Nachmittag, am Abend
Das letzte Zimmer
Der schöne Winter und das Alphabet
Der Tintenfleck
Die Geschichte vom krummen Lindenbäumchen
Ein friedlicher Morgen
Frühjahrsnovelle
Frühlingsanfang
Hundesonntag
Lied der Grasmücke
„Möchten Sie etwas für die Umwelt tun?“
Nahe der Stadt
Traumbilder
Tanjas Bild
Der Erfinder und die Störenfriede
Gespräch am Heiligen Abend
Der Spielzeugverkäufer
Impressum neobooks
Am Nachmittag, am Abend
Er saß auf der Couch, etwas vorgeneigt, als lauschte er. Plötzlich konnte er die Stille hören. Noch an keinem Abend war sie ihm so tief und beruhigend erschienen. Er hörte sie, nachdem auf der Straße ein schweres Baufahrzeug vorübergerumpelt war. Es schien, als näherte sich ihm dieses zärtliche Gefühl hier in der Stille; dieses Gefühl, das er am Nachmittag verloren zu haben glaubte.
Der Schein der Nachttischlampe drang durch die angelehnte Schlafzimmertür. Er hörte Lina in einer Zeitschrift blättern. Sie hüstelte nervös. Er wusste, sie wartete auf ihn. Vielleicht spürte sie seine Veränderung. In den Jahren ihrer Ehe hatte er zu oft vergeblich gehofft, sie käme, wenn er sich einsam fühlte, als dass er darüber hinweghörte. Er konnte jede Nuance ihrer Stimme, ihrer Mimik, ihrer Gestik, ihrer noch so kleinen Gewohnheiten deuten. Meistens war er es gewesen, der sich näherte. Kürzlich in der Straßenbahn hatte eine junge Mutter ihren dreijährigen Sohn aus irgendeinem Grund ärgerlich von sich geschoben, und der Kleine hatte sich nicht wegdrängen lassen, sondern sich mit aller Kraft gegen ihre Beine gestemmt. Er hatte den Kleinen sofort verstanden.
Erst mit den Jahren hatte er Linas Scheu erkannt, mit der sie zu ihm kam, diese Furcht, wie leise Fremdheit, die sie nicht ablegte. Lächelte sie, berührte ihn wie zufällig mit einem Finger, oder setzte sich unaufgefordert in seine Nähe, fühlte er sich geborgen. Obgleich er sich noch immer wünschte, sie näherte sich, streichelte ihn, und er müsste nicht um Zärtlichkeit betteln, fühlte er sich mit ihrer beider Suche zueinander verbunden.
Vor einer Stunde bereits, während er eine Kurzgeschichte von Tschechow gelesen hatte, um sich abzulenken, war er eingenickt. Doch er blieb sitzen. Er konnte jetzt nicht zu Lina, als wäre nichts vorgefallen, obwohl sie schon häufig zu verstehen gegeben hatte, für wie zweitrangig sie es hielt, würde er zu anderen Frauen gehen. Auch darüber sprechen konnte er heute nicht. Ihm schien, er habe dieses Mädchen in Lina verraten, dessen Wesen er mit dem Heranwachsen seiner Tochter verstehen lernte. Er fühlte sich erschöpft, an allen Äußerlichkeiten dieses Abends uninteressiert, als habe er zerrissen, was ihn bislang mit allen Fasern gehalten hatte: Nichts zu tun, was er nicht mit ganzem Herzen tun konnte.
Ellen hatte er zufällig in der S-Bahn wieder getroffen. Sie war klein, dünn, strähnig blond, trug eine kurzärmlige weiße Bluse, einen karierten Faltenrock, aus dem etwas zu gerade weiße Beine hervorsahen. An ihren wasserblauen Augen hatte er sie wiedererkannt und an den schmalen Lippen, die ihr im Kontrast miteinander einen Ausdruck sanfter Ironie gaben. Er hatte sie in der Schulzeit geliebt mit heimlicher Verehrung, mit der Jungen häufig lieben. Jetzt fiel ihm auf, dass er als Dreizehn- oder Vierzehnjähriger ein Gesamtbild aus wenigen Einzelheiten von ihr besessen hatte, das ihn bis in seine Träume hinein ausfüllte: ihre humorvoll lächelnden Augen, ihre Lippen, die sie zusammenkniff, als scheute sie sich zu sprechen, wie sie dabei ihren Kopf senkte, ihre kindliche helle Stimme, ihre stille Heiterkeit. Und jetzt klebte sein Blick an unwesentlichen Details, die sein jahrzehntelanges Bild von ihr verwischten. Er versuchte dessen Konturen aufzufrischen: Sie mit blondem gescheiteltem Haar, das rechts von einer Spange gehalten, ihr Gesicht freihielt; am Ausgang der Felshöhle in der Sächsischen Schweiz auf das Geländer der Treppe gestützt, dem Klassenlehrer zugewandt, der die Gruppe fotografierte. Er selbst in weiten ausgebeulten Trainingshosen und engem Pullover im Profil, nur Blicke für sie, ihr zugewandt.
Zweimal hatten sie sich im Café "Espresso" am Alexanderplatz, getroffen und waren einmal ins Kino gegangen, wo sie seine Hand gehalten und er sich recht tatenlos auf die Filmhandlung konzentriert hatte. Er konnte es nicht leugnen, seine heutigen Empfindungen zu Ellen ähnelten kaum noch denen aus seiner Erinnerung, dennoch war er ihrer Verabredung ins Strandcafé Grünau gefolgt.
Ellen lehnte halb sitzend auf einem Steinpfosten des niedrigen Holzzaunes und begrüßte ihn lächelnd. Sie trug ein dunkelrotes Kleid, in dem ihr Gesicht noch durchscheinender wirkte als sonst. Ihr Haar trug sie hochgesteckt, sodass sein Blick an ihrem schlanken Nacken festhielt. Das Café, so war auf einem Zettel an der Gartentür zu lesen, blieb einige Tage "wegen Reparatur der Tanzfläche" geschlossen.
"Gehen wir zu mir“, sagte sie, als überraschten sie die Schließtage nicht. Es klang ganz selbstverständlich. Er erschrak, fühlte, wie sein Lügen sich in ihm breitmachte und antwortete nur mit einem Schulterzucken. Weshalb dachte er, ich verspiele jede Sympathie. Zugleich verspürte er nervöse Ungeduld, sie zärtlich zu berühren. Er lächelte gezwungen und blieb wortkarg. Dieser Nachmittag, sagte er sich, ist das Äußerste, worauf du dich einlassen darfst, widersprach ihrer Einladung mit sich unzufrieden, aber nicht heftiger als mit einem mürrischen Gesicht.
Sie überquerten die lange Brücke, fuhren drei Stationen mit der Straßenbahn und gingen auf einem Trampelpfad zwischen Flachgaragen zu einem Altneubau. Während des gesamten Weges blieb er schweigsam. Ellen redete fast ohne Pause von ihrer Arbeit als Drogistin. Er erinnerte sich, dass sie, was damals noch unüblich war, in Oranienburg die Mittelschule besucht hatte, um Apothekerin zu studieren, während er zur Erweiterten Oberschule gegangen war. Im Gegensatz zu ihm war sie konsequent ihren Weg gegangen. Er folgte ihr gedankenverloren.
Vor der Wohnungstür suchte sie einige Sekunden lang an ihrem Schlüsselbund den passenden Schlüssel. In Gedanken spielte er mit einem Vorwand, sich zu verabschieden. Dann aber schloss sie mit entschuldigendem Lächeln auf, trat vorsichtig in den Flur, als dürfte sie ihn jetzt nicht stören. Er folgte zögernd. Wie behutsam sie mit ihm umging, doch schreckte ihre Rücksichtnahme ihn auf wie ein Albdrücken.
In der Wohnung hing der Geruch nach Terpentin, frischer Lackfarbe und Bohnenkraut. Ellen sprach jetzt leise mit ihm und doch ungezwungen. Und während er seine Jacke an den Haken neben der Tür hängte und die Schuhe von den Füßen streifte, antwortete er mit hölzernem Humor, trocken, ironisch, schlagfertig, wie um sich selbst zu ermutigen.
"Komm", rief sie mit leiser Euphorie in der Stimme, die ihn bekümmert durchatmen ließ, "ich zeige dir die Wohnung!" Er trottete hinter ihr her, betrachtete unaufmerksam das Kinderzimmer, begutachtete das Bad mit den drei, an die hellblaue Decke gemalten, Schwänen; lobte die Einrichtung ihrer winzigen Küche, die frisch mit Pariser Blau lackierten Gewürzregale, die Blumenkästen mit Petunien auf dem Fensterbrett, neben denen Farbbüchsen und Gläser mit Pinsel standen. Im Wohnzimmer, einer geräumigen Mansarde standen Korbmöbel und ein gewaltiger gebeizter Kleiderschrank. Ihn interessierte die Wohnung jedoch nicht ernstlich, da er wünschte, sie ginge ihn nichts an.
Nach dem Rundgang verschwand Ellen in der Küche. Er setzte sich auf die Ledercouch und blätterte uninteressiert und nervös in einer Reclambroschüre, die auf dem Tisch lag.
"Was möchtest du essen?", kam es aus der Küche. Um Himmelswillen!, wollte er sagen, nicht auch noch essen! Doch wollte er nicht ungeschickt erscheinen und antwortete möglichst gelassen: "Einen Apfel, bitte."
"Kaffee oder Kakao?"
"Na, meinetwegen, Kakao." Er fühlte sich zu Hause und zugleich von ihr vereinnahmt. Er hatte ihr erzählt, er trinke gern Kakao. Was ging das sie an? Das, was er sonst gern tat, hatte nichts mit dem zu tun, der er hier in dieser Wohnung war.
"Fang!", rief sie sanft von der Küchentür und warf ihm einen Apfel zu. Dann kam sie mit zwei geblümten Henkeltöpfen. Er kaute hastig, saß wie auf dem Sprung. Sie setzte sich mit angezogenen Beinen gegen die Armstützen gelehnt und trank in kleinen Schlucken. Unter ihrem Kleid sahen ihre zierlichen Füße hervor. Ihr Gespräch kam nicht in Fluss, wirkte albern, aufgesetzt. Er redete Belangloses, vermied das Thema "Familie", kam auf Bücher zu sprechen. Ellen sprach von sich, von unruhigen Nächten im Haus. Ein alter Mann aus der Wohnung nebenan wäre kürzlich gestorben. Er hätte an die Wand geklopft in der Nacht und um Hilfe gerufen. Die Nachbarn wären im Treppenhaus zusammengelaufen in Nachthemden und Pyjamas, und jemand hätte den Rettungsdienst alarmiert, da der alte Mann keine Luft bekam.
Dann schwiegen sie. Die Nachricht vom Tod des alten Mannes hier im Haus erschütterte ihn mehr, als er wahrhaben wollte. Nur die Vorstellung von der Versammlung der Nachthemden ermunterte ihn.
"Ein Psychologe würde aus der Stellung, in der wir beide zueinander sitzen, interessante Schlüsse ziehen", sagte sie leicht vorwurfsvoll und massierte mit schmerzvollem Gesicht ihr Bein.
"Nicht nur ein Psychologe", sagte er leise wie zu sich selbst, "auch ich finde uns interessant." Er saß eine Armlänge von ihr entfernt, etwas weggeneigt und sah ihr nachsinnend in die Augen. Vielleicht wäre ihrer beider Zukunft ohne die damalige Traumstörung näher beieinander verlaufen. Ellen stellte ihren Kaffeetopf auf den Tisch, rückte näher, kraulte ihm den Nacken.
Sie saßen an einem Abend im Schein einer trüben Glühlampe auf dem Heuboden, auf dem sie übernachteten, und sangen mit dem Lehrer und seiner Frau Volkslieder. Hinter ihnen betrachteten sich drei Jungen die Landkarte der Umgebung. Am anderen Tag wollte die Klasse zur Felsenbühne wandern. Er saß mit Ellen Rücken an Rücken, und es gab für ihn nichts auf der Welt, als sie beide im Dämmerlicht, der Geruch nach Heu, die Wärme ihres Rückens, der Klang ihrer hellen Stimme, die in ihm summte, ihn ausfüllte und ihn hinaustrug in die Weite seiner noch unbekannten Jahre. Als sich ihm plötzlich der Griff eines Wanderstockes um den Hals legte, ihn nach hinten zerrte. Er fiel mit dem Ellenbogen mitten in die Wanderkarte, die zerriss. Der Besitzer der Karte gab ihm eine Ohrfeige. Er, so brutal aus des Traumes Süße gerissen, holte mit der Faust aus, traf dessen Stirn und brach sich einen Handknochen. So endete der Abend und ihre Annäherung jäh. Während seine Mitschüler am anderen Tag wanderten, legte ihm ein Arzt in Hohenstein die Hand in Gips. Bis in alle Ewigkeit würde er dem Übeltäter die Attacke gegen seinen Hals nicht verzeihen.
Einen Moment lang hielt Ellen inne und fuhr ihm nachdenklich, als würde sie malen, mit einem Finger zwischen Hals und Ohren entlang. Er wünschte, er hätte den Nachmittag hinter sich und sehnte sich doch nach ihren Händen auf seiner Haut. Sie schmiegte sich an ihn. Er saß wie erstarrt und erinnerte sich, dass sie ihm erzählt hatte, seit ihrer Scheidung im Frühjahr vergangenen Jahres hätte sie sich keinem Mann genähert. Nicht einmal tanzen wäre sie gegangen und in Cafés oder Restaurants nur mit einer Freundin. Sie hätte sich wehrlos gefühlt, ihre “Solorolle” erst wieder lernen müssen, die Rolle, Initiative zu ergreifen. Er legte seine Arme um sie und versuchte sie zu küssen. "O", sagte sie überrascht und hielt sanft seinen Kopf. Sie war sehr schlank. Seine Hände begegneten sich ungewohnt früh. Die Wärme ihres Körpers schreckte ihn plötzlich auf. Er löste sich von ihr, ging in den Flur, stand vor den Garderobenhaken und blickte unentschlossen auf seine Jacke. Ellen folgte ihm langsam auf Strümpfen, lehnte sich an ihn.
"Bleib", flüsterte sie ihm ins Ohr und streichelte seinen Rücken. Er schloss die Augen. Es roch nach Flieder und Terpentin. Auf dem Hof schlug jemand die Klappe eines Müllcontainers zu. Sie klammerte sich an seine Schultern. Behutsam, wie aus Höflichkeit, hielt er sie mit den Fingerspitzen. Durch ihr dünnes Kleid spürte er ihre Rippen. Sie knöpfte ihm das Hemd auf, streichelte seine Brust, zupfte an den Haaren und begann, es ihm auszuziehen. Er stand reglos und starrte auf eine bläuliche Grafik neben dem Spiegel. Dann streifte er sich schnell die restlichen Kleidungsstücke vom Körper und stand nackt und etwas unbeholfen vor ihr. Das bisschen Lust, das ihn dazu getrieben hatte, den Nachmittag bei ihr zu bleiben, begann sich in einer weiten Leere zu verlieren. Er fühlte sich nackt bis auf den Grund der Seele. Wie, um sich gegen dieses unangenehme Gefühl zu schützen, nahm er ihre Hände, legte sie auf seine Brust und küsste ihren Hals. Sie knurrte wohlig.
"Du kennst mich nicht“, sagte er, starrte wieder auf die Grafik und sah, dass sie einen kahlen Baum darstellte, "du kennst mich nicht wirklich."
"O, doch", sagte sie, "du hast dich seit damals nicht verändert."
"Den ganzen Vormittag im Unterricht, bei dieser Wärme", sagte er ablenkend. "Ich bin verschwitzt." Er rückte von ihr weg, ging ins Bad, setzte sich auf den kalten Wannenrand. Als er duschte, fühlte er die Situation so aufdringlich vertraulich, dass ihm flau wurde. So deutlich hatte er noch nie erlebt, wohin es ihn treiben konnte, wich er in entscheidenden Momenten von der Wahrheit ab. Umständlich lange trocknete er sich ab, stieg auf Zehenspitzen über den Kokosläufer, das Badetuch um den Körper geschlungen. Ellen stand noch angezogen und mit verschränkten Armen ans Fensterbrett gelehnt und betrachtete ihn nachdenklich lächelnd. Aus dem Rekorder auf einem Eckschränkchen klang leise Panflötenmusik.
"Das Duschen hat mir gut getan“, sagte er und versuchte dabei locker und kraftvoll zu erscheinen. Er dehnte seinen Brustkorb und reckte sich. Betont unbeschwert warf er das Badetuch auf einen Stuhl, kroch rasch unter das dicke Federbett und drehte sich zur Wand. Der kühle Dederonbezug auf seiner Haut ernüchterte ihn. Er schämte sich seiner Nacktheit wie eines geheuchelten Versprechens. Trotz einer neugierigen Lust auf ihren Körper, fühlte er sich müde, entsetzlich fremd, und wollte nur schlafen. Noch gab es die Chance, unbeschadet diesen Nachmittag zu überstehen. Nach kurzem Schlummer würde er aufstehen, verträumt, gähnend, sie würden Kaffee trinken, wirklich miteinander reden, denn keiner hatte heucheln oder betteln müssen, und er würde seine Kindheitsillusion mit in die Jahre nehmen.
Er hörte es rascheln. Ellen stolperte und hielt sich am Stuhl, der über den Boden scharrte. Achtlos warf sie ihre Kleidungsstücke auf einen Wäschekorb unter dem Fenster, ließ das Rollo herunter und huschte hinaus. Minuten später kroch sie zu ihm unters Deckbett und schmiegte sich fröstelnd an seinen Rücken. Behutsam, wie erkundigend, ließ sie ihre Finger über seinen Körper gleiten. Einige Wassertropfen von ihren Schultern fielen auf seinen Rücken und rannen an ihm herunter. Obwohl ihre Berührung ihm guttat, fühlte er sich steif, drehte sich jedoch zu ihr und streichelte sie mit einer Hand. Ihre Haut erschien seinen Fingerspitzen etwas rau. Sie roch betäubend nach einem Fliederparfüm und ein wenig nach Schweiß. Es machte ihn verlegen, sie nicht liebevoller berühren und nicht küssen zu können. Er umarmte sie. Ihre eckigen, etwas hastigen Bewegungen und ihr leises Stöhnen, mit dem sie immer wieder seinen Namen flüsterte, stachelten seine Lust an oder etwas in ihm, das gern Gewalt ausübte. Er presste seine Lippen aufeinander, als wollte er nichts von der Situation in sich hineinlassen. Dann küsste er sie, weil er sie für Augenblicke dafür liebte, wie leicht ihr Körper unter seinen verhaltenen Bewegungen bebte.
"Bitte, sag' etwas Liebes!", flüsterte sie mit geschlossenen Augen. Ihm lag auf der Zunge, ihr einige nette Worte zu sagen, sie nicht betteln zu lassen. Doch brachte er kein Wort heraus und strich mit seiner Nase über ihre Augen. Seine Heuchelei sollte diesen Nachmittag nicht überdauern. Er spürte seinen Verrat gegen das kleine Mädchen Lina, gegen das Vertrauen, das die vielen Jahre bedeuteten, die sie mit ihm lebte. Das Erleben, dachte er mit plötzlicher Klarheit, sind persönliche Beschädigungen, man erfasst sie in den Details. Er setzte sich aufrecht und wollte aus dem Bett, sich anziehen. Doch sie hielt ihn umarmt und sagte brummelnd: "Bitte, streichle mich. Du darfst danach nicht sofort aufstehen." Er erschrak. Glaubte sie, er wüsste nicht, wie liebevoll er mit einer Frau umzugehen hätte; er wäre plump, grob und gefühllos? Doch auch jetzt konnte er nicht sprechen, und streichelte sie mit leisem Trotz. "Bei dir fühle ich mich geborgen", sagte sie. Worte, die ihm wohl taten.
"Ja“, sagte er und bemühte sich, nicht ironisch zu wirken. Er küsste Ellen auf die Wange, erhob sich rasch, nahm das Handtuch und ging ins Bad. In der Wanne hockte er sich unter den Wasserstrahl und weinte. Als er aus dem Bad kam, saß Ellen in Unterwäsche auf dem Bett und sah ihn fragend an. Er hoffte, sie würde nicht merken, dass er geweint hatte, ging in den Flur, sammelte seine Kleidungsstücke ein, zog sich an, sagte Belangloses über die Reisstrohmatten, zum Terpentingeruch. Sie trat aus dem Zimmer.
"Entschuldige, ich wollte dich vorhin nicht kränken."
"Ach, das ist es nicht", sagte er.
"Sehen wir uns wieder?", fragte sie und lehnte sich an ihn.
"So der Zufall es will", antwortete er leise. Brauchte sie Worte? Hatte sie seine Leblosigkeit nicht gespürt?
"Du machst es dir leicht."
"Ich weiß nicht, ob 'leicht' das passende Wort ist." Er küsste sie auf die Wange, schob sie sanft zur Seite und ging zur Tür.
Lina war eingeschlafen. Er hörte sie leise schnarchen. Die Lampe hatte sie brennen lassen, obwohl Licht sie beim Einschlafen störte. Er war wieder angelangt in Linas und seiner Einsamkeit, in der sie beide einander suchten, sich so schwer fanden und doch einander hielten.
Lange saß er regungslos. Nie hatte er Stille und Alleinsein als so wohltuend empfunden. Dann, während er sich auszog, hörte er die Stadtnacht: die S-Bahn, den dreisten Lärm später Autos, eines bummelnden Ikarus-Busses und den Wind in den Pappeln am Haus.
Das letzte Zimmer
Der Vater saß auf dem Bett und blickte erschrocken vor sich hin in eine unbestimmte Leere, als erlebte er gerade einen bösen Traum. Mit dem rechten Arm stützte er seinen kräftigen aufgeschwemmten Körper und atmete hörbar. Sein Unterhemd hing lappig feucht, und sein dünnes graues Haar klebte ihm wirr am Kopf.
Der Notarzt hatte einen Infarkt festgestellt und war hinausgegangen zum Wagen. Der Krankenfahrer stand unschlüssig im Zimmer, die Hände in den Taschen seines blaugrauen Kittels.
Der Vater erhob sich, stand gebeugt abwartend, hielt den seit Jahren gelähmten Arm an sich gedrückt wie ein unnützes Spielzeug, von dem er sich nicht trennen möchte. Die Mutter und der Sohn halfen ihm, die Arme ins Hemd und in die Jacke zu bekommen und Schuhe anzuziehen. Dann stand die Mutter am Kleiderschrank und drehte die Hände ineinander. Sie hatte diese Minuten seit Langem vorhergesehen, jetzt aber fiel es ihr schwer, zu verstehen, dass ihre Geschäftigkeit hier nicht mehr gefragt war.
Der Sohn hielt den Einweisungsschein für das Krankenhaus in den Händen. Seit Wochen kam er wieder einmal zu Besuch, zufällig. Aber wie viel von den Zufällen waren tatsächlich zufällig? Er besuchte die Eltern häufiger als früher, hatte sich für einen Tag in der Redaktion freistellen lassen. Nun stand der Vater da wie ein Kind, und er empfand das Bedürfnis, ihn zu umarmen, zu trösten. Doch sie hatten sich nie umarmt, und so blieb er, wo er war, steckte ihm verlegen einen Hemdzipfel in die Hose.
Das konnte ja nicht gut gehen, dachte der Sohn, das hält ja kein Herz aus, dieser schwere Körper und die kaputt gerauchten Bronchien. Und er musste daran denken, dass sie beide zu selten offen miteinander gesprochen hatten, als dass sie jetzt miteinander schweigen konnten. Deshalb wollte er reden. Er wollte dem Vater sagen, dass er an ihm seine Festigkeit und seine Klugheit gemocht hatte, dass er wohl sah, wie verändert er war, wie viel weicher und mitfühlender er geworden war ...
“Kommen Sie, Herr Beyerle”, sagte der Krankenfahrer laut und freundschaftlich, als kannte er den Vater seit Langem. Der Sohn betrachtete ihn verwundert. Der Fahrer sprach so wohltuend, dass er sich fragte, ob das die ständige Übung machte oder eine nie versiegende Güte. “Kommen Sie. Wir fahren ein Stück in die Umgebung.” Der Fahrer besaß einen vorspringenden Bauch und wirkte nur wenig jünger als der Vater.
Wären alle fort, dachte der Sohn, wäre ich mit Vater allein, könnte auch ich ihm solche freundlichen Worte sagen.
Sie fassten den alten Mann von beiden Seiten unter die Arme, und der Krankenfahrer sagte: “Das schaffen wir schon, Herr Beyerle. Jetzt spazieren wir erst mal nach draußen. Immer schön langsam. Immer mit der Ruhe.”
Bedächtig gingen sie zur Tür. Des Vaters schlurfender, gehorsamer Schritt hatte etwas Endgültiges, Unumkehrbares. Jede Minute dieses Abends hatte etwas Abschließendes: die Wortlosigkeit der Mutter, die Fürsorge des Sohnes, die Freundlichkeit des Pflegers.
Auf der Schwelle riss der Vater an den Armen, hielt inne und wandte sich um. “Nein! Ich gehe nicht! Lasst mich hier!” Er sah erschrocken zu seinem Bett, zum dunklen Fenster mit dem Kakteenregal, hinter dem der Hof lag mit den kleinen Gärten der Mieter.
“Im Krankenhaus, da haben sie die besseren Mittel, dir zu helfen”, sagte der Sohn mit unsicherer Stimme.
“Da werden Sie von morgens bis abends gut versorgt, Herr Beyerle”, sagte der Pfleger.
Dann schien der Vater sich zu erinnern, wie er vorhin, nach dem Erwachen aus der Ohnmacht, sich entsetzt geäußert hatte über seine Rückkehr ans Licht. “Ich bleibe nicht dort!”, sagte er mit leisem Trotz, und seine dicken bläulichen Lippen zogen sich schmollend zusammen.
“Vatichen, ich besuche dich jeden Tag”, versprach die Mutter.
Mit einem Ruck wandte sich der Vater plötzlich zur Tür, als fiele ihm ein, dass es nie seine Art gewesen war, weich zu werden oder Gefühle zu zeigen.
“Ich besuche dich schon morgen”, sagte die Mutter und setzte dem Vater eine karierte Schirmmütze auf den Kopf. Dem Sohn reichte sie des Vaters Krückstock, steckte ihm verstohlen eine Handvoll Münzen in die Jackentasche und deutete mit den Augen zum Pfleger. An der Wohnungstür verabschiedeten sie sich zerstreut. Der Sohn drehte sich noch einmal um und nickte ihr beruhigend zu. Acht Jahre lang hatte sie ihren Mann gepflegt, und nun stand sie da mit großen Kinderaugen. Jeder von uns hat heute Abend Kinderaugen, dachte der Sohn.
Als sie dem Vater in den Wagen halfen, fielen große Tropfen aus der Dunkelheit.
“Es regnet”, rief die Mutter.
“Ja”, bestätigte der Sohn, “ein schwerer warmer Sommerregen.”
Der Vater saß im Krankenstuhl hinter der Fahrerkabine. Er klammerte sich mit der gesunden Hand an die Armlehne, schwankte aber in jeder Kurve haltlos vor und zurück. Mit großen Augen blickte er wieder vor sich ins Leere.
Der Sohn saß unter dem niedrigen Wagendach halb liegend auf der Trage. Der Barkas federte hart, und er hielt sich am Rohrgestell fest.
Wir müssten dich zu Hause behalten, dachte er. Aber Mutter verkraftete deine Pflege nicht länger. Zwölf Jahre ist sie jünger als du. Sie wirkte eben traurig, aber erleichtert. Ein halbes Leben hat sie dir gedient, dich verwöhnt, seit eurer Heirat nach dem Krieg, als Papa nicht zurückgekehrt ist.
Der Wagen federte aufgeregt wippend, und dem Vater rutschte die Schirmmütze in die Stirn, das gab ihm einen verwegenen Ausdruck. Sein Gesicht blieb indes fragend, blickte wie horchend durch die nassen Scheiben ins Dunkel.
Den Sohn beunruhigte das ergebene Schweigen des Vaters, welches er an ihm nicht kannte. Er vermisste sein spöttisches Lächeln, seine mitunter sarkastische Ironie, die sie in den letzten Jahren zeitweise gemeinsam gegen Dritte verbunden hatte. Aus diesem duldsamen Schweigen, aus diesen kindlichen, großen Augen fühlte er die Sprachlosigkeit heraus, die als Druck auf ihm lastete.
Die Geschwindigkeit des Wagens verursachte dem Vater Atembeschwerden, wie während eines anstrengenden Laufes. Die Lichtfetzen, die von den Scheiben durch den Regen verzerrt vorüberhuschten, der quäkende Motor, das blecherne Trommeln des Regens auf das Dach, das leise Singen der Reifen auf dem nassen Asphalt, erzeugten in ihm die Vorstellung eines rasch ablaufenden Lebens, das irgendwann, bald, inmitten der Dunkelheit abrupt zum Stillstand käme. Warum lief plötzlich alles so schnell, ohne Verzögerung? Der Sohn fühlte sich gehetzt. Dieses Schweigen, das ihm die Summe ihrer gemeinsamen Jahre verdeutlichte, wollte er abschütteln, einfach bloß reden.
“Wir sind auf der Straße nach Potsdam”, sagte er darum bemüht belanglos. Wieder hörte er sich selbst sprechen, und eine unausweichliche Trauer breitete sich in ihm aus. Immer hatte er im Gespräch mit dem Vater sich selbst sprechen hören, so als wunderte er sich, was es mit dem Vater zu besprechen gäbe, als sei er überrascht, von ihm angehört zu werden. Selbst in Gesprächen mit anderen hatte ihn diese Unsicherheit nie ganz verlassen.
Der Vater hob den Kopf. “Auf der Straße, die an Hohen Neuendorf vorbeiführt?” Er fragte dies zaghaft, als gäben ihm die Erinnerungen die Chance, sich auf einen Rückweg zu orientieren.
“Ja, auf dieser neuen Asphaltchaussee nach Hennigsdorf”, sagte der Sohn. Er sprach möglichst heiter, unbeschwert. Nur keine Schatten, nur jetzt nicht unterliegen. Du hattest mich selten ohne Heiterkeit erlebt. Vielleicht war ich dir deshalb ein Rätsel. Dabei hattest du meine Heiterkeit provoziert. Dieses Lachen eines Clowns. Oder nahmst du es mir übel? Wie sie es in der Redaktion mir noch heute ankreideten als Leichtfertigkeit, als sonniges Gemüt. Woher kam dieser Zwang, so lange zu reden, mich reinzusteigern ins Reden, bis die anderen lachten?
Einmal, als Jugendlicher, fuhren sie mit dem Rad an den Liepnitzsee, Mädchen und Jungen. Es war sonnig, aber noch zu kalt, um zu baden. Sie saßen im Wald unter Buchen und Kiefern auf trockenem Laub und Gras. Da spielte er den Clown. Damals wurde er sich dessen zum ersten Mal bewusst. Er konnte sich an das Thema nicht mehr erinnern, nur, dass sie saßen und lachten, lange, bis zur Erschöpfung. Noch nach drei Jahrzehnten spürte er, wie ihm Gesicht und Bauch geschmerzt hatten. Er entsann sich auch dieses leisen Misstrauens, dass sie vielleicht über ihn lachten und dass er trotz ihrer Heiterkeit für sich allein blieb.
Heiterkeit als Widerstand gegen deine Strenge, Vater. Vielleicht fandest du sie aufsässig. Die andere Möglichkeit aber hieß: Selbstaufgabe, mich gegen mich selbst auf deine Seite schlagen. Du hattest mir die Heiterkeit eingebläut. Aber ich hatte mich nie darum bemüht, mich von einer Strafe zu befreien. “Schmuse mit Vati, bitte ihn!”, riet Mutter. Doch ich hätte Schlimmeres ertragen, bloß um nicht bitten zu müssen. Vielleicht kamen wir uns beide darin sehr nahe. “Wir sprechen uns noch”, sagtest du manchmal. Beispielsweise hatte ich Zucker genascht, zu Zeiten, als dieser zu den Nachkriegsraritäten zählte. Und wie häufig folgten diese Gespräche, die der Rohrstock diktierte, und als er ihn hinter dem Kleiderschrank verschwinden ließ, die Haselrute. Vielleicht gedieh dieser hartnäckige Optimismus auch während der mehrwöchigen Stubenarreste, die du verordnet hattest, wenn die Lehrer mir auf dem Zeugnis “schwatzhafte” Mitteilsamkeit bescheinigten.
Tiefes Mitleid mit dem Vater, mit sich beiden empfand der Sohn, mit ihrer langen unausgesprochenen Zeit, die begann, seit der Vater als “Onkel Kurt” ins Haus gezogen war. Solange er denken konnte, hatte er Mitleid mit dem Vater empfunden, der ihn so wenig verstand. Mitleid sogar in der Angst, wenn Schläge drohten. Weil er spürte, dass der Vater sich an eine äußere einschüchternde Macht hielt, sie für unentbehrlich hielt und damit doch sehr allein war. Denn nie hatte er Gewalt oder gar Macht über seine Empfindungen erhalten.
Der Vater hatte dem Sohn nie viel zugetraut. Als er aus der Schlosserei fortwollte, um ein Journalistikstudium zu beginnen, sprach der Vater mürrisch darüber. “Wer soll arbeiten, wenn alle studieren?” Gleichzeitig erzählte er bewundernd von einem jungen Mann aus der Nachbarschaft, dessen Kritiken zu Fußballspielen man sogar in der Zeitung lesen konnte. Er lobte Schriftsteller, Schlagersänger, Musiker. Erst viele Jahre später, in Gesprächen mit Bekannten, äußerte er heimlichen Stolz auf ihn, den “Redakteur”.
Aus dem Vorkriegsleben des Vaters kannte er nur Bruchstücke, die Mutter erzählt hatte. Der Vater ließ nur hin und wieder zusammenhanglose Details ans Licht. Er festigte den Eindruck, er könnte davon nicht reden, er würde damit eine alte Wunde aufreißen. So blieb dem Sohn die erste Hälfte seines Lebens geheimnisvoll kurz: Ein glücklicher Schuljunge vor dem Ersten Weltkrieg, seelisch und körperlich schwer krank, als dessen Vater an Tuberkulose im Feldlazarett starb. Auf Fotos aus der Zeit danach sah er ihn selten lächeln. Er lernte Dreher und in der Freizeit Geige spielen. Für ein Musikstudium reichten weder seine Ersparnisse noch die der Eltern. Als arbeitsloser Dreher schlug er sich mit Geigespielen durch in Berliner Cafés. In den Dreißigerjahren erhielt er Arbeit in einem Werkzeugmaschinenbetrieb. Dort leitete er die Werkkapelle, wurde wegen spezieller Rüstungsaufträge des Betriebes nicht eingezogen, schloss sich nach dem Krieg einem Tanzorchester an. Bei dessen ersten Auftritten lernte er Mutter kennen und sie heirateten.
Es rankten sich auch Träume um den anderen Vater, um “Papa”, von dem der Krieg nichts weiter zurückließ als zwei, drei nebulöse Erinnerungen, einen Karton voller Fotos und gelegentliche Gespräche mit Mutter über ihn. “Papa” wurde zum Traumhelden, dem er in Körpergröße und Muskelkraft nacheifern wollte, er unterstützte den Sohn in allem. Der Vater indes konnte sich nicht dagegen wehren.
Dabei hatte er ihn bewundert, gern von ihm gesprochen, wenn er bei Maiumzügen in Birkenwerder oder zur 600-Jahr-Feier neben der Blaskapelle herlief und seinen Freunden zeigte: “Der da mit der Trompete, das ist mein Vater.” Es gab Tage mit dem Vater, an die er sich gern erinnerte. Seltener an Gespräche. Dieser Satz: “Wir sprechen uns noch”, hatte ihm vielleicht grundsätzlich und ein für allemal das Misstrauen zu Gesprächen geschärft, denen er dennoch fortgesetzt auf den Leim ging. Möglich, dass die Wortarmut zwischen ihnen hier ihren Anfang hatte.
Zum Beispiel erinnerte er sich gern an den alljährlichen Spaziergang am Ostermorgen durch die stillen Straßen, entlang den Wiesen, über die Briese und nach Hause zurück zum Mittagessen. Der Vater, groß und breit, in seiner grauen Lodenjoppe, die Füße beim Gehen nach außen gesetzt. Und er, der Sohn, gehorsam nebenher, schweigend, wartete, dass der Vater sprach. Der Vater wollte doch etwas sagen, oder jedenfalls hoffte er darauf. Das frische Grün an den Sträuchern, die stillen Straßen, die sumpfigen Wiesen entlang am verlandeten Sandsee, über den Bach, womöglich noch das Läuten der Glocken, das auch von den Nachbarorten herüberwehte. Dieser Morgen war eigentlich wenig zum Reden geeignet, aber er hatte das Empfinden, der Vater war mit ihm vor allem deswegen unterwegs. Und dann sagte der Vater: “Setze die Füße mit den Zehen nach außen! Du stolperst noch über den großen Onkel.” Wie er sich dann mühte, zu begreifen, was der Vater meinte, was das mit der Fußstellung auf sich hatte, und er mit verkrampftem stelzigem Gang den Vater zufriedenzustellen suchte.
Ein Leben lang erinnerten ihn nun Leute mit dieser pedantischen selbstzufrieden wirkenden Seitfußstellung an diese Osterspaziergänge. Wenn er sie traf, war Ostern, dann läuteten die Glocken, er spazierte durch die Wiesen, zitierte den alten Geheimrat Goethe, und immer blieb die Erwartung, der Vater möchte doch unbefangen mit ihm reden ...
“Die Kreuzung”, sagte er und schob den Kopf dem Fenster zu, als wäre die Starre aufzulösen mit einer Bewegung. “Das Rathaus, da drüben.”
“Ja”, sagte der Vater und brummelte: “Der Schwarze Adler”. Das war ein Restaurant, das er zwei Jahre führte, als er die Kraft nicht mehr aufbrachte, Trompete zu spielen. Mit dieser Gaststätte begann sein Start im Handel. Später übernahmen er und Mutter einen Hauswirtschaftsladen.
“Der Bahndamm”, sagte der Sohn. “Bis zur Veltener haben sie den Wald abgeholzt - für eine Erdgasleitung und für ein neues Stück Autobahn.” In der Nähe des Bahndammes befand sich ihr Garten, den der Vater vor drei Jahren verkaufen wollte, als sich sein körperlicher Zustand verschlechterte. Er konnte sich dann aber doch nicht von diesem Stückchen Land trennen.
Der Vater zeigte zaghaftes Interesse. Er hob den Blick, sah zweifelnd auf die dunklen Scheiben und fragte leise nach den Einzelheiten, so als glaubte er nicht daran, dass es diese Vergangenheit je gegeben hatte.
“Ja, die Straße führt direkt bis zum Krankenhaus”, sagte der Sohn. “Es fährt auch ein Bus vom Bahnhof aus. Wir werden dich oft besuchen. Es ist sehr bequem mit dem Bus.”
Der Vater sah kurz zu ihm hin, und seine Augen waren voller Angst.
Weshalb begann nicht i c h zu reden? Und jetzt sind wir beide hier allein, zu zweit. Das letzte Mal womöglich. Zum letzten Mal allein miteinander. Und der Regen trommelt, die Reifen singen ... Wir könnten uns ansehen, könnten uns trösten, uns Mut zu sprechen. Weshalb hocke ich mit diesem stillen, einsamen Monolog neben dir auf der Pritsche wie mit einem Krampf im Sprachzentrum? Weshalb weinen wir nicht einfach? Weshalb nehmen wir uns nicht an die Hand und weinen. Er fühlte sich unsagbar hilflos, mehr, als der Vater es war. Weshalb nicht? Wir könnten doch ...
In weitem Bogen fuhr der Wagen vor einen beleuchteten Eingang und hielt. Fahrer und Arzt stiegen aus und öffneten die Tür.
“Wir haben's geschafft, Herr Beyerle. Schönes Wetter”, sagte der Fahrer. Mit eingezogenem Kopf stand er unter hochgeklappten Wagentür. “Und meine Tochter und mein Schwiegersohn wollen ab morgen am Krossinsee zelten. Na, prost Mahlzeit.”
Dann halfen sie dem Vater aus dem Wagen. Für den Vater existierte der Regen nicht. Er blickte mit schlaffer Unterlippe zur Tür des Krankenhauses, als suchte er sich an etwas zu erinnern.
Im Haus verabschiedeten sie sich. “Alles Gute, Herr Beyerle”, sagte der Krankenfahrer. Und zum Sohn: “Ich fahre Sie zurück. Darf ich zwar nicht, aber bei diesem Wetter kommen Sie nachts hier nicht mehr weg.”
Das Foyer war dunkel getäfelt und matt beleuchtet. Vom Personal war niemand zu sehen.
“Ich werde uns anmelden”, sagte der Sohn. Seine Stimme kam ihm zu laut vor, so direkt, als hätte sie mit dem Krankenfahrer ein Dolmetscher, ein Vermittler, verlassen. Er fühlte sich so unsicher.
“Du wirst erst spät zu Hause sein”, sagte der Vater wie zu sich selbst.
“Bin ich gewohnt”, erwiderte der Sohn. “Und morgen muss ich erst am Nachmittag in die Redaktion.” Und er dachte betroffen: Jetzt bist du besorgt um mich.
Gern hätte ich dir von meiner Tätigkeit erzählt, dass ich die Sportnachrichten zusammenstelle. Du hattest doch täglich Sportnachrichten erwähnt.
Der Vater strauchelte leicht, und der Sohn fasste ihn unter den Arm, hielt ihn an der Jacke. Schweigend gingen sie einige Schritte hinein in den Vorraum. Sie spürten den Atem des anderen. Nie hatten sie einander so gehalten. Es war halbdunkel. Von der niedrigen Decke strahlte rötliches Licht, und ihre Schritte klangen sehr vorsichtig.
Aus einer Tür hinter dem Tresen kam eine Schwester im rosa Kittel. Klein, derb, flink. Sie rollte einen hölzernen Räderstuhl heran, half dem Vater, sich zu setzen. Der Sohn überreichte ihr den Einweisungsschein, blieb hinter dem Stuhl, hielt den Krückstock.
Er ist so ergeben, dachte er. Wie soll ich jetzt den Anfang finden, mit ihm zu reden?
“Ihr Name”, fragte die Schwester.
“Beyerle”, sagte der Vater beinahe hastig, als wäre er erstaunt, dass sein Name noch gefragt war. “Mit Ypsilon.”
Der Sohn hielt sich an der Rückenlehne.
“In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Herrn?”, fragte die Schwester, an den Sohn, gewandt, ohne vom Blatt aufzusehen.
Sie spricht, als traute sie dem Vater nicht zu, für sich selbst zu reden, dachte der Sohn. Er stockte, zögerte mit der Antwort. Stiefvater? Oder wie sagt man? Das Gesicht begann ihm zu glühen. Wir hatten nie darüber gesprochen. Ich trage nicht seinen Namen, und dies hier ist eine öffentliche Einrichtung. Hier müssen die Angaben exakt sein.
“Das ist mein Sohn”, sagte der Vater mit ruhiger Stimme, als spräche er zu sich selbst.
“Er ist mein Vater”, bestätigte der Sohn rasch, als wäre ihm der Vater bloß zuvorgekommen mit der Antwort. Mein Sohn, hat er gesagt, mein Sohn. Eine tiefe Zuneigung zu dem alten Mann erfasste ihn, dessen Gesicht er jetzt nicht sah. Ein halbes Leben hatte es ihn angeblickt, als schmollte es, von ihm keinen Gehorsam empfangen zu haben. Er blickte auf die Schirmmütze und wiederholte, leise bestätigend: “Mein Vater.”
Die Schwester nickte, sah beide nachdenklich an und händigte dem Sohn den Schein aus. “Wir fahren zum EKG”, sagte sie und ging voraus. Der Vater nahm seine Mütze vom Kopf und hielt sie auf seinem Schoß. Der Sohn schob ihn in den Aufzug, dann einen langen Flur entlang. Nur das Surren der weichen Gummiräder und die trippelnden Schritte der Schwester waren zu hören. Dann die lebhaften Stimmen zweier Schwestern, die mit einem Tablett in einem Zimmer verschwanden. Und den Vater schien es nur noch zu geben als Rädersurren und Gewicht, das mit der Rückenlehne gegen seine Arme drückte.
Vor einem offenen Raum hielten sie. Er half dem Vater hoch und geleitete ihn die wenigen Schritte zu einer mit weißem Laken bedeckten Trage. Der Vater setzte sich.
Eine junge Schwester kam. “Guten Abend”, sagte sie unbewegt. “Machen Sie bitte den Oberkörper frei!” Bei jedem ihrer Worte zitterten ihre dicklichen sommersprossigen Wangen. Sie trug eine kurzärmlige weiße Bluse, aus der blasse fleischige Arme herausragten.
Der Sohn half dem Vater Jacke und Hemd auszuziehen und sah den Körper des Vaters nahe und nackt vor sich. Dieser Körper des Vaters schien ebenso ein Geheimnis wie die erste Hälfte seines Lebens. Diese bleiche geschwitzte Haut, dieser noch feste, aber aufgeschwemmte Leib schienen nicht zu ihm zu gehören. Nur die großen Hände kannte er, die waren nie zu verbergen gewesen und hatten sich ihm eingeprägt wie ein Gesicht.
Der Sohn saß auf einem Stuhl neben dem Vater. Er hatte das Empfinden, sie wären beide hier endgültig der Wahrheit ausgeliefert, einem Zusammentreffen, dem sie bisher ausgewichen waren. Und er glaubte jetzt den Vater zu sehen, wie er wirklich war, als hätte er sich ein Leben lang hinter sich selbst versteckt. Er meinte das Kind in ihm zu erblicken, dieses Kind auf dem Foto, mit ernsten Gesicht und im Matrosenanzug, auf einen Tennisschläger gestützt.
Haben wir die Rollen miteinander getauscht, um so zu versuchen, Worte zu finden? Wir sind uns näher gekommen heute, auf der Fahrt hierher, vorhin bei der Anmeldung. Aber weißt du es, so wie ich es weiß? Oder hofft es nur jeder für sich? Das müssten wir doch über die Lippen bringen, ein Wort nur: Verzeih. Oder einen Satz, vielleicht auch zwei Sätze: Wir hatten immer einander gebraucht, auch, wenn wir es leugneten. Doch wir hatten einander unsere Zuneigung beschnitten, sie uns vorenthalten, starrköpfig, starrsinnig.
“Legen Sie sich bitte hin, und drehen Sie sich zur Wand”, sagte die Schwester und hantierte mit Drähten.
Der Vater, jahrelange Pflege durch die Mutter gewohnt, spürte, dass dies alles hier nicht mehr galt.
“Schwester”, sagte er, “Sie müssen wissen, ich bin links ein wenig gelähmt.” Er sprach leise, beinahe weinerlich, als bezweifelte er, dass seine Worte etwas nützten.
Die Schwester reagierte nicht, sie hantierte wortlos, schien nicht zu hören. Sie schob dem Vater die Hosenbeine von den Knöcheln und heftete die Drähte klatschend mit Gummimanschetten an seine Waden.
Was wollen die Schwestern hier?, dachte der Sohn. Weshalb mischen Sie sich ein? Sehen sie nicht, dass es Wichtigeres gibt als diese Zahlen, als diese Maschine?
Der Apparat, der unbestechliche, tickte zwei Bögen voller Linien in die Stille. Knallende forsche Schritte drangen vom Flur her. Eine Frau mit offenem weißem Kittel und Absatzschuhen kam herein wie in größter Eile. Ernsten Gesichts grüßte sie kurz und leise, las das Kardiogramm. “Er bleibt hier”, sagte sie zur Schwester. “Auf die Zwölf.”
“Ich bleibe hier?”, fragte der Vater vorsichtig. “Ja, eine Durchblutungsstörung.” Sie blickte nicht auf. Ihr breites Gesicht wirkte konzentriert.
“Wie lange, Frau Doktor?”
“Einige Wochen.”
“Einige Wochen.” Er nickte resigniert. Aber Ferne ist Zukunft, bedeutet Hoffnung. Er atmete tief auf. Eine hübsche Schwester mit tänzelndem Gang brachte ihm ein Nachthemd, hängte es über seine Schulter. Der Vater setzte sich in den Räderstuhl, und sie fuhr ihn hinaus, den Flur entlang.
Der Sohn stand neben der Ärztin, wagte nicht, ihr ins Gesicht zu sehen.
Wenn du entlassen wirst, dachte er vage, wenn du nach Hause kommst, wenn es diese Möglichkeit gibt, werden wir uns besser verstehen. Viele Gespräche werden wir beginnen. Ich werde häufiger zu dir kommen, dich abholen zu einem Spaziergang. Oder wir fahren mit dem Wagen nach Rheinsberg oder nach Buckow. Dahin wolltest du früher immer, weil dein Vater mit dir dort gewesen war. Wir müssten mehr gemeinsam erleben.
“Keine Hoffnung”, sagte die Ärztin, “erstaunlich überhaupt, dass er den heutigen Tag überstanden hat.”
Der Sohn wollte noch fragen, die Plötzlichkeit überbrücken, diese unaufschiebbare, endgültige Situation begreifen. Aber sie antwortete präzise und sicher, ohne Feilschen, hielt die eindeutigen Argumente in den Händen.
Der Sohn nahm Kleidung, Tasche, Stock und Mütze des Vaters, ging auf den Flur, sah sich um.