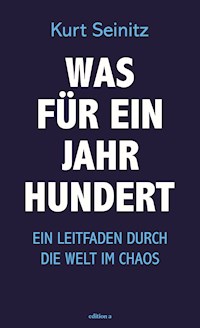
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Sprache: Deutsch
Kurt Seinitz hat sein Leben als Berichterstatter an den Brennpunkten des Zeitgeschehens verbracht und von Wladimir Putin bis Xi Jinping viele der großen politischen Akteure selbst getroffen. In diesem Buch liefert er einen Leitfaden durch ein irres Jahrhundert, der vieles fassbar, logisch und nachvollziehbar macht. Wie und warum verändert sich die Welt? Eine bodenständige Analyse voll Scharfsinn und Erfahrung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Seinitz:Was für ein Jahrhundert
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Bastian Welzer
Satz: Bastian Welzer
Gesetzt in der Premiera
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 26 25 24 23 22
ISBN 978-3-99001-601-5
eISBN 978-3-99001-602-2
Kurt Seinitz
WAS FÜR EIN JAHRHUNDERT
EIN LEITFADEN DURCH DIE WELT IM CHAOS
INHALT
VORWORT
JAHRHUNDERTWENDE UND ZEITENWENDE
DIE VERDICHTUNG DER KRISEN
PUTIN, ZERSTÖRER EINER EPOCHE
ENDE DER GLOBALISIERUNG?
WENDEZEITEN SIND NICHT NEU
WIE DIE WELTORDNUNG VERLOREN GING
DIE GROSSE SYSTEMVERDROSSENHEIT
DEMOKRATIE IN BEDRÄNGNIS
40 JAHRE ORBÁN?
»JALTA« – DIE MUTTER DER ALTEN ORDNUNG
DER ZUSAMMENBRUCH DES SOWJETIMPERIUMS
DAS AMERIKANISCHE ZEITALTER
DIE FALSCHEN KRIEGE DER USA
DER ABSTIEG DER ALTEN MÄCHTE
DER AUFSTIEG CHINAS
NAHOST – DIE MUTTER DER KRISEN
DIE KRISE DER ISLAMISCHEN WELT
KRISE DES GLAUBENS
KLIMAKRISE, MIGRATIONSKRISE
DAS WUNDER SÜDAFRIKA
SUCHE NACH DER NEUEN ORDNUNG
VORWORT
»Was für ein Jahrhundert!«, ging mir durch den Kopf, als die Nachricht vom russischen Einmarsch in die Ukraine kam. »Wieso wird die Welt immer wahnsinniger?« Seit 9/11 zu Beginn dieses Jahrhunderts, dem Terrorangriff auf die New Yorker Zwillingstürme, kommt die Welt nicht mehr zur Ruhe. Wer bisher geglaubt hatte, in unserem Jahrhundert wäre es nicht mehr möglich, dass ein durchgeknallter Machthaber Europa in ein Schlachtfeld verwandelt, der wurde eines Schlechteren belehrt. Auch wenn manche Vorgänge und Entscheidungen noch so abwegig erscheinen mögen, haben sie doch eine Ursache.
Warum passiert, was passiert? Das ist das Leitmotiv dieses Buches. Dazu zählen auch die persönlichen Anekdoten, die ich während meiner fünfzigjährigen Laufbahn mit Weltenlenkern erlebt habe. Manche sind so urkomisch, dass ich bis zum 23. Februar 2022, dem Vortag des Krieges, immer wieder behauptet hatte: »Mich kann nichts mehr überraschen.« Dann kam Putin.
Ja, die Welt ist verrückt geworden – und brandgefährlich. Folgen wir den Spuren, warum es so gekommen ist.
JAHRHUNDERTWENDE UND ZEITENWENDE
»Globalisierungsdreck« – diese Bezeichnung für Coronaimpfstoffe bei den Demonstrationen der Impfgegner ließ den ersten Verdacht aufkommen, dass mit der Welt etwas nicht mehr stimmt. Was geht in solchen Köpfen vor? Wie können derart abstruse Verschwörungsmythen in unserem stolzen »Zeitalter der Vernunft« möglich sein?
Die Pandemie war noch nicht vorbei, da schlug Putin zu. Wider jede Vernunft brach er einen Eroberungskrieg nach dem Muster früherer Jahrhunderte vom Zaun. Der russische Präsident hat damit das Faustrecht in die internationale Politik zurückgebracht – ein schwerer zivilisatorischer Rückfall. Seine Invasion der Ukraine rundet das Bild einer Zeitenwende ab: Dieser Einmarsch war mehr als nur eine territoriale Grenzüberschreitung. Überschritten werden in diesem Jahrhundert allenthalben Grenzen zur Unvernunft.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Sie ist aus dem Zeitalter der Aufklärung, das sich als vernunftgeleitet hielt, in ein Zeitalter der Wirrnis gestürzt. Solche Wendezeiten sind allerdings kein neues Phänomen. Tektonische Erschütterungen der herkömmlichen Ordnung gab es immer wieder in der Geschichte. Epochen der Umwälzungen waren von Angst, von Gegenreaktionen oder dem Glauben an Heilslehren begleitet. Viele Menschen fühlten sich von neuen Erkenntnissen und Herausforderungen einfach überfordert, fanden keinen vertrauten Halt mehr an alten Ufern.
Signifikant für Wendezeiten – oder sogar ihr Auslöser – ist die Globalisierung beziehungsweise sind es ihre Vorläufer in früheren Jahrhunderten. Globalisierung steht für die Verflechtung aller Lebensbereiche über den bis dahin gekannten Lebensraum hinaus. Das erzeugt Gefühle der Unsicherheit, der Verlorenheit und des mangelnden Überblicks. Wer aber Zusammenhänge erkennt, kann Entwicklungen und Ereignisse entwirren und einordnen, Wurzeln freilegen, Verunsicherung bannen, muss sich nicht überraschen lassen. Das Gebot lautet: Durchblick gewinnen.
DIE VERDICHTUNG DER KRISEN
Das Jahr 1979, in dem die folgenschwere Islamische Revolution im Iran ausbrach, gilt heute als »Mutter der Zeitenwende«, als Geburtsstunde der Welt im Umbruch. (Die vielfältigen Ereignisse des Jahres 1979 werden in diesem Buch noch ausführlich behandelt.) Seit dem Paukenschlag von Teheran folgten Krise auf Krise, Terror auf Terror (mit dem Höhepunkt des New Yorker 9/11 zum Jahrhundertbeginn), Krieg auf Krieg, Pandemiewelle um Pandemiewelle und schließlich Putins Krieg – und über allem schwebt das Damoklesschwert der Klimakrise und ihrer Auswirkungen. Diese Fortfolge von immer neuen Krisen, diese Verdichtung der Krisen, stellt die Welt vor Probleme, für die sie noch keine Lösung hat. Beate Winkler, die frühere Leiterin der EU-Grundrechtsagentur, bringt es in der ORF-Sendefolge DialogForum auf den Punkt: »Die Welt ist nicht nur im Umbruch, sie steht auch am Scheideweg. Es finden Veränderungen gleichzeitig in allen Lebensbereichen statt. Das Alte ist weg, das Neue noch nicht da. Die oftmals gehörte Frage dazu: Wann wird es wieder so sein wie früher?«
PUTIN, ZERSTÖRER EINER EPOCHE
Der russische Staatsführer hat mit seinem Tabubruch die Welt in ihren Grundfesten erschüttert und die gesamte europäische Friedensordnung zum Einsturz gebracht. Diese Ordnung war als eine Lehre aus den und eine Antwort auf die beiden verheerenden europäischen Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, aufgebaut worden. Man konnte sich einen neuen derartigen Krieg in Europa einfach nicht mehr vorstellen. Niemand rechnete mit solch einer Ruchlosigkeit und Grausamkeit im Kreml. Die Europäer waren vom Frieden verwöhnt gewesen. Kriege fanden seit einer Generation nur noch in Computerspielen statt. Das Erwachen ist bitter. Mit der Friedensordnung ging auch die Friedensdividende verloren, die Europa über Jahrzehnte Wohlstand gebracht hatte. Wir erleben die größte Vermögensvernichtung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wer hätte gedacht, dass die Ernährungssicherheit auch in Europa noch einmal ein Thema sein wird.
Putins Tabubruch wird auf Jahrzehnte derart einschneidende Folgen haben, dass der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Bundestagsrede anlässlich des Krieges quasi offiziell das Wort »Zeitenwende« für alle Bereiche des öffentlichen Lebens in die Politik eingebracht hat. Die deutsche Regierung sah sich zu einer scharfen politischen und militärischen Wende genötigt, nachdem man in Berlin allzu lange in der Tradition des deutschen Idealismus an die Angleichung der russischen Politik an europäische Maßstäbe geglaubt hatte. Sogar als Putin schon 100.000 Truppen für »Manöver« an der ukrainischen Grenze aufmarschieren hatte lassen, reisten Scholz und andere europäische Staatsführer nach Moskau, um den Kremlchef zu beschwichtigen. Im Nachhinein stellte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (von den Grünen) nüchtern fest: »Wir wurden eiskalt belogen. Die gesamte internationale Gemeinschaft.«
Das wirft die Frage nach Lüge und Täuschung als Mittel der russischen Politik auf. Lügen ist in der politischen Elite Russlands traditionell keine moralische Frage, sondern eine Waffe zur Durchsetzung von Zielen und der älteste Trick der Kriegsführung. Wer Lügen glaubt, entlarvt sich als Naivling und damit als Schwächling. Mit Täuschungsmanövern hatten schon Attila und die Mongolen Krieg in Europa geführt. Dieses Erbe muss jeder Politiker im Umgang mit der russischen Führung beachten.
Keine Berechtigung hat das Mobbing gegen Deutschland aus Kiew und aus dem Westen wegen der zögerlichen Haltung bei den Militärlieferungen an die Ukraine. Die westlichen Alliierten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg alles darangesetzt, den Deutschen durch ein Umerziehungsprogramm (»Reeducation«) den Militarismus auszutreiben. Dass sie dabei übererfolgreich waren, kann man den Deutschen heute nicht zum Vorwurf machen. Deutschland will in Europa lieber aus der zweiten Reihe führen und lässt sich das viel kosten.
Das ewige Rätsel Russland
Die Frage ist uralt: Warum verhält sich Russland so, wie es sich verhält? Warum ist es seit dem frühhistorischen Abschütteln des »mongolischen Jochs« der Inbegriff von Unfreiheit und (geistiger) Abschottung geblieben? Weshalb endet alle Macht stets in der absoluten Allmacht einer Person? Was verspricht sich Kriegsherr Putin von seiner Strategie »Befreiung durch Zerstörung« in der Ukraine?
Der Klüngel im Kreml hatte sich dreifach verrechnet: kein Blitzkrieg, kein »regime change« in Kiew, kein Westen, der sich alles gefallen lässt. Jetzt müssen kleinere Brötchen gebacken werden. Die Politikwissenschaftlerin Claudia Major von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik im ORF-Hörfunk: »Für Putin ist ein schlecht laufender Krieg immer noch besser als ein schlechter Frieden, ein dahinköchelnder Krieg, an den sich Europa gewöhnt, besser als eine Kompromisslösung, bei der die russische Öffentlichkeit Fragen stellen könnte.«
In Putins Epochenbruch sieht Claudia Major eine echte Zeitenwende: »Wir müssen anerkennen, dass es nicht mehr so sein wird wie vorher. Das Vorher war die Zusammenarbeit mit Russland, in Europa eine Friedensordnung aufzubauen. Russland hat sich mit diesem Krieg daraus verabschiedet. Es wählte Krieg, um seine Interessen durchzusetzen, und das ist ein ganz großer Unterschied im Denken. Für uns bedeutet das, anzuerkennen, es gibt jemanden, der bevorzugt Krieg im Gegensatz zu friedlichen Lösungen.« Hat da die Diplomatie, die Suche nach Gesprächen, überhaupt eine Chance? Rüdiger von Fritsch, bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau, im Deutschlandfunk: »Putin hat das Schachbrett umgeworfen. Er hat statt Dialog auf Konfrontation gesetzt. Dennoch bleibt es dabei: Diplomatie heißt 19-mal die Mauer hochklettern, 19-mal herunterfallen und hoffen, dass es beim zwanzigsten Mal klappt.«
Schwer liegt auf Russland das bleierne Gewicht der reaktionären orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, die sich als Gegenpol zur »lateinischen« Kirche versteht, als »Drittes Rom« (nach dem Fall von Konstantinopel), aber auch als Endzeit-Rom sowie als Hüter der christlichen Zivilisation in einer Welt ohne rechten Glauben. Seit der endgültigen Spaltung der beiden Kirchen 1054 ist sie von Misstrauen gegen Ideen aus dem Westen geprägt. In ihr lebt die DNA des Byzantinischen Reiches mit all ihren Merkmalen weiter. Laut dem Politikwissenschaftler Jörg Himmelreich prägte dieser Bruch nicht nur das politische System des Zarenreichs, sondern auch noch jenes der Sowjetunion und ist mit der Herrschaft Putins sogar stärker denn je im russischen Staatsdenken verankert: »So bildet die historische orthodoxe Herrschaftsideologie auch heute wieder die Goldgrube für Putins autokratisches Regime und seinen wiederbelebten russischen Expansionismus.«
Thron und Altar bilden in Putins Russland wieder eine untrennbare Einheit. Patriarch Kyrill – er stammt noch aus einer Generation, wo der sowjetische KGB (Komitee für Staatssicherheit) die Priesterauswahl traf – predigt für die »militärische Spezialoperation« seines KGB-Kollegen Putin. Dieser Kurs war schon vor dem Krieg die Ursache gewesen, dass sich ein eigenes Kiewer Patriarchat von Moskau getrennt hat (mit dem Segen des ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel/Istanbul, der in Moskau eine Konkurrenz sieht). »Kyrill inszeniert seit Jahren Russland als Bollwerk gegen die westliche ›gottlose Zivilisation‹«, so Friedrich Schmidt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. »Als Beispiel von westlicher Dekadenz nennt Kyrill, der selbst eine Vorliebe für westliche Luxusgüter wie teure Uhren hat, ›übermäßigen Konsum‹ und vor allem ›Gay-Paraden‹: Die Rechtgläubigen seien in einen Kampf eingetreten. Zudem negiert Kyrill, wie Putin, jede Eigenständigkeit der Ukrainer, die für ihn Teil eines einheitlichen russischen Volkes seien. Wie Putin gibt Kyrill ›äußeren‹ (also westlichen) Kräften, die ›Russland schwächen‹ wollten, die Schuld am Krieg. Kyrill hatte schon Putins Syrieneinsatz als ›heiligen Kampf‹ bezeichnet.« Kirche und Politik werfen einander die Bälle zu.
Vom »Heiligen Krieg« spricht im TV Wjatscheslaw Nikonow, der prominente Abgeordnete der Staatsduma (Unterhaus des russischen Parlaments) und Enkel von Stalins Außenminister Wjatscheslaw Molotow: »Wir erleben in der heutigen Welt ein Phänomen – den Zusammenprall der Kräfte des Guten und des Bösen, repräsentiert durch die Nazibataillone der Ukraine. Wir stehen auf der Seite des Guten. Deshalb ist es ein Heiliger Krieg, ein wirklich Heiliger Krieg, und wir müssen ihn gewinnen, denn wir haben keine andere Wahl.«
Auf eine Volkserhebung in Russland braucht niemand zu hoffen. Dafür sorgt schon der Fatalismus der sprichwörtlichen »russischen Seele«. Für die eigenen Opfer, sprich Kanonenfutter, gilt das Sprichwort »Die Weiber werden noch gebären« und die Opfer der anderen interessieren nicht.
Schon die alte Sowjetunion war in ihrer Seele nichts anderes als Uralt-Russland. Ich erinnere mich noch an die bildliche Darstellung der hierarchischen Reihung der Mitglieder des Politbüros und des Präsidiums des KP-Zentralkomitees der kommunistischen Sowjetunion. Generationen von Auslandskorrespondenten in Moskau waren damit beschäftigt, aus Verschiebungen der Rangordnung politische Zeichen abzulesen. Eines Tages führte mich ein österreichischer Diplomat in das Moskauer Patriarchat – und siehe da: Dort fand sich haargenau die gleiche hierarchische Darstellung der Metropoliten, Bischöfe, Archimandriten, Erzpriester und so weiter. Lenin und Stalin, selbst ein verhinderter Priesterzögling, waren also aufmerksame Schüler gewesen.
Modernisierungsimpulse sind in Russlands Geschichte stets nur auf dem Verordnungsweg von oben und aus der Ideenwelt des Westens – stoßweise – nach Russland gekommen, bevor das Reich dann wieder in traditionelle Stagnation verfiel: von einem Zaren Peter I., der den Russen die Bärte abschnitt und sie in westliche Kleidung zwang, von einer deutschen Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, die als Zarin Katharina II. einen Hauch von Aufklärung brachte, oder von Lenins Marxismus. Liberalismus hat das Reich nie erlebt, außer in Ansätzen unter dem – gescheiterten – »Westler« Michail Gorbatschow (Stichwort »Glasnost«). Heute ist es wieder so weit: heiliges Mütterchen Russland gegen den Rest der Welt – bei der Abstimmung in der UNO-Generalversammlung fünf zu 141.
Den bisher treffendsten Erklärungsversuch zum Rätsel Russland unter den aktuellen Vorzeichen liefert der Stalin-Biograf Stephen Kotkin. Sein Fazit: Russland hat historisch schon immer das Problem gehabt, einen Großmachtanspruch zu stellen, ohne ihn – mit Ausnahmen – erfüllen zu können. Die Ambitionen übersteigen die Möglichkeiten. So ist Russland mit 144 Millionen Einwohnern an Wirtschaftskraft nur dreieinhalbmal größer als Österreich mit neun Millionen Einwohnern und der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt lieferte einmal betreffend Russland das klassisch gewordene Zitat: »Obervolta (in Afrika) mit Raketen«. Professor Kotkin in der Zeitschrift New Yorker: »Was wir heute sehen, sind historische Muster – ein Autokrat, Unterdrückung, Militarismus, Misstrauen gegen das Fremde und vor allem gegen den Westen.«
Das Urproblem durch den ganzen Lauf der Geschichte sieht Stephen Kotkin darin, dass Russland immer geglaubt hat, als Macht des orthodoxen Ostens eine Mission erfüllen zu müssen: »Es kämpft ständig um diese Ansprüche, konnte sie aber nicht erfüllen, da der Westen immer der Mächtigere blieb. Um diese Kluft zu überwinden und das Land vorwärtszutreiben, greifen seine Autokraten zur Gewalt.« Die Konzentration der Macht auf eine Person und der Durchgriff der Autokraten nach unten, so Kotkin, hätten in der Geschichte eine selbstständige Entwicklung staatlicher Strukturen behindert. Putin griff auf altrussische Muster zurück.
Die Blindheit der Autokraten grenze an Selbstbetrug, analysiert der Autor. So habe Putin in Bezug auf die Ukraine das erwartet, was er sich selbst wünschte: dass die Ukrainer gar kein eigenständiges Volk seien oder dass sie die Russen mit offenen Armen empfangen würden, um von einem von außen dirigierten Regime befreit zu werden. Eine große Überraschung müsse die Haltung des Westens gewesen sein: »All dieser Unsinn, wie dekadent der Westen sei, dass es mit dem Westen vorbei sei – all das erwies sich als großer Quatsch. Das muss Putin schockiert haben! Welch eine Fehleinschätzung!« Zitat Kotkin: »Der Westen ist kein geografischer Begriff, er ist eine Welt der gemeinsamen Werte. Russland ist ein Teil Europas, aber nicht des Westens. Japan ist Westen, aber nicht Europa. Dieser Westen hat sich gegen Putin erhoben, in einem Ausmaß, das weder er noch Xi Jinping erwartet haben … Wenn du davon ausgehst, dass der Westen aus Kabul davongerannt ist, dass Selenskyj nur ein TV-Komiker ist, ein Russisch sprechender Jude, musst du geglaubt haben, dass Kiew in zwei bis vier Tagen zu nehmen ist.« Putin wurde zum Gefangenen seiner Anti-Kiew-Besessenheit und seiner Hybris (Überlegenheitsempfinden).
Aus historischer Sicht ebenso rätselhaft wie das Verhalten Russlands ist aber auch das Verhalten westlicher Invasoren. Was hatte sie angezogen? Dreimal marschierten Armeen aus dem Westen Richtung Moskau, zweimal wurde dabei die russische Hauptstadt besetzt, jedes Mal mussten die Invasoren unverrichteter Dinge abziehen.
Im Jahr 1610 waren es die vereinigten Polen-Litauer, die in der russischen »Zeit der Wirren« einen katholischen Prätendenten auf den Zarenthron bringen wollten. Den Patriarchen Hermogenes, der zum Volksaufstand aufrief, warfen sie in den Kerker und ließen ihn verhungern. 1913, zum 300-Jahr-Jubiläum der Romanow-Dynastie, wurde er dafür von der russisch-orthodoxen Kirche als Märtyrer (Opfer des Westens) heiliggesprochen. Er gilt als Nationalheld. Im Jahr 1812 war es Napoleon, der – bereits in Selbstüberschätzung – Russland in die Knie zwingen wollte. Er wurde von General Winter besiegt. Im Jahr 1941 war es Hitler, der sich auf russischem Boden einen Vernichtungskrieg zwischen den beiden politischen Systemen Marxismus/Leninismus und Faschismus/Nazismus lieferte. Auch sein Feldzug fiel General Winter zum Opfer.
Das Gefühl der Bedrohung zwischen dem Westen und Russland war also über Jahrhunderte gegenseitig. War es anfangs aus Gründen der Religion und/oder der nationalen Selbstbehauptung gewesen, so ging es später um die politischen Systeme. Das russische Sicherheitsempfinden ist geprägt von Invasionserfahrungen (auch jene von den Mongolen) und langen, nur schwer kontrollierbaren Grenzen. Die Abwehrkämpfe nährten einen Opfermythos, der durch eine aggressive Haltung kompensiert wird. Jede vermeintliche neue Bedrohung am Horizont wird so zur »selffulfilling prophecy«, einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.





























