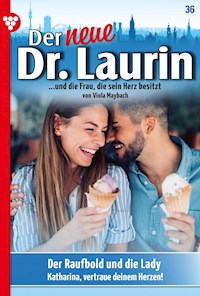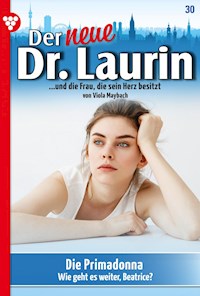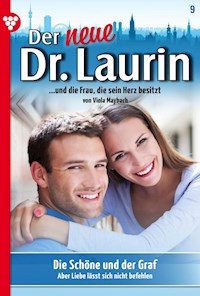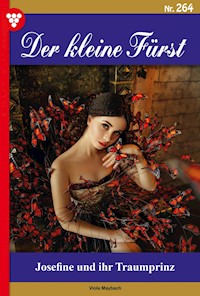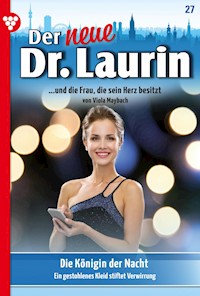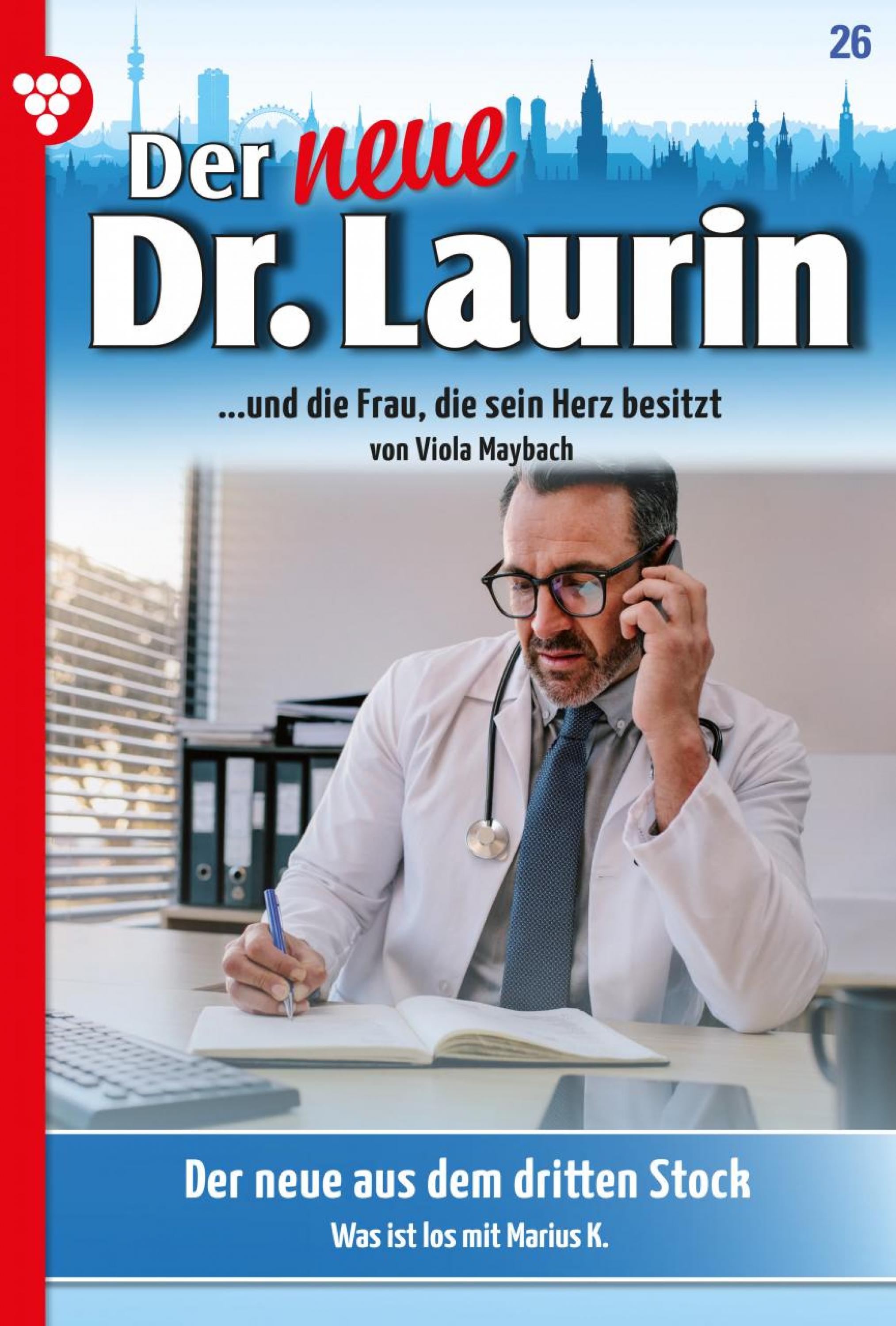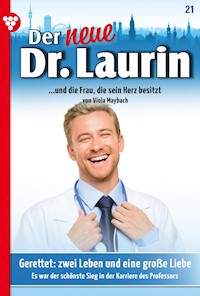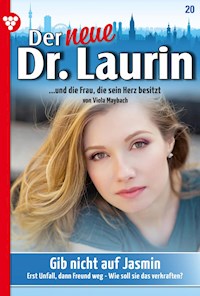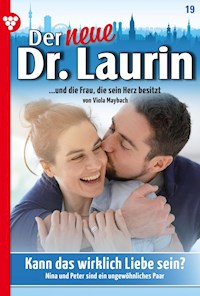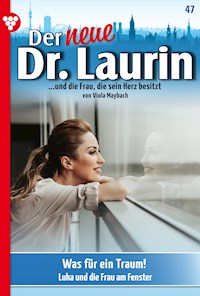
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der neue Dr. Laurin
- Sprache: Deutsch
Diese Serie von der Erfolgsschriftstellerin Viola Maybach knüpft an die bereits erschienenen Dr. Laurin-Romane von Patricia Vandenberg an. Die Familiengeschichte des Klinikchefs Dr. Leon Laurin tritt in eine neue Phase, die in die heutige moderne Lebenswelt passt. Da die vier Kinder der Familie Laurin langsam heranwachsen, möchte Dr. Laurins Frau, Dr. Antonia Laurin, endlich wieder als Kinderärztin arbeiten. Somit wird Antonia in der Privatklinik ihres Mannes eine Praxis als Kinderärztin aufmachen. Damit ist der Boden bereitet für eine große, faszinierende Arztserie, die das Spektrum um den charismatischen Dr. Laurin entscheidend erweitert. Als Leon Laurin, Chirurg, Gynäkologe und Chef der Kayser-Klinik im Südwesten Münchens, am sehr frühen Morgen nach Hause fuhr, weil er mitten in der Nacht eine Notoperation hatte durchführen müssen, war er so müde, dass er beinahe im Schritttempo fuhr, um nur ja kein weiteres Unheil anzurichten. Es hatte zuvor einen bösen Unfall in der Nähe der Klinik gegeben, deshalb war er von Timo Felsenstein, dem Leiter der Notaufnahme, kurz nach Mitternacht angerufen worden. »Tut mir leid, Leon«, hatte Timo gesagt, »aber wir schaffen es hier nicht ohne dich.« Daraufhin war Leon sofort aufgestanden. Antonia, die neben ihm ruhig schlief, war nicht einmal kurz wach geworden. Er hatte ihr einen Kuss auf die Wange gedrückt und war aus dem Schlafzimmer geschlichen. Er hatte den Mann, der vor ihm auf dem OP-Tisch zu verbluten drohte, retten können, auch Timo war erfolgreich gewesen bei einem verletzten Kind, Eckart Sternberg jedoch, Leons Freund und Kollege, hatte einen Patienten verloren. Leon wusste, was das bedeutete. Ein solches Erlebnis wirkte lange nach, man konnte den Tod eines Patienten, den man trotz aller Bemühungen nicht hatte verhindern können, nicht einfach abschütteln wie ein paar Tropfen Wasser. Es war immer wieder aufs Neue ein großes Unglück, nicht nur für die Angehörigen, auch für die Ärzte. Er beschloss, den Wagen an der Straße stehen zu lassen, er musste ja schon bald erneut aufbrechen. Im Grunde, dachte er, hätte er auch gleich in der Klinik bleiben und weiterarbeiten können, aber er war so unglaublich müde … Und er wusste, wenn er jetzt noch drei Stunden schlief, würde er den Tag besser bewältigen. Sie hatten in der Klinik eine Serie harter Tage hinter sich. Es kam immer mal wieder vor, dass sich Schwierigkeiten häuften, so wie jetzt gerade. Dann lief nichts glatt, schon Kleinigkeiten gingen schief, es schienen viel mehr Patienten zu kommen als sonst, Maschinen, die jahrelang fehlerfrei gelaufen waren, versagten den Dienst, mehr Angestellte als sonst meldeten sich krank, ein offenbar psychisch gestörter Patient terrorisierte eine ganze Station, und in der hervorragenden Klinikküche brannte zum ersten Mal etwas an. Und zu allem Überfluss gab es dann noch Nächte wie diese, in denen ihnen ein Patient auf dem OP-Tisch starb. Rechts von ihm blinkte etwas, er wandte den Kopf. Fing er jetzt schon an, vor lauter Müdigkeit Gespenster zu sehen? Aber nein, es blinkte wieder!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der neue Dr. Laurin – 47 –Was für ein Traum!
Luka und die Frau am Fenster
Viola Maybach
Als Leon Laurin, Chirurg, Gynäkologe und Chef der Kayser-Klinik im Südwesten Münchens, am sehr frühen Morgen nach Hause fuhr, weil er mitten in der Nacht eine Notoperation hatte durchführen müssen, war er so müde, dass er beinahe im Schritttempo fuhr, um nur ja kein weiteres Unheil anzurichten. Es hatte zuvor einen bösen Unfall in der Nähe der Klinik gegeben, deshalb war er von Timo Felsenstein, dem Leiter der Notaufnahme, kurz nach Mitternacht angerufen worden.
»Tut mir leid, Leon«, hatte Timo gesagt, »aber wir schaffen es hier nicht ohne dich.«
Daraufhin war Leon sofort aufgestanden. Antonia, die neben ihm ruhig schlief, war nicht einmal kurz wach geworden. Er hatte ihr einen Kuss auf die Wange gedrückt und war aus dem Schlafzimmer geschlichen.
Er hatte den Mann, der vor ihm auf dem OP-Tisch zu verbluten drohte, retten können, auch Timo war erfolgreich gewesen bei einem verletzten Kind, Eckart Sternberg jedoch, Leons Freund und Kollege, hatte einen Patienten verloren. Leon wusste, was das bedeutete. Ein solches Erlebnis wirkte lange nach, man konnte den Tod eines Patienten, den man trotz aller Bemühungen nicht hatte verhindern können, nicht einfach abschütteln wie ein paar Tropfen Wasser. Es war immer wieder aufs Neue ein großes Unglück, nicht nur für die Angehörigen, auch für die Ärzte.
Er beschloss, den Wagen an der Straße stehen zu lassen, er musste ja schon bald erneut aufbrechen. Im Grunde, dachte er, hätte er auch gleich in der Klinik bleiben und weiterarbeiten können, aber er war so unglaublich müde … Und er wusste, wenn er jetzt noch drei Stunden schlief, würde er den Tag besser bewältigen.
Sie hatten in der Klinik eine Serie harter Tage hinter sich. Es kam immer mal wieder vor, dass sich Schwierigkeiten häuften, so wie jetzt gerade. Dann lief nichts glatt, schon Kleinigkeiten gingen schief, es schienen viel mehr Patienten zu kommen als sonst, Maschinen, die jahrelang fehlerfrei gelaufen waren, versagten den Dienst, mehr Angestellte als sonst meldeten sich krank, ein offenbar psychisch gestörter Patient terrorisierte eine ganze Station, und in der hervorragenden Klinikküche brannte zum ersten Mal etwas an. Und zu allem Überfluss gab es dann noch Nächte wie diese, in denen ihnen ein Patient auf dem OP-Tisch starb.
Rechts von ihm blinkte etwas, er wandte den Kopf. Fing er jetzt schon an, vor lauter Müdigkeit Gespenster zu sehen? Aber nein, es blinkte wieder! Leon rieb sich die Augen, das Blinken blieb. Er verhielt sich ruhig, bis er ganz sicher war, dass ihm sein Gehirn keinen Streich spielte. Dann erst öffnete er sehr leise die Autotür, stieg aus und drückte sie fast geräuschlos wieder zu.
Er kam sich lächerlich vor, wie er auf leisen Sohlen sein eigenes Grundstück betrat, als sei er ein Dieb, aber er wollte wissen, was es mit diesem Blinken auf sich hatte. Es schien aus einem der Bäume zu kommen, die seitlich neben dem Haus wuchsen.
Lautlos näherte er sich dem Baum, aber plötzlich hörte das Blinken auf, stattdessen meinte er, ein unterdrücktes Geräusch zu hören. Ihm wurde mulmig zumute. Waren etwa Einbrecher am Werk, und hier draußen stand jemand Schmiere und war von ihm überrascht worden? Er fühlte sich in diesem Moment wahrhaftig nicht fit genug, um es mit durchtrainierten Ganoven aufzunehmen, zumal er allein war. Seine Müdigkeit allerdings war verflogen, Adrenalin durchströmte seinen Körper wie eine Droge.
Trotz seines mulmigen Gefühls holte er sein Handy heraus, schaltete die Taschenlampe ein und leuchtete in den Baum. Ein erschreckter Schrei – oder eher ein Quieken – ertönte, als der Lichtstrahl ein junges Mädchen erfasste. Sie mochte vierzehn oder fünfzehn Jahre alt sein und hätte vor Schreck beinahe das Gleichgewicht verloren, konnte sich aber im letzten Moment noch an einen Ast klammern.
»Was hast du da oben zu suchen?«, fragte Leon mit gedämpfter Stimme, um nicht auch noch seine Familie zu wecken. »Komm sofort herunter und erklär mir das, wenn du nicht willst, dass ich die Polizei rufe.«
Das würde er auf keinen Fall tun, aber es konnte ja nicht schaden, der Kleinen – war sie wirklich schon vierzehn? Ihr Gesicht wirkte noch so kindlich! – ein wenig Angst zu machen, damit sie mit der Wahrheit herausrückte. Vielleicht hatte sie ja einen älteren Kumpel, der sich gerade in Laurins Keller nach etwas umsah, das sich zu stehlen lohnte.
Sie kletterte wortlos vom Baum. Als sie vor ihm stand, sah er, dass sie tatsächlich jünger sein musste als von ihm zunächst geschätzt. Sie sah hübsch aus mit ihren langen dunklen Haaren und den ebenfalls dunklen Augen, war aber noch ziemlich klein und sehr dünn. Sie hatte sich dunkle Sportsachen angezogen und zitterte. Vor Kälte oder vor Angst? Es hatte sicher keinen Sinn, sie danach zu fragen, er würde von ihr kaum eine ehrliche Antwort erhalten.
»Also, wieso sitzt du mitten in der Nacht in einem Baum auf unserem Grundstück?«, fragte er. War dies möglicherweise ein Fall fürs Jugendamt? Vielleicht war sie ausgerissen, und die verzweifelten Eltern suchten sie bereits überall …
»Ich wollte ihn nur mal aus der Nähe sehen«, wisperte das Mädchen. »Echt, ich … ich …« Sie fing an zu weinen.
Leon fluchte innerlich. Gegen Tränen war er machtlos, vor allem, wenn jemand so bitterlich weinte wie dieses Mädchen. Er erkannte echte Verzweiflung, wenn er sie sah, und das hier war echte Verzweiflung. Wahrscheinlich war sie also tatsächlich weggelaufen und versteckte sich – vor wem auch immer. Dann erst realisierte er, was sie gesagt hatte. »Wen wolltest du aus der Nähe sehen?«, fragte er.
»Konny«, wisperte sie. »Ich bin nur seinetwegen hier, ehrlich. Bitte, rufen Sie nicht die Polizei, ich wollte doch …« Sie fing erneut an zu weinen.
Leon brauchte mehrere Sekunden, um zu begreifen, womit er es hier zu tun hatte. Beinahe hätte er laut gelacht. Sie war nicht ausgerissen, sie war ein Fan seines Ältesten!
Konstantin wollte Schauspieler werden. Er war erst sechzehn Jahre alt und hatte, außer in seiner Schultheatergruppe, keinerlei Erfahrungen als Schauspieler gehabt, bevor er von dem jungen Regisseur Oliver Heerfeld quasi vom Fleck weg für die Hauptrolle seines neuen Films engagiert worden war – und dieser Film lief gerade mit beachtlichem Erfolg in den Kinos. So weit war es also gekommen, dass die Fans seines Sohnes hier im Garten auf Bäume stiegen, um einen Blick auf ihn zu erhaschen.
»Er schläft um diese Zeit«, erwiderte er trocken. »Das hättest du dir eigentlich denken können.«
»Hab ich ja«, antwortete das Mädchen mit einem Hauch von Trotz in der Stimme. »Aber ich dachte, er wird wach, wenn er die Lichtzeichen sieht – und wenn er ans Fenster kommt, redet er vielleicht mit mir, und ich kann ein Foto von ihm machen.« Ihre Stimme klang stockend, die Augen waren noch immer nass.
»Wie heißt du?«, fragte Leon.
»Lara. Rufen Sie jetzt die Polizei?«
»Nein, das werde ich nicht tun, dieses Mal nicht, aber beim nächsten Mal. Was hast du dir dabei gedacht, Lara? Stell dir nur mal vor, alle, denen der Film gefällt, würden sich so verhalten wie du. Was dann? Sollen wir auswandern, weil wir uns sonst vor lauter Fans nicht mehr retten können?«
»Es tut mir leid«, murmelte Lara. »Echt, es tut mir leid, ich mache das nicht noch einmal, das verspreche ich.«
»Wissen deine Eltern, dass du hier herumläufst?«
Ein erschrockener Blick aus dunklen Augen traf ihn. »Nein! Die denken, ich liege im Bett. Die würden ausrasten, wenn sie wüssten, wo ich bin.«
»Hoffentlich. Du hast dich also heimlich aus der Wohnung geschlichen.«
Lara nickte mit gesenktem Kopf. Sie weinte nicht mehr, zum Glück.
»Woher glaubst du eigentlich zu wissen, wo genau Konstantins Zimmer ist?«
Lara hob den Kopf, ihre dunklen Augen weiteten sich. »Das wissen alle!«, sagte sie atemlos. »Im Internet gibt es viele Fangruppen, die tauschen sich aus, und daher habe ich das auch. Und weil ich in der Nähe wohnte, dachte ich …« Sie brach ab. »Kann ich jetzt gehen?«, fragte sie. »Ich mache das nie wieder, Ehrenwort. Aber ich wollte so gern ein Foto von ihm machen. Ein privates, meine ich. Nicht so ein gestelltes, nachdem man ihn angesprochen hat, und dann ist er so nett und lächelt in die Kamera. Ich wollte … etwas Besonderes.«
Sie war so jung! Leon hatte seinen Ärger längst vergessen, stattdessen verspürte er so etwas wie Rührung, als er sich vorstellte, dass sie bereit gewesen war, sich für die Erfüllung dieses Wunsches mitten in der Nacht aus dem Bett zu quälen, sich aus der Wohnung zu schleichen und dann noch wie ein Dieb ein fremdes Grundstück zu betreten und auf einen Baum zu klettern. Am liebsten hätte er ihr ein Foto seines Sohnes geschenkt, aber so weit ging er dann doch nicht. Mädchen in dem Alter konnten Geheimnisse in der Regel nicht für sich behalten. Also würden bald Laras sämtliche Freundinnen Bescheid wissen und vielleicht auf die Idee gekommen, auch einmal auf diese Weise eine Annäherung an Konstantin Laurin zu versuchen. Das wollte er lieber nicht riskieren.
»Gut, ich glaube dir, dass du es ernst meinst«, sagte er. »Ja, du kannst jetzt gehen.«
»Danke schön«, erwiderte sie. Sie hatte sich bereits umgedreht und sich ein paar Schritte von ihm entfernt, als sie noch einmal stehenblieb. »Sie sind echt nett«, sagte sie.
»Du bist auch nett, Lara. Mach es in Zukunft besser.«
Sie nickte, dann ging sie.
Nachdenklich betrat Leon das Haus. Sie alle hatten sich noch nicht daran gewöhnt, dass Konstantin allmählich bekannt wurde. Antonia und er hatten die Möglichkeit, dass es so kommen könnte, verdrängt, wie er ehrlich zugeben musste. Ihre Kinder waren da weitsichtiger gewesen. Kevin, ihr jüngerer Sohn, zog Konstantin gern mit Hollywood auf, und die Jüngste, Kyra, hatte schon mehrfach die Befürchtung geäußert, in Zukunft vor allem ›die Schwester von Konstantin Laurin‹ zu sein und nicht mehr um ihrer selbst willen gemocht zu werden. Nur Kaja, Konstantins Zwillingsschwester, hielt sich bedeckt. Leon nahm aber an, dass auch ihr der wachsende Rummel um ihn langsam unheimlich wurde.
Im Haus war es dunkel und still. Seltsam, auf der Herfahrt war er noch todmüde gewesen, jetzt war er wach und sogar ein bisschen aufgedreht. Aber es war noch keine vier Uhr, also lohnte es sich auf jeden Fall, sich wieder ins Bett zu legen.
Leon schlich nach oben, zog sich aus und legte sich wieder zu seiner Frau ins Bett. Antonia gab ein paar Geräusche von sich, aber richtig wach wurde sie nicht. Dennoch schmiegte sie sich an ihn, und ihr warmer Körper sorgte dafür, dass sich seine Müdigkeit wohlig zurückmeldete.
Er dachte noch ein wenig über Lara nach. Beim Frühstück würde er sie nicht erwähnen, denn morgens hatte niemand Zeit, alle waren in Eile, für ein ruhiges Gespräch fehlte da die Ruhe. Aber beim Abendessen würde er seine nächtliche Begegnung schildern. Er war gespannt auf die Reaktionen seiner Frau und der Kinder. Vor allem auf Konstantins Haltung dazu.
Mit diesem Gedanken schlief er ein.
*
Marisa Körner fuhr mit ihrem Rollstuhl so geschickt durch die kleine Wohnung, als täte sie das schon seit Jahren, dabei war sie noch nicht einmal zwei Monate wieder zuhause. Der Unfall, bei dem sie schwer verletzt worden war – ein Lastwagenfahrer hatte sie auf dem Fahrrad beim Abbiegen nicht gesehen – lag jetzt fast vier Monate zurück. Sie war in der Kayser-Klinik gleich mehrfach operiert worden, hatte dort mehrere Wochen verbracht und danach noch einige Zeit in einer Reha-Klinik.
Aber was die Ärzte und Physiotherapeuten auch versucht hatten: Ihre Lähmung in den Beinen war nicht zurückgegangen. Sie hatte sich sonst gut erholt, nur laufen konnte sie seit dem Unfall nicht mehr. Noch freilich sagten ihr die Ärzte, sie solle die Hoffnung nicht aufgeben, und das tat sie auch nicht – jedenfalls versuchte sie sich an die Hoffnung zu klammern. Aber es gab Tage, die dunkler waren als andere, selbst für einen Menschen wie sie, der sich nicht so leicht unterkriegen ließ.
»Unsere Marisa ist eine Kämpferin«, sagten ihre Eltern oft, und das stimmte. Aber immer nur kämpfen konnte kein Mensch, auch sie nicht.
Dabei kam sie im Grunde gut klar. Sie brauchte im Alltag eigentlich keine Hilfe mehr, sogar im Bad schaffte sie es allein, und da sie in einem Haus mit Aufzug wohnte, erledigte sie auch die meisten Einkäufe selbst. Es gab zwar vielfältige Hindernisse, aber mit den meisten wurde sie fertig. Außerdem war ihre Familie ihr eine große Hilfe. Ihre Eltern wohnten zwar nicht in München, aber sie riefen oft an, und immer sprachen sie ihr Mut zu. Und in den ersten beiden Wochen, als Marisa nach Hause entlassen worden war, hatte sich ihre Mutter um sie gekümmert. In der Zeit hatte ihr Vater allein auf dem Hof zurechtkommen müssen. Marisas Eltern waren Landwirte. Deshalb war ihre größte Stütze seit dem Unfall ihre jüngere Schwester Tanja.
Marisa war Verwaltungsangestellte bei der Stadt, und das war ein weiteres Glück: Sie konnte von zu Hause aus arbeiten. Sie hatte jetzt ein Online-Büro, war ans Verwaltungsnetz angeschlossen und arbeitete wieder voll, genau wie vor dem Unfall. Die Arbeit half ihr enorm, denn sie hätte sonst nicht gewusst, womit sie ihre Tage hätte füllen sollen. So lenkte die Arbeit sie über weite Strecken des Tages von ihrem Unglück ab, darüber war sie froh.
Ihr Schreibtisch stand so, dass sie von dort aus hinunter auf die Straße sehen konnte, das war ihr wichtig. Ab und zu brauchte sie eine Unterbrechung, eine kleine Pause, in der sie entweder einen Kaffee trank oder zumindest mit ihren Augen spazieren ging. Das tat sie besonders gern. Wenn es warm genug war, öffnete sie auch schon mal das Fenster und ließ sich von der Sonne bescheinen, das war dann beinahe wie ein kleiner Urlaub.
Sie konnte sich auch über fehlende Kontakte nicht beklagen. Ihre Kolleginnen und Kollegen meldeten sich regelmäßig bei ihr, schickten ihr Nachrichten, riefen sie an, einige kamen vorbei. Und alle machten ihr Mut oder versuchten es zumindest.
Aber es gab eben Tage wie diesen, wo es regnete, wo der Himmel grau war, wo sie mit ihrer Arbeit nicht recht vorankam und wo es nichts zu geben schien, das imstande gewesen wäre, ihre Stimmung zu heben.