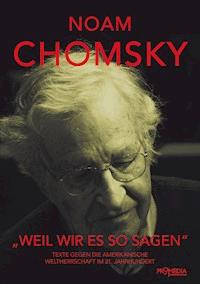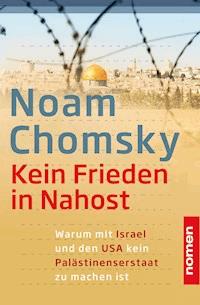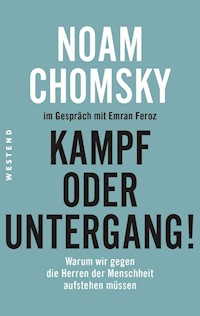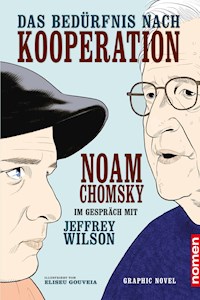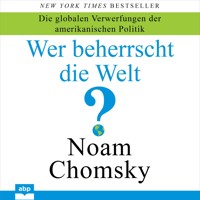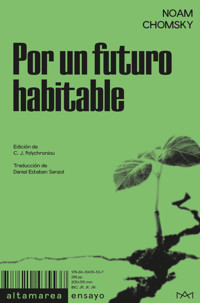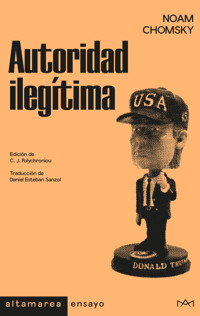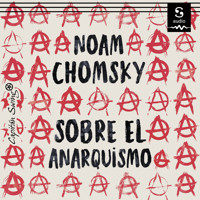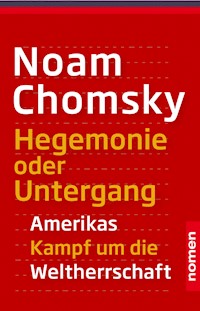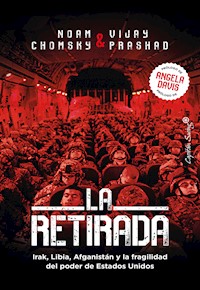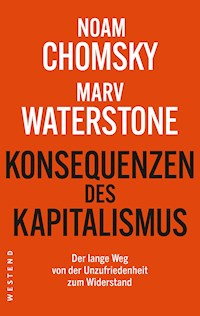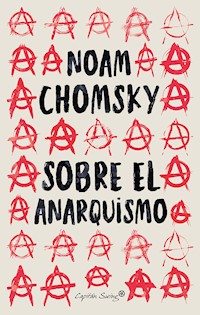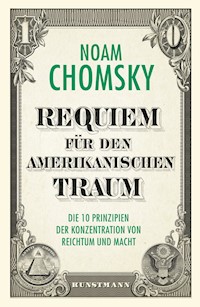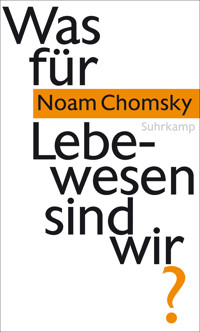
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noam Chomsky gilt als der Begründer der modernen Linguistik und als einer der Gründerväter der Kognitionswissenschaften. Zugleich ist er einer der meistgelesenen politischen Denker der Welt. Dieses Buch ist die philosophische Summe seines Lebens: Erstmals führt er alle seine großen Themen zusammen und begibt sich auf die Suche nach dem Wesen des Menschen.Chomsky nimmt seinen Ausgang bei der Sprache. Diese ist für ihn ein angeborener Mechanismus, der ein keineswegs zwingendes Muster aufweist und unser Denken bestimmt. Wir alle denken gemäß diesem Muster – und daher können wir auch nur das wissen, was die menschliche Sprache zu denken erlaubt. Einige Geheimisse der Natur könnten uns deshalb für immer verborgen bleiben. Zugleich eröffnet die Sprache aber eine kreative Freiheit; uns ist ein Freiheitsinstinkt gegeben, der uns gegen Herrschaft aufbegehren und eine freie Entfaltung suchen lässt. In der libertären Tradition von Wilhelm von Humboldt, John Stuart Mill und Rudolf Rocker zeichnet uns Chomsky als anarchische Lebewesen, die nach einer Assoziation freier Menschen streben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Noam Chomsky gilt als der Begründer der modernen Linguistik und als einer der Gründerväter der Kognitionswissenschaften. Zugleich ist er einer der meistgelesenen politischen Denker der Welt. Dieses Buch ist die philosophische Summe seines Lebens: Erstmals führt er alle seine großen Themen zusammen und begibt sich auf die Suche nach dem Wesen des Menschen. Chomsky nimmt seinen Ausgang bei der Sprache. Diese ist für ihn ein angeborener Mechanismus, der ein keineswegs zwingendes Muster aufweist und unser Denken bestimmt. Wir alle denken gemäß diesem Muster – und daher können wir auch nur das wissen, was die menschliche Sprache zu denken erlaubt. Einige Geheimnisse der Natur könnten uns deshalb für immer verborgen bleiben. Zugleich eröffnet die Sprache aber eine kreative Freiheit; uns ist ein Freiheitsinstinkt gegeben, der uns gegen Herrschaft aufbegehren und eine freie Entfaltung suchen lässt. In der libertären Tradition von Alexander von Humboldt, John Stuart Mill und Rudolf Rocker zeichnet uns Chomsky als anarchische Lebewesen, die nach einer Assoziation freier Menschen streben.
Noam Chomsky, geboren 1928, ist emeritierter Professor für Linguistik und Philosophie am Massachusetts Institute of Technology. Er ist Träger zahlreicher Ehrendoktorwürden und Auszeichnungen wie des Kyoto – Preises und der Helmholtz – Medaille.
Zuletzt erschienen:
Sprache und Geist (stw 19)
Reflexionen über die Sprache (stw 185)
Regeln und Repräsentationen (stw 351)
Noam Chomsky
Was für Lebewesen sind wir?
Aus dem Amerikanischen von Michael Schiffmann
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel What Kind of Creatures Are We? bei Columbia University Press.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016
Erste Auflage 2016
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© 2016 Noam Chomsky
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Inhalt
Vorwort von Akeel Bilgrami
1. Was ist Sprache?
2. Was können wir verstehen?
3. Was ist das Gemeinwohl?
4. Die Geheimnisse der Natur – Wie tief verborgen?
Namenregister
Akeel BilgramiVorwort
Dieses Buch präsentiert das Ergebnis des lebenslangen Nachdenkens eines Sprachwissenschaftlers über die weiteren Auswirkungen seiner wissenschaftlichen Arbeit. Der Titel dieses Bandes, Was für Lebewesen sind wir?, vermittelt bereits, wie weitreichend diese Folgen tatsächlich sein könnten. Sie umfassen ein beeindruckendes Spektrum von Gebieten: theoretische Linguistik, Kognitionswissenschaft, Wissenschaftsphilosophie, Geschichte der Wissenschaft, evolutionäre Biologie, Metaphysik, Erkenntnistheorie, die Philosophie von Sprache und Geist, politische und Moralphilosophie und, andeutungsweise, sogar das Ideal einer humanen Bildung und Erziehung.
Kapitel 1 legt klar und präzise Noam Chomskys eigene grundlegende Ideen im Bereich der theoretischen Linguistik und der Kognitionswissenschaft dar, beides Felder, in denen er eine absolut zentrale Gründerrolle gespielt hat. Dabei zeichnet Chomsky die Fortschritte auf, die im Lauf der Jahre erreicht wurden, aber richtet unsere Aufmerksamkeit noch viel mehr darauf, wie vorläufig alle Behauptungen über Fortschritte geäußert werden müssen, da selbst in den grundlegendsten Forschungsbereichen noch sehr viel Arbeit zu tun bleibt. Außerdem berichtet er von Veränderungen der Perspektive, von denen einige der bedeutendsten erst im Lauf der letzten zehn Jahre stattfanden.
Das Kapitel beginnt mit der Motivierung der Frage, die mit dem Titel, »Was ist Sprache?«, angesprochen ist. Wir müssen diese Frage stellen, denn ohne Klarheit darüber zu gewinnen, was Sprache ist, werden wir nicht nur unfähig sein, die richtigen Antworten auf andere Fragen zu diversen spezifischen Aspekten der Sprache zu finden (und diese spezifischen Fragen vielleicht sogar richtig zu stellen), sondern wir werden uns auch der Untersuchung der biologischen Basis und der evolutionären Ursprünge der Sprache nie nähern oder auch nur plausibel darüber spekulieren können.
Schon eine Tradition, die auf Galileo und Descartes zurückgeht, erkannte das grundlegendste Merkmal der Sprache, das dann in deutlichster Form durch Humboldt artikuliert wurde: Die Sprache »stehe ›eigentlich einem unendlichen und wahrhaft unbegrenzten Gebiete, dem Inbegriff alles Denkbaren gegenüber. Sie muß daher von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch machen, und vermag dies durch die Identität der gedanken- und spracherzeugenden Kraft.‹«[1] Auch Darwin wird zitiert, der dies im Kontext von Fragen zur Sprachevolution auf elementarere Weise wiederholt: »[V]on den Tieren unterscheide[t] sich der Mensch bloß durch seine [fast] unendlich größere Fähigkeit, die verschiedenartigsten Laute und Ideen zu assoziieren.« Notieren wir, dass Humboldt und Darwin hier auf drei grundlegende Merkmale der Sprache hinweisen. Erstens, die Behauptung einer auf einer endlichen Basis beruhenden unendlichen Fähigkeit, zweitens, die Verbindung von Ideen mit Lauten, und drittens, die Beziehung zwischen Sprache und Denken. Sie alle gehen ein in das, was Chomsky gleich eingangs zur Grundeigenschaft der Sprache erklärt: »Jede Sprache stellt ein unbegrenztes Spektrum hierarchisch strukturierter Ausdrücke zur Verfügung, die an zwei Schnittstellen interpretiert werden: einer sensomotorischen für die Externalisierung und einer konzeptuell-intentionalen für geistige Prozesse.« Mit dem hierarchisch-strukturellen Element ist hier das erste, mit der sensomotorischen Schnittstelle das zweite und mit der konzeptuell-intentionalen Schnittstelle das dritte Merkmal angesprochen.
Was diese Grundeigenschaft möglich macht, ist eine Berechnungsprozedur. Diese Tatsache hat eine zweifache philosophische Bedeutung: Eine Theorie der Sprache ist notwendigerweise eine generative Grammatik, und die Theorie handelt notwendigerweise von einem Objekt, das sich im Besitz einzelner Menschen befindet und eine interne Eigenschaft individueller Personen und ihrer geistigen Wesensart (das heißt intensionaler Elemente) darstellt. Sie ist keine Theorie externalisierter Äußerungen und daher handelt sie auch nicht von einem sozialen Phänomen. Die Nomenklatur zur Erfassung dieser Unterscheidung zwischen dem, was individuell, intern und intensional, und dem, was externalisiert und sozial ist, wird vom Begriff I-Sprache auf der einen und dem der E-Sprache auf der anderen Seite geliefert. Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung können nur I-Sprachen sein, E-Sprachen dagegen nicht.[2] Und während eine derartige Untersuchung letztlich durch eine biologische Erklärung bestätigt werden muss, erfasst die Wissenschaft, bis es so weit ist, die Phänomene auf einer abstrakteren Ebene als der der Biologie und spricht auf kognitiver Ebene von der rechnerischen Fähigkeit, die der Grundeigenschaft Genüge tut.[3]
Eine andere, allgemeinere Aufgabe besteht in der Entdeckung der allen I-Sprachen gemeinsam zugrundeliegenden Merkmale, die wiederum von den biologischen Eigenschaften festgelegt sind, mit denen menschliche Wesen ausgestattet sind (ein Thema, dessen weiter reichende Bedeutung für die gesamte Kognition in Kapitel 2 erneut diskutiert wird). Diese allgemeinere Aufgabe wird mit dem Ziel angegangen, das biologische Rüstzeug zu entdecken, das bestimmt, welche generativen Systeme als I-Sprachen dienen können. Mit anderen Worten, welches sind die möglichen menschlichen Sprachen?
Chomsky weist dann darauf hin, dass sich sofort nach Beginn der ernsthaften Erforschung generativer Grammatiken unter Berücksichtigung der Grundeigenschaft einige überraschende und merkwürdige Phänomene zeigten, die zu weitreichenden Konsequenzen führten. Eines davon ist die »Strukturabhängigkeit« sprachlicher Operationen: In sämtlichen Konstruktionen in allen Sprachen basieren diese Operationen ausnahmslos auf struktureller Entfernung statt auf dem rechnerisch weitaus simpleren Begriff der linearen Entfernung. Lerner einer Sprache wissen das automatisch, ohne dass es ihnen beigebracht wurde. Diese Beobachtung wird auch durch Daten aus der experimentellen Neurowissenschaft und der Psychologie gestützt. Das Resultat folgt aus der Annahme, dass die lineare Reihenfolge den Operationen, welche die strukturierten Ausdrücke generieren, die an der konzeptuell-intentionalen Schnittstelle für das Denken und für die Planung von Handlungen interpretiert werden, schlicht nicht zur Verfügung steht. Das wiederum folgt aus der sehr natürlichen Annahme, dass I-Sprachen generative Systeme sind, die auf der elementarsten, die lineare Reihenfolge ignorierenden Rechenoperation basieren. Diese und zahlreiche weitere Gesichtspunkte stellen wichtiges Beweismaterial für die These dar, dass lineare Reihenfolge für die Sprache nur eine untergeordnete Bedeutung hat und am Kern von Syntax und Semantik gar nicht beteiligt ist. Dasselbe gilt für die verschiedenen externen Arrangements der Zeichensprache, von der wir heute wissen, dass sie in Struktur, Erwerb, Gebrauch und sogar neuraler Repräsentation der gesprochenen Sprache bemerkenswert ähnlich ist. Vermutlich spiegeln diese externen Eigenschaften Bedingungen wider, die vom sensomotorischen System diktiert werden. Die Option, von der linearen Reihenfolge Gebrauch zu machen, stellt sich also für den Sprachlerner gar nicht erst. Lineare Reihenfolge und vergleichbare Arrangements sind relevant für das, was gehört/gesehen – das heißt externalisiert – wird, nicht für das, was gedacht wird und sprachintern stattfindet.
Chomsky weist dann auch darauf hin, dass diese Schlussfolgerungen gut zu dem wenigen passen, was über den Ursprung der Sprache bekannt ist. Das sensomotorische System »schein[t] schon lang vor dem Auftauchen der Sprache vorhanden gewesen zu sein« und weist offenbar nur wenige spezifische Anpassungen an die Sprache auf. Der Sprache liegen kognitive Prozesse viel tiefer gehender Art zugrunde, als sie bei Affen oder vermutlich auch bei nicht-menschlichen Hominiden zu finden sind beziehungsweise wären. Affen besitzen Gestensysteme, die für Zeichensprache, und auditive Systeme, die für die Wahrnehmung gesprochener Sprache geeignet sind, aber im Unterschied zu menschlichen Babys interpretieren sie Letztere lediglich als Geräusch und sind selbst bei intensivem Training nicht imstande, auch nur die Anfänge menschlicher Zeichensprache zu erlernen. Aristoteles charakterisierte Sprache als »Laut mit Bedeutung«, aber die eben skizzierten Gesichtspunkte legen für Chomsky nahe, dass die Priorität in dieser Formulierung auch umgedreht werden könnte und man Sprache vielleicht besser als »Bedeutung mit Laut« verstehen sollte. Falls dies nach Platonismus – einer enthusiastisch von Jerrold Katz propagierten Idee – klingt, muss daran erinnert werden, dass Chomsky »Bedeutung« hier als ganz und gar psychologische (und letztlich biologische) Kategorie und keineswegs als platonistische Verdinglichung verstanden wissen will.
Solche Schlüsse wiederum stützen Chomskys langjährigen Standpunkt, dass Sprache nicht so verstanden werden sollte, wie es von Philosophen, Anthropologen und anderen allenthalben getan wird, nämlich als dem Wesen nach an Kommunikation gebunden. Wenn die Externalisierung der Sprache ein sekundärer Prozess und die Beziehung von Sprache und Denken primär ist, dann kann Kommunikation für keine der Antworten auf die Frage dieses Kapitels – Was ist Sprache? – zentral sein. Tatsächlich gibt es laut Chomsky Grund zu der Annahme, dass der größte Teil von Sprache und Denken überhaupt nicht externalisiert wird. Wenn man dezidiert von dem Verständnis ausgeht, dass die Sprache nichts von Menschen Konstruiertes, sondern Teil ihrer biologischen Ausstattung ist, könnten im Bereich der wissenschaftlichen oder philosophischen Untersuchung der Sprache beträchtliche Veränderungen in unseren methodologischen Ansätzen notwendig sein.
Der von Chomsky zustimmend zitierten Bemerkung Darwins zufolge ist das Fundamentale an der Sprache die »Fähigkeit, die verschiedenartigsten Laute und Ideen zu assoziieren«. Abgesehen von der Tatsache, dass Chomsky wie erwähnt nunmehr die Lautseite (ebenso wie andere Methoden der Externalisierung) für weniger bedeutend hält, nimmt seine eigene theoretische Darstellung der Grundeigenschaft an dieser Stelle Darwin beim Wort – wenn auch vielleicht nicht ganz exakt, da »Assoziieren« nicht wirklich das passende Wort für die Beschreibung der zentralen in seiner Darstellung postulierten Operation ist. Assoziation findet ja sogar bei der klassischen Konditionierung (mit Glocke und Nahrung) statt, und Chomsky ist berühmt für seine Zurückweisung behavioristischer Sprachtheorien. Außerdem könnte die Rede von der Assoziation zwischen zwei Dingen angesichts der Art, wie selbst viele nicht-behavioristische Psychologen dieses Wort verstehen, andeuten, dass die Reihenfolge ihrer Erwähnung – »Laut«, »Bedeutung« – eine Wichtigkeit hat, die in völligem Widerspruch zu der Tatsache steht, dass Chomsky den für die semantische Interpretation an der konzeptuell-intentionalen Schnittstelle geeigneten Formen ein viel größeres Gewicht zuweist als denen an der sensomotorischen Schnittstelle. Wenn wir Darwins irreführendes Wort »assoziieren« für das, was er sagen wollte, beiseitelassen, möchte Chomsky mit diesem Zitat die Tatsache ins Zentrum stellen, dass wir Menschen einzigartig in unserer Fähigkeit sind, Ideen und syntaktische Elemente »zusammenzufügen«. Und diese fundamentale Konzeption von der Sprache findet ihr Echo in der theoretischen Beschreibung der Grundeigenschaft, in der die entscheidende Operation als »Verknüpfung« bezeichnet wird, wobei diese entweder extern an zwei verschiedenen Objekten oder intern, von innerhalb des einen Objekts aus, operieren kann, um ein weiteres Objekt zu konstruieren. Aus dem zweiten Fall ergibt sich automatisch die überall vorzufindende Eigenschaft der »Deplatzierung« (also Ausdrücke, die an einer bestimmten Stelle gehört, aber außerdem auch an einer anderen Stelle interpretiert werden) in genau der Form, die für eine komplexe semantische Interpretation angemessen ist.
Diese Operationen werden Externe Verknüpfung und Interne Verknüpfung genannt, und der Respekt der wissenschaftlichen Methode vor dem Prinzip der Einfachheit, der für die Sprachwissenschaft genauso gilt wie überall sonst, gebietet dann, dass wir die grundlegende Operation auf dieses Minimum beschränken und keine weiteren Operationen zur Erklärung der rechnerischen Fähigkeit postulieren, auf der die Grundeigenschaft basiert. Mittels einiger Beispiele, die zeigen, wie sich der Bauplan der Sprache als optimal erweist, wenn wir uns an dieses methodologische Gebot halten, skizziert Chomsky auch Änderungen in seinen eigenen Auffassungen wie zum Beispiel in Bezug auf das Phänomen der »Deplatzierung«, das er früher als »Unvollkommenheit« betrachtete, das aber heute für ihn einfach genau das ist, was man erwarten sollte, wenn man sich an die erwähnten einfachsten methodologischen Annahmen hält.
Das Kapitel schließt mit einem kühnen Versuch, diese methodologischen Gesichtspunkte zu nutzen, um zwei scheinbar disparate Fragen zusammenzubringen: Wie sollen wir die Grundeigenschaft charakterisieren? Wie und wann ist Sprache entstanden? Dieses Zusammenspiel möglichst einfacher Annahmen zur Charakterisierung der Grundeigenschaft und der begleitenden Postulierung eines optimalen Bauplans der Sprache könnte dazu beitragen, der vor dem Hintergrund der spärlichen verfügbaren Daten plausibelsten Hypothese über die Ursprünge der Sprache Substanz zu verleihen, der zufolge die Sprache nicht graduell, sondern plötzlich (und das erst vor recht kurzer Zeit) entstanden ist. Des Weiteren kann man dann spekulieren, dass ein solch plötzlicher »großer Sprung nach vorn« vielleicht durch eine »geringfügige Neuverdrahtung des Gehirns« bewirkt wurde, die »die Operation Verknüpfung, natürlich in ihrer einfachsten Form, hervorgebracht und damit die Basis für unbegrenztes und kreatives Denken« geschaffen hat, etwas, was der Mensch bis dahin nicht besaß.
Kapitel 2, »Was können wir verstehen?«, untermauert einige dieser Schlüsse, indem es zunächst über ein anderes zentrales Thema in Chomskys Werk spricht, nämlich die Grenzen der menschlichen Kognition.
Es gibt eine Formel, die wir alle schon oft verwendet haben: »der Umfang und die Grenzen von …«. Chomsky nimmt sie sehr ernst und gibt ihr in der Darlegung seines Verständnisses unserer kognitiven Fähigkeiten eine entscheidende Wendung. Diese Fähigkeiten, die in ihrem Umfang breiter und tiefer sind als bei jedem anderen uns bekannten Lebewesen, haben diesen Umfang teilweise gerade deswegen, weil sie auch Grenzen unterliegen, Grenzen, die auf unsere Natur oder, wie der Titel dieses Buches nahelegt, die Art von Lebewesen, die wir sind, zurückgehen – und ganz besonders auf die Tatsache, dass unsere kognitiven Fähigkeiten eine biologische Basis haben.
Wir sind auf diesen Punkt implizit schon in Kapitel 1 gestoßen, obwohl er dort noch speziell auf die menschliche Fähigkeit zur Sprache beschränkt war. Die dort vorgelegte theoretische Darstellung der Sprache setzte diesen Begriff von Grenzen voraus – jedenfalls setzt sie ihn dann voraus, wenn wir mit angeborenen genetischen Strukturen ausgestattet sind, die uns unsere einzigartige Fähigkeit zur Sprache verleihen, die aber gleichzeitig beschränken, was Sprache für uns ist und was für I-Sprachen es geben kann. Der technische Terminus »UG« soll der Charakterisierung genau dieser angeborenen Strukturen dienen, und genau innerhalb des von dieser genetischen Ausstattung definierten Rahmens von Möglichkeiten undGrenzen wird Sprache in der zuvor zusammengefassten generativen Beschreibung als Rechenfähigkeit erklärt.
Was für die Sprache gilt, ist nur der Sonderfall eines ganz allgemeinen Spektrums von Möglichkeiten und Grenzen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass Menschen nun einmal biologische Wesen sind. Diese Idee scheint nicht auf Widerspruch zu stoßen, wenn es um physische Fähigkeiten geht, etwa darum, was uns dazu befähigt, aufrecht zu gehen, so dass wir nicht wie Schlangen über den Boden gleiten können.[4] Chomsky hält es für ein Vorurteil zu behaupten, das, was im Fall solcher physischer Fähigkeiten offensichtlich ist, sei im Fall kognitiver Fähigkeiten nicht ebenso klar, auch wenn die endlosen Kontroversen um angeborene Ideen Letzteres nahelegen. Der Besitz bestimmter kognitiver Fähigkeiten bedeutet notwendigerweise, dass andere kognitive Fähigkeiten fehlen können, kognitive Fähigkeiten, die andere Arten geistbegabter Wesen durchaus haben könnten. Nur wenn wir, sowie wir die menschliche Kognition erforschen, die Tatsache unserer Biologie verleugnen, können wir auf die Idee kommen, diese Grenzen abzustreiten. Und Kapitel 2 betrachtet derartige Fragen nach den Grenzen unserer kognitiven Fähigkeiten ganz allgemein und über den Sonderfall der Sprache hinaus, obwohl es an verschiedenen Punkten auch erneut auf die Sprache zurückkommt und zu diesem Thema verschiedene Schlüsse zieht.
Es untersucht das methodologische Fazit dieser Idee kognitiver Grenzen, indem es zunächst auf eine Unterscheidung zurückgreift, die Chomsky vor nunmehr fast fünfzig Jahren getroffen hat, nämlich die zwischen »Problemen« und »Geheimnissen«. Dabei greift er auf Peirce' Verständnis der wissenschaftlichen Methode und des wissenschaftlichen Fortschritts zurück, das sich auf das Konzept der Abduktion beruft, das dem, was als »zulässige Hypothesen« zählt, Grenzen auferlegt, und argumentiert, dass angeborene, von unserer genetischen Ausstattung festgelegte Strukturen den Fragen, die wir formulieren können, Grenzen setzen. Die Fragen, die wir mit einiger Aussicht auf Erfolg stellen können, werden »Probleme« genannt, aber angesichts der Grenzen, in denen eine Formulierung solcher Fragen überhaupt möglich ist, wird es auch solche geben, die jenseits unserer kognitiven Fähigkeiten liegen; soweit wir sie uns überhaupt vorstellen können, werden wir angesichts unseres gegenwärtigen Wissensstandes und konzeptuellen Rahmens unfähig sein, die entsprechenden Fragen so zu formulieren, dass sie auf brauchbare Weise wissenschaftlich verfolgt werden können. Diese Fragen nennt Chomsky »Geheimnisse«. Der Titel dieses Buches, Was für Lebewesen sind wir?, spricht genau diesen Punkt an, da andere Lebewesen mit einer anderen biologischen Ausstattung als der unseren sehr wohl fähig sein könnten, Probleme zu formulieren, die für uns ein undurchdringliches Rätsel bleiben. Demnach ist für Chomsky, wenn auch womöglich nicht für Peirce (der, wenn er von zulässigen Hypothesen sprach, unserem Charakter als biologische Wesen vielleicht eine weniger bestimmende Rolle zuwies),[5] die Unterscheidung zwischen »Problemen« und »Geheimnissen« ein Unterschied, der durch den Organismus, von dem die Rede ist, definiert wird.
Ein sehr wichtiger Teil dieses methodologischen Bildes besagt, dass wir lernen sollten, mit der Tatsache unserer kognitiven Grenzen und den »Geheimnissen«, deren Anerkennung sie uns aufnötigen, zu leben. Das letzte Kapitel dieses Buches, »Die Geheimnisse der Natur«, behandelt bedeutende Augenblicke in der Geschichte der Wissenschaft, um daraus genau diese methodologische Lehre zu ziehen.
Einer dieser Momente trat ein, als Newton die kontaktmechanischen Annahmen der frühneuzeitlichen Wissenschaft umstürzte und einen Begriff der Schwerkraft postulierte, der die früheren Konzepte von Materie, Bewegung und Kausalität untergrub, die ja letzten Endes (vermutlich durch die kognitiven Grenzen unserer Biologie bestimmte) wissenschaftliche Versionen unseres Commonsense-Verständnisses von der Welt der Gegenstände waren. Chomsky weist darauf hin, dass mit Newton ein neues System auftauchte, innerhalb dessen etwas – im Lichte dieser Grenzen betrachtet – bis daher Unbegreifliches vorgeschlagen wurde. Newton selbst gestand die Unbegreiflichkeit seiner Thesen ein und bezeichnete sie sogar als Absurdität, und niemand seit Newton hat irgendetwas tun können, um das alte Bild wiederherzustellen. Stattdessen hat die Absurdität ganz einfach Eingang in unser wissenschaftliches Weltbild gefunden. Newton ließ sich davon nicht abschrecken, entwickelte Gesetze von erklärender Kraft und ließ das Fehlen eines tieferen, zugrundeliegenden Verständnisses der Welt beiseite, das, wenn wir es hätten, dem Sinn verleihen würde, was nach seinem und dem Eingeständnis anderer als »okkulte« Kraft beschrieben werden musste. Dies genügte, um verständliche Theorien der Welt zu konstruieren. Und um das zu tun, war es nicht notwendig, die Welt in jenem tieferen Sinn verständlich zu finden, der durch unsere kognitiven Grenzen frustriert wird.
Spätere Denker (unter denen sich besonders Priestley als höchst scharfsinniger und einsichtsvoller Kommentator auszeichnet) machten sich diese methodologische Perspektive ausdrücklich zu eigen und zogen daraus Konsequenzen für diverse Fragen in der Philosophie des Geistes, die viele Philosophen von heute verwirrend finden, die sie aber, wenn sie Priestleys Einsichten akzeptieren würden, dazu veranlassen könnten, das, was sie als Geist-Körper-Problem oder als das »schwierige Problem« des Bewusstseins verstehen, neu zu überdenken. Philosophen haben eine Tendenz, dieses oder jenes Thema als einzigartig »schwierig« abzustempeln und dann in diesem bequemen Modus der Frustration zu verharren. Chomsky beruft sich gerade deswegen auf die eben skizzierte Geschichte, um zu zeigen, dass die Kennzeichnung solcher Probleme als »schwierig« alles andere als einzigartig ist. So wurden die Auswirkungen der Einführung der »Schwerkraft« in die Physik in der Zeit nach Newtons Entdeckung als nicht weniger problematisch betrachtet, nicht zuletzt von Newton selbst.[6] Die Bedeutung seiner Entdeckung für das so genannte Geist-Körper-Problem besteht darin, dass nunmehr fraglich ist, ob es – seit Newton – überhaupt noch kohärent formuliert werden kann. Die ursprünglich angsteinflößende Einführung von etwas so »Mysteriösem« wie der »Schwerkraft« erwies sich schließlich als unentbehrlich für unser Verständnis materieller Körper und ihrer Wirkung aufeinander ohne Kontakt und so wurde sie schlicht in die Wissenschaft integriert – und tatsächlich Bestandteil des neuen wissenschaftlichen Commonsense. Wenn wir daraus einen philosophischen Schluss ziehen sollten, dann den, dass alles immateriell ist und dass es daher gar kein definierbares Geist-Körper-Problem mehr gibt. In einer denkwürdig gewendeten Umkehrung des Slogans von Ryle sagt Chomsky, Newton habe keineswegs das Gespenst vertrieben, sondern die Maschine zerstört und das Gespenst unbehelligt gelassen. Was das Bewusstsein betrifft, stellt er die bei so unterschiedlichen Denkern wie Quine und Searle zu beobachtende Tendenz der Philosophen in Frage, einen Großteil unseres geistigen Lebens für bewusst zu halten, wenn man sich die Operationen regelgeleiteter Fähigkeiten sowohl im Bereich der Sprache als auch dem des Sehens ansieht. Chomsky bezieht hier eine besonders klare Position, weil sogar noch ein Großteil unseres bewussten Denkens mit Aspekten unseres Geistes interagiert, die dem Bewusstsein verborgen sind, weshalb eine Beschränkung auf das Bewusste auch ein wissenschaftliches Verständnis lediglich des bewussten Geistes behindern würde.
Angesichts seines Interesses an wissenschaftlichen Erklärungen möchte Chomsky auch zeigen, dass einige Arten, Sprache und, weiter gefasst, Denken zu betrachten, wissenschaftlich sinnlos sind. So finden wir hier im Besonderen eine umfangreiche Diskussion der atomischen Elemente der Berechnung. Unter Verweis auf in Kapitel 1 etablierte Punkte merkt er an, ihre Bezeichnung in der Literatur als »Wörter« und »lexikalische Einheiten« sei irreführend, da sie direkt mit der konzeptuell-intentionalen Schnittstelle interagieren, von der schon gezeigt wurde, dass sie gegenüber der sensomotorischen Schnittstelle primär ist – die Atome werden also nicht durch die Prozesse der Externalisierung konstruiert. Noch verblüffender für Philosophen ist Chomskys Behauptung, dass diese Elemente mit Ausnahme einiger explizit willkürlicher Ausnahmen in der Mathematik und Wissenschaft keinerlei referentiellen Eigenschaften haben und dass ihnen daher keine wesenseigenen Beziehungen zu kognitionsunabhängigen Objekten in der Außenwelt zugeschrieben werden sollten. Die I-Sprache, die als einzige tatsächlich wissenschaftlich erforschbar ist, hat somit einen durch und durch internen Charakter. Dieser Punkt wird hier mittels einer Darstellung historischer Auffassungen wie der von Aristoteles und Hume sowie einer Diskussion von Beispielen der erwähnten Atome untersucht, die von recht konkreten Exemplaren wie »Haus« oder »Paris« bis zu abstrakten Konzepten wie »Person« und »Ding« reichen. Diese Erörterung zeigt, dass Referenz oder Denotation zu kontextabhängig für eine wissenschaftliche Untersuchung sind und daher als bedeutsam für den Gebrauch der Sprache betrachtet werden sollten, nicht aber als grundlegender Aspekt der Sprache selbst. All das führt zu einer anderen Taxonomie als der, die man bei vielen Philosophen findet, und verweist fast alles, was diese über »Semantik« zu sagen haben, in den Bereich der Pragmatik.
Diese Schlussfolgerungen sind auch für die Frage nach dem Ursprung der Sprache von Bedeutung. Die Signale, die Tiere miteinander austauschen, werden durch direkte Verbindungen ausgelöst, die sie zu Objekten in der Außenwelt haben. Sie sind unmöglich zu verstehen, wenn man eine dieser kausalen Verbindungen außer Acht lässt, während die gerade skizzierte Diskussion ja gerade darauf abzielte, zu zeigen, dass es für die Atome des menschlichen Berechnungssystems keine derartigen wesenseigenen Verbindungen zu einer geistunabhängigen Realität gibt. Das liefert einen weiteren Grund für den Schluss, dass unser menschliches Wesen und die Fähigkeiten zu Sprache und Denken, die uns eigen sind und die wir besitzen, auf die Art evolutionär erklärt werden sollten, wie das in Kapitel 1 geschah, und nicht durch Manöver, die Chomsky in Kapitel 2 unter Berufung auf Lewontin als »Geschichtenerzählerei« über die graduelle Evolution aus unseren tierischen Vorläufern bezeichnet, eine Erklärungsweise, in die man nur zurückfällt, wenn man der Natur des zu erklärenden Phänotyps zuvor nicht genügend wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es handelt sich teilweise auch deswegen um »Geschichtenerzählerei«, weil wir, wie Chomsky unter erneutem Verweis auf Lewontin sagt, »das Pech« haben, dass uns keinerlei Daten zur Verfügung stehen, auf denen solche Erklärungen aufbauen könnten. Sie bleiben dem menschlichen kognitiven Zugang verborgen, eine weitere Form unserer Beschränkung.
Demnach sind Grenzen unserer kognitiven Fähigkeiten aus einer Vielzahl von Gründen unvermeidlich, deren wichtigster und am ernstesten zu nehmender die bloße Tatsache ist, dass wir biologische Wesen sind. Anders als Locke, Priestley, Hume, Russell, Peirce und Lewontin, die zu den »Helden« dieses Kapitels in Chomskys Buch zählen, behauptet Hilbert ganz explizit, »dass es ein unlösbares Problem überhaupt nicht gibt«, während ein Großteil der modernen Philosophie die Existenz von Geheimnissen eher implizit bestreitet. Beide leugnen damit eine Selbstverständlichkeit, die aus der erwähnten schlichten Tatsache folgt. Es ist faszinierend, dass Chomsky nach seiner Darstellung all dessen selbst eine interessante Kombination von Haltungen dazu einnimmt. Einerseits stellt schon die Idee kognitiver Grenzen, die uns Menschen mit »Geheimnissen« konfrontieren, die für andere Arten von Wesen vollkommen durchschaubar sein könnten, ein Eintreten für das dar, was Philosophen als eine realistische Metaphysik bezeichnen. Oder wie Chomsky sagt: »Wenn man von mysterianischen Gemeinplätzen ausgeht, ist das, was für mich unvorstellbar ist, kein Kriterium für das, was existieren kann.« Doch andererseits ist seine Haltung, sobald dies einmal anerkannt ist, genau wie die Newtons durch und durch pragmatisch. Nur weil das, was wir studieren, die Welt, letztlich vielleicht nicht verständlich ist, heißt das nicht, dass wir uns von dem Versuch abhalten lassen sollten, verständliche wissenschaftliche Theorien über die Welt zu entwickeln. Laut Chomsky könnte selbst das Konzept des freien menschlichen Handelns, das wohl jenseits der Reichweite der Konzepte (darunter vor allem Determiniertheit und Zufall) liegt, die wir besitzen, eines Tages wissenschaftlich erfasst werden, obwohl wir von einem solchen Verständnis derzeit noch weit entfernt sind. Das unterscheidet sich stark von der Haltung Kants, der erklärte, wir könnten die Freiheit zwar sehr wohl denken, aber niemals erkennen. Wie Peirce und vor ihm Newton, aber im Unterschied zu Kant möchte Chomsky nicht, dass sein eigener Mysterianismus und sein eigenes Bestehen auf den Grenzen unserer kognitiven Fähigkeiten »Barrieren auf dem Weg zum Wissen« errichten, wie Peirce es einmal ausgedrückt hat.
Kapitel 3, »Was ist das Gemeinwohl?«, lässt die Beschränkung der Diskussion auf unsere durchs Prisma unserer individuellen Fähigkeiten in den Bereichen Sprache und Kognition angesehene Natur hinter sich und betrachtet uns als soziale Wesen. Es versucht auszuloten, worin das Gemeinwohl besteht und welche politischen und wirtschaftlichen Bedingungen dieses befördern oder hemmen.
Bei der Verfolgung dieser Fragen spielt die Aufklärung eine große Rolle, wobei das, was Chomsky unter dieser Bezeichnung versteht, sehr weit gefasst ist und neben den vertrauten »liberalen« Figuren wie Adam Smith[7] und Mill auch solche einer breit verstandenen romantischen Tradition wie Humboldt und Marx mit einschließt. Und auch ihre Auslegung ist weit gefasst und betont nicht nur die Seite von Smith, die von den meisten seiner liberalen und radikalen Kritiker ebenso wie von seinen konservativen Anhängern häufig unterdrückt wird, sondern auch die Prinzipien, die es erlauben, die Aufklärung als Vorläufer nicht nur einer späteren anarchistischen Tradition in Europa, sondern auch John Deweys in den USA zu sehen.
Der Ausgangspunkt dieser Untersuchungen ist in Wirklichkeit individualistisch und steht mit den vorherigen Kapiteln in Beziehung. Selbst innerhalb ihrer biologisch festgelegten Grenzen stellen die kreativen Fähigkeiten, die jedes Individuum besitzt (und die in Kapitel 1 für den spezifischen Bereich der Sprache diskutiert wurden) genau jenes Potenzial dar, dessen volle Entwicklung die Einzelnen als selbstbestimmte Menschen wachsen und gedeihen lässt. Die soziale Frage nach dem Gemeinwohl ergibt sich ganz von selbst, wenn man fragt, welche Art von Institutionen diese Form von Entwicklung im Individuum verhindert. Gesellschaftliche Verhältnisse wie der Kapitalismus, die das Eigeninteresse hervorheben, behindern die Entwicklung individueller Fähigkeiten, statt sie zu fördern. Sowohl Adam Smith' plastische Verurteilung der Zerstörung, die die Arbeitsteilung im Hinblick auf unsere schöpferische Individualität anrichtet, als auch Deweys harsche Worte über den Schatten, den die Interessen der Großkonzerne auf fast jeden Aspekt des öffentlichen und persönlichen Lebens werfen, werden hier zitiert, um diesen Punkt zu etablieren. Die Tradition des Anarchismus (von Bakunin bis Rocker und zum Anarcho-Syndikalismus der Periode des spanischen Bürgerkriegs) vereint sozialistische Ideen mit den liberalen Prinzipien der klassischen Aufklärung, um ein Ideal – gemeinschaftliche Arbeit, Kontrolle der Arbeitenden über ihren Arbeitsplatz und die Produktionsmittel sowie ein um freiwillige Vereinigungen herum zentriertes gesellschaftliches Leben – zu entwerfen, dessen Realisierung zwei wichtige Hindernisse für das Ziel der menschlichen Entwicklung, nämlich sowohl den marktwirtschaftlichen Kapitalismus als auch die bolschewistischen Tendenzen zur Installierung einer »roten Bürokratie«, hinwegfegen würde. Deweys Ideen zu Erziehung und Bildung zeigen uns, wie im Gegensatz zu einem Großteil der Praxis in unseren heutigen Bildungsinstitutionen das Ziel der menschlichen Entwicklung von einem frühen Alter an am besten erreicht werden kann.
Es liegen uns berührende Berichte vor, die zeigen, wie zentral viele dieser Ideale für den Aktivismus etlicher Basisbewegungen von der frühen radikalen parlamentarischen Tradition im England des 17. Jahrhunderts über die von Norman Ware in seiner Studie über die Industriearbeiter der US-amerikanischen Tradition beschriebenen »Fabrikmädchen« und Handwerker bis hin zu den katholischen Befreiungstheologen in Zentralamerika waren. Diese sehr alten demokratischen Traditionen der Arbeiterbewegung werden hier recht ausführlich mit einem ganz anderen Verständnis von Demokratie verglichen, das in einer Tradition steht, die in den USA mit den »aristokratischen« Beschränkungen Madisons begann, wer regieren dürfe, und dann durch Walter Lippmanns Vision einer demokratischen Herrschaft durch den »Experten« fortgeschrieben wurde, der US-amerikanischen Version des leninistischen Konzepts der Herrschaft der Vorhutpartei. Wie Chomsky mit dem Hinweis auf Meinungsumfragen zu verschiedenen wichtigen Themen wie etwa zum Gesundheitssystem zeigt, sorgen Konzeptionen wie die erwähnten dafür, dass das, was die Bevölkerung will, praktisch nie die Agenda »demokratischer« Politik bestimmt. Und natürlich dominiert dieses Verständnis von Demokratie die gesellschaftliche und staatliche Praxis in einem Großteil der westlichen Welt, und es ist Chomsky wichtig, darauf hinzuweisen, dass selbst die schlimmsten dieser Systeme niemals den Anspruch aufgeben, sie verfolgten wohlklingende Ideale des Gemeinwohls, woran sich zeigt, dass die Idee des Gemeinwohls auf paradoxe Art universal ist: Es wird gepredigt, als gelte es für alle, obwohl es von jenen, die angeblich »alle« repräsentieren, aber zum größten Teil die Interessen einiger weniger vertreten, überall verletzt wird.
Angesichts seines grundlegenden Ausgangspunkts, nämlich der menschlichen Kreativität und der Wichtigkeit ihrer ungehinderten Entfaltung, ist Chomskys Sympathie für den Anarchismus nicht überraschend und genau wie in diesem Kapitel hat er diesen Punkt immer erläutert, indem er erklärt, dass keine Form des Zwangs, die diese Kreativität hemmt, je einfach als gegeben hingenommen werden darf. Zwang bedarf einer Rechtfertigung. Sämtliche Formen des Zusammenlebens, unter denen Zwang ausgeübt wird, einschließlich der Zwangsausübung durch den Zentralstaat, müssen stets gerechtfertigt werden. Die Nullhypothese dabei ist, dass sie nicht