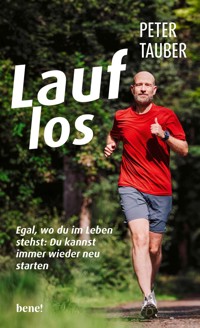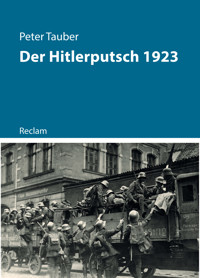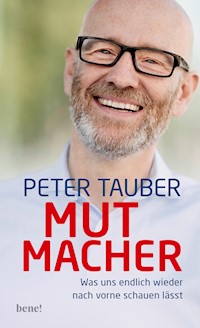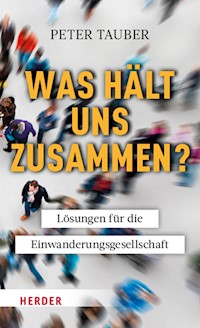
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Deutschen befinden sich in einer Identitätskrise. Wir sprechen seit der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 von einer Spaltung der Gesellschaft. Durch Migration hat sich unser Land verändert und wird sich weiter verändern. Doch in Wahrheit geht es in den meisten Debatten gar nicht um Flüchtlinge, Integration oder Einwanderung, sondern um grundsätzlichere Fragen der Identität: Wie sehen wir uns als Deutsche zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Wie wollen wir sein? Peter Tauber geht in seinem neuen Buch diesen Fragen nach und knüpft zu ihrer Beantwortung an das aufgeklärte, liberale Preußen an. Ob beim Ideal des Staatsbürgers, bei der Idee der Nation oder in der Einwanderungspolitik - Preußen ist trotz aller historischer Schattenseiten viel moderner, als uns rückwärtsgewandte Reaktionäre glauben machen wollen. "Wir müssen den Kampf um die Herzen derjenigen aufnehmen, die heute zu uns kommen und auch derjenigen, deren Vorfahren einst zu uns kamen und die sich erkennbar noch nicht als Teil dieser Gesellschaft sehen.Denn die meisten Ausländer, die in Deutschland leben, leben gerne hier. Es spricht nichts dagegen, dass sie Deutsche werden und sich auch so fühlen. Es kommt in erster Linie darauf an, was wir tun. Nicht woher wir kommen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Tauber
Was hält uns zusammen?
Lösungen für die Einwanderungsgesellschaft
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: Verlag Herder
Umschlagmotiv: ©SFC/shutterstock
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timişoara
ISBN E-Book (E-Pub): 978-3-451-82132-5
ISBN E-Book (E-PDF): 978-3-451-82154-7
ISBN Print: 978-3-451-38892-7
Inhalt
Wer sind wir? Auf der Suche nach Zusammenhalt
Die Herausforderungen sind groß, und Veränderungen sind unvermeidlich
Für ein neues Verhältnis von Staat und Bürgern: Preußen als Vorbild
Bestimmen wir unser Selbstverständnis neu
Was tun wir füreinander? Für einen neuen Republikanismus
Wege aus der selbstgewählten Untätigkeit: Plädoyer für eine neue Aufklärung
Freiheit ist kein Selbstzweck: Die Ehrenamtlichen halten uns zusammen
Ohne Eltern ist kein Staat zu machen: Familien machen uns stark
Zurück zu Humboldt: Bildung muss auch Herzensbildung sein
Verantwortung lernen: Wir brauchen eine allgemeine Dienstpflicht
Anerkennung gerecht verteilen: Wir brauchen eine Verantwortungselite
Veränderungen richtig lenken: Warum es für den Wandel Konservative braucht
Jeder nach seiner Façon: Wie Religiosität uns allen nützt
Das Wichtigste: Auf uns Staatsbürger kommt es an
Welche Ordnung brauchen wir? Für ein neues Staatsverständnis
Nicht Kultur und Herkunft entscheiden: Die moderne Idee der deutschen Nation
Reduzierung auf das Wesentliche: Ein Staat, der seine Kernaufgaben erfüllt
Konzentration auf die Ordnung: Eine wahrhaft wehrhafte Demokratie
Was den Staat nichts angeht: Religionsfreiheit
Für alle das Beste: Ein europäisches Deutschland
„Vernunftstaat“ Bundesrepublik: Das ideale Preußen als Vorbild
Wer gehört zu uns? Für eine neue Migrationspolitik
Wir brauchen Einwanderung, also sollten wir sie gestalten
Ein gutes Vorbild: Das multikulturelle Preußen
Wichtig ist, was jemand tut, nicht, woher jemand kommt: Ein gemeinsames Leitbild
Was ist denn nun deutsch? Die Fehler der alten Integrationspolitik vermeiden
Was brauchen wir? Unsere „preußischen“ Reformen
Literatur
Vita
f
„Preußen ist wie eine neue Wolljacke:
Es kratzt ein bisschen, hält aber warm.“
OTTO VON BISMARCK
„Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen.“
IMMANUEL KANT
Wer sind wir? Auf der Suche nach Zusammenhalt
Eine der großen Fragen unserer Zeit ist die Frage nach der eigenen Identität. Aufgrund der Globalisierung und der Digitalisierung, aufgrund des Schwindens von vermeintlichen Gewissheiten gibt es eine zunehmende Sehnsucht, den eigenen Standort zu bestimmen. Für die Deutschen, die in einem Land leben, das seit Adenauers Zeiten Millionen von Menschen eine neue Heimat gegeben hat – Gastarbeitern aus Südeuropa und der Türkei, Spätaussiedlern aus Osteuropa und den Weiten Russlands und Flüchtlingen aus aller Welt –, tut diese Standortbestimmung doppelt not. Eine Einwanderungsgesellschaft braucht einen Konsens darüber, was für alle, die in der Gesellschaft leben, gilt. Worauf verpflichten sich Neubürger und die, die vielleicht nur temporär in dieser Gesellschaft leben? Aber auch: Welche Verpflichtungen gelten generell für alle Staatsbürger?
Die moralischen Verwerfungen, die der Nationalsozialismus angerichtet hat, wirken auf unterschiedliche Art und Weise fort, sind bestenfalls überlagert worden durch ein 1945 kaum vorstellbares Maß an Wohlstand und Reichtum unserer Gesellschaft. Fast ein Menschenleben nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges braucht es folglich eine Standortbestimmung.
Wer sind wir also? Wie wollen wir gern sein und gesehen werden? In welchem Deutschland wollen wir leben? Und welche Geschichte von uns erzählen wir eigentlich denen, die zu uns gekommen sind, die gerade ankommen und die noch kommen werden? Denn eins ist sicher: Wir werden auch weiterhin Einwanderung brauchen, wenn wir das Maß an Wohlstand und Stabilität bewahren wollen, in dem wir leben. Um die gestellten Fragen zu beantworten, muss man wissen, wer man ist. Doch gerade aufgrund des fundamentalen Wandels, dem wir uns gegenübersehen, ist die Beantwortung dieser Frage umso schwieriger.
Als Nation in der Mitte Europas können wir den erwähnten Veränderungen wegen unserer Größe und Wirtschaftskraft schwerlich ausweichen. Und die Katastrophen des 20. Jahrhunderts prägen trotz der Aufbauleistung und des Ansehens, das die Deutschen inzwischen weltweit genießen, immer noch viel stärker unser Denken, als wir uns das selbst zugestehen. Wir befinden uns in einer tiefen Identitätskrise. Die Frage, wer wir sind, und mehr noch, wer wir sein wollen, stellt sich mit Macht.
Dabei darf man nicht ausblenden, dass wir mehrere Identitäten mit uns herumtragen. Wir sind eben nicht nur Deutsche. Wir kommen aus einer bestimmten Region, die uns oft mindestens so wichtig ist wie die Nation. Wir haben eine Religion, einen Beruf, eine Familie, eine sexuelle Orientierung, Lebenserfahrungen, die uns prägen und dazu führen, dass jeder von uns eine eigene und unverwechselbare Identität hat, die uns zu Individuen, zu Menschen mit einer eigenen Würde macht. Das macht es nicht leichter, Gemeinsamkeiten und Verbindendes herauszuarbeiten und zu stärken – und danach sehnen sich aktuell viele Menschen. Es braucht einen Staat, der einerseits die Freiräume für unsere Verschiedenheit schafft, damit wir am Ende eine gemeinsame Identität und ein Verständnis davon, wie wir als Deutsche sein wollen, entwickeln können.
Die Behauptung der politischen Linken, im 21. Jahrhundert sei die Idee der Nation obsolet, wird durch die internationalen Entwicklungen Lügen gestraft. Die meist aus dem rechten politischen Spektrum postulierte Idee einer homogenen Nation war aber eben immer nur eine Idee, wenn man von Deutschland spricht. Nicht umsonst haben die Deutschen sich lange als Kulturnation verstanden, die Millionen Deutsche, die in Ost- und Südosteuropa lebten, einbezog. Parallel dazu gehörten zu den deutschen Staatsgebilden vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis hin zum Deutschen Reich Bismarcks immer wieder andere Völkerschaften dazu: Niederländer, Polen, Franzosen, aber auch die Sorben, Kaschuben und Dänen. Nicht nur die Habsburger Doppelmonarchie war ein Vielvölkerstaat.
Wir und unsere Nation. Eine Reihenfolge gibt es nicht. Es ist ein Wechselverhältnis. Unsere Nation hat für Westdeutschland seit 1949 und seit 1990 für das ganze deutsche Volk eine freiheitliche und demokratische Ordnung gewählt, von der wir bisher überzeugt waren, dass sie einen Rahmen bilden kann, um gemeinsame und individuelle Identität zu entwickeln und zu leben.
Das Land in der Mitte Europas war bereits lange vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder das Ziel von Einwanderung oder der Ausgangspunkt großer Auswanderungswellen. Das Wissen darum ist verloren gegangen. Unser historisches Bewusstsein ist erschreckend eng. Wir leben in einer ahistorischen Zeit. Erst durch den Zweiten Weltkrieg wurden Siedlungsraum der Deutschen und Grenzen der zunächst beiden deutschen Nationalstaaten weitgehend deckungsgleich. Aber von einem ethnisch homogenen Staatsvolk kann man nur für kurze Zeit sprechen – bis in den 1960er Jahren die Gastarbeiter in Scharen nach Deutschland kamen und blieben. Lange sind die Deutschen der Frage ausgewichen, wie man diese Menschen und ihre Nachkommen in der zweiten, dritten und inzwischen vierten Generation eigentlich ansprechen soll. Gastarbeiter sind es keine mehr, sie sind ja schließlich alle hier geboren. Migranten passt auch nicht so recht. Bisher hat es niemand gewagt, diese Sprachlosigkeit aufzubrechen und sie als das anzusprechen, was sie sind: Landsleute, Deutsche. Warum eigentlich nicht?
Der Wunsch nach Zusammenhalt in unserem Land, der allerorten zu hören ist, ist nicht neu, sondern beschäftigt unsere Gesellschaft schon lange. Der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist mit „Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“ überschrieben. Dem aufkommenden Rechtspopulismus, der einer Spaltung der Gesellschaft das Wort redet, begegneten viele Menschen mit Sorge und dem Ruf nach mehr Zusammenhalt.
In der aktuellen Bewältigung der Coronapandemie hingegen werden viele Beispiele des Zusammenhalts als Zeichen der Hoffnung beschrieben und dargestellt. Sich als Gemeinschaft zu sehen ist ein tiefes Bedürfnis der Deutschen. Wir wünschen uns eine Verbindung untereinander, wollen das Gemeinsame betonen. Neben dem Wunsch nach Individualität zeigt sich: Uns im Verhältnis zu anderen zu verorten, ist Teil unserer Identität. Wir möchten gern dazugehören, zusammengehören. Zusammenhalt ist dafür ein Wort, das erst in den letzten Jahren in der öffentlichen Debatte benutzt wurde. Es beschreibt eine Richtung, ein Ziel. Gesellschaft hingegen, das das Wort Volk als Ausdruck der Zugehörigkeit abgelöst hat, ist zu neutral. Neu ist also: Die Menschen wünschen sich Gemeinschaft. Sie wollen dazugehören.
Das ist eine gute Nachricht, denn die Erfahrung lehrt, dass eine Gemeinschaft mehr ist als die Summe ihrer Teile. Gemeinschaftlich und solidarisch zu handeln ist eine Grundvoraussetzung, um Herausforderungen zu meistern. Der Historiker Arnulf Baring hat bereits vor vielen Jahren erkannt: „Eine Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der Leistungsbereitschaft der Deutschen ist notwendig, damit wir uns vor den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bewähren können.“
Die bisherigen Versuche, eine offene gesellschaftliche Diskussion darüber zu führen, wer wir sind, wer wir sein wollen und welche Erwartungen es gegenüber Menschen gibt, die sich eine Zukunft in Deutschland aufbauen wollen, sind alle gescheitert. Die politische Linke verweigert sich in weiten Teilen bis heute dieser Diskussion, sieht man von einigen positiven Ausnahmen wie dem grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer oder dem Ministerpräsidenten Baden-Württembergs Winfried Kretschmann einmal ab. Und seit der Diskussion um eine Leitkultur, die so begonnen wurde, dass man leider den Eindruck gewinnen konnte, es ginge um die Restauration der alten Bundesrepublik und eine vollständige Assimilation aller Einwanderer, haben es auch die Bürgerlichen, Liberalen und Konservativen versäumt, den wiederkehrenden Ruf nach einer deutschen Leitkultur inhaltlich und intellektuell zu unterfüttern. So klingt die wunderbar regelmäßig aufflammende Diskussion über eine solche Leitkultur denn auch eher wie das Pfeifen im Walde und ist ein gutes Beispiel für die Suche nach uns selbst.
Wir sprechen seit der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 zudem von einer Spaltung der Gesellschaft. Die Ursache für diese Spaltung liegt aus meiner Überzeugung nicht in der Entscheidung des Herbstes, die Grenze offen zu lassen und zumindest für eine gewisse Zeit rund 850 000 fremden Menschen Hilfe und Zuflucht zu gewähren. Die Flüchtlinge, die damals nach Deutschland kamen, haben uns lediglich wie in einem Brennglas vor Augen geführt, was wir eigentlich längst wussten: Durch Migration hat sich unser Land verändert und wird sich weiter verändern. Und nun gibt es einen Teil der Bevölkerung, der diese Entwicklung nicht bereit ist zu akzeptieren und auch nicht versteht, dass sie unumkehrbar ist. Dem gegenüber steht der übergroße Teil, der erkannt hat, dass wir uns zu dieser Veränderung verhalten müssen. Wie die richtigen Antworten auf diese Veränderung aussehen, darüber gibt es politischen Streit. Angesichts der augenscheinlichen Probleme und des sichtbaren Scheiterns von Integration in mancher deutschen Großstadt gerät dabei allzu leicht aus dem Blick, wie gut das Zusammenleben zwischen Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft an vielen Stellen in unserem Land jeden Tag gelingt. Ausgehend von diesem Befund müssen Antworten gefunden werden.
Doch statt Zuversicht ist Angst das prägende Gefühl der öffentlichen Debatte. Manche bedienen diese Angst und versuchen daraus politisches Kapital zu schlagen. Die Diskussionen nicht nur am Stammtisch, sondern auch in den Familien, am Arbeitsplatz und auf der politischen Bühne werden wieder grundsätzlich. Der bisher geltende politische Konsens der Bundesrepublik wird hinterfragt, angezweifelt, steht auf dem Prüfstand oder wird sogar offen abgelehnt.
In Wahrheit geht es in den meisten Debatten deshalb auch gar nicht ausschließlich um Flüchtlinge, Integration oder Einwanderung. In Wahrheit geht es um uns selbst. Wie sehen wir uns als Deutsche zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Wie wollen wir sein? Wie sehen wir unsere Nation? Welche politische Ordnung halten wir für die richtige, um unseren Platz in der Welt zu behaupten? All diese Fragen sind spannend, sie sind relevant. Und sie sind unbeantwortet. Das ist ein wesentlicher Grund, warum viele Menschen sich bedroht fühlen. Offensichtlich haben wir keine wirklich überzeugenden Antworten, die uns Sicherheit geben und auf denen unser Angebot gründet, wenn wir Menschen in unsere Gesellschaft integrieren und sie ein Teil von uns werden.
Die Herausforderungen sind groß, und Veränderungen sind unvermeidlich
Man kann wahrlich nicht behaupten, dass unsere Zeit frei von Konflikten und Problemen wäre – unabhängig davon, dass es den Deutschen in den letzten Jahren so gut ging wie noch nie in ihrer Geschichte. Das beginnt bei den ökonomischen Eckdaten zu Beginn des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts: Stabiler Arbeitsmarkt mit Vollbeschäftigung in vielen Regionen der Republik, steigende Löhne bei einer faktisch nicht vorhandenen Inflation, die Renten steigen ebenfalls, solide Finanzen der öffentlichen Haushalte, keine neuen Schulden, eine stetig wachsende Volkswirtschaft, jahrelang Steuereinnahmen in Rekordhöhe und weitgehend intakte Sozialversicherungen sowie Milliardeninvestitionen in schnelles Internet und Straßen sowie in Bildung und Forschung zeugen von Stabilität und Sicherheit. An diesem Befund hat auch die Coronapandemie nichts geändert. Und wir haben die Aussicht, dass Deutschland nach dieser Krise auf die Erfolgsspur zurückkehren kann.
Das Deutschland vor 100 Jahren war das komplette Gegenteil. Die heute heranwachsende Generation genießt einen gesellschaftlichen Frieden und ein Maß an Sicherheit, das für die eigenen Urgroßeltern kaum vorstellbar war. Trotz aller Probleme gehen Gewalt und Kriminalität zurück. Unsere Gesellschaft ist relativ arm an Konflikten, der soziale Frieden ist hoch. Der gesellschaftliche Aufstieg mag schwer sein, aber er ist nicht unmöglich. Die Ressourcen und das Wissen, das zur Verfügung steht, um Probleme und Herausforderungen zu meistern, sind so groß wie nie zuvor.
Dass die Bundesrepublik nach den USA heute zu den wichtigsten internationalen Partnern Israels gehört, ist 75 Jahre nach der Shoa nicht nur ein Wunder, sondern auch das Ergebnis kluger Politik und harter Arbeit seitens Deutschlands. Und dieses gegenseitige Vertrauen, diese Freundschaft steht sinnbildlich für die Kontinuität und die Verlässlichkeit unserer Nation in der Völkergemeinschaft. Deutschlands Stimme ist eine Stimme der Vernunft in der Welt und findet deswegen Gehör. Konrad Adenauer hat mit der Bundesrepublik „aus den Trümmern der Stahlgewitter ein Haus der Ehre neu erbaut“, wie es der Publizist Wolfram Weimer formuliert hat.
Doch viele spüren, dass dieser Zustand womöglich nicht von Dauer, ja sogar trügerisch ist. Waren wir seit 1990 lange Zeit – um ein Bild des Historikers Christopher Clark aufzugreifen – „Schlafwandler“, haben wir die neuen Herausforderungen nicht gesehen und Krisen ignoriert? Oder sind „Angstkrisen“, wie sie der Historiker Frank Biess für die Bundesrepublik als wiederkehrende Elemente der deutschen Geschichte beschreibt, normal? Viele zweifeln daran, dass die Eliten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Lage sind, die aufziehenden Herausforderungen und Probleme zu lösen.
Die Coronapandemie führt uns drastisch vor Augen, wie fragil unsere Welt ist. Der erste Reflex, der Rückzug ins Private, ins Nationale, mag verständlich sein, suggeriert aber eine falsche Sicherheit. Die Globalisierung ist nicht die Ursache dafür, dass Covid-19 auch in Europa und anderen Teilen der Welt eine große Zahl an Opfern gefordert hat. Der Blick in die Geschichte lehrt, dass Krankheiten von der Pest, den Pocken bis hin zur Cholera immer ihren Weg um den Globus fanden, wenngleich die Zeitabläufe andere waren. Sosehr die Geschwindigkeit der Verbreitung uns heute besorgt, so sehr kann man konstatieren, dass die Welt heute über geeignete Mittel verfügt, um auch solchen Krisen zu begegnen – wenn man auf Zusammenarbeit setzt.
Unser Staat folgt seit Jahrzehnten der Prämisse, dass sein Handeln betriebswirtschaftlich nachvollziehbar sein muss. Aber ist das nicht ein Holzweg? Der Staat ist kein Unternehmen, folglich kann man ihn auch nicht so führen wie einen Konzern. Es kommt nicht von ungefähr, dass eine der beliebtesten Verschwörungstheorien die von der Deutschland GmbH ist. Deutschland sei kein Staat, wir alle seien keine Bürger, sondern Angestellte, so kann man es im Internet in verschiedenen Variationen nachlesen. Wissend raunen dort Reichsbürger und andere, ein Beleg für diese Behauptung sei ja allein die Tatsache, dass wir alle über einen Personalausweis verfügen, der uns als Personal dieser GmbH ausweise und eben kein Nachweis unserer Identität als Deutsche sei. Das ist so krude, dass man es achselzuckend beiseitewischen könnte, wenn nicht solches Reden auf immer mehr fruchtbaren Boden fallen würde. Auch das ist ein Zeichen der Verunsicherung, der Angst und des mangelnden Wissens um sich selbst.
Zunehmend äußern Menschen Zweifel an unserer staatlichen Ordnung. Sie glauben nicht, dass die parlamentarische Demokratie und die föderale Bundesrepublik eingebettet in das geeinte Europa auf Dauer die aktuellen und kommenden Probleme bewältigen können. Aus dieser Sinnsuche resultiert die Frage nach unserer eigenen Identität und Rolle.
Die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, die deutsche Einheit und das momentane Ansehen, die wirtschaftliche Stärke haben die Deutschen nicht selbstbewusst gemacht – im Gegenteil. Sorgen und Ängste werden laut. Manche sprechen von einer Spaltung der Gesellschaft, die sichtbar wird durch eine bisher ungekannte Zahl fremdenfeindlicher Anschläge und Gewalttaten sowie eine zunehmende Verrohung des Umgangs von Bürgern miteinander. Dem steht eine große Hilfsbereitschaft für Menschen in Not gegenüber, die unser Land so ebenfalls noch nie erlebt hat und die uns alle stolz machen sollte. Hinzu kommt, dass Deutschland weltweit ein Ansehen genießt wie nie zuvor. Das gilt auch für das Vertrauen in die deutsche Politik, wie man anhand der Würdigung der Bundeskanzlerin durch das Time Magazine als „Kanzlerin der freien Welt“ erkennen kann. Nur die Deutschen trauen sich selbst offensichtlich nicht so recht.
Gleichwohl muss die Frage gestellt werden, wie sich Bürgerinnen und Bürger sowie der Staat und seine Institutionen auf Krisen vorbereiten bzw. vorbereitet haben. Unter den Staaten Europas und der westlichen Welt scheint Deutschland mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Man gewinnt den Eindruck, dass wir Glück im Unglück haben. Die Pandemie ereilt unser Land zudem in einer Zeit, in der die Ausgangslage nicht hätte besser sein können. Man stelle sich vor, wir müssten solche massiven wirtschaftlichen Einschnitte und den dringend notwendigen Mehrbedarf im Gesundheitssystem in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und leerer öffentlicher Kassen stemmen!
Gerade jetzt sei die Zeit für Reformen und Veränderungen, mahnen manche. Bis vor kurzem war die Veränderungsbereitschaft in unserem Land gering ausgeprägt. Wer will sich schon etwas zumuten, wenn es vermeintlich gerade so gut läuft? Ein Beispiel hierfür war und ist die Autoindustrie. Erst die Proteste der jungen Generation, die Skandale und die Überheblichkeit der deutschen Autobauer sowie der Klimawandel zwingen nun die deutschen Autokonzerne zu Veränderungen, die dringend notwendig sind. Es bleibt offen, ob dieser wichtige Bereich unserer Volkswirtschaft die Weichen für die Zukunft richtig stellt.
Andere wieder leiden jetzt schon an den Veränderungen, die sich am Horizont abzeichnen und deren Herausforderungen mit den Flüchtlingen, die 2015 und 2016 in großer Zahl Deutschland erreichten, erstmals ein Gesicht bekommen haben. Da ist die Frage, wie man Wohlstand und Freiheit auf Dauer bewahren kann, gerade in unserer Zeit, mehr als berechtigt.
Das Festhalten am Vertrauten, das Suchen danach bestimmt das Denken. Wir haben nicht verinnerlicht, dass gerade unsere Gesellschaft ihren Erfolg nicht nur der Dynamik und Offenheit, sondern auch der Fähigkeit verdankt, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Die Bundesrepublik hat von ihrer Gründung über das Wirtschaftswunder, die 68er-Bewegung, den linken Terror, den Systemkonflikt mit der DDR bis hin zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung sowie zur folgenden europäischen Integration den Nachweis geführt, dass sie zu notwendigen Reformen und Veränderungen fähig ist.
Kriege und Krisen nötigen menschlichen Gesellschaften Veränderungen ab. Sie beschleunigen oft den Wandel. Wie steht es heute mit der Veränderungsbereitschaft und der Kraft für notwendige Umgestaltungen? Der Euro ist in der Staatsschuldenkrise nicht zerbrochen, aber ob die Reformen wirklich tragfähig für die Zukunft sind, bleibt offen. Müssen die Staaten, die sich einer gemeinsamen Währung bedienen, nicht auch konsequent für die gemeinsamen Schulden haften? Die Flüchtlingskrise des Jahres 2015, die sowohl die Schwächen des europäischen Asylsystems als auch den mangelhaften Schutz der Außengrenze der Europäischen Union offenbarte, endete zwar mit einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen in Europa, aber es gibt weder ein neues funktionierendes Asylsystem in Europa noch einen gemeinsamen effektiven Schutz der Außengrenze, und so harrt die wunderbare Idee offener Grenzen in Europa der Vollendung.
Dauerhaft kann es offene Grenzen in der Europäischen Union nur geben, wenn sich die Europäer gemeinsam für den Schutz der äußeren Grenzen der EU verantwortlich fühlen. Und die Coronapandemie ist eben nicht nur eine Herausforderung der einzelnen Nationalstaaten in Europa, die vom Umfang und Zeitpunkt der Pandemie und ihrer Folgen unterschiedlich betroffen waren und sind, sondern es bedarf auch hier einer europäischen Antwort, die nicht allein in Rettungspaketen bestehen kann, sondern die strukturelle Veränderungen nach sich ziehen muss.
Aber wir brauchen gar nicht kritisch anhand dieser drei Beispiele auf Europa zu schauen, wie wir das so oft tun. Fangen wir bei uns selbst an. Wo müssen wir uns ändern als Deutsche?
Zwei Dinge kann man nicht ändern: Geschichte und Geografie. Die Deutschen leben in der Mitte Europas und nicht auf einer Insel. Wir sind zu groß und wirtschaftlich zu stark, um uns auf uns selbst zurückzuziehen und einfach die Tür zuzumachen, wenn draußen der Wind of Change weht. Und wir haben auf der Suche nach unserem Platz auf diesem Kontinent in zwei verheerenden Weltkriegen nicht nur Unheil weit über Europa hinaus verbreitet, sondern selbst einen hohen Preis bezahlt. Die Bundesrepublik mit ihrer Bundeshauptstadt am Rhein, dem beschaulichen Bonn, war eine Antwort auf dieses blutige 20. Jahrhundert. Mit der Wiedervereinigung und dem Umzug der Regierung nach Berlin sollte sich nicht viel ändern, so die stille Hoffnung manches Vertreters der alten Bundesrepublik. Doch in dem Maße, in dem sich die Welt um die Deutschen herum wandelt, ließ und lässt sich diese Idee einer nun lediglich etwas größeren Bundesrepublik, die international in einer eher zurückhaltenden Rolle verharrt, kaum aufrechterhalten.
Auch zu glauben, wie es vielfach stillschweigend angenommen wurde, der Osten würde sich lediglich „integrieren“ müssen, und dann könne man die Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik fortschreiben, erweist sich zunehmend als falsche Annahme. Es war voraussehbar, dass ein Volk nach über 40 Jahren der Teilung und unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen ein tendenziell unterschiedliches Verständnis von Freiheit und der Rolle des Staates entwickelt. Die deutsche Einheit ist daher längst nicht nur eine Frage gleicher Löhne und Rentenpunkte. Sie ist eine politische Frage und eine Frage der Erwartungshaltungen und des Selbstverständnisses. Die Deutschen in Ost und West sind offensichtlich geprägt von unterschiedlichen Vorstellungen ihrer Nation. Es geht bei der inneren Einheit unseres Landes also längst nicht nur um materielle Fragen und Partizipation.
Die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat ist hoch, das Schimpfen auf die Politik ein beliebter Volkssport. Oft geschieht das ohne großes Nachdenken. Was ist eigentlich die Konsequenz, wenn man das leichtfertig Dahingesagte weiterdenkt? Denen, die den Wert unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geringschätzen, kann man nur mit den Worten des amerikanischen Historikers Timothy Snyder zurufen: „Staaten sind keine Strukturen, die man als gegeben voraussetzen, ausbeuten oder verwerfen kann, sondern die Frucht langer und mühsamer Arbeit. Es ist verführerisch, aber gefährlich, den Staat von rechts zu zerschlagen oder von links wissend auf den Scherbenhaufen zu starren. Doch politisches Denken ist weder Zerstörung noch Kritik, sondern die geschichtsbewusste Imagination pluraler Strukturen – eine Arbeit, die jetzt geleistet werden muss, damit Leben und Moral in der Zukunft bewahrt werden können.“
Das klingt erst mal kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach: Wir sollen uns des Wertes einer stabilen und weitgehend funktionstüchtigen staatlichen Ordnung bewusst sein und sie dort wo notwendig verändern und weiterentwickeln. Dabei gilt es, auf dem Bestehenden aufzubauen, und nicht, es zu zerstören. Das erwarten die Mütter und Väter des Grundgesetzes nun von uns. Sie haben damals diese Bundesrepublik auf den Lehren der beiden preußischen Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel und insbesondere Immanuel Kant gegründet. Die Bundesrepublik ist keine Schöpfung aus dem Nichts, sondern setzt politische und geistesgeschichtliche Traditionen fort, die von den Nationalsozialisten nicht zerstört werden konnten. Das ist uns heute kaum noch bewusst.
Für ein neues Verhältnis von Staat und Bürgern: Preußen als Vorbild
Es stellen sich auf der Suche nach unserer Identität drei zentrale Fragen: Erstens gilt es zu klären, welche Vorstellung wir von unserer Nation und der politischen Ordnung, in der wir leben wollen, haben. Zweitens müssen wir entscheiden, welches Verständnis vom Citoyen, vom Staatsbürger dieser Ordnung zugrunde liegt. Welche Rechte, aber auch welche Aufgaben und Pflichten fallen uns als Bürger zu, um zum Erfolg des Staates beizutragen? Und was macht diesen Erfolg eigentlich aus? Drittens bleibt die Frage, wer denn nun dazugehört, wenn wir von den Deutschen oder von Deutschland sprechen. Angesichts einer von Migration geprägten Gesellschaft und aufgrund der Tatsache, dass wir durch die Demografie auf Einwanderung angewiesen sein werden, ist das die drängende Frage. Das bisherige, historisch geprägte sowie zudem falsche Bild eines ethnisch homogenen Staatsvolkes führt sich selbst beim Betrachten der Wirklichkeit ad absurdum. Aber was tritt an seine Stelle? Und wie kann es gelingen, hier einen neuen Konsens herzustellen?
Die Folie zur Beantwortung dieser Frage ist in diesem Buch Preußen. Die preußische Geschichte hat Licht und Schatten. Doch Geschichte erlaubt uns eine Auswahl und eine Bewertung dessen, was uns heute vorbildlich sein kann. Der liberale preußische Konservatismus, ein preußisches, den Staat prägendes Selbstbild des Maßhaltens und der Vernunft sowie ein Verständnis von Bildung und Bürgertum, das – ob wir wollen oder nicht – auch diese Bundesrepublik geprägt hat und dessen Geist wir wiedererwecken sollten, können uns Antworten und Orientierung geben.
Der langjährige Bundestagsabgeordnete Kurt Birrenbach (CDU) hat es so formuliert: „Durch den objektiven historischen Rückblick auf die Vorgeschichte unseres Landes könnten der Bundesrepublik Deutschland Anstöße für eine zukünftige Entwicklung durch die geschichtliche Forschung gegeben werden, die sich auf längere Frist als staatstragend erweisen könnten.“ Diese Einschätzung teile ich.
Preußische Geschichte ist so vielfältig und birgt so viele unterschiedliche Aspekte, dass man sich getrost die preußischen Traditionen vornehmen kann, die uns heute wieder oder immer noch bedenkenswert oder gar vorbildlich erscheinen, und auch die zweifellos vorhandenen Irrungen beiseitelegen darf. Es geht – das sei noch einmal ausdrücklich betont – eben nicht um einen historischen Vergleich oder gar eine umfassende Darstellung preußischer Geschichte. Der Historiker Lothar Gall hat zu Recht festgestellt: „Kein europäischer Staat der letzten Jahrhunderte zeigt so viele Gesichter, bei keinem ist die Frage nach dem spezifischen Charakter so schwer zu beantworten – und findet dementsprechend so entschiedene Antworten unterschiedlicher Natur – wie bei Preußen.“ Und Galls Kollege Hans-Ulrich Wehler hat ergänzt: „Die Abwägung der Nachteile und Vorzüge Preußens macht es nicht gerade leicht, schnell eine Bilanz zu ziehen.“
Wehler mahnt, man solle das Heute nicht „mit einem nostalgisch verharmlosten Preußen“ vergleichen. So ist auch seine Bilanz Preußens am Ende negativ. Historisch mag man darüber streiten. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Mein Blick ruht auf einem wohlverstandenen Preußentum. Damit wird schnell klar, dass es hier eher um preußische Redlichkeit und Liberalität als um Reaktion und Militarismus gehen wird. Und natürlich geht es um Konservatismus. Doch so einfach ist selbst das nicht. Welche Aspekte des preußischen Konservatismus, welche Werte und welche Haltung sind denn im 21. Jahrhundert noch sinnstiftend oder zeitgemäß zu übersetzen?
Sich für die Zukunft Deutschlands an den alten Preußen orientieren, dass klingt für manche wie ein schlechter Scherz. Nicht wenige sehen in Preußen den Quell allen Übels, das im 20. Jahrhundert die Deutschen ereilte: Militarismus, Nationalismus, Untertanengeist. Und doch waren es die Preußen, die sich den Fragen nach ihrer Identität, der Staatsverfasstheit und dem Bürgerverständnis stellen mussten wie wir heute. Und sie haben auf vergleichbare Fragen ganz andere Antworten gegeben, als wir es bis dato tun. Und es waren übrigens andere Antworten, als wir sie Preußen in Unkenntnis der Geschichte zuschreiben. Wenn wir von Preußen als Vorbild sprechen, dann kann es – das sei noch einmal betont – also nur um das aufgeklärte, das liberale Preußen gehen. Dann sprechen wir von dem Ethos preußischer Freiheit und Pflicht, vom humboldtschen Bildungsideal und Menschenbild sowie der Philosophie Kants als beispielgebend.
Es ist einfach, Preußen zu diskreditieren. Und bezeichnenderweise bedienen sich die meisten dabei der nationalsozialistischen Täuschung, die eine nie vorhandene Kontinuität vom alten Fritz bis zum „böhmischen Gefreiten“, wie Hindenburg Adolf Hitler abfällig nannte, suggerierte. Der Historiker Christopher Clark weist indes auf den absoluten Gegensatz hin, in dem Preußen und Nationalsozialismus zueinander stehen. „Preußen steht für die Hoheit des Staates, für die Idee, dass der Staat die gesamten Interessen der Zivilgesellschaft in sich aufnimmt. Für die Nationalsozialisten war das unvorstellbar, sie wollten ein völkisches Gebilde an die Stelle des Staates setzen.“ Dieser Widerspruch hinderte Hitler und Goebbels allerdings nicht daran, Preußen als „schillernden Fetisch“ zu missbrauchen, auch wenn die transzendente Würde des preußischen Staates, erdacht von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nichts gemein hatte mit dem nationalsozialistischen Rassenstaat.
Der Schriftsteller Heinz Ohff schrieb: „Preußische und deutsche Tradition ist anders. Sie hat wenig mit dem zu tun, was die Braunen als deutsch und preußisch ausgaben.“ In diesem Urteil sind sich Christopher Clark und Ohff einig. Das Preußen, von dem hier die Rede sein soll, wurde nicht erst 1947 durch die Alliierten, die glaubten, eine Staatsidee zu verbieten und nicht nur einen nicht mehr vorhandenen Staat aufzulösen, getilgt. Vielleicht verschwand es bereits mit der Reichsgründung 1871 aus der Geschichte, wie manche Historiker meinen. Vieles, was man heute als preußisch bezeichnet, war längst deutschnational, und es bedurfte eines Bismarcks, um diesen überbordenden deutschen Nationalismus, dem sich auch viele Preußen hingaben, zu zähmen. Nach ihm brach sich der teutonische, nicht der preußische Furor in zwei Weltkriegen Bahn.
So einfach ist es bei genauerem Hinsehen also nicht, den Stab über Preußen zu brechen. Preußische Tugenden stehen der Ideologie des Nationalsozialismus diametral entgegen. Preußens Fähigkeit zur Integration war zudem nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine politische: Auch Bismarcks Integration Preußens in das Deutsche Reich und die dann folgende Außenpolitik als „ehrlicher Makler“ sind bedenkenswert, wenn man nach der heutigen Rolle Deutschlands in Europa und der Welt fragt.
Der durch den Publizisten Sebastian Haffner so wunderbar als „Vernunftstaat“ beschriebene preußische Staat wurde von Männern wie dem großen Immanuel Kant erdacht und von nüchtern-pflichtbewussten Beamten und Bürgern mit Leben erfüllt, als anderenorts Staatlichkeit noch von einem ständischen Dünkel der Fürstenherrschaft geprägt war. Preußen wollte gar kein Nationalstaat sein. Sebastian Haffner, der Preußen wohl wie kaum ein Zweiter verstanden hat, hat es so beschrieben: „Es war ganz einfach ein Staat, nichts weiter, ein Vernunftstaat, offen für alle. Gleiches Recht für alle. Und gleiche Pflichten allerdings, das auch.“ Dieses Verständnis ist nicht die schlechteste Grundlage für das Zusammenleben von Menschen. Der preußische Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke hat es in seiner Zeit so formuliert: „Jede Nation ist Idee.“ Und die Idee eines Staates, der effektiv organisiert ist, der funktioniert, der das Recht schützt, der Sicherheit schafft, mag langweilig klingen, ist aber, wenn man sich in der Welt umschaut, offensichtlich alles andere als selbstverständlich.
Freiheit und Pflichtbewusstsein gingen in Preußen eine fast symbiotische Verbindung ein. So entstand ein Ethos, das sowohl das Bürgertum als auch den Adel zu Dienern des Staates werden ließ – mit dem König als erstem Diener an der Spitze. Daneben erwarben die Bürger Rechte, die aus der Pflichterfüllung gegenüber dem Staat erwuchsen und die in dem Ringen um eine Verfassung, erste Formen der gesellschaftlichen Teilhabe und Aufstiegsmöglichkeiten durch Bildung in der Gesellschaft ihren Niederschlag fanden. Das Tor zur bürgerlichen Freiheit war in Preußen aufgestoßen worden.
Freiheit ist auch heute der entscheidende Wert, wenn es um das Selbstverständnis eines echten Citoyens in unserer Republik geht. Doch was bedeutet Freiheit? Die Verabsolutierung von Freiheit kann keine Antwort sein. Zumal es mitzudenken gilt, dass sich das „Leben nicht auf Vorteilssuche aufbauen“ lässt, wie es Georg Wilhelm Friedrich Hegel formuliert hat.
Grundvoraussetzung für einen leistungsfähigen Staat sind Bürgerinnen und Bürger, die den Staat, das Gemeinwesen tragen. Das verlangt keine Rückkehr eines obrigkeitsstaatlichen Verständnisses, das den Bürger dem Staat unterordnet. Vielmehr geht es um die Frage, ob wir uns im Sinne des von Ernst-Wolfgang Böckenförde aufgestellten Diktums bewusst sind, dass der freiheitliche, säkularisierte Rechtsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Die Voraussetzungen für ein funktionierendes Gemeinwesen müssen wir selbst ins Werk setzen! Es braucht also Bürgerinnen und Bürger, die ein Staatsverständnis leben, das die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die parlamentarische Demokratie trägt. Freiheit ist dann vor allem die Voraussetzung für ein bürgerliches Ethos, das die Verantwortung des Einzelnen für die Gesellschaft wieder stärker betont.
Preußen war ein Staat, der nicht nur seinen Beamten und Soldaten, sondern auch seinen Bürgern einiges abverlangte. Der preußische Staat war dabei beileibe kein schwacher Staat – im Gegenteil. Eine effiziente Verwaltung, eine funktionierende Justiz und ein hohes Maß an Sicherheit schufen ein Gemeinwesen, das von seinen Bürgern nicht zwingend geliebt, aber geschätzt wurde. Damit lag Preußen ein Staatsverständnis zugrunde, das ohne den Bürger nicht zu denken war und den Gedanken des Dienens und der Verantwortung für sich selbst und andere zum Ausgangspunkt aller Überlegungen machte.
Nur so konnten Bildung, Aufklärung, Toleranz und Recht gedeihen.
Aus den Ideen Kants ist der Begriff der kantischen oder auch preußischen Pflicht hervorgegangen. „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Der kategorische Imperativ ist also ein Aufruf zum Handeln. Er fordert von uns als Bürgerinnen und Bürger das Eintreten für das Gemeinwohl auch dann, wenn wir selbst zurückstehen müssen. Das steht im Widerspruch zur Neigung, das individuelle Glück zu suchen, setzt die Achtung vor dem Gesetz voraus und funktioniert nicht ohne Freiheit sowie die Fähigkeit, Normen anzunehmen, diese als richtig zu erkennen und zu achten. Wenn wir also unzufrieden sind mit manchem Zustand in unserem Land, dann müssen wir auch kritisch auf uns selbst schauen. Sind diejenigen, die besonders laut schimpfen, dazu bereit? Und wie verhält es sich mit der meist lautstark vorgetragenen Erwartungshaltung gegenüber dem Staat?
Der preußische Widerstandskämpfer Helmuth James Graf von Moltke hat in seinen Gedanken zu einer möglichen Neuordnung Deutschlands nach dem Ende der Naziherrschaft ein Prinzip formuliert, das die Freiheit in den Mittelpunkt stellt. Er hat daraus abgeleitet, was das für Staat, Gesellschaft und Bürger bedeutet: „Die Freiheit des Einzelnen muss einer der wesentlichen Programmpunkte jeder politischen Neuordnung sein. Diese Freiheit darf jedoch nicht als ein absolutes Recht dargestellt werden, sondern lediglich als Korrelat der inneren Bindung. […] Die Gewährung von Freiheit ist daher als Vorleistung an den Einzelnen anzusehen, die ihn verpflichtet, sich um die Gegenleistung zu bemühen.“
Es gibt keine Preußen mehr. Wer sollte also diese Werte und eine konservative Haltung mit Leben füllen? Nun waren es eben selten gebürtige Preußen, die zu den prägnantesten Verfechtern dieses vorbildlichen Preußens zählten. Vielleicht liegt darin die Stärke des Vernunftstaates. Die Offenheit des Staates, der zugleich nach klar erkennbaren und unumstößlichen Prinzipien agierte, ist das, was für uns heute interessant ist. Im Mittelpunkt steht dabei der Gedanke des Dienens. Dass sich immer wieder Männer – und auch Frauen – diesem Selbstverständnis verpflichtet fühlten, war das Glück Preußens.
Dabei konnte dieser „Vernunftstaat“ darauf bauen, dass Dienst gerade auch von denen geleistet wurde, die gar keine gebürtigen Preußen, sondern Sachsen, Hannoveraner oder Mecklenburgerinnen waren. Das, wofür Preußen stand, erweckte ihre Bereitschaft, sich in den Dienst der für gut befundenen Sache zu stellen. Und genau das ist es, was Deutschland heute braucht: Bürgerinnen und Bürger, die den Staat zu ihrer eigenen Sache machen und nicht nur Erwartungen formulieren und Ansprüche stellen.