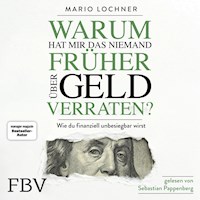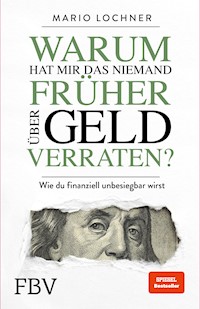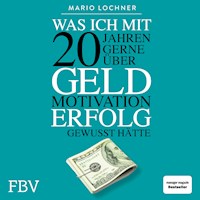
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Viele plagen sich lange Jahre im Beruf, um dann festzustellen, dass sie doch nicht das tun, was sie erfüllt und womit sie erfolgreich sind. Es kommt darauf an, frühzeitig im Leben auf die persönliche Motivation und die eigenen Potenziale zu setzen und die Weichen auf Glück und Erfolg zu stellen. Mario Lochner weist den Weg zur Überholspur im Leben. Im ersten Teil des Buches geht es darum, wie man seine persönliche Motivation im privaten und beruflichen Bereich findet. Im zweiten Teil gibt der Autor Ihnen die Erfolgswerkzeuge an die Hand, die Sie maßgeschneidert für sich anwenden können. Im dritten Teil schließlich geht es darum, wie Sie mit nur wenigen Stunden pro Jahr ein finanzielles Fundament für die Rente aufbauen. Mario Lochner ist Diplom-Betriebswirt, Journalist und einer der profiliertesten Finanz-Blogger Deutschlands. Er ist Redakteur des Wirtschaftsmagazins Focus-Money und das Gesicht des erfolgreichen Youtube-Kanals »Mission Money« mit mehr als 100 000 Abonnenten.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIO LOCHNER
Was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation, Erfolg gewusst hätte
MARIO LOCHNER
WAS ICH MIT 20 JAHREN GERNE ÜBER GELD MOTIVATION ERFOLG GEWUSST HÄTTE
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe, 6. Auflage 2021
© 2020 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Christiane Otto
Korrektorat: Manuela Kahle
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-277-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-510-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi 978-3-96092-511-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Vorwort
TEIL I: MOTIVATION
Talent ist ein Mythos
Jeder kann es schaffen – du musst es nur wollen
Warum mich Freunde am meisten motivieren
Du brauchst eine Mission
Das schönste Übel der Welt oder warum Geld gefährlich sein kann
Bring den Felsen ins Rollen – Motivation kommt durch Aktion!
Mach das Leben zu einem Spiel
Was würdest du tun, wenn du schon reich wärst?
Hack your Brain: Wie du endlich an dich glaubst
So gestaltest du deine Heldenreise
Die Welt wird immer besser
TEIL II: ERFOLG
Die Erfolgslüge oder warum Ergebnisse gar nichts bedeuten
Sei nicht Wikipedia, sei ein Freak!
Verkaufe deine Seele – und zwar so teuer wie möglich
Erwarte nicht, dass die anderen dich verstehen
Traue niemandem, vor allem nicht dir selbst
Du solltest dich nie für ein Genie halten
Game of Chance! Warum nicht alles aus einem Grund passiert
Warum du reifen musst wie ein guter Whisky
Warum der Tod dich erfolgreicher macht
Die Dilogie vom Nein – warum es das goldene Wort ist
Die Fokus-Lüge – warum du nicht All In gehen musst
Lernen durch Schmerz – So wirst du unzerbrechlich
TEIL III: GELD
Geld funktioniert wie eine Ketchup-Flasche
Aktien sind nicht riskant oder warum Unsicherheit die wahre Stabilität ist
Die Börse torkelt wie ein Besoffener
Die Börse ist kein Schönheitswettbewerb, sondern ein Model-Casting
Pass auf deine Chips auf!
Gold glänzt immer wieder
Wie du Verluste verschwinden lässt oder drei Gründe, warum Sherlock deine Finanzen regeln sollte
Warum Gordan Gekko falsch lag oder warum Gier keine Rendite bringt
Zahlen können tödlich sein
Vorsicht vor Experten!
Eine kleine Geschichte des großen Unsinns oder wie du bessere Entscheidungen für dein Geld triffst
Was ich gerne mit 20 Jahren mit meinem Geld gemacht hätte
Denk negativ und nimm dir Zeit dafür
Schau nach unten oder sei einfach dankbar
Danke
Anmerkungen
VORWORT
Dieser Sieg bricht mir das Genick. Am 6. Juli 2008 verwandelt Rafael Nadal seinen vierten Matchball im Wimbledon-Finale gegen Roger Federer. Nach vier Stunden und 48 Minuten schlägt Federer eine Vorhand ins Netz, Nadal gewinnt, der Spanier lässt sich auf den Rasen fallen und hält sich die Hände vors Gesicht, er weint vor Freude. Und ich schreie daheim vor dem Fernseher vor Glück. Ich habe auf Nadal gewettet! 5000 Euro gehören jetzt mir! Doch was sich in diesem Moment anfühlt wie Unbesiegbarkeit, ist der Beginn einer schmerzhaften Reise für mich. Der Gewinn zerrinnt in wenigen Wochen. Im Rausch interessiert mich das Geld kaum, es geht um den schnellen Erfolg. Aber daraus wird in den nächsten Monaten eine Katastrophe: Ich verzocke meine Ersparnisse für Sportwetten, Poker und alles, was schnelle Gewinne verspricht. Mit Anfang 20 liege ich am Boden: ohne Geld – und ohne Stolz.
Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil ich will, dass du es besser machst. Ich wollte den Erfolg erzwingen. Es war eine Beschleunigung, aber sie hat schnell in den Abgrund geführt. Wie konnte das nur passieren? Ich war zu unerfahren, um das Ausmaß einzuschätzen, zu ungeduldig, mir eine Strategie zu basteln für den Umgang mit Geld, und zu überheblich, um überhaupt ein Scheitern für möglich zu halten. In diesem Buch will ich dir die richtigen Abkürzungen zeigen. Ich verrate dir, was ich gerne schon mit 20 Jahren über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte. Dafür gilt eine Spielregel: Ich schreibe dieses Buch so ehrlich wie möglich. Während ich diese Zeilen tippe, sitze ich am Flughafen in Kuala Lumpur und denke darüber nach, was mir am meisten weitergeholfen hat im Leben. Und mir fällt ein, dass Neil Gaiman bei seiner Rede vor den Absolventen der University of the Arts gesagt hat, dass der Moment, in dem man das Gefühl hat, nackt auf der Straße herumzulaufen und der Öffentlichkeit zu viel von sich selber zu zeigen, der Moment ist, in dem man vielleicht endlich anfängt, alles richtig zu machen.1
Deswegen möchte ich dir von meinen Niederlagen erzählen. Sie führen uns im Leben manchmal zu den größten Siegen. Sie zeigen uns, wie schlimm Schmerzen sein können und motivieren uns dazu, so etwas nie wieder zu erleben. Sie treiben uns dazu, besser zu werden. Mich hat es dazu gebracht, mich intensiv mit Geld zu beschäftigen und das sogar zu meinem Beruf zu machen. Wer weiß, ob ich ohne diese Erfahrungen Finanzjournalist geworden wäre und ob ich mich jemals so intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt hätte, mit meiner Motivation, meinen Wünschen und Schwächen? Und wer weiß, ob ich jemals dieses Buch geschrieben hätte? Der Autor Matthew Syed hat den Ausdruck Black-Box-Denken geprägt. Jeder kann abstürzen, aber wir müssen daraus lernen. Und dieses Mindset möchte ich dir beibringen.
Wir müssen alle unsere Fehler machen. Wir müssen Schmerzen erleben, die wir in diesen Momenten gar nicht aushalten. Sei es in der Liebe, im Job oder im ewigen Kampf mit uns selbst. Scheitern ist keine Schande, aber ich widerspreche der These, dass man möglichst oft scheitern sollte. Man sollte sich nie an Niederlagen gewöhnen. Fail Better ist ein Motto, das mir geholfen hat, ebenso wie folgendes Zitat von Samuel Beckett: »Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.« Der Tennisspieler Stan Wawrinka hat sich diesen Spruch auf den Unterarm tätowieren lassen. Anschließend gewann er drei Grand-Slam-Turniere – die Australian Open, French Open und US Open. »Besser scheitern« ist eine mächtige Idee. Aber noch mächtiger finde ich: »besser machen«.
Ich hatte Abkürzungen gesucht, weil wir im Leben vor zwei großen Konflikten stehen: Wir wollen zum einen fürs Alter sparen, aber was haben wir vom Geld, wenn wir erst mit 70 oder 80 Jahren darüber verfügen? Wir wollen doch das Geld jetzt ausgeben! Und zum anderen müssen wir alle erst durch unsere Erfahrungen lernen. Aber was nützt die Weisheit, wenn wir alt sind und keine Wahl mehr haben, welchen Job wir ein Leben lang machen oder mit wem wir Kinder haben. Gibt es keine Überholspur für Geld, Motivation und Erfolg? Eine Überholspur für ein besseres Leben? Einen Masterplan gibt es nicht. Aber es gibt Fehler, die du vermeiden kannst. Ich will dir in diesem Buch zeigen, was ich selber gelernt und mir von den klügsten Köpfen abgeschaut habe.
Um besser zu werden, musste ich erst mal kapieren, was damals falsch gelaufen war und warum ich so gehandelt habe. Heute weiß ich, was mich antreibt: die Gier nach neuen Erlebnissen. Was Sensation Seeking bedeutet, habe ich erst mit 26 gelernt. Es geht darum, das Leben zu bereichern durch neue Erlebnisse. Ich erinnere mich an einen der ersten Einträge auf meinem Blog mit dem Titel »Warum ich niemals denselben Tag zweimal erleben will«. Es ging dabei um meine Motivation: neue Sachen lernen und erleben. Eigentlich ist das nichts Ungewöhnliches, das menschliche Hirn giert nach dem Neuen. Der Philosoph Peter Sloterdijk hält den Menschen gar für »neophil«.2 Wir sollen also das Neue lieben. Das würde ich sofort unterschreiben. Ein Tag, an dem ich nichts Neues erlebe oder lerne, frustriert mich. Noch besser wiedererkannt habe ich mich, als ich gelesen habe, wie Nassim Taleb von den »Kicks« und dem »hormonelle(n) Rausch« erzählt, den er am Finanzmarkt im Zusammenhang mit den dort einzugehenden Risiken verspürte. Er hatte nie geglaubt, dass er sich für Mathematik interessieren könne, bis ihm dann »an der Wharton-School ein Freund von den finanziellen Optionen erzählte, die ich bereits erwähnt habe (und deren Generalisierung, komplexen Derivaten)«.3
Als ich meine erste Aktie (Allianz) mit 16 Jahren kaufte, spürte ich jedes Mal diesen Kick, wenn ich nur den Kurs überprüfte. Es fühlte sich nicht gut an, ein flaues Gefühl im Magen, aber es machte etwas mit mir. Damals war ich noch sehr vorsichtig, später schlug die Vorsicht in Übermut um. Aber Geld war die falsche Option, um den Nervenkitzel auszuleben. Es hat viel mit Planung zu tun – und gerade den Thrill solltest du vermeiden, wenn du Erfolg haben willst. In diesem Buch will ich dir zeigen, wie du selbst mit solidem Halbwissen vernünftig in Aktien investierst.
Weil du dieses Buch liest, erfüllst du schon mal eine Voraussetzung für mehr Erfolg und Geld: Du willst mehr. Und ich will, dass du dich nie wieder dafür rechtfertigen musst. Der Philosoph Kallikles wäre sogar stolz auf dein Mindset. Für ihn war das Mehr-haben-Wollen ein Prinzip unserer Natur. Er ging sogar so weit, dass er behauptete, dass es gerecht sei, wenn der Bessere und Fähige mehr habe. Freiheit hieß für den Sophisten auch, dass es für unsere Wünsche keine Einschränkungen gibt. »Wer richtig leben will, muss seine Wünsche möglichst groß sein lassen und darf sie nicht zügeln.«4 Im Silicon Valley und auf Instagram sagt man heute dazu: Think Big. Ich will dir aber auch zeigen, was heute in deinem Leben schon möglich ist – selbst mit wenig Geld. Und ich möchte dir zeigen, warum Geld die Basis für ein glückliches Leben ist, aber auch eines der schönsten Übel sein kann, wenn du es zu deinem einzigen Sinn erhebst.
Heute brauche ich keine Sportwetten mehr, ich lebe den Nervenkitzel anders aus: Ich habe auf YouTube mit Kollegen für Focus-Money den Kanal Mission Money mit mehr als 160.000 Abonnenten aufgebaut, stehe vor der Kamera, erzähle den Zuschauern von meinen Lieblingsaktien und interviewe erfolgreiche Fondsmanager wie Ken Fisher und Jens Ehrhardt.5 Hunderttausende Menschen haben unsere Videos geklickt. Das macht mich glücklich, weil wir den Zuschauern sinnvollen Content bieten und weil wir uns immer wieder beweisen müssen. Der Thrill hat einen Sinn bekommen. Ich stand auch bei Live-Events auf der Bühne und diskutierte mit den erfolgreichsten Börsengurus Deutschlands. Wenn ich, kurz bevor es auf die Bühne geht, im Bauch spüre, dass eine Achterbahn hoch- und runterfährt, fühlt es sich an, als würde ich gleich ohne Fallschirm in die Tiefe springen. Zündet mein Gag? Sitzt meine Argumentation? Und wie werden die anderen reagieren? Ich liebe diese Unsicherheit und mich ihr zu stellen.
Was mich noch mehr motiviert: Geschichten erzählen. In jedem Video und auf der Bühne erzähle ich meine Geschichte. Und jede Bühne ist anders. Mein Sensation Seeking ist erwachsen geworden.
Im ersten Teil dieses Buches will ich dir deshalb erzählen, was uns wirklich motiviert. Oft sind es die Aufgaben an sich: das Schreiben von Texten, Skizzieren von Bildern oder das Forschen im Labor. Wenn wir wissen, was wir wollen, erhält unser Leben eine ganz andere Intensität. Aber dafür müssen wir wissen, was wir wollen. Was dich wirklich antreibt und wie du deine persönliche Mission findest, dabei helfe ich dir. Du wirst endlich verstehen, warum du für manche Jobs nicht geeignet bist und welches Umfeld du wirklich brauchst, um motiviert und glücklich zu sein.
Im zweiten Teil dieses Buches soll es um Erfolg gehen. Ich verspreche dir aber nicht, die Geheimnisse der Schönen und Reichen zu lüften. Denn Erfolg ist eines: individuell. Wer das Leben von anderen kopieren will, wird scheitern, weil es sich für einen selber nicht echt anfühlt und für andere auch nicht. Und erfolgreich sind wir nur, wenn wir Emotionen bei anderen auslösen. Nur Emotionen führen zu Handlungen, führen dazu, dass uns andere Menschen lieben. Deswegen will ich dir dabei helfen, deine Geschichte erfolgreich zu erzählen und dich möglichst teuer zu verkaufen. Ich will dir Erfolgswerkzeuge an die Hand geben, die du maßgeschneidert für dich anwenden kannst. Wer zudem versteht, wie sein Hirn funktioniert und warum es so wichtig ist, es auf Erfolg zu programmieren, erst der kann erfolgreich werden. Wusstest du zum Beispiel, dass unser Gehirn nicht zwischen Träumen und Realität unterscheiden kann? Du sollst deine Träume leben und nie wieder dafür, was andere von dir erwarten. Die Freiheit zu tun, was wir wirklich wollen, ist der wahre Erfolg.
Ein erfolgreiches Leben können wir nur leben, wenn wir es uns zu eigen machen. Und da kommt spätestens Geld ins Spiel. Natürlich ist Geld nicht alles. Aber ohne Geld ist alles nichts. Deswegen möchte ich im dritten Teil dieses Buches eines schaffen: dich dazu zu motivieren, deine Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Aktienexperte werden? Nein, darum geht es nicht. Selbst wenn du dich nur mit finanziellen Basics auseinandersetzt, kapierst du mehr von der Börse als 95 Prozent aller Menschen. Und das verschafft dir einen unbezahlbaren Vorsprung. Dinge, die wir lieben, kosten Geld. Und je weniger uns die finanzielle Situation stresst, weil wir per Autopilot fliegen, umso mehr können wir uns dem wichtigsten Rohstoff der digitalen Ära widmen: Zeit. Es ist ein mächtiger Gedanke, dass Geld für uns arbeitet, während wir reisen oder das Buch unseres Lebens lesen. Stell dir das Leben wie Monopoly vor. Wirst du gewinnen, wenn du nur Geld kassierst, wenn du über Los gehst? Oder wird derjenige gewinnen, der investiert und ständig von seinen Mitspielern Miete kassiert?
Bei den meisten Menschen erlebe ich eine finanzielle Ohnmacht. Nach dem Motto: Das ist nichts für mich. Die Reichen – das sind die anderen. Der Umgang mit Geld gehört für mich aber genauso zum Leben wie Ernährung, Sport oder Allgemeinbildung. Der Umgang mit Geld kann heute so einfach sein. In diesem Buch möchte ich dir zeigen, wie du selbst mit nur wenigen Stunden pro Jahr ein Fundament für deine Rente aufbauen kannst. Hast du schon mal von ETFs gehört? Dabei handelt es sich um sogenannte Exchange Traded Funds. Sie funktionieren wie Investmentfonds, nur sind sie viel billiger, und du kannst dir mit nur einem ETF Hunderte von Aktien kaufen. Ich zeige dir in diesem Buch, wie du dir spielend leicht ein Depot aus ETFs aufbaust. Wie du dein Risiko senken, deine Ängste überwinden und schon mit 25 Euro pro Monat starten kannst.
Mein größter Erfolg wäre es, wenn du dieses Buch liest und danach einem Freund bei einem Drink an der Bar von einer Anekdote erzählst, die für dich wertvoll ist. Darauf, dass die größten Siege, Siege bleiben und sich alle Niederlagen ins Positive drehen lassen. Wir können nicht alle ein Buch schreiben. Aber wir können großartige Geschichten erleben. Unsere gemeinsame Geschichte soll hier starten, und der Erfolg soll kein Ende finden.
TEIL I MOTIVATION
TALENT IST EIN MYTHOS
Was haben Warren Buffett, Cristiano Ronaldo und Albert Einstein gemeinsam? Die Antwort: Sie sind alle drei erfolgreich. Wahrscheinlich sind sie sogar die Besten auf ihrem Gebiet. Jeder, der sich für Investieren, Fußball oder Physik begeistert, wird ihren Erfolgen nacheifern. Aber was soll das bringen? Zum Genie wird man doch geboren, oder? Jetzt stelle ich dir die ultimative Frage: Glaubst du trotzdem, dass du es auch schaffen kannst? Ich habe Hoffnung, dass du zumindest überlegst, sonst würdest du dieses Buch gar nicht lesen. Aber wenn dich das Ganze abschreckt und du Einstein und Co. als Genies betrachtest, die auf einer Wolke über uns schweben, dann ist das ein natürlicher Reflex. Denn wir fallen immer wieder auf das vermeintlich Göttliche rein, ich nenne es den Genie Bias.
Schauen wir uns das Phänomen Schritt für Schritt an. Zunächst scheint die Ratio noch überlegen zu sein, wenn wir den Erfolg der anderen beurteilen. Menschen neigen nämlich in Umfragen dazu, Fleiß höher zu gewichten als Potenzial – und zwar im Verhältnis zwei zu eins.6 Die Ergebnisse stimmen überein mit einer Befragung, die die Psychologin Chia-Jung Tsay mit Musikern durchgeführt hat. Auch hier wurde fleißiges Üben höher eingeschätzt als Talent. Aber das ist nur die Oberfläche. Wenn sich die Frage ändert, tritt der Genie Bias ans Licht. Bei der Untersuchung wurden den Befragten die Biografien von zwei Musikern vorgelegt. Ihr Erfolg war quasi identisch verlaufen. Der eine Musiker wurde als »Naturtalent« beschrieben, der andere als »Streber«. Dann wurden den Befragten zwei Hörproben vorgespielt – und jetzt kommt der Clou: Sie waren beide vom selben Musiker, er spielte nur zwei verschiedene Passagen aus einem Werk. Nach der Hörprobe beurteilten die Probanden auf einmal das »Naturtalent« als besser. Ihm sei langfristig mehr Erfolg beschieden, und er wäre bei der Entscheidung über ein Engagement zu bevorzugen.7
Aber ist das wirklich so? Meine These lautet: nein! Man muss kein Genie sein, um erfolgreich zu sein. Es mag Ausnahmetalente geben, aber Begabung spielt nur eine kleine Rolle. Gegen diesen Genie Bias müssen wir immer wieder ankämpfen. Ein Genie ist im wörtlichen Sinne eine »erzeugende Kraft«. Das Wort steht auch für Anlage und Begabung. Ohne eine gewisse Veranlagung wird niemand Erfolg haben. Aber wir überhöhen Giganten wie den Tennis-Star Roger Federer gerne und schreiben ihnen übermenschliche Fähigkeiten zu. Aber das wird ihnen nicht gerecht, weil man die harte Arbeit übersieht, die diese Menschen investieren. Federer galt bereits als Teenager als Talent, aber auch als Rüpel, der seine Schläger zerdepperte. Erst durch den Tod seines Jugendtrainers Peter Carter kam er zur Besinnung und beschloss, sein Talent nicht mehr zu verschwenden. Sein Talent veredelte er erst durch hartes Training zur Weltklasse. Das zwischenzeitliche Scheitern, die Tränen und Schmerzen der Erfolgreichen vergessen wir gerne, am Ende bleiben nur die Siege übrig. Warum suchen wir die Perfektion in anderen? Das ist in erster Linie Selbstschutz. So sah es auch Friedrich Nietzsche: »Jemanden ›göttlich‹ nennen, heißt: ›Hier brauchen wir nicht zu wetteifern‹.«8
Aber die großen Leistungen der anderen sollten uns gerade anspornen. Ich habe für den YouTube-Kanal Mission Money als Moderator mit den erfolgreichsten Menschen der Investment-Branche gesprochen. Genialität alleine reicht nicht für den Erfolg. Florian Homm war einst erfolgreicher Hedgefondsmanager und zählte als Milliardär zu den reichsten Deutschen. Auf der Höhe seines Schaffens rief er seine Assistenten teilweise nachts um 3 Uhr an, weil er selber gar nicht mehr zwischen Tag und Nacht unterscheiden konnte. Warren Buffett liest nach eigenen Angaben fünf Stunden am Tag. Und Hedgefondsmanager Ray Dalio schildert in seinem Buch Principles (deutscher Titel: Die Prinzipien des Erfolgs) warum Talent ohne Fleiß nichts bringt. Er war der Ursache für die Finanzkrise auf die Schliche gekommen, weil er hart dafür gearbeitet hatte, nicht weil er sich auf sein Genie verließ. Mit seinem Team wälzte er Akten und Zahlen und erkannte schließlich ein Muster, wie es schon mehrfach in der Historie vorgekommen war. Eine toxische Mischung, die später Börsen und Banken zum Beben bringen sollte. Am Ende seiner Recherche, aber reichlich spät, fand er auch Gehör bei Funktionären wie Timothy Geithner, damals Präsident der New Yorker Zentralbank und später Finanzminister der USA. Er berichtet in seinem Buch, wie er Geithner bei einem Lunch vor den Kopf schlug, als er mit ihm einige Zahlen durchging. Geithner war verwundert darüber, wo Dalio die Zahlen herhatte, worauf dieser ihm erklärte, dass die Zahlen öffentlich zugänglich seien und er sie nur zusammengesetzt und in einer anderen Weise betrachtet hätte.9
Menschen, die als Genies gelten, arbeiten meistens hart. Der Psychologe Dean Simonton fand heraus, dass kreative Genies über die gesamte Produktion auf ihrem Gebiet nicht besser waren als ihre Kollegen, aber sie waren fleißiger. »Die Wahrscheinlichkeit, eine einflussreiche oder erfolgreiche Idee hervorzubringen«, steigt nach Simonton »mit der Gesamtzahl der hervorgebrachten Ideen.«10 Jeder kennt die bekannten Werke von Shakespeare wie Macbeth und Hamlet – aber insgesamt schrieb er 37 Dramen und 154 Sonette.11
Viele geniale Dinge in dieser Welt sind sogar schon mal dagewesen. Steve Jobs beispielsweise hat erkannt, dass kreative Menschen hauptsächlich dazu in der Lage sind, Dinge miteinander zu verbinden und sich fast schon schämen, wenn man sie danach fragt, weil sie eigentlich nur einen Zusammenhang erkannt und nicht viel selber gemacht haben.»– sie waren in der Lage, ihre Erfahrungen miteinander zu verbinden und etwas Neues daraus zu machen.«12 So lief es beispielsweise mit dem iPod. Die Idee geht auf den britischen Erfinder Kane Kramer zurück: Er wollte Musik digital per Telefon verschicken und dann direkt im Laden drucken lassen. Die Plattenpressen waren aber so unhandlich, dass er zum Glück gezwungen wurde, ein tragbares Abspielgerät für digitale Musik zu entwerfen. Eine geniale Idee – besonders für das Jahr 1979. Es hatte einen Bildschirm und Knöpfe für die Auswahl der Songs. Sogar Paul McCartney war unter den ersten Investoren. Der einzige Haken: Auf Kramers Player passte nur ein einziger Song. Apple sollte es 22 Jahre später besser machen.13
Der Soziologe Dan Chambliss schrieb 1989 in einer Studie, dass überragende Leistung eigentlich ein Zusammenfluss Dutzender kleiner Befähigungen ist, die man sich selbst beigebracht hat oder die einem zugeflogen sind und die man sich im Lauf der Zeit anzuwenden angewöhnt hat, bis sie als synchronisiertes Ganzes zusammenwirken. Es ist nichts Außergewöhnliches oder Übermenschliches an ihnen. Es zählt nur, dass sie permanent und auf die richtige Art und Weise zur Anwendung gebracht werden und durch ihr Zusammenschmelzen Höchstleistungen zustande bringen.14 Bei mir ist das Schreiben das beste Beispiel. Ich wollte mit Anfang 20 einen Krimi schreiben und habe an einem einwöchigen Schreibseminar in der italienischen Provinz teilgenommen. Im Juli 2009 hatte ich mir mit 22 Jahren eingebildet, dass es schon reichen würde, ein paar gute Ideen und ein gewisses Talent zum Schreiben zu haben. Dann kam der Schlag ins Gesicht: Ich konnte gar nichts. Mir fehlte das Handwerk – heute würde ich sogar sagen, dass es peinlich war, was ich damals ablieferte. Aber es zählt nicht, was wir aus dem Stegreif können, sondern wie schnell wir lernen. Je peinlicher es dir ist, was du vor zehn Jahren gemacht hast, umso größer war wahrscheinlich der Sprung, den du nach vorne gemacht hast. Und ich wollte beim Schreiben einen Sprung machen.
In den Monaten und Jahren nach dem Seminar in Italien las ich jedes Buch, das sich mit gutem Stil beschäftigte, beispielsweise alles von Wolf Schneider. Und ich suchte mir Vorbilder. Ich schrieb ganze Seiten von Hemingway ab, analysierte jeden Satz und fand so zu meinem eigenen Stil. Ich schloss ein Journalismus-Fernstudium ab, schrieb während meines BWL-Studiums für die Süddeutsche Zeitung und die Abendzeitung und absolvierte schließlich mein Volontariat bei der Burda-Journalistenschule. Mittlerweile habe ich Hunderte Texte für Focus-Money geschrieben und schreibe gerade diese Zeilen. Talent hat dabei aus meiner Sicht nur eine kleine Rolle gespielt. Und du kannst es auch schaffen. »Jede Tätigkeit des Menschen ist zum Verwundern kompliziert«, schrieb Nietzsche, »(…) aber keine ist ein ›Wunder‹.«15
JEDER KANN ES SCHAFFEN – DU MUSST ES NUR WOLLEN
Ray Charles verlor mit sieben Jahren sein Augenlicht. Mit 15 Jahren starb seine Mutter und er musste miterleben, wie sein jüngerer Bruder ertrank. Laut eigener Aussage hatte er die Wahl, sich entweder als blinder Bettler auf die Straße zu stellen oder »alles daranzusetzen, um Musiker zu werden«.16 Dirk Nowitzki gilt als Basketball-Legende, nur fünf Spieler haben mehr Punkte in der NBA erzielt. Aber er ging am Anfang durch die Hölle in den USA: Nachdem Nowitzki von Würzburg zu Dallas gewechselt war, hatte er nicht genügend Muskeln, um sich gegen die anderen Power Forwards durchzusetzen. Nowitzki schwächelte in der Verteidigung, Dirk konnte keine Defense. Die US-Journalisten strichen ihm deswegen das »D« für Defense aus seinem Namen und verpassten ihm den Spitznamen »Irk«, und die eigenen Fans buhten ihn aus.17 Nowitzki war frustriert und zweifelte, überlegte sogar, zurück nach Würzburg zu wechseln. Aber dann kämpfte er für seine Punktlandung. Er trainierte so hart, bis er den Durchbruch schaffte. Er schlich sich nachts mit seinem Mitspieler Steve Nash in die Halle und warf Korb um Korb. Im Play-off-Duell gegen San Antonio verlor er einen Schneidezahn und spielte blutverschmiert mit einem provisorischen Tampon im Mund weiter. »Irk« wurde zum Relikt, heute kennt man ihn nur noch als »German Wunderkind« und »Dirkules«.
Was bringt Menschen wie Nowitzki oder Charles dazu, sich durchzubeißen, bis sie ihr Ziel erreichen? Philosophisch lässt sich die Frage mit der Lehre der Stoiker beantworten. So war Epiktet der Meinung, dass man sich von Dingen, die man nicht beeinflussen kann, nicht beeinträchtigen lassen und sich stattdessen besser auf die Dinge konzentrieren sollte, die man ändern kann.18 Charles und Nowitzki haben ihr Schicksal akzeptiert und sich auf das konzentriert, was sie ändern können. Epiktet wäre stolz, aber ihr Mindset lässt sich auch mit der Psychologie erklären.
Bereits seit den 1950er-Jahren untersuchen Psychologen die sogenannte Kontrollüberzeugung und erkennen, dass die innerliche Kontrollüberzeugung im Zusammenhang mit wissenschaftlichem Erfolg, Selbstmotivation, wenig Stress oder Depressionen und einem längeren Leben gesehen werden muss.19 Es dreht sich alles um den sogenannten Locus of Control, also den Ort der Kontrolle. Pari Majd erklärt bei ihrem Ted Talk Can you change your perception in four minutes?, dass es darum geht, ob Menschen daran glauben, dass sie den Ausgang eines Ereignisses beeinflussen können.20
Für unsere Selbstwahrnehmung gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder liegt der Locus of Control intern oder extern. Schauen wir uns zwei Beispiele an. Edward Extern kennt nur ein Gefühl: Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wenn er in der Schule eine schlechte Note bekommt, dann ist natürlich der Lehrer schuld. Er hasst ihn sowieso – und dann hatte Edward beim Test auch noch seinen Glücksbringer vergessen. Dagegen fühlt sich Isabel Intern so, als hätte sie alles selber in der Hand: Sie hat beim Test versagt, weil sie zu wenig gelernt hat. Wer wird es weiterbringen?
Wir sollten uns nicht einbilden, wir könnten alles beeinflussen. Und wir sollten uns nicht für alles verantwortlich fühlen, sonst kann es Selbstvertrauen kosten. Beispielsweise kann man sich nicht mit jedem Menschen auf der Welt gut verstehen, und man sollte für Konflikte nicht immer die Schuld bei sich selber suchen. Aber wir sollten grundsätzlich auf der internen Seite stehen. Dann nehmen wir unser Leben in die eigene Hand. Das belegt die Forschung: Isabel wird beim nächsten Test mehr lernen und am Ende eine bessere Karriere hinlegen. Edward wird zwar seinen Glücksbringer dabeihaben, aber wohl wieder eine Fünf kassieren. Majd führt bei ihrem Talk noch ein Zitat von Muhammed Ali an, der einmal bekannte, dass er jede Minute des Trainings gehasst, aber sich selber gesagt habe: »Gib nicht auf. Leide jetzt – und lebe für den Rest deines Lebens als Champion.« So geht interne Kontrollüberzeugung.
Auf YouTube, Instagram und in Büchern hagelt es Empfehlungen fürs perfekte Mindset: Du sollst einfach dran glauben – und dann kann dich keiner stoppen. Solche Weisheiten greifen zu kurz. Wir müssen erst unser Hirn verstehen, bevor wir uns verbessern können. Am anschaulichsten erklärt das Mindset die Psychologin Carol Dweck. Sie hat bei ihrer Forschung ebenfalls zwei Pole ausgemacht: Sie unterscheidet zwischen statischem und dynamischem Selbstbild. Im Englischen drücken es die Begriffe noch besser aus, was sie damit meint: Growth Mindset und Fixed Mindset.21 Als ich auf diese Theorie stoße, sehe ich mich wieder in der Schule sitzen: In der fünften Klasse habe ich mich nicht getraut, mich zu melden, wenn ich etwas nicht verstand. Die anderen hätten einen ja für dumm halten können. Aber der Dumme war am Ende ich, weil ich nichts gelernt habe. Und genau hier klärt sich die Frage: Sind wir Dynamiker oder Statiker?
Der Statiker liebt Aufgaben, die er blind erledigen kann. Er holt sich Selbstvertrauen, indem er Routinearbeit erledigt und nicht scheitern kann. Es geht ihm um Bestätigung. Kennst du diese Freunde, die Angst davor haben, eine attraktive Person zu daten? Man könnte ja nicht gut genug sein. Oder sich auf einen anspruchsvollen Job bewerben? Das geht bestimmt schief! Aber reicht das aus, um erfolgreich zu werden? Der Dynamiker sagt: nein. Er sucht sich immer schwierigere Aufgaben und scheitert besser. Ich bin froh, dass ich mein Mindset um 180 Grad drehen konnte und gelernt habe, die Herausforderung zu lieben. Der Politologe Benjamin Barber bringt es auf den Punkt: »Ich teile die Welt nicht in Schwache und Starke, oder Gewinner und Verlierer ein. Ich teile die Welt in Lerner und Nicht-Lerner ein.«22
Wenn dich der Mut jemals verlassen sollte, dann erinnere dich an den griechischen Philosophen Kallikles. Es geht wieder um das Problem, das in der Schule seinen Anfang findet: Wenn einer mehr wissen will – und die anderen mit dem Finger auf ihn zeigen und »Streber« schreien. In unserer Gesellschaft müssen wir früh gegen Widerstände ankämpfen, wenn wir besser sein wollen. Kallikles wäre wohl einer von den Strebern gewesen. Aber er hätte es genossen und nur daran gedacht, dass er später mal das größere Haus und die schönere Frau haben würde. Für ihn bestand das Problem nicht darin, dass wir zu viel wollen. Die Mehrheit hatte vielmehr entschieden, dass dies moralisch verwerflich sei. Du hast bestimmt auch schon diese Menschen getroffen, die hartnäckig behaupten, dass die Reichen und Berühmten in Wirklichkeit unglücklich wären? Natürlich gibt es Manager, die sich zu Tode schuften. Aber rechtfertigt das ein Plädoyer für Mittelmäßigkeit oder gar Armut? Wohl kaum. Es gibt auch genug Menschen aus der Unter- und Mittelschicht mit kaputten Familien. Für Kallikles war das Mehr-haben-Wollen sogar ein Naturgesetz.23 Jeder soll sich genau so viel nehmen, wie er will: der eine wenig, der andere viel. Doch du solltest es niemals in Frage stellen, wenn du mehr willst. Der Pädagoge Benjamin Bloom macht jedem Mut, indem er nach vierzig Jahren intensiver Forschung zu dem Schluss kam, dass fast jeder lernen könne, was ein Mensch lernen kann, solange das Lernumfeld stimmt.24 Wir müssen nur wollen!
Test yourself! Wo liegt dein Locus of Control? Mache den Test und finde heraus, wie stark du daran glaubst, dass du dein Leben selbst im Griff hast: https://psychologia.co/locus-of-control/
WARUM MICH FREUNDE AM MEISTEN MOTIVIEREN
»Wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst, geht es dir dann darum, der Beste zu sein?«
Ich sitze vor meinem MacBook und soll einen Persönlichkeitstest ausfüllen. In wenigen Wochen steht diese Fortbildung an, es geht darum, seine Potenziale besser auszuschöpfen und seine Motivation zu steigern. Dafür brauchen die Coaches vorab den ausgefüllten Fragenkatalog, um meine Motive zu analysieren. Ich bin skeptisch, aber ich nehme mir trotzdem zehn Minuten Zeit und versuche, jede Frage ehrlich zu beantworten und nicht den Fehler zu begehen, dass ich mich möglichst gut darstellen möchte mit meinen Antworten. Am Ende wird mir dieser Test bewusst machen, was mich wirklich motiviert. Und das möchte ich dir auch ermöglichen!
Deswegen treffe ich mich mit jener Frau zum Interview im Münchner Stadtteil Bogenhausen, die diese Analyse entwickelt hat: Barbara Haag hat BWL, Psychologie und Wirtschaftsmediation studiert und die Managementberatung kopfarbeit. gegründet. Sie ist es auch, die die aHead Motivanalyse entwickelt hat.
In unserem Gespräch erklärt sie mir, was sie dazu bewogen hat, diesen Test zu entwickeln: »Ich begleite seit vielen Jahren Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung. Da geht es um die Frage, wie ich mir gewisse Kompetenzen aneignen kann, etwa das Führen von Menschen, und vor allem, wie es mir gelingt, nicht immer wieder in alte Muster zurückzufallen. Der Schlüssel zu einer nachhaltigen Verhaltensveränderung liegt eben nicht nur im Können, sondern im Wollen. Viele wissen also ganz genau, wie etwas geht, sie agieren jedoch insbesondere in Stress-Situationen falsch. Das Thema der inneren Antreiber hatte mich gepackt und so arbeitete ich mich tiefer ein in die Theorie der beiden Psychologen John William Atkinson und David McClelland.«
Atkinson und McClelland entschlüsselten in den 1960er-Jahren die Leistungsmotivation. In dieser Theorie gibt es drei Säulen der Motivation: Leistung, Gesellung und Macht. Haag wollte die Motivanalyse auf Basis dieser drei Säulen entwickeln, indem sie das Machtmotiv weiter aufschlüsselte in die Kategorien Wettbewerb, Autonomie und Vision. Dazu kommen noch Leistung und Freundschaft – und fertig sind die fünf Motive für die Persönlichkeitsanalyse. Aber wie finden wir nun heraus, welche Motive uns dominieren? Die Motivanalyse basiert auf 24 Fragen. Wenn du diese beantwortet hast, weißt du, was dich wirklich antreibt. Es können auch zwei oder drei Motive hervorstechen. Welche Motive mich antreiben, verrate ich dir am Ende dieses Kapitels, ebenso wie den Link zur Motivanalyse – dann kannst du selber herausfinden, welcher Typ du bist.
Die Kenntnis über deine Motive hilft dir dabei, dich selber besser zu verstehen, aber sie wird dir auch nützlich sein, um deine Freunde und Kollegen besser zu begreifen. In welchem Umfeld fühlen sie sich wohl? Oder warum agieren sie manchmal so schräg? »Motive lassen sich nicht ändern, wir können aber erfolgreich sein und Spaß haben, wenn wir unsere Motive im Blick haben«, sagt Haag. Gehen wir die fünf Motive nun einmal kurz durch:
Leistung treibt uns auf den ersten Blick alle an, aber hinter diesem Motiv verbergen sich Menschen, denen es nicht darum geht, mit ihrer Leistung andere zu beeindrucken oder Einfluss auf andere Menschen zu nehmen. »Leistungsmotivierte Menschen wollen ihre Expertise weiter ausbauen«, sagt Haag. Sie fangen da erst an, wo andere schon keine Lust mehr haben. Bist du ein Steuerexperte, der sich am liebsten ganz tief in die Gesetze vertieft? Oder liebst du es, mathematische Formeln bis auf die fünfte Nachkommastelle zu zerlegen? Dann motiviert dich wahrscheinlich Leistung. Ein typischer Beruf wäre Wissenschaftler, aber Haag erklärt mir, dass sich der Leistungstyp durch alle Branchen ziehe, er möge es nur nicht so gerne, in einem Umfeld zu arbeiten, das sich ständig verändert. Als typische Beispiele nennt sie mir Jeff Bezos und Angela Merkel. »Bezos gilt als Perfektionsfanatiker«, erklärt Haag, »er ist der reichste Mann der Welt, aber viele Menschen kennen nicht mal sein Gesicht. Das ist typisch für einen Leistungsmotivierten. Sie stellen ihr Licht gerne unter den Scheffel, wie unsere Bundeskanzlerin.« Solche Leistungsmotivierte lieben es, sich mit anderen Experten auszutauschen und können stundenlang fachsimpeln. Small Talk übers Wetter finden sie dagegen belanglos, und sie arbeiten lieber an ihrem Werk, weil sie sich dem besten Ergebnis verpflichtet fühlen. Sie lieben Planung, Sicherheit und Struktur. Wettbewerb interessiert sie dagegen nicht, die Benchmark sind sie selber. Aus meiner Sicht ist ein großer Vorteil leistungsorientierter Menschen: Wenn dich Leistung motiviert, dann steht dir dein Ego nicht im Weg. Du konzentrierst dich auf dich selber und willst dich stetig entwickeln.
Du misst dich dagegen gerne mit anderen und stellst deine Erfolge ins Schaufenster? Dann ist dein Motiv wahrscheinlich Wettbewerb. »Solche Menschen sind die geborenen Anführer, sie steuern gerne«, sagt Haag. Das Spannende an diesem Motiv ist: Es ist den meisten Menschen unangenehm, weil sie nicht gerne zugeben, dass sie besser sein wollen als andere. »Es geht scheinheilig zu, man muss sich in Deutschland fast für seinen Erfolg entschuldigen. Dabei finden wir die Insignien des Erfolgs überall. Warum sitzen die Vorstände meistens in der oberen Etage? Oder warum haben sie spezielle Parkplätze und die größten Büros? Dabei geht es um Demonstration der Macht«, erklärt Haag. »Der Wettbewerbstyp misst sich im Gegensatz zum Leistungsmotivierten gerne mit anderen und will auch, dass andere es mitkriegen, wenn er gewinnt. Deswegen mag er auch Hierarchien, weil er zeigen kann, wo er steht. Er geht Risiken ein und trifft Entscheidungen, auch wenn sie mal unangenehm sein mögen.« Es mag jetzt nach gefühlskaltem Rambo klingen, aber Haag bestätigt mir, dass Wettbewerber ein sehr gutes Gespür für Menschen hätten. Sie nennt mir als Beispiele Boris Becker, Cristiano Ronaldo, Carsten Maschmeyer, Coco Chanel und auch Heidi Klum. »Sie wird geliebt und gehasst – das ist typisch für diesen Typ.« Wettbewerbsmenschen profilieren sich eben gerne, deswegen wäre der klassische Beamtenjob eher nichts für sie. Anlegen solltest du dich mit ihnen nur, wenn du auf starken Gegenwind vorbereitet bist. Weil sie gerne austeilen, stecken sie auch ein, aber du solltest sie nie bloßstellen – das kränkt diesen Typ ungemein. Politiker wie Markus Söder, Horst Seehofer und Donald Trump sind auch gute Beispiele für den Wettbewerbstyp.
Kommen wir als Nächstes zum Gegenpol des Wettbewerbers: dem Freundschaftsmotivierten. »Immer wenn er mit Menschen zu tun hat, die er mag, kann er am besten arbeiten«, sagt Haag. »Dieser Typ will gemeinsam etwas erschaffen und dafür braucht er ein stabiles Umfeld.« Kann man so einen Typen mit Homeoffice motivieren? Eher nicht! Der Freundestyp liebt gerade den Austausch auf dem Flur und geht gerne mit den Kollegen nach der Arbeit noch ein Bier trinken. Als typisches Beispiel für den Freundestyp nennt Haag mir Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, Jamie Oliver und Dirk Nowitzki. »Solche Menschen sind sehr beliebt und wollen gemocht werden. Daraus ziehen sie ihre ganze Energie. Deswegen sind sie sehr konfliktscheu und passen sich gerne anderen an.« Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt: Der Freundschaftsmotivierte will nicht der Partyhengst sein, der die Party schmeißt und dem alle zujubeln, sondern er will tiefe Beziehungen – also lieber fünf echte Freunde als 1000 falsche. Die Stärken liegen aus meiner Sicht auf der Hand: Der Freundestyp kann gut mit anderen Menschen und kommt meistens selber gut an. Aber er passt sich zu sehr an, geht Konflikten aus dem Weg und hat auch Angst vor Veränderung.
Kommen wir zum vierten Motivtyp: Vision. »Diese Menschen wollen eine Idee realisieren«, sagt Haag, »aber beim Visionär geht es nicht darum, einen super Job zu machen wie beim Leistungsmotiv, sondern einen Traum zu bauen und andere Menschen dafür zu begeistern. Sie steuern also gerne andere, die den Traum für sie umsetzen sollen. Es handelt sich also auch um ein Machtmotiv wie beim Wettbewerbstyp, aber der Visionär führt viel emotionaler, weil es ihm um die Begeisterung geht.« Haag nennt mir Steve Jobs als typisches Beispiel und seine Präsentationen der neuen Apple-Produkte, die er stets vor einer schwarzen Wand und im schwarzen Rollkragenpulli zur Schau stellte. Er will die Menschen also von seiner Vision überzeugen und richtet das Spotlight auf sein Werk und nicht auf sich selbst. »In diesem Punkt unterscheidet sich der Visionär fundamental vom Freundschaftstyp. Er neigt im Extremfall zum Missionieren. Er wird entweder bewundert oder als Fantast abgetan. Jobs wurde auch nicht von all seinen Mitarbeiten angebetet.« Barack Obama gilt auch als klassischer Visionär. Die Stärke ist gleichzeitig das Problem: Dieser Typ ist rund um die Uhr mit seiner Vision beschäftigt. Bedenken und Stillstand bringen ihn auf die Palme. Wenn dich dieses Motiv antreibt, solltest du dir also möglichst ein Umfeld suchen, das dich unterstützt.
Wenn Steve Jobs ein Visionär ist, dann müsste doch auch Elon Musk einer sein, oder? Aber Haag widerspricht und ordnet den Tesla-Chef stärker dem Autonomie-Motiv zu! »Er setzt seine Idee um, aber es ist ihm egal, was andere denken. Bewunderung braucht und sucht er nicht, er provoziert gerne. Solche Typen sind innovativ, kreativ, sie denken quer und sind gerne anders. Sie wollen beweisen, dass sie es alleine schaffen und niemanden brauchen. Leistungs- und Wettbewerbsmotivierte wittern Probleme, aber einer wie Musk sieht nur die Chancen.« Als weiteres Beispiel nennt mir Haag Richard Branson, er verkörpere das Motto der Autonomie perfekt: Ich mach‘ mein Ding. »Bei Autonomie geht es um Macht, und zwar um Macht über sich selbst. Sie wollen frei und selbstbestimmt sein. Man darf sie niemals einschränken«, erklärt Haag. »Sie möchten so viel wissen, können und besitzen, dass ihnen niemand etwas kann. Sie möchten sich selber möglichst gut kennenlernen, um Herr über sich selbst zu werden. Sie schonen sich nicht und überschreiten ähnlich wie der Leistungsmotivierte gerne Schmerzgrenzen. Sie wirken oft unnahbar, vertrauen sich nur wenigen an, aus der Sorge heraus, durchschaubar zu sein.«
Haag erklärt mir, dass die Vertreter der Machtmotive Wettbewerb, Autonomie und Vision eines gemeinsam hätten: ein Gespür für Menschen, nur machten sie eben verschiedene Dinge damit! Mich beeindruckt das Autonomie-Motiv, also die Idee davon, Macht über sich selbst zu haben. Es besteht nur die Gefahr, als selbstsüchtiger Einzelgänger abgestempelt zu werden. Denn wer selber autonom lebt, der zeigt sich auch tolerant bis gleichgültig anderen gegenüber. »Sie machen ungern Vorschriften und sind sehr tolerant, außer sie werden in ihrer Freiheit eingeschränkt. Der Autonomie-Motivierte hasst es auch, ungefragt Ratschläge zu bekommen und erteilt selber auch keine«, erklärt Haag.
Friedrich Nietzsche schrieb einst: »Hat man sein warum? des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem wie?«25 Das kann ich nur bestätigen. Gerade das Freundschaftsmotiv spielt bei mir eine dominante Rolle. Mit den Kollegen, mit denen ich am meisten zu tun hatte, war ich immer befreundet. Konflikte können bei mir schnell auf den Magen schlagen. Ich könnte es mir niemals vorstellen, langfristig mit Menschen zu arbeiten, die ich nicht mag oder denen ich nicht vertraue. Auf der anderen Seite treiben mich auch die Vision und ebenfalls etwas der Wettbewerb an. Ich liebe es, Dinge zu verändern und andere Menschen von meinen Ideen zu überzeugen, sonst wäre es wahrscheinlich auch schwierig, einen YouTube-Kanal zu moderieren. Die Vision motiviert mich auch, dieses Buch zu schreiben, weil ich dir zeigen will, wie leicht du mehr aus deinem Geld machen kannst. Und ich gebe es zu: Ich liebe den Wettbewerb, und ich liebe es zu gewinnen.
Test yourself! Willst du herausfinden, welches der fünf Motive dich am meisten motiviert? Dann surfe einfach auf www.ahead-academy.de und mache deine kostenlose Motivanalyse.
DU BRAUCHST EINE MISSION
Es ist Freitag. Mitten im August, auf Stockholm brennt die Sonne, einer der heißesten Tage des Jahres. Eigentlich müsste das Mädchen heute in die Schule gehen, aber es geht schon länger nicht mehr. Es packt lieber seinen lila Rucksack und setzt sich alleine vor den schwedischen Reichstag. Einsam sitzt das Mädchen dort, kaum 1,50 Meter groß, zwei blonde Zöpfe hängen herunter, und es hält ein Schild, auf dem steht: »Skolstrejk för klimatet«. Das ist Schwedisch und bedeutet: »Schulstreik für das Klima.«
Das Mädchen heißt Greta Thunberg, und sie hat es durchgezogen. Drei Wochen lang hat sie Tag für Tag die Schule geschwänzt. Anfangs kämpften die Lehrer gegen ihren Widerstand, später solidarisierten sie sich mit ihr. Und es sollten noch viele mehr dazu kommen: Greta legte das Fundament für die »Fridays for Future« und wurde das Gesicht der Klimabewegung. In ganz Europa nehmen sich Tausende Schüler Greta zum Vorbild und schwänzen freitags die Schule, weil sie eine Mission haben: Sie kämpfen für eine bessere Zukunft – ihre eigene Zukunft.
Thomas Alva Edison hatte angeblich für die Weiterentwicklung der Glühbirne 9500 kleine Kohlefäden ausprobiert, bis er denjenigen fand, der die Glühbirne dauerhaft zum Leuchten brachte. Edison war der Meinung, dass Aufgeben die größte Schwäche sei und man nur Erfolg haben könne, wenn man immer wieder einen neuen Versuch wage.26 Er ließ sich vom Traum für seine Minisonne nicht abbringen. Den Menschen Tausende von Sonnen in die Hand zu geben und die Dunkelheit zu besiegen. Oder gar die Welt vor der Klima-Katastrophe retten. Gibt es klarere Missionen als die von Edison oder Thunberg?
Wer solche Ziele verfolgt, muss eine ungemeine intrinsische Motivation aufbringen. Von außen wirkt so eine Mission auf manche sogar wie Besessenheit. Und genau solchen Menschen folgen wir. Stell dir deine Mission vor wie einen Kompass, der dich durchs Leben leitet. Ist unsere Mission vielleicht sogar der Sinn des Lebens? Joseph Campbell, der Erfinder der Heldenreise, war der Meinung, »dass wir Erfahrungen machen wollen, bei denen wir uns lebendig fühlen«.27 Warum stehst du jeden Tag auf? Wann hast du dich zum letzten Mal lebendig gefühlt? Was dich zu Tränen rührt, was deine Stimme zittern lässt oder dich lächeln lässt – das sind die Dinge, für die es sich zu leben lohnt.
Wer sein Warum beantwortet und seine Mission findet, kann darauf große Ideen aufbauen oder sogar Geld-Druckmaschinen wie aus dem Silicon Valley: Die Google-Gründer wollten ursprünglich alle Informationen auf der Welt ordnen und für alle zugänglich machen. Elon Musk will die Welt von fossilen Brennstoffen befreien. Steve Jobs wollte die Welt mit seinem Design verändern. Was verbindet Menschen und Kunden? Nicht das, was wir machen. Nicht das, wie wir es machen. Entscheidend ist das Warum. Das beschreibt Bestseller-Autor Simon Sinek in seinem Buch Frag immer erst: warum.28 Er führt den sogenannten Golden Circle dafür an (siehe Darstellung unten).
Abbildung 1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Simon Sinek
Schauen wir uns Apple als Beispiel an. Was macht der i-Konzern? Er verkauft iPhones und iPads. Wie er das macht, wissen wir alle. Aber warum macht er das? Steve Jobs hatte die Vision, seinen Kunden tausend Songs in die Hosentasche zu packen. Du kannst dir das Gebilde eines Konzerns wie Apple wie einen Eisberg vorstellen. Das iPhone steht sichtbar an der Spitze, aber das Fundament, das Fans, Mitarbeiter und Investoren von Apple verbindet, befindet sich unter Wasser. Das Warum ist die Identität, der Sinn und der Wert der Marke. Das Warum bildet den Kern aller Handlungen. Und bei Apple wirkt das Warum so stark, dass die Apple-Jünger die iPhones nicht nur kaufen, sondern auch noch Marketing dafür betreiben, indem sie jedem erzählen, dass das iPhone das einzig wahre Smartphone sei.
Finde deine Mission, und du wirst nie wieder dran zweifeln, ob du gut darin werden kannst. Du wirst andere Menschen inspirieren und genau jene Leute anziehen, die denselben Glauben haben wie du. Das Warum spricht unsere Emotionen an – und nicht unsere Ratio. Deswegen schaffen wir es bei einem starken Warum sogar, Bösewichte zu lieben. Denken wir an Walter White, dem Charakter aus der Serie Breaking Bad: Ein spießiger Chemielehrer aus Albuquerque, der ein perfektes Familienleben mit seiner Frau Skyler und seinem Sohn Walter Junior führt. Eines Tages kommt der Schock: Walter erkrankt an Lungenkrebs. In seinem Hirn gibt es nur noch einen Gedanken: Er muss Geld auftreiben, damit seine Familie nach seinem Tod ein gutes Leben führen kann. Durch Zufall kommt er mit dem Kleinkriminellen und Drogendealer Jesse Pinkman in Kontakt, der früher sein Schüler war – und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Walter wird im Lauf der Serie das beste Crystal Meth des Landes fabrizieren und zum größten Drogendealer der USA aufsteigen. Klingt nach einem Menschen, den wir nicht als Nachbarn haben wollen. Walter lässt Menschen töten und hat am Ende sogar seinen Schwager auf dem Gewissen, der für die Drogenschutzbehörde arbeitet. Trotzdem fiebern wir mit einem Drogenbaron. Weil wir sein Warum verstehen und mitfühlen können. Und gibt es ein stärkeres Warum, als seine Familie retten zu wollen?
Eine Gruppe versammelt sich immer hinter einem Mythos, sie glaubt an ein gemeinsames Ziel. So vereinen sich beispielsweise die Gelbwesten in Frankreich, weil sie für mehr Gerechtigkeit kämpfen und dafür auf die Straße gehen. Auch bei unserer Mission-Money-Community gilt dasselbe Prinzip. Menschen, die sich für Geld und Aktien begeistern, tauschen sich in den YouTube-Kommentaren, unserer Facebook-Gruppe und auf unseren Live-Events aus. Eine gemeinsame Idee oder ein Mythos bringen Millionen von Menschen zu einer Religion zusammen oder zu einer Partei. Stell dir vor, du sperrst zehn Menschen in einen Raum, die alle ein anderes Warum haben. Der eine möchte die Wale retten, der andere Luxusuhren für die breite Masse anbieten, und noch ein anderer will die Menschheit auf den Mars umsiedeln. Ich verrate dir ein Geheimnis: In diesem Raum wird kein gemeinsamer Geist entstehen.
Vielleicht würdest du mir jetzt gerne die Frage stellen, warum ich dieses Buch schreibe? Bei mir verbinden sich zwei Warums: Zum einen liebe ich es, Geschichten zu erzählen. Am liebsten erzähle ich, was mich inspiriert und bewegt. Das fließt über in mein zweites Warum: Sachen ausprobieren und mein Leben optimieren. Wie ich es umsetze, ist ganz einfach: Ich schreibe dieses Buch hier so, wie ich es selber gerne lesen würde. Wenn du dein Warum gefunden hast, dann lässt sich darum ganz einfach ein Kosmos aufbauen, und du wirst nie abhängig von einer Plattform sein. Wie du deine Mission am besten erzählst, dazu kommen wir in den nächsten Kapiteln. Aber eines solltest du dir jetzt schon klarmachen: Gerade wenn dich eine Vision motiviert und du Leute für ein Team brauchst, um diese Vision umzusetzen, besonders dann brauchst du ein starkes Warum. Wenn du also das beste Schiff der Welt bauen willst, dann lehre dein Team, das Meer zu lieben.