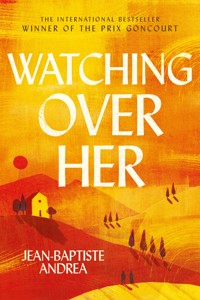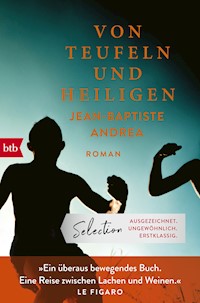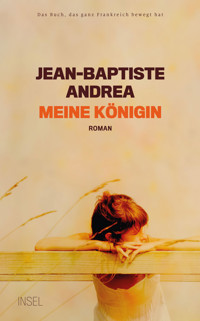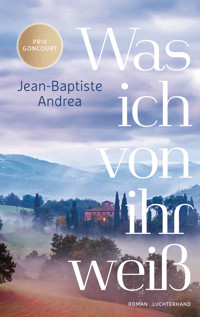
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der sensationelle Romanerfolg aus Frankreich: Die Geschichte eines Paares, das gegen die Konventionen der Zeit kämpft. »Ein zauberhaftes Buch über eine unerschütterliche Liebe.« Le Figaro Magazine. Lieblingsbuch der Buchhändler*innen in Frankreich. Ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt.
»Über manches, was uns fehlt, kommen wir nie hinweg.« Im großen Spiel des Schicksals hat Mimo – Michelangelo Vitaliani - die falschen Karten gezogen. In Armut geboren, wird er als kleiner Junge zu seinem Onkel nach Italien gegeben, um das Handwerk eines Bildhauers zu erlernen. Dort, in dem kleinen ligurischen Dorf Pietra d’Alba, begegnet er Viola, Tochter aus gutem Hause und jüngstes Kind der Orsinis, einer angesehenen Adelsfamilie. Viola scheint vom Glück begünstigt zu sein, doch sie ist eine junge Frau, die nicht in die Zeit passt. Sie will »fliegen« - auf eigenen Beinen stehen, aus dem engen gesellschaftlichen Korsett ausbrechen, das für eine Frau ihres Standes nur die Ehe vorsieht. Von ihrer ersten Begegnung an durchleben Viola und Mimo Seite an Seite die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Aufstieg des Faschismus und die Unruhen der Weltkriege. Er, der ungewöhnlich kleine Bildhauer, wird ein von der Elite gefeierter Künstler; sie versucht unermüdlich, ihre Träume als emanzipierte Frau zu verfolgen. Beide werden sich immer wieder verlieren und finden, als Verbündete oder Gegner, ohne ihre Freundschaft jemals aufzugeben. Aber was nützt Mimo aller Ruhm, wenn er Viola am Ende doch ziehen lassen muss?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Der sensationelle Romanerfolg aus Frankreich: Ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt 2023.
Die Geschichte eines Paares, das gegen die Konventionen der Zeit kämpft. »Ein zauberhaftes Buch über eine unerschütterliche Liebe.« Le Figaro Magazine
»Über manches, was uns fehlt, kommen wir nie hinweg.« Im großen Spiel des Schicksals hat Mimo – Michelangelo Vitaliani – die falschen Karten gezogen. In Armut geboren, wird er als kleiner Junge zu seinem Onkel nach Italien gegeben, um das Handwerk eines Bildhauers zu erlernen. Dort, in dem kleinen ligurischen Dorf Pietra d’Alba, begegnet er Viola, Tochter aus gutem Hause und jüngstes Kind der Orsinis, einer angesehenen Adelsfamilie. Viola scheint vom Glück begünstigt zu sein, doch sie ist eine junge Frau, die nicht in die Zeit passt. Sie will »fliegen« – auf eigenen Beinen stehen, aus dem engen gesellschaftlichen Korsett ausbrechen, das für eine Frau ihres Standes nur die Ehe vorsieht.
Von ihrer ersten Begegnung an durchleben Viola und Mimo Seite an Seite die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Aufstieg des Faschismus und die Unruhen der Weltkriege. Er, der ungewöhnlich kleine Bildhauer, wird ein von der Elite gefeierter Künstler; sie versucht unermüdlich, ihre Träume als emanzipierte Frau zu verfolgen. Beide werden sich immer wieder verlieren und finden, als Verbündete oder Gegner, ohne ihre Freundschaft jemals aufzugeben. Aber was nützt Mimo aller Ruhm, wenn er Viola am Ende ziehen lassen muss?
»Einer der großen französischen Romane.« Libération
»Fulminant.« ELLE
Zum Autor
Jean-Baptiste Andrea, Jahrgang 1971, ist ein französischer Romanautor und Filmemacher. Er wurde für Was ich von ihr weiß mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet und gilt »in Frankreich als einer der vielversprechendsten Autoren seiner Generation« (DER SPIEGEL). Jean-Baptiste Andrea wuchs in Cannes auf, später zog er nach Paris und machte dort seinen Abschluss in Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Seine Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er lebt in Cannes.
Thomas Brovot übersetzt Literatur aus dem Französischen und Spanischen, u. a. von Mario Vargas Llosa und Juan Goytisolo. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Paul-Celan-Preis.
Jean-Baptiste Andrea
Was ich von ihr weiß
Roman
Aus dem Französischenvon Thomas Brovot
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Veiller sur elle« bei L’Iconoclaste, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture / Toni Anzenberger
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31936-6V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für Berenice
Zweiunddreißig sind es. Zweiunddreißig, die an diesem Tag im Herbst 1986 die Abtei noch bewohnen, am Ende einer so steilen Straße, dass blass um die Nase wird, wer sie befährt. In tausend Jahren hat sich nichts geändert. Nicht das Abschüssige, nicht das Schwindelgefühl. Zweiunddreißig robuste Herzen – so muss es sein, wenn man am Rand des Abgrunds lebt –, zweiunddreißig Staturen, die robust einmal waren, in ihrer Jugend. In ein paar Stunden werden sie einer weniger sein.
Die Brüder bilden einen Kreis um den, der nun geht. Es hat schon viele Kreise gegeben, viele Abschiede, seit sich die Mauern der Sacra über ihnen erheben. Momente der Gnade, des Zweifels, der Körper, die sich gegen das nahende Dunkel stemmen. Es hat sie gegeben, weitere Abgänge werden folgen, und so warten sie geduldig.
Der heute im Sterben liegt, ist nicht wie die anderen. Als Einziger hat er kein Gelübde abgelegt. Trotzdem durfte er vierzig Jahre an dieser Stätte bleiben. Wann immer es Diskussionen gab, Fragen, kam ein Mann im purpurnen Gewand, nie derselbe, und entschied. Er bleibt. Er ist Teil dieses Ortes, so selbstverständlich wie der Kreuzgang mit seinen Säulen und romanischen Kapitellen, deren restaurierter Zustand sich in hohem Maße seinem Talent verdankt. Klagen wir also nicht, er bezahlt seinen Aufenthalt in natura.
Nur seine Fäuste schauen unter der braunen Wolldecke hervor, beiderseits des Kopfes, ein zweiundachtzigjähriges Kind in den Fängen eines Albtraums. Die Haut ist gelb, kurz vorm Reißen, ein über scharfe Kanten gespanntes Pergament. Auf der Stirn der ölige Glanz des Fiebers. Eines Tages mussten seine Kräfte ihn ja verlassen. Schade, dass er nicht auf ihre Fragen geantwortet hat. Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Geheimnisse.
Ohnehin ist ihnen, als wüssten sie es längst. Nicht alles, aber das Wesentliche. Die Meinungen gehen mitunter auseinander. Um sich die Langeweile zu vertreiben, legen sie den Eifer eines Klatschweibs an den Tag. Ein Krimineller sei er, ein ehemaliger Geistlicher, ein politischer Flüchtling. Manche sagen, er werde gegen seinen Willen festgehalten – eine abwegige Theorie, man hat gesehen, wie er gegangen und zurückgekommen ist –, andere behaupten, er sei zu seiner eigenen Sicherheit da. Dann die beliebteste Version, umgeben auch vom größten Geheimnis, denn Romantisches schafft es allenfalls als Konterbande herein: Er sei da, um über sie zu wachen. Sie, die in ihrer marmornen Nacht wartet, nur ein paar hundert Meter von der kleinen Zelle entfernt. Sie, die sich seit vierzig Jahren geduldet. Alle Mönche der Sacra haben sie einmal gesehen. Alle würden sie gern ein weiteres Mal sehen. Sie müssten nur Padre Vincenzo um Erlaubnis bitten, den Superior, aber die wenigsten trauen sich. Vielleicht aus Angst vor unfrommen Gedanken, die angeblich denen zufliegen, die ihr zu nahe kommen. Und unfromme Gedanken haben die Mönche schon reichlich, wenn sie des Nachts verfolgt werden von Träumen mit dem Gesicht eines Engels.
Der Sterbende kämpft, öffnet die Augen, schließt sie wieder. Einer der Brüder könnte beschwören, darin Freude erkannt zu haben – ein Irrtum. Man legt ihm behutsam ein kühles Tuch auf die Stirn, auf die Lippen.
Der Kranke regt sich, und zumindest diesmal sind sich alle einig.
Er will etwas sagen.
Natürlich will ich etwas sagen. Ich habe den Menschen fliegen sehen, immer schneller, immer weiter. Habe zwei Kriege erlebt und wie Nationen untergehen, habe auf dem Sunset Boulevard Orangen gepflückt, glaubt ihr, ich hätte nichts zu erzählen? Bitte um Verzeihung, ich bin undankbar. Ihr habt mich gekleidet, habt mir zu essen gegeben, obwohl ihr selber nichts oder nur sehr wenig hattet, als ich beschloss, mich bei euch zu verstecken. Aber ich habe zu lange geschwiegen. Schließt die Fensterläden, das Licht tut weh.
Er regt sich. Schließen Sie die Fensterläden, Bruder, das Licht scheint ihn zu stören.
Die Schatten, die im Gegenlicht, vor einer piemontesischen Sonne, bei mir Wache halten, die Stimmen, die mit dem herannahenden Schlaf schwinden. Alles ging so schnell. Vor nicht mal einer Woche konnte man mich noch im Küchengarten sehen oder auf einer Leiter, irgendwas war immer auszubessern. Langsamer, wegen des Alters, aber da bei meiner Geburt niemand etwas auf mich gegeben hätte, nötigte es sehr wohl Bewunderung ab. Und dann konnte ich eines Morgens nicht mehr aufstehen. In den Augen der anderen las ich, dass die Reihe nun an mir war, dass man bald die Totenglocke läuten und mich in den kleinen Garten mit Blick auf die Berge tragen würde, dorthin, wo der Klatschmohn wächst über einem jahrhundertealten Reigen von Äbten und Illuminatoren, Küstern und Kantoren.
Es steht schlecht um ihn.
Die Fensterläden knarren. Seit vierzig Jahren bin ich hier, sie haben immer geknarrt. Endlich die Dunkelheit. Dunkel wie im Kino – ich habe gesehen, wie der Film aufkam. Am Anfang nichts, nur ein leerer Horizont. Eine blendende Ebene, die mein Gedächtnis, je länger ich hinschaue, mit Schatten bevölkert, mit Schemen, die zu Städten werden, Wäldern, Menschen und Tieren. Sie rücken vor, nehmen Aufstellung im Vordergrund, meine Akteure. Einige erkenne ich wieder, sie haben sich nicht verändert. So erhaben wie lächerlich, geschmolzen im selben Tiegel, untrennbar miteinander verbunden. Die Münze der Tragödie ist eine seltene Legierung aus Talmi und Gold.
Eine Frage von Stunden nur.
Eine Frage von Stunden? Dass ich nicht lache. Ich bin schon lange tot.
Noch eine kalte Kompresse. Er scheint sich zu beruhigen.
Aber seit wann können die Toten ihre Geschichte nicht mehr erzählen?
Il Francese. Was habe ich den Spitznamen gehasst, auch wenn man mir noch schlimmere angehängt hat. All meine Freuden, all meine Leiden haben ihren Ursprung in Italien. Ich komme aus einem Land, wo die Schönheit immer bedrängt ist. Schlummert sie auch nur fünf Minuten, geht ihr die Hässlichkeit gnadenlos an die Kehle. Genies sprießen hier wie Unkraut. Gesungen wird, wie man tötet, gemalt, wie man betrügt, die Hunde lässt man an die Mauern der Kirchen pinkeln. Nicht umsonst war es ein Italiener, Mercalli, der seinen Namen einer Skala der Zerstörung gab, der Skala für die Stärke von Erdbeben. Was die eine Hand aufbaut, reißt die andere ein, und die Empfindungen sind die gleichen.
Italien, Reich des Marmors und des Unrats. Mein Land.
Tatsache ist, dass ich 1904 in Frankreich auf die Welt gekommen bin. Fünfzehn Jahre zuvor hatten meine Eltern, kaum verheiratet, Ligurien verlassen, um ihr Glück zu machen. Doch das Glück war ihnen nicht hold, die Leute beschimpften sie als Makkaronis, bespuckten sie und verlachten sie wegen ihrer Art, das r zu rollen. Mein Vater konnte den blutigen rassistischen Ausschreitungen in Aigues-Mortes 1893 nur knapp entrinnen, zwei seiner Freunde waren umgekommen: der tapfere Luciano und der alte Salvatore. Ohne diese Adjektive wurden ihre Namen fortan nie erwähnt.
Viele Familien verboten ihren Kindern, die Sprache der Heimat zu sprechen, um nicht »wie ein Makkaroni« zu klingen. Sie schrubbten sie mit Kernseife in der Hoffnung, sie ein wenig heller zu machen. Nicht so die Vitalianis. Wir sprachen italienisch, aßen italienisch. Wir dachten italienisch, das heißt in Superlativen, wobei oft der Tod beschworen wurde, mit reichlich Tränen, die Hände selten in Ruhestellung. Wir schimpften vor uns hin, wie man bei Tisch das Salz reicht. Unsere Familie war ein Zirkus, und wir waren stolz darauf.
1914 erklärte der französische Staat, der so wenig Eifer an den Tag gelegt hatte, um Luciano, Salvatore und die anderen zu schützen, dass mein Vater zweifelsohne ein guter Franzose sei und somit der Einberufung würdig, zumal ein Beamter ihn, ob irrtümlich oder spaßeshalber, beim Abschreiben der Geburtsurkunde zehn Jahre jünger gemacht hatte. So zog er los, mit langem Gesicht und ohne Blume im Gewehr. Sein eigener Vater hatte 1860 beim Zug der Tausend sein Leben gelassen. Mit Garibaldi hatte Nonno Carlo Sizilien erobert. Aber nicht eine bourbonische Kugel hatte ihn getötet, sondern, im Hafen von Marsala, eine Prostituierte von zweifelhafter Hygiene, was man in der Familie stillschweigend überging. Er war tot, und die Botschaft war klar: Krieg tötet.
Er hat meinen Vater getötet. Eines Tages erschien ein Gendarm in der Werkstatt, über der wir wohnten, unten im Tal der Maurienne. Meine Mutter öffnete jeden Tag, für den Fall, dass ein Auftrag hereinkam, den ihr Mann nach seiner Rückkehr würde ausführen können, früher oder später würde er sich wieder ans Behauen des Steins machen müssen, Wasserspeier restaurieren, Brunnen bauen. Der Gendarm setzte eine den Umständen angemessene Miene auf, und bei meinem Anblick schien er noch untröstlicher zu sein, er hüstelte und sagte, eine Granate sei eingeschlagen, tja. Als meine Mutter mit stoischer Würde fragte, wann der Leichnam überführt werde, geriet er ins Stammeln und erklärte, auf dem Schlachtfeld gebe es Pferde, auch andere Soldaten, und eine Granate, die richte großen Schaden an, also, da wisse man nicht immer, wer wer sei, nicht einmal, was ein Mensch sei und was ein Pferd. Meine Mutter dachte schon, er würde anfangen zu weinen, und schenkte ihm ein Glas Amaro Braulio ein – ich habe nie gesehen, dass ein Franzose diesen Kräuterbitter trinkt, ohne das Gesicht zu verziehen –, sie selbst weinte erst viele Stunden später.
Natürlich kann ich mich an all das nicht erinnern, oder nur sehr schlecht. Aber ich kenne die Fakten, und ich frische sie ein wenig auf, mit ebenjenen Farben, die mir jetzt in der Zelle, in der ich seit vierzig Jahren auf dem Monte Pirchiriano wohne, zwischen den Fingern zerrinnen. Bis heute – oder zumindest bis vor ein paar Tagen, als ich noch dazu imstande war – spreche ich schlecht Französisch. Seit 1946 hat mich niemand mehr il Francese genannt.
Ein paar Tage nach dem Besuch des Gendarmen sagte mir meine Mutter, in Frankreich könne sie mir nicht die Ausbildung bieten, die ich benötigte. Ihr Bauch rundete sich bereits über einem Brüderchen oder einem Schwesterchen – das nie auf die Welt kam, zumindest nicht lebend –, und während sie mich unter Küssen begrub, erklärte sie, dass sie mich zu meinem eigenen Wohl fortschicke, zurück in die Heimat, weil sie an mich glaube, weil sie sehe, wie groß meine Liebe zum Stein sei, trotz meiner jungen Jahre, weil sie wisse, dass ich zu Großem bestimmt sei, deshalb habe sie mir auch diesen Vornamen gegeben.
Von den beiden Päckchen, die ich in meinem Leben zu tragen hatte, war mein Vorname wahrscheinlich das leichtere. Trotzdem habe ich ihn aus tiefster Seele gehasst.
Meine Mutter kam oft hinunter in die Werkstatt, um ihrem Mann bei der Arbeit zuzusehen. Dass sie schwanger war, wurde ihr klar, als sie spürte, wie ich bei einem Schlag mit dem Meißel in ihrem Bauch zuckte. Bis dahin hatte sie sich nicht geschont und meinem Vater geholfen, riesige Blöcke zu verschieben, was vielleicht das Weitere erklärt.
»Er wird einmal Bildhauer«, verkündete sie.
Mein Vater grummelte und meinte, das sei ein schmutziger Beruf, bei dem die Hände, der Rücken und die Augen sehr viel schneller verschlissen als der Stein, und wenn man kein Michelangelo sei, könne man sich das auch ersparen.
Meine Mutter stimmte ihm zu und beschloss, mir einen Vorsprung zu verschaffen.
Mein Name ist Michelangelo Vitaliani.
Mein Heimatland lernte ich im Oktober 1916 kennen, in Begleitung eines Säufers und eines Schmetterlings. Der Säufer hatte meinen Vater gekannt und war dank des Zustands seiner Leber der Einberufung entgangen, doch so wie die Dinge sich entwickelten, stand zu vermuten, dass seine Zirrhose ihn nicht länger würde schützen können. Kinder, Alte, Lahme wurden eingezogen. In den Zeitungen hieß es, wir würden das Spiel gewinnen, die Boches wären bald Geschichte. In unserer Gemeinde hatte man im Jahr zuvor die Nachricht, dass Italien sich den Alliierten angeschlossen hatte, wie eine Siegesverheißung aufgenommen. Doch all jene, die von der Front zurückkehrten, sangen ein anderes Lied, sofern sie noch Lust hatten zu singen. Der ingegnere Carmone, der wie die anderen Makkaronis in Aigues-Mortes Salz geerntet und dann in Savoyen einen Lebensmittelladen aufgemacht hatte, wo er seinen Weinvorrat zum großen Teil selbst konsumierte, hatte also beschlossen, zurückzukehren. Wenn schon sterben, dann lieber in der Heimat, die Lippen rot vom Montepulciano, so ließ sich die Angst vertreiben.
Seine Heimat waren die Abruzzen. Er war sehr nett und auch bereit, mich auf dem Weg bei Zio Alberto abzusetzen. Er tat es, weil er ein wenig Mitleid mit mir hatte, aber auch, denke ich, wegen der Augen meiner Mutter. Die Augen von Müttern haben es oft in sich, aber bei meiner war die Iris von einem sonderbaren Blau, fast violett. Mehr als eine Schlägerei hatten sie ausgelöst, bis mein Vater Ordnung in die Sache brachte. Ein Steinmetz hat gefährliche Hände, dem würde ich gewiss nicht widersprechen. Die Konkurrenten hatten es bald aufgegeben.
Am Bahnhof von La Praz vergoss meine Mutter dicke violette Tränen. Mein Onkel Alberto, Steinbildhauer auch er, würde sich meiner annehmen. Sie versprach, bald nachzukommen, sobald sie die Werkstatt verkauft und etwas Geld verdient hätte. Eine Sache von Wochen, höchstens ein paar Monaten – sie brauchte zwanzig Jahre. Der Zug schnaufte, stieß einen schwarzen Qualm aus, den ich noch heute auf der Zunge schmecke, und nahm den beschwipsten Ingegnere und ihren einzigen Sohn mit.
Was immer die Leute sagen, mit zwölf Jahren hält die Traurigkeit nicht lange an. Ich wusste nicht, wohin der Zug mit uns schwankte, sehr wohl aber, dass ich noch nie Eisenbahn gefahren war – oder ich erinnerte mich nicht. Die Aufregung kippte bald ins Unwohlsein. Alles ging viel zu schnell. Kaum hatte ich etwas in den Blick genommen, eine Tanne, ein Haus, war es schon wieder weg. Eine Landschaft ist nicht dazu da, sich zu bewegen. Ich fühlte mich elend und wollte mich dem Ingegnere anvertrauen, aber der schlief und schnarchte mit offenem Mund.
Zum Glück hatte ich den Schmetterling. Er kam in Modane hereingeflogen und setzte sich an die Fensterscheibe zwischen mir und den vorbeiziehenden Bergen. Nach einem kurzen Kampf gegen das Glas gab er auf und rührte sich nicht länger. Ein schöner Schmetterling war das nicht, nicht diese bunte und goldene Pracht, die ich später, im Frühling, sehen würde. Nur ein nichtssagender Schmetterling, grau, ein wenig bläulich, wenn man die Augen fest zusammenkniff, ein vom Tag benommener Falter. Für einen Moment dachte ich daran, ihn zu quälen, so wie alle Jungs in meinem Alter, aber dann merkte ich, dass meine Übelkeit verging, wenn ich ihn fest ansah, er war der einzige Ruhepol in einer Welt im Aufruhr. Stundenlang blieb der Schmetterling dort sitzen, gesandt von einer befreundeten Macht, um mich zu beruhigen, und so bekam ich vielleicht zum ersten Mal eine Ahnung davon, dass nichts wirklich ist, was es zu sein scheint, dass ein Schmetterling nicht nur ein Schmetterling ist, sondern eine Geschichte, etwas gewaltig Großes auf allerkleinstem Raum, was die erste Atombombe ein paar Jahrzehnte später bestätigen sollte und was ich, vielleicht mehr noch, hinterlasse, wenn ich im Unterbau der schönsten Abtei des Landes sterbe.
Als der Ingegnere Carmone aufwachte, schilderte er mir sein Projekt, denn ein solches hatte er. Er war Kommunist. Du weißt, was das ist? In unserer Gemeinde in Frankreich hatte ich das Schimpfwort etliche Male gehört, die Leute fragten sich ständig, ob dieser oder jener einer war. Ich antwortete: »Pfff, klar, das ist ein Mann, der Männer und Frauen liebt.«
Der Ingegnere lachte. Ja, in gewisser Weise sei ein Kommunist ein Mann, der Männer und Frauen liebe. »Eine falsche Art, die Menschen zu lieben, gibt es auch gar nicht, das verstehst du doch, oder?« Ich hatte ihn noch nie so ernst gesehen.
Die Familie Carmone besaß ein Grundstück in L’Aquila, einer Provinz, der die Geografie ein zweifaches Unrecht angetan hatte. Zum einen war es die einzige Provinz in den Abruzzen ohne Zugang zum Meer. Zum anderen wurde sie in regelmäßigen Abständen von Erdbeben heimgesucht, genau wie das Ligurien meiner Vorfahren, mit dem Unterschied, dass Ligurien, dieses Luder, sich am Meer aalte.
Das Grundstück bot einen hübschen Blick auf den Lago di Scanno. Der Ingegnere beabsichtigte, dort auf einem riesigen Kugellager einen Turm zu errichten, wo er die Proletarier aus der Gegend unterzubringen gedachte, das alles zu einem moderaten Mietpreis, von dem er angemessen würde leben können – zumal er als guter Kommunist die oberste Etage für sich reservierte. Dank zweier Pferdegespanne, die alle zwölf Stunden wechselten, würde sich das Gebäude im Laufe des Tages um die eigene Achse drehen. So kämen ausnahmslos alle Bewohner, ohne Profiteure oder Ausgebeutete, einmal am Tag in den Genuss eines Seeblicks. Vielleicht würde die Elektrizität eines Tages die Pferde ersetzen, auch wenn Carmone zugab, dass sie wohl nie bis dorthin käme. Aber er träume gern.
Die Kugeln hätten darüber hinaus den Vorteil, die Konstruktion bei einem Erdbeben vom Boden abzukoppeln. Bei einem Beben der Stärke 12 auf der Skala von Mercalli – aus dem Mund des Ingegnere hörte ich zum ersten Mal den Namen – habe sein Haus im Vergleich zu einem normalen Gebäude eine um dreißig Prozent höhere Chance standzuhalten. Dreißig Prozent klinge vielleicht nach nicht viel, aber mit Stärke 12 sei nicht zu spaßen, erklärte er und verdrehte die Augen, das sei gewaltig.
Dann döste ich vor mich hin, die Augen fest auf meinen Schmetterling gerichtet, während wir nach Italien hineinfuhren und der Ingegnere mir mit innigen Worten von Zerstörung erzählte.
Gleich bei der ersten Begegnung fielen Italien und ich uns wie alte Freunde in die Arme. Ich hatte es so eilig, in Turin aus dem Zug zu kommen, dass ich auf dem Trittbrett stolperte und mit ausgestreckten Armen auf dem Bahnsteig landete. Ich blieb einen Moment liegen, dachte nicht einmal daran zu weinen, selig wie ein Priester bei der Weihe. Italien roch nach Flintenstein. Italien roch nach Krieg.
Der Ingegnere beschloss, eine Droschke zu nehmen. Es war teurer, als zu Fuß zu gehen, aber meine Mutter hatte ihm in einem Umschlag Geld zugesteckt, und so wie der Wein zum Trinken da sei, machte er klar, müsse auch das Geld ausgegeben werden, also, wenn du nichts dagegen hast, kaufen wir uns vor der Weiterfahrt ein Viertelchen Roten vom Po.
Ich hatte nichts dagegen, und ich staunte nicht schlecht über das Gewimmel ringsum: Soldaten auf Urlaub, Soldaten im Aufbruch, Träger, Lokführer und Scharen von zwielichtigen Gestalten, deren Funktion oder Ansinnen dem Jungen, der ich war, rätselhaft erschienen. Zwielichtige Gestalten hatte ich in meinem Leben noch keine gesehen, und ich hatte das Gefühl, dass sie meine eindringlichen Blicke mit Wohlwollen erwiderten, wie um zu sagen, du bist einer von uns. Vielleicht starrten sie auch nur auf die blaue Beule, die auf meiner Stirn wuchs. Ich ging durch einen Wald von Beinen, glückselig, überwältigt von all den Gerüchen: Teeröl und Leder, Pulver und Metall, ein Geschmack von Dämmerlicht und Schlachtfeld. Und dann die Geräusche, der Lärm einer Schmiede. Es knirschte, quietschte, krachte, eine von Analphabeten gespielte konkrete Musik weit abseits der Säle, in denen blasierte Honoratioren sich einmal drängen sollten, um so zu tun, als würden sie die Klänge schätzen.
Ohne dass ich es wusste, war ich im schönsten Futurismus gelandet. Die Welt war nichts als Geschwindigkeit, mit der Schritte, Züge, Kugeln dahinschossen, Schicksale umschlugen oder Bündnisse wechselten. Nur schienen all diese Menschen, all diese Massen es nicht wahrhaben zu wollen. Mit Hurra stürzten sie zu den Waggons, den Schützengräben, einem Horizont aus Stacheldraht, und doch war da etwas, zwischen zwei Bewegungen, zwei Schwüngen, das schrie, ich will noch ein bisschen leben.
Als ich später Karriere zu machen begann, zeigte mir ein Sammler stolz seine jüngste Erwerbung, das futuristische Gemälde Die Revolte von Luigi Russolo. Das war in Rom, um das Jahr 1930, glaube ich. Der Mann hielt sich für einen Kenner mit einer Leidenschaft für abstrakte Kunst. Ein Narr war er. Wer an diesem Tag nicht am Bahnhof Porta Nuova gewesen ist, wird das Werk nicht verstehen. Wird nicht verstehen, dass nichts Abstraktes daran ist. Es ist ein gegenständliches Bild. Russolo hat gemalt, was uns ins Gesicht explodiert ist.
Natürlich würde kein Zwölfjähriger es so formulieren. In dem Moment schaute ich mich lediglich um, mit weit aufgerissenen Augen, während der Ingegnere in einer Kaschemme am Ende des Bahnsteigs seinen Durst löschte. Aber all das habe ich gesehen. Ein Zeichen, wenn es denn noch eines bedurfte, dass ich nicht so war wie die anderen.
Als wir den Bahnhof verließen, schneite es leicht. Wir waren kaum draußen, da trat uns ein Carabiniere in den Weg und verlangte meine Papiere. Nicht die meines Begleiters, nur meine. Mit klammen Fingern, steif von der Kälte und dem Viertelchen Roten vom Po, gab ihm der Ingegnere Carmone die Genehmigung für mich. Der Polizist sah mich misstrauisch an, mit einer Miene, die er jeden Morgen vor der Arbeit aufsetzen und am Abend wieder ablegen musste, sofern sie ihm nicht angeboren war.
»Du bist ein kleiner francese?«
Ich mochte es nicht, dass man mich Franzose nannte. Und noch weniger, dass man mich als klein bezeichnete.
»Selber kleiner francese, cazzino.«
Der Carabiniere hätte fast keine Luft mehr bekommen, cazzino war die beliebteste Beleidigung hinter den Häusern meiner Kindheit, und wer ergreift schon einen Beruf, der mit einer so schönen Uniform aufwartet, wenn er dann verhöhnt wird ob der Größe seiner Männlichkeit.
Als guter Ingenieur zog der Ingegnere den Umschlag meiner Mutter hervor und schmierte die klemmenden Rädchen im Getriebe. Bald konnten wir weitergehen. Ich wollte auf keinen Fall in eine Droschke steigen und deutete auf eine Straßenbahn. Carmone grummelte, schaute auf eine Karte, stellte ein paar Fragen und kam zu dem Schluss, dass die Tram uns nicht weit von dem Ort absetzen würde, wo wir hinmussten.
Mit dem Hintern auf einer Holzbank fuhr ich durch die erste Großstadt meines Lebens. Ich war glücklich. Ich hatte meinen Vater verloren, wusste nicht, wann ich meine Mutter wiedersehen würde, aber ich war glücklich, ja, trunken von all dem, was noch vor mir lag, diesem Berg an Zukunft, den ich zu besteigen und nach meinem Maße zu behauen hatte.
»Sagen Sie, Signor Carmone …«
»Ja?«
»Elektrizität, was ist das?«
Er sah mich verblüfft an, und dann schien er sich zu erinnern, dass ich das erste Jahrzehnt meines Lebens in einem Dorf in Savoyen verbracht und es nie verlassen hatte.
»Das da, mein Junge.«
Er deutete auf eine Straßenlaterne, hoch oben thronte eine schöne goldene Kugel.
»So etwas wie eine Kerze also?«
»Die aber nie ausgeht. Das sind Elektronen, sie bewegen sich zwischen zwei Stückchen Kohle.«
»Was sind das, Elektronen? So eine Art Feen?«
»Nein, die sind Wissenschaft.«
»Was ist das, Wissenschaft?«
Ringsum wirbelten die Flöckchen, leicht wie ein Mädchenkleid. Der Ingegnere antwortete auf meine Fragen ohne Herablassung oder Ungeduld. Bald kamen wir an einem riesigen Gebäude vorbei, es war noch im Bau: das Lingotto. Ein paar Jahre später sollten dort die Fiats über eine gewundene Rampe zum Dach hinaufbefördert werden, wo sich ihre Räder nach der fertigen Montage zum ersten Mal drehten – eine mechanische Sacra di San Michele. Die Vororte wurden spärlicher, die Straßen wichen holprigen Pisten, und die Tram hielt inmitten von etwas, was wie ein Feld aussah. Die letzten drei Kilometer mussten wir zu Fuß gehen. Ich bin diesem Carmone dankbar, dass er mich so weit begleitet hat, trotz der Kälte, trotz der Zeiten. Wir liefen durch den Matsch, und ich stellte mir vor, wie in seiner Erinnerung die Augen meiner Mutter schon verblassten und ihm weniger violett vorkamen. Aber er führte mich sicher bis an die Tür von Zio Alberto.
Wir mussten Sturm läuten und mehrmals ans Türholz klopfen, ehe Alberto zu öffnen geruhte, er trug nur ein schmutziges Unterhemd. Die gleichen trüben Augen wie der Ingegnere, durchzogen von roten Äderchen – beide Männer teilten eine maßlose Liebe zum Rebensaft. Meine Mutter hatte geschrieben und mein Kommen angekündigt, es gab also nicht viel zu erklären.
»Das ist Ihr neuer Lehrling, Michelangelo, der Sohn von Antonella Vitaliani. Ihr Neffe.«
»Ich mag es nicht, wenn man mich Michelangelo nennt.«
Zio Alberto schaute zu mir hinunter. Ich dachte, er würde mich fragen, wie ich am liebsten genannt werden wollte, dann hätte ich gesagt: »Mimo.« Der Spitzname, mit dem meine Eltern mich seit jeher gerufen hatten, der Spitzname, den ich noch siebzig Jahre hören sollte.
»Ich kann ihn nicht brauchen«, sagte Alberto.
Ein weiteres Mal hatte ich eine Kleinigkeit vergessen. Denn das ist es, ja, eine Kleinigkeit.
»Ich verstehe nicht recht. Ich dachte, Anto… die Signora Vitaliani hätte Ihnen geschrieben, und es wäre abgemacht.«
»Geschrieben hat sie. Aber so einen nehme ich nicht als Lehrjungen.«
»Wieso das?«
»Weil mir niemand gesagt hat, dass das ein Zwerg ist.«
C’è un piccolo problema, hatte die alte Rosa gesagt, die Nachbarin, die meine Mutter in einer stürmischen Nacht entband. Der Ofen klapperte, so heftig fegte der Wind durch den Kamin herein und schürte ein höllisches Feuer, die Wände leuchteten rot auf. Ein paar Matronen aus der Nachbarschaft, die gekommen waren, um dem Ereignis beizuwohnen und einen neugierigen Blick auf diesen strammen Körper zu werfen, der ihre Ehemänner zum Träumen brachte, hatten sich längst davongemacht, sich bekreuzigend und mit einem il diavolo auf den Lippen. Furchtlos summte die alte Rosa vor sich hin, wischte ab, munterte auf. Die Cholera, die Kälte, schlichtweg das Pech, ein Messer, das man nicht gezogen hätte, wäre man weniger betrunken gewesen, es hatte ihr Kinder, Freunde, Ehemänner genommen. Sie war alt, war hässlich, hatte nichts zu verlieren. Und so ließ der Teufel sie in Ruhe, er sah genau, wo er sich nur Ärger einhandelte. Es gab leichtere Beute.
C’è un piccolo problema, sagte sie also und zog mich aus Antonella Vitalianis Schoß heraus. Alles hing an diesem Wort, piccolo, klein, und wer immer mich sah, für den war klar, dass ich mein Leben lang mehr oder weniger piccolo bleiben würde. Rosa legte mich auf meine erschöpfte Mutter. Mein Vater kam die Treppe heraufgestürzt, Rosa erzählte später, er habe bei meinem Anblick die Stirn gerunzelt, habe sich umgeschaut, als würde er nach anderem suchen, nach seinem richtigen Sohn, nicht nach diesem unfertigen Etwas, und dann habe er genickt, verstehe, kann passieren, so wie es passieren konnte, dass er auf einen in den Tiefen eines Steinblocks verborgenen Riss schlug, und die Arbeit von Wochen war zunichte. Wer wollte es dem Stein verübeln.
Just dem Stein schrieb man mein Anderssein zu. Meine Mutter hatte es nicht verstanden, sich auszuruhen, und so große Blöcke in die Werkstatt geschleppt, dass die Muskelmänner im Ort erröteten. Der arme Mimo hatte, glaubte man den Nachbarinnen, dafür büßen müssen. Achondroplasie sollte man es später nennen und mich als kleinwüchsig bezeichnen, was, ehrlich gesagt, nicht besser war als Zio Albertos »Zwerg«. Und dann hieß es, meine Größe definiere mich nicht. Aber wenn das stimmte, warum dann von meinem Wuchs sprechen? Ich habe noch nie gehört, dass von einer »mittelwüchsigen Person« die Rede ist.
Ich war meinen Eltern deswegen nie böse. Wenn mich der Stein zu dem gemacht hat, der ich bin, wenn schwarze Magie am Werk war, dann hat er mich mit dem, was er mir genommen hat, auch beschenkt. Der Stein hat immer zu mir gesprochen, alle Steine, Kalksteine, metamorphe Gesteine, selbst Grabsteine, ebenjene, auf die ich mich bald legen sollte, um mir die Geschichten der dort Ruhenden anzuhören.
»So war das nicht gedacht«, murmelte der Ingegnere und tippte sich mit dem Finger im Handschuh an die Lippen. »Das ist ärgerlich.«
Inzwischen schneite es heftig. Zio Alberto zuckte die Achseln und wollte uns schon die Tür vor der Nase zuschlagen. Der Ingegnere ging mit dem Fuß dazwischen. Er zog den Umschlag meiner Mutter aus der Innentasche seines alten Pelzmantels und gab ihn meinem Onkel. Darin steckten fast die gesamten Ersparnisse der Vitalianis. Jahre des Exils, des Schuftens, der von Salz und Sonne verbrannten Haut, des ständigen Neubeginns, Jahre des Marmors unter den Nägeln, manchmal mit einem Hauch von dieser Zärtlichkeit, die mich auf die Welt gebracht hatte. Deshalb waren die schmutzigen und knittrigen Geldscheine so wertvoll. Deshalb öffnete Zio Alberto die Tür wieder ein Stück.
»Der Betrag war für den Kleinen. Für Mimo, meine ich«, korrigierte er sich und wurde rot. »Wenn Mimo einverstanden ist, es Ihnen zu geben, wäre er kein Lehrling mehr, sondern Ihr Partner.«
Zio Alberto nickte bedächtig.
»Hmm, ein Partner.«
Er zögerte noch. Carmone wartete so lange wie möglich, dann seufzte er und nahm ein Ledertäschchen aus seinem Gepäck. Alles am Ingegnere zelebrierte den Verschleiß, das Geflickte, eine Ästhetik der vergehenden Zeit. Das Leder des Täschchens aber war neu und weich. Mit seinem rissigen Handschuh strich Carmone darüber, öffnete es und nahm widerstrebend eine Pfeife heraus.
»Für den Erwerb dieser Pfeife habe ich keine Mühe und keine Kosten gescheut. Sie wurde aus Bruyèreholz geschnitzt, aus dem Wurzelstock, auf den der große Garibaldi, der Held zweier Welten, sich niedergesetzt haben soll bei seinem so edlen wie vergeblichen Versuch, Rom mit unserem schönen Königreich zu vereinen.«
Ich hatte Dutzende solcher Pfeifen gesehen, die man in Aigues-Mortes den einfältigen Franzosen verkaufte. Ich fragte mich, wie die hier in Carmones Hände gelangt war, wie er darauf hatte reinfallen können. Ich schämte mich ein wenig, für ihn und für Italien. Er war naiv und hatte ein großes Herz. Die noble Geste kostete ihn viel, aber er meinte es ehrlich, wollte mir helfen, ganz sicher, nicht weil er es eilig hatte, weiterzukommen, oder weil er fürchtete, sich mit einem zwölfjährigen Jungen von ungewöhnlichen Proportionen herumschlagen zu müssen. Alberto stimmte zu, und sie besiegelten die Sache mit einem Schluck von einem so scharfen Schnaps, dass es die Luft in dem alten Haus vergällte. Dann stand Carmone auf, ein Schlückchen noch zum Abschied, und bald entfernte sich seine wankende Gestalt im stiebenden Schnee.
Er drehte sich ein letztes Mal um, die Hand erhoben im gelben Schein einer sterbenden Welt, und lächelte mir zu. Die Abruzzen waren weit weg, er war nicht mehr der Jüngste, die Zeiten waren rau. Ich bin später nicht zum Lago di Scanno gefahren, aus Angst, dass es dort keinen Turm auf einem Kugellager gab und auch nie geben sollte.
Ich verdanke den sogenannten »gefallenen« Frauen viel, und mein Onkel Alberto war der Sohn einer solchen. Einer tapferen jungen Frau, die weder Wut noch Scham kannte und sich im Hafen von Genua unter die Männer legte. Sie war die einzige Person, von der mein Onkel respektvoll sprach, mit einem Überschwang, dass es schon an Verehrung grenzte. Aber die Heilige aus den Gassen war weit weg. Und da Alberto weder lesen noch schreiben konnte, wurde seine Mutter mit jedem Tag mehr zu einem Mythos. Ich selbst konnte recht gut schreiben, worüber mein Onkel, als er es bemerkte, hocherfreut war.
Mein Onkel Alberto war nicht mein Onkel. Wir hatten nicht das kleinste Atom Blut gemeinsam. Ich konnte die Sache nie ganz aufklären, aber offenbar hatte sein Großvater bei meinem Großvater in der Schuld gestanden, ein nicht zurückgezahltes Darlehen, dessen moralische Last von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Auf seine perfide Art war Alberto ehrlich. Als meine Mutter ihn gebeten hatte, mich aufzunehmen, war er einverstanden gewesen. Er besaß eine kleine Werkstatt in einem Vorort von Turin. Da er Junggeselle war und nicht gerade dem Luxus frönte, reichte ein Auftrag hier und da, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, oder hatte bis zu meiner Ankunft gereicht. Denn der Krieg – ein Unternehmen des Fortschritts und als solches gepriesen von vielen Schwärmern, die im Übrigen das Wort »Schwärmer« nicht mochten und lieber »Dichter« oder »Philosoph« sagten – hatte Materialien populär gemacht, die billiger waren als der Stein, leicht herzustellen und zu bearbeiten. Stahl war für Alberto der schlimmste Feind, selbst im Schlaf schimpfte er auf ihn. Er hasste ihn noch mehr als die Menschen aus Österreich-Ungarn oder Deutschland. Für einen Tognino, wie man die Deutschen dort nannte, ließen sich noch mildernde Umstände anführen. Mit ihrer Küche und ihren lächerlichen Pickelhauben hätten sie allen Grund, wütend zu sein. Außerdem wüsste niemand, wie man mit Stahl wirklich baute, und wenn erst alles zusammengebrochen wäre, würde man schon sehen, wer zuletzt lachte. Alberto hatte nicht begriffen, dass alles längst zusammengebrochen war. Zugutehalten musste man dem Stahl, dass er nicht ganz unschuldig daran war, dass schöne Kanonen aus ihm wurden.
Alberto sah aus wie ein alter Mann, war es aber nicht. Mit seinen fünfunddreißig Jahren wohnte er allein in einem Zimmer neben der Werkstatt. Seine Ehelosigkeit erstaunte, zumal er, nachdem er geduscht, den Marmorstaub abgewaschen und sich in seinen einzigen Anzug geworfen hatte, gar nicht so wenig hermachte. Er besuchte immer dasselbe Bordell in Turin, wo er die Mädchen mit schon sprichwörtlichem Respekt behandelte. Zu Beginn der Zwanzigerjahre war der Ausdruck »sich benehmen wie Alberto« sehr beliebt in den südlichen Vierteln der Stadt, zwischen Lingotto und San Salvario, ehe er aus der Mode kam, als Alberto umzog und seinen Marmor und seinen Sklaven mitnahm, mit anderen Worten mich. Partner, dass ich nicht lache.
Oft wurde ich gefragt, welche Rolle er im Folgenden gespielt hat. Wenn mit »Folgendem« meine Karriere gemeint ist, keine. Versteht man darunter jedoch mein letztes Werk, ist ein Schimmer von ihm zweifellos darin enthalten. Nein, kein Schimmer, sondern Stückchen – ich möchte nicht, dass man denkt, er hätte jemals geglänzt. Zio Alberto war ein Arschloch. Kein Monster, nur ein blöder Sack, was auf dasselbe hinausläuft. Ich denke ohne Hass an ihn zurück, aber auch ohne Wehmut.
Fast ein Jahr habe ich im Schatten dieses Mannes gelebt. Ich habe gekocht, geputzt. Habe geschleppt, ausgeliefert. Hundertmal wäre ich fast von einer Straßenbahn überfahren oder einem Pferd umgestoßen worden, verprügelt von einem Kerl, der sich über meine Größe lustig machte. Der Ingegnere Carmone hätte seine helle Freude gehabt an der elektrisierten Stimmung in unserem Viertel. Jeder Kontakt war ein potenzieller Blitzschlag, eine Bewegung von Elektronen bei der man nie wusste, was sie bewirkte. Wir waren im Krieg mit Deutschland, Österreich-Ungarn, unseren Regierungen, unseren Nachbarn, um nicht zu sagen im Krieg mit uns selbst. Der eine wollte Krieg, der andere Frieden, der Ton wurde rau und rauer, und wer den Frieden wollte, schlug am Ende als Erster zu.
Zio Alberto hatte mir verboten, seine Werkzeuge anzufassen. Eines Tages erwischte er mich, wie ich ein kleines Weihwasserbecken korrigierte, das die benachbarte Pfarrgemeinde Beata Vergine delle Grazie bei ihm bestellt hatte. Ein- oder zweimal die Woche ließ Alberto sich gehörig volllaufen, beim letzten Mal hatte es Spuren hinterlassen. Das Becken war ein plumpes Ding, eine Beleidigung, ein Zwölfjähriger hätte es besser machen können, und das machte er auch, während der andere seinen Rausch ausschlief. Alberto wachte auf und ertappte mich auf frischer Tat, Eisen in der Hand. Verblüfft besah er sich mein Werk, verdrosch mich und schimpfte mit mir in einer Sprache, die ich nicht verstand, einer Mundart aus Genua. Dann schlief er wieder ein. Als er die Augen erneut aufschlug und sah, dass ich mich kaum noch bewegen konnte, voller blauer Flecken, tat er, als wüsste er von nichts. Er ging zu seinem Weihwasserbecken, stellte fest, dass er nicht unzufrieden war mit seiner Arbeit, und bot gönnerhaft an, es selbst auszuliefern.
Alberto diktierte mir regelmäßig Briefe an seine Mutter, dabei durfte ich auch meiner Mutter einen schreiben – großzügigerweise bezahlte er das Porto. Antonella antwortete nicht immer, sie war ständig unterwegs, auf der Suche nach einer Arbeit, die es ihr ermöglichte, noch eine Woche durchzuhalten, dann noch eine. Ihre violetten Augen fehlten mir. Mein Vater, der Mann, der meine ersten ungeschickten Schläge geführt hatte, der Mann, der mir beigebracht hatte, was ein Zahneisen ist, ein Steinbeil, eine Riffelfeile, er schwand in der Erinnerung.
Im Laufe des Jahres 1917 wurde die Arbeit immer weniger, Albertos Stimmung immer düsterer und seine Trunkenheit immer heftiger. Vor einem dämmrigen Grund marschierten manchmal Kolonnen von Soldaten, in den Zeitungen war nur noch vom Krieg die Rede, vom Krieg, vom Krieg, aber wir verspürten lediglich ein vages Unwohlsein, ein Gefühl des Abgetrenntseins von unserer Umgebung, als wären wir nie am richtigen Ort. Irgendwo dort hinten riss ein scheußliches Tier den Horizont in Stücke. Wir aber führten ein fast normales Dasein, ein Leben von Drückebergern, das allem, was wir aßen, einen Beigeschmack von Schuld verlieh. Jedenfalls bis zum 22. August, als das Brot ausging und es nichts mehr zu essen gab. Turin explodierte. Der Name Lenin erschien auf den Wänden der Stadt, Barrikaden wurden errichtet, am Morgen des 24. hielt mich ein Revolutionär auf der Straße an und sagte, ich solle aufpassen, ihre Barrikaden seien elektrifiziert, für mich ein deutliches Zeichen, dass sich die Welt veränderte. Der Typ nannte mich »Genosse« und klopfte mir auf den Rücken. Ich sah Frauen, die sich beschämten Soldaten entgegenstellten, sah sie auf Panzer klettern und ihre so siegesgewissen wie wütenden Busen präsentieren, auf die sie nicht zu schießen wagten. Zumindest nicht sofort.
Der Aufstand dauerte drei Tage. Niemand konnte sich auf irgendetwas verständigen, außer dass man den Krieg satthatte. Mit Salven aus Maschinengewehren führte die Regierung schließlich die Einigung herbei, fünfzig Tote ließen die erhitzten Gemüter abkühlen. Ich verkroch mich in der Werkstatt. Als eines Abends wieder Ruhe eingekehrt war und mit ihr auch ein wenig Brot, kam Zio Alberto fröhlicher gelaunt als sonst nach Hause. Er tat, als wollte er mir eine Ohrfeige geben, gluckste, als er sah, wie ich unter den Tisch abtauchte, und sagte, ich solle zur Feder greifen, worauf er mir einen Brief an seine Mutter diktierte. Er roch nach dem billigen Wein, den man an der Straßenecke ausschenkte.
Mammina,
ich habe das Geld erhalten, das Du mir angewiesen hast. Damit kann ich jetzt die kleine Werkstatt kaufen, von der ich Dir an Weihnachten erzählt habe. Die ist in Ligurien, also näher bei Dir. In Turin gibt es keine Arbeit mehr. Aber drüben haben sie ein Schloss, da gibt es immer etwas auszubessern, und eine Kirche, an der liegt den Behörden viel, also immer was zu tun. Hier habe ich verkauft, zu keinem guten Preis, aber egal, ich habe unterschrieben bei diesem Geizhals von Lorenzo, und bald mache ich mich auf den Weg, mit Mimo, dieser Rotznase. Ich schreibe Dir dann aus Pietra d’Alba, Dein Dich liebender Sohn.
»Und mach mir eine schöne Unterschrift, pezzo di merda«, schloss Zio Alberto. »Eine, die zeigt, dass ich es geschafft habe.«
Wenn ich an damals zurückdenke, wundere ich mich selbst: Ich war nicht unglücklich. Ich war allein, hatte nichts und niemanden, im Norden von Europa pflügte man die Wälder um, verstreute metallgespickte Leiber, dazu ein paar Granaten, die Jahre später unschuldigen Spaziergängern ins Gesicht explodieren sollten, man ersann eine Verwüstung, dass Mercalli erblasst wäre, schließlich hatte er seiner armseligen Skala nur zwölf Stufen zugestanden. Aber ich war nicht unglücklich, das merkte ich jeden Abend, wenn ich zu meinem persönlichen Pantheon von Idolen betete, die im Laufe meines Lebens immer wieder wechselten und zu denen später auch Opernsänger und Fußballspieler gehörten. Meine Tage waren, vielleicht weil ich jung war, schöne Tage. Erst heute kann ich ermessen, was die Schönheit des Tages der ahnenden Nacht verdankt.
Der Abt verlässt sein Arbeitszimmer und steigt die Treppe der Toten hinab, wie sie nicht zu Unrecht genannt wird. Erst dann wird er an das Bett des Mannes treten, der im Nebengebäude im Sterben liegt. Die Brüder haben ihm ausrichten lassen, dass die Stunde naht. Er wird ihm das Brot des Lebens auf die Lippen legen.
Padre Vincenzo geht durch die Kirche, ohne die Fresken zu beachten, passiert das Tierkreiszeichen-Portal und gelangt zu den Terrassen auf der Spitze des Monte Pirchiriano, von wo aus die Abtei auf das Piemont herabblickt. Vor ihm die Ruinen eines Turms. Der Legende nach ist hier einst ein junges Bauernmädchen, die schöne Alda, davongeflogen, um feindlichen Soldaten zu entkommen, geholfen hatte ihr der heilige Michael. Doch dann wollte sie, vanitas vanitatis, das Kunststück vor den Dorfbewohnern wiederholen, wollte sie nur beeindrucken, und stürzte in die Tiefe. So wie im vierzehnten Jahrhundert auch ein Teil des Turms einstürzen sollte, der ihren Namen trägt, niedergerissen von einem der vielen Erdbeben, die die Region von Zeit zu Zeit erschüttern.
Ein Stück weiter verschwinden ein paar Stufen im Boden, abgesperrt von einer Kette und einem Schild »Durchgang verboten«. Mit einer Geschmeidigkeit, die angesichts seines Alters Anerkennung verdient, steigt der Abt darüber hinweg. Es ist nicht der Weg zum Nebengebäude, wo der Sterbende auf ihn wartet. Bevor er zu ihm geht, möchte der Priester sie sehen. Sie, die ihm manchmal einen ungemütlichen Schlaf bereitet, denn er fürchtet ein Eindringen, wenn nicht Schlimmeres. Man weiß nie, was alles passieren kann, so wie damals, vor fünfzehn Jahren, als Fra Bartolomeo jemanden überraschte, direkt vor dem letzten schützenden Gitter. Der Mann, ein Amerikaner, hatte sich als verirrter Besucher ausgegeben. Der Abt hatte die Lüge sofort gerochen, er kannte den Geruch zur Genüge, es war der Geruch der Beichtstühle. Kein Tourist konnte versehentlich so tief in die Fundamente der Sacra di San Michele hinabsteigen. Nein, der Mann war gekommen, weil er das Gerücht gehört hatte.
Der Abt hatte richtig vermutet. Fünf Jahre später war derselbe Mann zurückgekehrt, mit einer förmlichen Genehmigung und einer Unterschrift aus den oberen Etagen des Vatikans. Man hatte ihm also Zugang verschafft, und die Liste jener, die sie betrachteten, wurde ein wenig länger. Leonard B. Williams war der Name dieses Professors der Universität Stanford, Kalifornien. Williams hatte sein Leben der Gefangenen der Sacra gewidmet und ihr Geheimnis zu durchdringen versucht, hatte eine Monografie über sie veröffentlicht, ein paar Aufsätze, dann Schweigen. Seine Arbeiten, so brillant sie auch waren, schlummerten in vergessenen Regalen. Ein kluger Schachzug des Vatikans, er hatte die Tore geöffnet, als gäbe es nichts zu verbergen. Jahrelang war es ruhig geblieben. Doch seit ein paar Monaten meldeten die Mönche Touristen, die keine waren. Schnüffler, unter Tausenden zu erkennen. Der Druck nahm wieder zu.
Eine kleine Ewigkeit steigt der Abt hinunter, findet sich mühelos zurecht in dem Labyrinth der Gänge. Selbst im Dunkeln würde er den Weg finden, so oft ist er ihn schon gegangen. Ein helles Klingeln begleitet ihn, wie von kleinen Schellen – der Schlüsselbund in seiner Hand. Diese verflixten Schlüssel. Für jede Tür der Abtei gibt es einen, manchmal auch zwei, als schlüge selbst hinter dem unerheblichsten Türblatt ein Geheimnis. Als würde das Geheimnis, das sie hier versammelt, die Eucharistie, nicht genügen.
Er ist fast am Ziel. Riecht die Erde, die Feuchtigkeit, den Duft des Granits, Milliarden Atome, niedergedrückt vom eigenen Gewicht und auch ein wenig von diesem Grün der Hänge ringsum. Endlich die Gittertür. Die alte wurde ausgetauscht und hat jetzt eine Fünffachverriegelung. Die Fernbedienung funktioniert nicht auf Anhieb, Padre Vincenzo drückt verzweifelt auf die Gummitasten, jedes Mal das Gleiche, und das nennt man Fortschritt, wir haben 1986 und schaffen es nicht mal, eine funktionierende Fernbedienung herzustellen. Er fängt sich wieder, Herr, vergib mir meine Ungeduld.
Schließlich erlischt das rote Lämpchen, der Alarm ist deaktiviert. Der letzte Gang wird überwacht von zwei hochmodernen Kameras, jeweils nicht größer als ein Schuhkarton. Unmöglich könnte hier jemand hereinkommen, ohne dass es sofort auffällt. Und selbst wenn es einem Eindringling gelänge – wozu? Er würde sie nicht mitnehmen können. Zehn starke Männer hatte es gebraucht, um sie hinunterzuschaffen.
Padre Vincenzo erschauert. Nicht den Diebstahl muss man befürchten. Er hat diesen spinnerten Laszlo Toth nicht vergessen. Und wieder ermahnt er sich, »spinnert« verträgt sich nicht mit Barmherzigkeit, sagen wir »psychisch gestört«. Sie waren nur knapp einer Tragödie entgangen. Aber er will jetzt nicht an Laszlo denken, an das unheimliche Gesicht und die leuchtenden Augen des Ungarn. Die Tragödie hatte abgewendet werden können.
Wir sperren sie ein, um sie zu schützen. Was für eine Ironie, denkt der Abt. Sie ist da, seien Sie unbesorgt, ihr geht’s prima, nur dass niemand sie sehen darf. Niemand außer ihm, dem Padre, dazu die Mönche, die es beantragen, die wenigen Kardinäle, die sie vor vierzig Jahren dort eingesperrt haben und noch leben, ein paar Bürokraten wohl auch. Etwa dreißig Personen auf der ganzen Welt, höchstens. Und ihr Schöpfer natürlich, mit seinem eigenen Schlüssel. Er konnte kommen, wann er wollte, hat sich um sie gekümmert und sie regelmäßig gereinigt. Ja, denn gereinigt werden muss sie.
Der Abt schließt die beiden letzten Schlösser auf. Er beginnt immer mit dem oberen, ein Tick, der vielleicht so etwas wie Nervosität verrät. Er würde ihn gern loswerden, und genau wie bei seinem letzten Besuch nimmt er sich fest vor, beim nächsten Mal mit dem unteren anzufangen. Die Tür öffnet sich lautlos – der Schlosser hat nicht gelogen, die Angeln sind von hervorragender Qualität.
Er macht kein Licht. Die ursprünglichen Neonröhren wurden, zur gleichen Zeit wie das Gitter, gegen eine sanftere Beleuchtung ausgetauscht, umso besser, das Neonlicht kam einer Misshandlung gleich. Trotzdem sieht er sie lieber im Dunkeln. Der Abt tritt vor, und aus Gewohnheit berührt er sie mit den Fingerspitzen. Sie ist ein wenig größer als er. In der Mitte des runden Raums – ein schlichtes Heiligtum mit romanischem Gewölbe – steht sie leicht gebeugt auf ihrem Sockel, versunken in einem steinernen Traum. Das einzige Licht fällt aus dem Gang herein, in seinem Schein zeichnen sich zwei Gesichter ab, ein gebrochenes Handgelenk. Der Abt kennt jedes Detail der Statue, die dort im Dunkel schläft, er hat sie sich angeschaut, bis seine Augen nicht mehr konnten.
Wir sperren sie ein, um sie zu schützen.
Aber die sie dort hingebracht haben, vermutet der Abt, wollten nur sich selbst schützen.
Savona hatte Italien zwei Päpste geschenkt, Sixtus IV. und Julius II. Dabei hätte Pietra d’Alba, gerade mal dreißig Kilometer nördlich der Stadt, dem Land fast einen dritten beschert. Dass es nicht dazu gekommen ist, daran bin ich nicht ganz unschuldig.
Sicher hätte ich gelacht, hätte mir jemand an diesem Morgen des 10. Dezember 1917 gesagt, dass die Geschichte des Papsttums einmal von dem Jungen beeinflusst werden sollte, der dort hinter Zio Alberto herschlurfte. Drei Tage waren wir fast ununterbrochen unterwegs gewesen. Das ganze Land hing an den Nachrichten von der Front, nachdem uns die österreichisch-ungarischen Truppen bei Caporetto eine herbe Schlappe beigebracht hatten. Es hieß, die Stellungen in der Nähe von Venedig seien befestigt. Es hieß aber auch das Gegenteil, eine Landung des Feindes stehe bevor, und dann würde man uns im Schlaf die Kehle durchschneiden oder, noch schlimmer, zwingen, Kohl zu essen.
Ins Licht des Morgens geschlagen, war Pietra d’Alba vor uns auf seiner Felsenspitze erschienen. Eine Täuschung, wie ich bald begriff, denn Pietra erhob sich nicht auf einem Bergsporn, sondern am Rand eines Plateaus. Der Weg zwischen der Mauer, die sich um den Ort zog, und der Kante des Felshangs war kaum breit genug für zwei Menschen nebeneinander. Dann fünfzig Meter Abgrund. Oder pure Luft, angefüllt mit Essenzen von Harz und Thymian.
Man musste erst durchs ganze Dorf hindurch, ehe sich zeigte, wofür es bekannt war: eine weite Hochebene, die sanft auf das Piemont zuwogte, ein Stück Toskana, aus einer geologischen Laune heraus dorthin verschoben. Im Westen wie im Osten wachte Ligurien und erinnerte den Ort daran, es sich nicht allzu bequem zu machen. Es war Gebirge, die Hänge bedeckt von einem Wald, dessen Grün fast so dunkel war wie die dort umherstreifenden Tiere. Aber Pietra d’Alba war ein schöner Ort mit seinem zart rosenroten Stein – tausendfach hatte sich das Morgenrot darin eingebettet.
Wer das Dorf besuchte, egal wie erschöpft oder missgelaunt, dem fielen sofort zwei ansehnliche Gebäude auf. Das erste, eine grandiose Barockkirche, verdankte sowohl ihre Größe als auch ihre Fassade aus rotem und grünem Marmor – kaum zu erwarten so weit im Landesinneren – ihrem Schutzheiligen. San Pietro delle Lacrime war an der Stelle errichtet worden, wo Petrus haltgemacht hatte auf seinem Weg zur Evangelisierung dieses ungehobelten Landes, das einmal Frankreich werden sollte. In jener Nacht, so die Legende, hatte er von seiner dreimaligen Verleugnung Jesu geträumt und geweint. Die Tränen waren in den Fels gesickert und hatten eine unterirdische Quelle gebildet, die fortan ein Stück weiter einen See speiste. Die Kirche hatte man um 1750 lotrecht über dieser Quelle erbaut, und nun trat sie in der Krypta hervor. Man schrieb ihr wunderkräftige Eigenschaften zu, und die Spenden flossen reichlich. Ein Wunder hatte es jedoch nie gegeben, abgesehen vielleicht, dank dem Wasser, von der Verwandlung des Plateaus in ein Stück Toskana.
Der Chauffeur setzte uns direkt vor der Kirche ab, Alberto hatte darauf gedrängt. Auch hatte er unbedingt von Savona aus mit dem Auto kommen wollen, als Eroberer, nicht wie diese Bauerntrampel auf einem Fuhrwerk. Es war eine frühe Werbeaktion, die gleichwohl ins Leere lief. Offenbar hatte das Dorf am Vortag ein ausgelassenes Fest gefeiert, dem Spruchband nach zu urteilen, das noch in einem Brunnen hing und einem Löwen als Schärpe diente, sowie dem Konfetti, das ein verspielter Wind bei jeder Bö aufwirbelte. Alberto bat den Fahrer zu hupen, was nur ein paar Turteltauben zur Kenntnis nahmen. Wütend beschloss er, den Rest des Wegs zu Fuß zu gehen. Die Werkstatt, die er gekauft hatte, befand sich außerhalb des Dorfs.
Erst als wir aus Pietra hinaustraten, sahen wir das zweite Gebäude. Oder es sah uns, denn mir war, als würde es uns trotz der Entfernung taxieren und Besucher als unwürdig einschätzen, sofern sie keine Fürsten waren, keine Dogen, Sultane, Könige oder zumindest Markgrafen. Wann immer ich nach längerer Abwesenheit nach Pietra d’Alba zurückkam, hatte die Villa Orsini auf mich genau diesen Effekt. Sie stoppte meine Schritte an derselben Stelle, zwischen dem letzten Brunnen des Dorfes und ebendort, wo sich die Straße über das Plateau hinabzog.
Die Villa stand am Waldrand, etwa zwei Kilometer von den letzten Häusern entfernt. In einer grünen Gischt waren die wilden, steilen Gebirgsausläufer an ihren Mauern gestrandet. Ein Land der Höhen und der Quellen, dessen Pfade, munkelte man, ihren Platz wechselten, sobald man einen Fuß auf sie setzte. Nur Holzfäller, Köhler und Jäger drangen dort ein. Von ihnen auch stammte die Geschichte von den sich bewegenden Pfaden, so wollten sie ihren Stolz bewahren, wenn sie sich im Wald verlaufen hatten und, abgezehrte, zerzauste kleine Däumlinge, eine Woche später wieder herausfanden.
Vor der Villa erstreckten sich, so weit das Auge reichte, Orangenbäume, Zitronenbäume, Pomeranzen. Das Gold der Orsinis, geprägt und poliert von einem Meereswind, der von der Küste her seine unendliche Milde über diese Höhen blies. Unmöglich konnte man nicht stehen bleiben, so überwältigend war die Landschaft, buntfarbig, pointillistisch, ein nie verlöschendes Feuerwerk in allen Tönen, Mandarine, Melone, Aprikose, Mimose, Schwefelblüte. Im Kontrast zum Wald hinter dem Haus zeigte sich anschaulich die zivilisatorische Mission der Familie, und so stand es auch in ihrem Wappen. Ab tenebris, ad lumina. Fern der Finsternis, hin zum Licht. Ordnung, die Gewissheit, dass alles seinen Platz hatte und dass besagter Platz ausnahmslos dem der Orsinis unterstand. Die Familie erkannte nur den Primat Gottes an, ließ es sich aber nicht nehmen, seine Angelegenheiten in dessen Abwesenheit zu regeln. Sodass die beiden ansehnlichen Gebäude in Pietra d’Alba unwiderruflich miteinander verbunden waren und es auch bis zum Ende bleiben sollten, verschwistert, zwei Brüder, die wenig miteinander sprachen, sich aber schätzten.
Noch heute sehe ich mich an diesem Morgen die Reihen der Orangenbäume entlanggehen, im Rücken die uns folgenden neugierigen Blicke. Sehe, wie vor mir die Werkstatt erscheint, ein altes Bauernhaus mit nebenan einer Scheune, dazwischen die große Grasfläche mit einem Nussbaum in der Mitte. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass es meiner Mutter dort gutgehen würde, wenn ich erst genug Geld verdient hätte und sie holen könnte. Alberto schaute sich um, die Fäuste in die Hüften gestemmt, die Wimpern mit Raureif gepudert. Er nickte zufrieden.
»Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Stein finden.«
1983 wollte Franco Maria Ricci mir unbedingt ein paar Seiten in seiner Kunstzeitschrift FMR widmen. Da er ein wenig verrückt war, stimmte ich zu. Das einzige Gespräch, auf das ich mich eingelassen habe. Dabei befragte mich Ricci nicht, wie ich erst dachte, über sie. Aber sie war präsent in dem Artikel, zumindest indirekt, so unauffällig wie ein Elefant.
Der Artikel ist nie erschienen. Leute in einflussreichen Positionen bekamen Wind von der Sache, die Auflage war ohnehin gering, und noch vor Erscheinen wurden sämtliche Exemplare in der Druckerei aufgekauft. Die Nummer 14 der FMR vom Juni 1983 erschien eine Woche verspätet und mit ein paar Seiten weniger. Ohne Zweifel besser so. Franco schickte mir ein Exemplar, das er vor dem Einstampfen hatte retten können. Nach meinem Hingang wird man es in der kleinen Kofferkiste unterm Fenster meiner Zelle finden. Es ist dieselbe, mit der ich vor siebzig Jahren in Pietra d’Alba angekommen bin.
In dem Gespräch habe ich Folgendes gesagt:
Mein Onkel Alberto war nie ein großer Bildhauer. Deshalb war ich lange Zeit auch nur Mittelmaß. Ich dachte nämlich – seinetwegen und taub gegenüber der einzigen Stimme, die mir das Gegenteil sagte –, dass es den richtigen Stein gäbe. Aber den gibt es nicht. Das weiß ich, weil ich jahrelang nach dem richtigen Stein gesucht habe. Bis ich begriff, dass ich mich nur nach dem Stein bücken musste, der zu meinen Füßen lag.
Der alte Emiliano, ehemals Steinmetz, hatte seine Werkstatt für einen Spottpreis an Alberto verkauft. Wann immer Alberto die Sache erwähnte, rieb er sich die Hände. Er rieb sich die Hände in Turin, rieb sich die Hände auf der Fahrt, rieb sich die Hände beim Anblick von Pietra d’Alba, der Werkstatt und der Scheune. Er hörte erst auf, sich die Hände zu reiben, als wir unsere erste Nacht dort verbrachten und er spürte, wie jemand zu ihm ins Bett kroch und zwei eiskalte Füße an die seinen drückte.
Alberto hatte mir erlaubt, mich in der Scheune einzurichten, was so viel hieß wie, die Werkstatt und das Nebenzimmer waren sein Zuhause. Die Aufteilung war mir nur recht: Wer hat als Dreizehnjähriger nicht davon geträumt, im Stroh zu schlafen? Zu ihm gelaufen bin ich, als ich es kurz nach Mitternacht schreien hörte. Alberto war schon im Begriff, handgreiflich zu werden, zuerst dachte ich, da wäre ein anderer Mann.
»Was hast du hier zu suchen, du kleines Miststück?«
»Ich bin Vittorio!«
»Wer?«
»Vittorio! Siehe Annex zum Vertrag!«
Ich höre noch seine ängstliche Stimme, flatternd zwischen zwei Registern, hoch-tief-hoch. Genau mit diesen Worten stellte er sich vor: Vittorio, siehe Annex zum Vertrag. Es wäre ein Verbrechen gewesen, das Geschenk eines solchen Spitznamens auszuschlagen.
Annex war drei Jahre älter als ich. In diesem Land der stämmigen Männer, immer nah an der Scholle, um die es sich zu kümmern galt, fiel er mit seiner Größe aus dem Rahmen. Es war das Einzige, was sein Vater ihm vererbt hatte, ein schwedischer Agronom, von dem niemand je erfuhr, zu welchem Zweck er in die Region gekommen war. Er hatte eine junge Frau aus dem Dorf geschwängert und sich, als sie ihm die Neuigkeit mitteilte, stante pede davongemacht.
Es dauerte einen Moment, bis wir begriffen, dass Annex der Angestellte des alten Emiliano war und dass er immer bei seinem einstigen Meister geschlafen hatte. Einem Spruch zufolge wählte ein Mann, der im Winter in diesen Landen zu entscheiden hatte zwischen einem Sack Gold und einem schönen Feuer, nicht immer das Gold. Wärme war rar, in den Häusern wie in den Herzen. Für Alberto war es ein Unding, dass zwei Männer zusammen schliefen, das hatte er ja noch nie gehört. Mit einem Schulterzucken versprach Annex, in die Scheune zu ziehen, was meinen Onkel noch mehr aufbrachte – er bedauerte schon, dass er das vom Notar übersandte Dokument nicht richtig gelesen hatte. Ich wollte mir die kleine Spitze nicht verkneifen und erinnerte ihn daran, dass er überhaupt nicht lesen konnte. Er war nicht beleidigt und sagte nur, der Notar Dordini hätte ihn warnen müssen. Außerdem, wenn er so darüber nachdachte, hatte der Dottore es vielleicht sogar getan an dem Abend, als sie mit den Burschen von der Zimmermannsinnung einen gehoben hatten. Ein Briefwechsel bestätigte später, dass Annex zu dem Gemäuer gehörte, welches man ihm zum Spottpreis und unter der ausdrücklichen Bedingung übertragen hatte, dass der junge Mann für zehn Jahre ab Unterzeichnung angestellt bleiben sollte – siehe Annex zum Vertrag.
In meinem Leben bin ich selten jemandem begegnet, der für die Arbeit am Stein so unbegabt war wie Annex. Trotzdem war er uns eine wertvolle Hilfe. Er hatte Stehvermögen, bekam einen Hungerlohn und war mit Kost und Logis leidlich zufrieden. Alberto entdeckte an sich, was Annex betraf, eine fast schon zärtliche Ader, als er nach einiger Zeit feststellte, dass er nun einen zweiten Sklaven hatte: eine besser gebaute Version von mir, weniger frech und vor allem ohne jedes Talent.
Am nächsten Tag erschien ein langer Tross, ein Gewimmel von Karren und Pferden, die in der blassvioletten Dämmerung dampften. Es war Albertos Ausstattung, die man ihm aus Turin brachte. Die Männer tranken mit meinem Onkel einen Schluck und machten sich gleich wieder auf den Weg.
Jetzt waren wir bereit für unsere ersten Kunden. Im Dorf hatte es immer nur zwei gegeben: die Kirche und die Orsinis. Alberto beschloss, beiden seine Aufwartung zu machen, und erörterte die protokollarische Reihenfolge, zu wem zuerst, an triftigen Argumenten mangelte es weder hier noch da. Das Rennen machten die Orsinis. Für Albertos Geschmack sprach die Kirche etwas zu viel von Armut, ein ums andere Mal betonte er, er habe Wechsel zu bezahlen, auch wenn das nicht stimmte. Seine Mutter hatte ihm das Geld für den Kauf der Werkstatt geschickt, und uns zahlte er nichts. Kurz nach dem Angelus erschienen wir also, Alberto, Annex und ich, am Dienstboteneingang der Villa. Eine Hausangestellte öffnete, musterte unsere bunte kleine Truppe und fragte, in welcher Angelegenheit wir kämen.
»Ich bin Maestro Alberto Susso aus Turin«, trug mein Onkel vor und schlug einen katzbuckelnden Ton an. »Sie haben sicher von mir gehört. Ich habe die Werkstatt des alten Emiliano übernommen, und ich möchte den hochwohlgeborenen Herrschaften, dem Marchese und der Marchesa Orsini, meine Aufwartung machen.«
»Warten Sie hier.«
Auf die Dienstbotin folgte der Verwalter, und es wurde entschieden, dass wir nicht in die Zuständigkeit der Verwaltung fielen, sondern in die des Sekretärs des Marchese, der bald darauf am Tor in der Mauer erschien. Dahinter war ein leuchtend grüner Park zu erkennen, der dunkle Glanz eines Teichs, ein Dampfen in der morgendlichen Luft.
»Der Marchese und die Marchesa empfangen keine Handwerker«, erklärte der Sekretär. »Sprechen Sie mit dem Verwalter.«