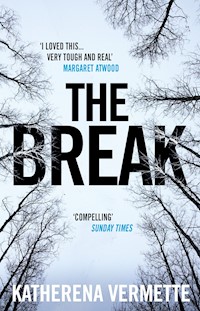3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winnipeg, am Rande der Stadt. In einer kalten Winternacht schaut die junge Mutter Stella aus dem Fenster und bemerkt, dass draußen auf der einsamen Brache vor ihrem Haus ein Mädchen überfallen wird. Voller Furcht ruft sie die Polizei. Als die Beamten eintreffen, finden sich zwar Zeichen eines Kampfes, eine zerbrochene Bierflasche und Blut im Schnee, aber vom Opfer fehlt jede Spur. Und die Beamten haben Zweifel, dass Stellas Aussage, eine Frau sei vergewaltigt worden, der Wahrheit entspricht. Doch es ist die Polizei, die sich irrt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Winnipeg, in einer kalten Winternacht: Stella, eine junge Mutter indianischer Abstammung, schaut aus dem Fenster und bemerkt, dass auf dem einsamen Streifen Brachland vor ihrem Haus jemand angegriffen wird. Voller Furcht ruft sie die Polizei. Als die Beamten eintreffen, finden sich zwar Zeichen eines Kampfes, eine zerbrochene Bierflasche und Blut im Schnee, aber von dem Opfer fehlt jede Spur. Und die sie haben Zweifel an Stellas Aussage, eine Frau sei vergewaltigt worden. Doch am nächsten Tag wird eine Jugendliche mit brutalen Verletzungen in die Notaufnahme gebracht: es ist Emily, die 13-jährige Tochter von Stellas Cousine.
Aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, fügt sich nach und nach zusammen, was zu den schrecklichen Ereignissen in jener Nacht führte. Doch es ist keine typische Kriminalgeschichte, es ist vielmehr die Geschichte der Familie des Opfers – und der Familie der Täter. Es geht um soziale Ausgrenzung, Gewalt und die Frage nach dem Warum. Und es sind vor allem die Frauen, die leiden und ihre Narben davontragen. Aber sie sind es auch, denen es gelingt, über Generationen ihre Weisheit und Stärke weiterzugeben.
Zur Autorin
KATHERENA VERMETTE, aufgewachsen in Winnipeg, Manitoba, ist Filmemacherin, Lyrikerin und Schriftstellerin indigener Abstammung. Ihr Debütroman Was in jener Nacht geschah war Bestseller und Debattenbuch in Kanada und wurde vielfach ausgezeichnet: McNally Robinson Book of the Year Award, Margaret Laurence Award for Fiction, Carol Shields Winnipeg Book Award. Shortlist für Governor’s General Literaray Award, Rogers Writers’ Trust und Canada Reads.
Katherena Vermette
Was in jener Nacht geschah
Aus dem Englischen von Kathrin Razum
Für meine Mutter
Den Verlorenen zu Ehren
Mit Liebe denen zugeeignet, die sich durchgeschlagen haben – ihr zeigt uns den Weg
Betty, wenn ich anfange, ein Gedicht über dich zu schreiben wird es stattdessen womöglich eines über die Jagdsaison über die freie Jagd auf indigene Frauen.
– aus »Helen Betty Osborne« von Marilyn Dumont
Am häufigsten geben Menschen ihre Macht dadurch auf, dass sie meinen, keine zu besitzen.
– Alice Walker
ERSTER TEIL
Die Brache ist ein Stück Land westlich der McPhillips Street. Ein schmales Feld, etwa vier Parzellen breit, das die dichten Häuserreihen auf beiden Seiten unterbricht und sämtliche Avenues von Selkirk bis Leila quert, diesen ganzen Randbereich des North End. Manche Leute haben keine Bezeichnung für dieses Stück Land und verschwenden wahrscheinlich auch keinen Gedanken daran. Auch ich habe es nie benannt, ich wusste einfach, dass es da war. Aber als sie, meine Stella, in ein Haus direkt daneben zog, nannte sie es die Brache, und sei es nur im Kopf. Niemand hatte ihr je eine andere Bezeichnung dafür genannt, und aus irgendeinem Grund fand sie, dass sie ihm einen Namen geben müsse.
Es ist eine Stromtrasse und wurde wahrscheinlich als solche ausgewiesen, als hier sonst noch nichts war. Als es auf dem Tiefland westlich des Red River nur hohes Gras und Kaninchen gab, etwas Gebüsch hier und da, bis hinauf zu dem See im Norden. Das Wohnviertel wuchs darum herum empor. Die Häuser wurden ursprünglich für osteuropäische Immigranten gebaut, die man auf diese, die falsche Seite der Bahnlinie drängte und vom wohlhabenden Süden der Stadt fernhielt. Jemand hat mir mal erzählt, dass die Häuser im North End alle billig und groß gebaut wurden, aber auf kleinen, schmalen Parzellen. Damals musste man Land von einer bestimmten Größe besitzen, um wählen zu dürfen, und diese Parzellen waren alle ein paar Zentimeter kleiner bemessen.
Die hohen, metallenen Strommasten wurden sicher erst später errichtet. Riesig und grau stehen sie zu beiden Seiten des schmalen Stücks Land und halten zwei glatte silberne Kabel hoch über dem höchsten der Häuser. Alle zwei Blocks wiederholen sich diese Masten, wieder und wieder, bis weit in den Norden. Womöglich sogar bis zum See. Die Kleine von meiner Stella, Mattie, hat sie Roboter genannt, als die Familie dort hinzog. Roboter ist eine gute Bezeichnung für die Masten. Sie haben einen eckigen Kopf und gehen unten ein bisschen auseinander, wie jemand, der strammsteht, und dann sind da noch die beiden hochgestreckten Arme, mit denen sie die Leitungen in den Himmel halten. Sie sind eine erstarrte Armee, die Wache steht und alles sieht. Wie ringsum Häuser gebaut und abgerissen werden, Menschen herbeiströmen und wieder verschwinden.
In den Sechzigern begannen Indianer hier einzuziehen – als die Status-Indianer die Reservate verlassen durften und viele in die Städte zogen. Die Europäer machten sich daraufhin nach und nach aus dem Viertel davon, wie ein Mann, der sich im Dunkeln von einer schlafenden Frau wegschleicht. Jetzt gibt es viele Indianer hier, große Familien, anständige Leute, aber auch Gangs, Nutten, Drogenhöhlen, und all die großen, schönen Häuser wirken in sich zusammengesunken und müde, wie die alten Leute, die noch in ihnen wohnen.
Die Gegend rund um die Brache ist nicht ganz so arm wie das restliche North End, sie hat etwas von einem Arbeiterviertel, genug, um den hart schuftenden Bewohnern das Gefühl zu geben, dass sie nicht Teil des ganzen Elends sind, abseits des Dramas leben. Hier stehen öfter Autos vor den Häusern als auf der anderen Seite der McPhillips Street. Es ist eine gute Wohngegend, aber man erkennt es trotzdem, wenn man weiß, worauf man achten muss. Wenn man die Häuser mit den niemals geöffneten, mit Laken verhängten Fenstern sieht. Wenn man die Autos sieht, die spätnachts kommen, mitten in der Brache parken, fern von jedem Haus, und nur zehn Minuten bleiben, ehe sie wieder verschwinden. Meine Stella sieht es. Ich habe ihr beigebracht, hinzusehen und immer wachsam zu sein. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch war, aber sie lebt noch, also muss etwas Gutes daran sein.
Ich habe diesen Ort, den meine Tochter die Brache nennt, immer gemocht. Früher bin ich im Sommer dort spazieren gegangen. Es gibt einen Pfad, der sich bis zum Stadtrand hinzieht, und wenn man bloß aufs Gras hinunterschaut, während man ihn entlanggeht, könnte man meinen, man wäre auf dem Land. Alte Leute haben dort Gärten angelegt, große Gärten mit gepflegten Mais- und Tomatenbeeten, sauber und ordentlich. Im Winter allerdings kann man dort nicht spazieren gehen. Niemand schaufelt einen Weg frei. Im Winter ist die Brache eine weiße, windige Weite, ein Meer von beißend kaltem Schnee, der vom kleinsten Windstoß aufgewirbelt wird. Und wenn der Schnee auf die nackten Stromleitungen trifft, entsteht ein durchdringendes Summen. Es ist ein anhaltendes Geräusch, leise genug, um es ignorieren zu können, wie ein Flüstern, das man als Stimme erkennt, ohne dass man jedoch verstehen könnte, was gesagt wird. Wenn es schneit, kommen einem die Leitungen ganz nah und niedrig vor, obwohl sie mehr als drei Stockwerke hoch über einem hängen, und sie machen dieses summende Geräusch, das fast wie Musik ist, nur nicht so weich. Man kann es ignorieren. Es ist einfach ein weißes Rauschen, und manche Leute können so etwas ignorieren. Andere hören es, gewöhnen sich aber daran.
Es schneite, als es geschah. Der Himmel war rosa und prall, und es hatte endlich angefangen zu schneien. Selbst drinnen im Haus hörte meine Stella das Summen, so deutlich wie ihren eigenen Atem. Wenn sich am Himmel die Wolken ballen, weiß sie, dass es kommen wird, aber sie hat gelernt, damit zu leben, so wie mit allem, was sie durchgemacht hat.
1 STELLA
Stella sitzt mit zwei Polizisten an ihrem Küchentisch, und eine Zeitlang sagt keiner etwas. Sie sitzen einfach da, schauen alle weg oder nach unten, eine lange Pause. Der ältere Polizist räuspert sich. Er riecht nach abgestandenem Kaffee und Schnee und sieht sich in Stellas Zuhause um, in ihrer sauberen Küche und dem dunklen Wohnzimmer nebenan, als versuchte er, Beweise für irgendetwas zu finden. Der Jüngere geht seine handschriftlichen Notizen durch, blättert die knittrigen Seiten seines kleinen Spiralhefts um.
Eine Decke um die Schultern, hat Stella die eine Hand um einen Becher heißen Kaffee gelegt, nimmt dessen Wärme auf und zittert doch. Mit der anderen Hand knüllt sie ein Papiertaschentuch zusammen. Sie schaut nach unten. Ihre Hände sehen aus wie früher die ihrer Mutter, älter aussehende Hände bei einer jungen Frau. Alte-Frauen-Hände. Ihre Kookom hatte früher auch solche Hände, und jetzt, wo sie von Kopf bis Fuß eine alte Frau ist, sind ihre Hände praktisch transparent, die Haut dort ist ganz dünn. So schlimm ist es bei Stella noch nicht, aber auch ihre Hände sind zu runzlig, sehen zu alt aus für ihren Körper, als wären sie schon vorausgealtert.
Der Polizist atmet schwer. Stella blickt schließlich auf und braucht all ihre Kraft, um ein weiteres Mal alles zu erzählen. Die Polizisten sitzen beide mit gestrafften Schultern da und rühren die Becher mit dampfendem Kaffee nicht an, die sie ihnen hingestellt hat. Aus den Funkgeräten an ihren Schultern knistert und rauscht es, zwischendurch gedämpfte Stimmen, Zahlen, Meldungen.
Sie hat den Versuch aufgegeben, vor diesen Fremden nicht zu weinen.
Officer Scott, der jüngere der beiden, bricht schließlich das Schweigen.
»Also, wir wissen sicher, dass da draußen etwas Schwerwiegendes passiert ist.« Er schaut sie von der Seite an. Sein Ton ist sachlich, er spricht langsam, legt das Gewicht auf die Wörter da draußen und passiert. Verzieht den Mund in geübter Anteilnahme, die Stella als vorgetäuscht erkennt, aber trotzdem annimmt. Der Ältere, bärtige, Officer Christie, sieht sie nicht an, er stimmt nur mit einem kurzen Nicken zu und räuspert sich erneut. Stella glaubt, dass er sich langweilt; der Jüngere dagegen, sehr jung ist er, wirkt eifrig, womöglich sogar aufgeregt.
Officer Scott versucht – noch einmal – nett auszusehen und fragt sie noch einmal: »Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Irgendetwas?«
Stella blinzelt eine Träne weg und schüttelt den Kopf. Sie schaut aus dem Fenster auf die Brache hinaus, auf das leere Grundstück neben ihrem Haus. Sie muss nicht hinsehen, um zu wissen, dass es leicht schneit. Sie hört das leise, tiefe Summen der Leitungen zwischen den nahen, aber nicht sichtbaren Strommasten. Auch jetzt in der Nacht ist der Himmel noch leuchtend rosa, prall von weiterem Schnee. Die Brache ist eine größtenteils unberührte Fläche, die sich bis zu dem Haus auf der anderen Seite erstreckt. Dessen Holzwände und der Schnee reflektieren das Licht von Mond und Straßenlampen, aber die Fenster sind natürlich dunkel. Alle Fenster sind dunkel, außer denen von Stella.
Die beiden Polizisten sind vorhin dort draußen gewesen, sind um das Blut herumgestapft, um die Lache, die den Schnee geschmolzen hat. Stella kann sie vom Fenster aus gerade noch sehen, einen Teil zumindest. Sie liegt auf dem weißen Boden wie ein dunkler Schatten, ist inzwischen wahrscheinlich gefroren. Schneeflocken fallen darauf, wollen das Blut verdecken. Es sieht nicht unheilvoll aus. Nicht wie das, was es wirklich ist.
Stella geht im Kopf noch mal alle Einzelheiten durch, erinnert sich an alles, will es vergessen. Es dürfte jetzt ungefähr vier Uhr sein, Jeff wird bald nach Hause kommen. Sie will nichts so sehr, wie dass Jeff nach Hause kommt. Sie horcht nach ihren Kindern, ist vorbereitet, falls sie aufwachen sollten, wundert sich, dass sie noch nicht aufgewacht sind bei all dem Getrampel, als die Polizisten hereingekommen sind, aber oben ist alles ruhig. Das Baby schläft, seit Stella die Kinder vor etwa vier Stunden, nachdem sie den Notruf 911 angerufen hatte, schließlich ins Bett gebracht hat. Die Kinder sind eingeschlafen, aber Stella konnte nicht schlafen. Sie wartete und schaute aus dem Fenster, nichts als ihre bangen Gedanken im Kopf. Also stand sie wieder auf und fing an zu putzen. Als die Polizei endlich kam, war alles blitzblank.
Ihre Gedanken zerfasern, aber sie erinnert sich an alles, immer wieder.
»Sie war klein, so klein.« Stellas Schultern beben, als sie die Sprache wiederfindet. »Eine ganz kleine Frau, vielleicht einen Meter fünfzig groß, jedenfalls nicht viel mehr.« Sie klammert sich an der Decke fest, in die sie sich gehüllt hat. »Lange, glatte schwarze Haare. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen. Ganz klein und schmal.« Stella fasst an ihr eigenes langes schwarzes Haar und erinnert sich noch an etwas anderes. Einen Moment lang versagt ihre Stimme. Sie weiß, dass sie sich wiederholt.
»Also, Sie haben sie nur durch die Tür gesehen, richtig?« Scott hat aufgehört, sich Notizen zu machen. Sein Stift ruht auf dem Heft, oberhalb der paar in Blau gekrakelten Wörter. Christie trinkt schließlich doch einen Schluck Kaffee.
»Ja, durch die Vortür. Durch die Glasscheibe.« Stella macht eine vage Handbewegung. Sie kann die Frau immer noch sehen, durch die Milchglasscheibe, wie sie sich langsam entfernt, langsam in das Seitensträßchen verschwindet.
»Das ist eine ziemliche Entfernung, Mrs McGregor. Sind Sie sicher, dass es nicht vielleicht ein junger Mann war? Sie wissen ja, dass viele von den jungen Indigenen die Haare lang tragen.«
Stella schaut ihn bloß an. Sein zu junges Gesicht, immer noch die Maske eines Lächelns, festgefroren. Naiv. Sie denkt an dieses Wort, wälzt es im Kopf herum. Naiv.
»Nein, es war ein Mädchen. Eine Frau.« Sie schaut wieder nach unten, wickelt die Hände in ihre Decke, zittert aber immer noch.
»Okay, okay. Erzählen Sie es uns noch mal«, versucht Scott es sanft. »Von Anfang an bitte. Sie haben draußen Geräusche gehört.«
Stella schüttelt den Kopf. »Draußen habe ich nichts gehört. Das Baby ist aufgewacht. Ich bin hochgegangen, um den Kleinen zu holen, und hab oben aus dem Fenster geschaut. Zuerst wusste ich nicht, was ich da sehe, ich dachte, das ist eine Schlägerei oder so was. Es hat schlimm ausgesehen, deswegen hab ich die 911 angerufen. Aber ich konnte nichts machen, weil mein Baby so geschrien hat. Er zahnt gerade.«
Sie blickt auf und sieht, wie dieser Scott nickt und sich vorbeugt. Geübt. Sein Partner schlürft noch mal von seinem Kaffee und schaut auf die Uhr. Stella dreht sich nach der alten Wanduhr um – 4.05 Uhr. Ja, Jeffs Schicht ist zu Ende, er wird auf dem Heimweg sein.
»Notrufzentrale 911.«
»Ja, hallo. Vor meinem Haus ist jemand überfallen worden. Da wird jemand zusammengeschlagen oder so was.«
»Tut mir leid, ich verstehe Sie nur ganz schlecht. Überfallen, haben Sie gesagt? Vor Ihrem Haus?«
»Ja, genau. Schschsch, Adam, schschsch, mein Kleiner.«
»Und wo ist das, wo wohnen Sie?«
»Magnus. 1243 Magnus. Westlich von McPhillips. Gleich neben der Brache, also, dieser unbebauten Fläche.«
Sie hört ein Seufzen am anderen Ende. »Also gut, hören Sie, ist diese Schlägerei noch im Gang?«
»Ja, ich glaube schon, oder warten Sie mal, ich glaube … Jetzt rennen sie weg.«
»Okay …«
»Oh nein! Oh Gott! Schsch, Adam, ist ja gut.«
»Hallo? Hören Sie? In welche Richtung rennen sie weg?«
»McPhillips. Richtung McPhillips. Aber da liegt jemand, verletzt! Ein Mädchen, eine Frau, glaube ich. Oh Gott!«
»Ich schicke sofort jemanden los. Hallo? Hören Sie mich?«
»Oh Gott oh Gott oh Gott, sie steht nicht auf. Ihre Beine … sie bewegt sich nicht …«
»Hallo? Ich verstehe Sie kaum, weil das Baby so schreit. Ich schicke sofort jemanden zu Ihnen.«
»Oh Gott!«
»Bleiben Sie bitte, wo Sie sind, ja? Hören Sie?«
»Aber sie bewegt sich nicht.«
Scott versucht es noch einmal. »Und dann sind Sie an die Tür gegangen und haben zugesehen, wie sie – wie das Opfer aufgestanden ist?«
»Ja«, bringt sie mühevoll hervor, nickt.
»Und Sie sind nicht hinausgegangen? Haben nicht mit ihr gesprochen?«
Stella schüttelt den Kopf, heftet den Blick wieder auf ihre Hände. Sie erträgt es nicht, wie diese Polizisten sie anschauen.
Er versucht es noch einmal. »Ist Ihnen bei den Angreifern irgendetwas aufgefallen? Logos an den Kleidern, irgend so was?«
Stella versucht ihre Wut herunterzuschlucken, ihre Tränen, ihre Scham, und schaut den Polizisten an. Seine Haut ist so jung, dass er noch ein paar Pickel hat. Und um die Nase herum hat er dunkle Sommersprossen. Stella hat diese Art Sommersprossen immer gemocht, braune Sprenkel auf der Haut.
»Nein, bloß – hm.« Stella verstummt, denkt kurz nach. »Sie hatten dunkle, weite Sachen an, Bomberjacken wahrscheinlich. Einen langen schwarzen Zopf hab ich gesehen. Die anderen hatten Kapuzen auf. Schwarze Kapuzen. Große dunkle Jacken.« Das hat sie alles schon gesagt. Vielleicht, denkt sie, versuchen die, ihr eine Falle zu stellen, sie bei einer Lüge zu ertappen oder so.
Scott lehnt sich zurück. Christie schlürft wieder von seinem Kaffee, so laut, dass man ihn fast »Aah!« sagen hört.
»Wenn Sie sich noch an irgendetwas anderes erinnern, Mrs McGregor, auch wenn es Ihnen völlig belanglos erscheint …«
Stella schüttelt nicht nur den Kopf, sondern den ganzen Körper. Sie will nicht daran denken, kann aber nicht anders. Es läuft immer wieder vor ihrem inneren Auge ab, ein visuelles Echo, die Bilder fließen ineinander. Die Einzelheiten beginnen bereits zu verschwimmen, schemenhafte schwarze Gestalten vor dem weißen Schnee. Die gedämpften Laute der Nacht, das Baby, das gar nicht mehr aufhört zu schreien. Stellas besänftigende Stimme, schsch, mein Kleiner, schsch, während sie zugleich die Gestalten beobachtet, die über etwas kauern, über was? Was ist das? Dann springen sie plötzlich alle auf und rennen weg. Nein, nicht alle. Da ist noch etwas, nein jemand, eine einzelne Gestalt. Liegt da, still und reglos, jemand Dunkles, Kleines im Schnee.
»Stell? Stell?« Jeff stürmt laut rufend durch die Hintertür herein. Stella schrickt zusammen und eilt zu ihm, ehe er noch lauter wird.
»Hey.« Sie sieht sein besorgtes Gesicht. Packt die beiden Seiten seines offenen Parkas und zieht ihn an sich. Sie weiß nicht, womit sie anfangen soll.
»Wo sind die Kinder?«, fragt er schroff, voller Angst.
»Ihren Kindern geht’s gut, Mr McGregor«, ruft Scott vom Tisch aus. »Keine Sorge.«
Jeff schiebt Stella sanft von sich weg und schaut ihr ins Gesicht. Sie nickt und lässt sich dann an seine Brust sinken, jetzt wieder in Tränen aufgelöst. Unter seiner Jacke ist es so warm. Seine kräftigen Arme umschließen sie, und einen Augenblick lang geht es ihr besser.
»Es gab einen Zwischenfall vor Ihrem Haus, Mr McGregor«, fährt der junge Polizist fort, »Ihre Frau war Zeugin eines Überfalls.«
»Ein Überfall?«, fragt Jeff nach. Er nimmt Stellas Hand, und sie setzen sich an den Tisch. Sie will seine Hand gar nicht mehr loslassen.
Die Polizeibeamten stellen sich nicht vor, sprechen in knappen, förmlichen Sätzen. Jeff hört ihren Erklärungen nickend zu. Stella wird wieder kalt.
»Ihre Frau glaubt, es habe sich um eine Art Vergewaltigung gehandelt.« Der junge Polizist spricht die Wörter aus, als wären es Fragen. Frau? Vergewaltigung?
»Nein, es war eine Vergewaltigung. Da ist jemand vergewaltigt worden.« Sie wendet sich Jeff zu. »Eine Frau, eine kleine, dünne Frau.«
Jeff nickt ihr nur zu und drückt ihre Hand. Er denkt, das hilft.
»Hören Sie, Mrs McGregor«, schaltet sich jetzt der ältere Polizist ein, »wir machen diese Arbeit schon sehr lange, und es sieht einfach nicht nach einem sexuellen Übergriff aus. Das ist ziemlich – unwahrscheinlich?« Auch er spricht, als stellte er eine Frage.
»Wieso? Wieso sagen Sie das?« Stella versucht, mit fester Stimme zu sprechen, beginnt jetzt aber selbst an sich zu zweifeln. Es war so dunkel, und sie ist so müde.
»Erstens war es draußen, und zwar im Winter. Das wäre schon mal sehr ungewöhnlich. Und außerdem ist da draußen sehr viel Blut, das heißt, dass jemand, na ja, geblutet hat.«
»Aber vielleicht war sie ja verletzt? Ist zusammengeschlagen worden? Können Sie denn nicht das Blut untersuchen oder irgend so was?«, stammelt Stella.
»Ich weiß, dass Sie verstört sind, aber halten wir uns an die Tatsachen. Am Tatort lag eine zerbrochene Bierflasche.« Christie hält inne, seufzt. »Alkohol führt oft zu Schlägereien. Und Blut weist ebenfalls auf eine Schlägerei hin. Sexuelle Übergriffe finden meistens nicht im Winter statt, draußen in der Kälte. Das ist einfach … unwahrscheinlich. Ich weiß, es war bestimmt schrecklich, das mitanzusehen. Solche Gewalt. Da gerät man leicht in … Panik.« Christie nickt und nimmt einen letzten Schluck Kaffee, als wollte er sagen, das Gespräch ist beendet.
Stellas Tränen versiegen, und eine altbekannte Wut steigt in ihr auf. Sie findet nicht die richtigen Worte. Aber selbst die würden die beiden Männer nicht überzeugen.
»Also, wir wissen einfach nicht, was passiert ist, oder? Keiner von uns weiß es sicher«, versucht Jeff zu vermitteln. Stella sitzt neben ihm, hält immer noch seine Hand umklammert. Sie merkt, dass er erleichtert ist. Dass er glaubt, jetzt sei alles in Ordnung.
Seit diesem Vorfall wollte sie nur eins, nämlich dass er da ist und sie tröstet. Aber jetzt ist er da, und sie fühlt sich nicht besser. Sie ist wie betäubt, aber er drückt nur ihre Hand. Was nicht hilft. Sie will seine loslassen, kann aber nur ihren Griff lockern, ihre Hand in seiner schlaff werden lassen. Er merkt es nicht einmal. Sie schaut aus dem Fenster. Es schneit jetzt heftiger.
Am liebsten würde sie ihre Kookom anrufen. Sie denkt an sie, ihre schöne Großmutter, die jetzt zweifellos schläft, in ihrer modrigen, aber warmen Kellerwohnung drüben in der Church Street. Stella möchte sich in ihre runzligen Arme kuscheln, sie flüstern hören, dass alles in Ordnung ist, so wie sie es immer getan hat. Stella hat ihr das immer abgenommen, egal was war.
»Wir melden uns, wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt.« Christie steht auf. »Hier in der Gegend ist ein Gangkampf wohl am wahrscheinlichsten. Ich würde mir keine weiteren Gedanken machen. Schließen Sie Ihr Haus gut ab. Sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit.«
Jeff bringt die beiden zur Tür, aber Stella bleibt sitzen, schaut wutentbrannt hinaus in den Schnee. Sie hört das verhaltene, höfliche Lachen, mit dem Weiße sich verabschieden, und das macht sie noch wütender.
»Fuck, hab ich eine Angst gehabt«, sagt Jeff, als er zu ihr zurückkommt. Er nimmt sie in den Arm, tröstend, doch es tröstet nur ihn selbst. »Als ich den Streifenwagen draußen gesehen habe, hab ich den Schreck meines Lebens gekriegt.«
Stella sitzt einfach nur da und lässt sich von ihm halten.
»Ich weiß, was ich gesehen habe«, sagt sie dann und merkt, dass sie jetzt nur noch trotzig klingt. Kläglich.
»Ich weiß, Schätzchen, ich weiß. Aber vielleicht«, er hält inne, überlegt noch einmal. »Wer weiß denn schon, was da draußen wirklich passiert ist?«
»Ich. Ich weiß es«, sagt sie und senkt dann die Stimme, um die Kinder nicht aufzuwecken. »Ich weiß, was ich gesehen habe, Jeff.«
»Ja, natürlich. Aber die haben schon recht, meinst du nicht? Es ist einfach – unwahrscheinlich.«
»Aber …«
»Die beiden wissen, wovon sie reden, Stell. Und weißt du«, er hält erneut inne, gibt sich wirklich Mühe. Er setzt sich neben sie, schaut sie direkt an. »Ich meine, vielleicht hast du das zum Teil ja doch nur geträumt?« Auch er spricht jetzt in Fragen. »Du schläfst doch in letzter Zeit nicht gut, weil Adam so anstrengend ist, seit er zahnt.«
Stella steht auf, sie schäumt vor Wut. Sie trägt die dämlichen Kaffeetassen in die Küche, schmeißt sie ins Spülbecken und fängt an abzuwaschen. Stellt die Tassen ins Trockengestell, wischt die Arbeitsfläche ab. Jeff bleibt am Küchentisch sitzen und wartet darauf, dass sie etwas sagt.
»Ich bin nicht verrückt«, sagt sie schließlich.
»Ich denke auch nicht … das behauptet auch niemand. Ich dachte einfach nur, vielleicht ….« Er gähnt. Sie merkt, dass er das eigentlich nicht will, aber er tut es trotzdem. Es ist so spät, dass es schon wieder früh ist. Sie hatte stundenlang auf die Polizei gewartet. Zitternd gewartet, gedacht, sie würden jeden Moment kommen. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu putzen und zu weinen. Schon da hätte sie ihre Kookom anrufen sollen. Die hätte zwar geschlafen, aber irgendwann wäre sie rangegangen. Oder Aunty Cher, die wäre noch wach gewesen. Aunty Cher hätte ihr zugehört. Wahrscheinlich wäre sie rübergekommen und hätte Kaffee gekocht, hätte die Bullen angeschrien, als sie anfingen, sich zu verhalten, als glaubten sie ihr nicht. Aber Stella hat nichts davon getan.
Jeff steht auf, stellt sich hinter sie ans Spülbecken und zieht sie an sich, zwingt sie in eine Umarmung. Sie wartet, bis er fertig ist, damit sie den nassen Lappen auswringen kann.
»Du hast halb geschlafen. Und das ist okay. Es ist okay. Aber bei deiner Vergangenheit, Schätzchen, ist es einfach nicht auszuschließen, dass du geträumt hast. Oder durcheinander warst.«
Sie löst sich von ihm und geht den Tisch abwischen. »Da draußen ist alles voller Blut«, sagt sie über die Schulter. Der Wind hat aufgefrischt, er rüttelt an dem alten Fenster.
»Es behauptet doch keiner, dass nichts passiert ist«, erwidert Jeff seufzend. »Es könnte bloß etwas anderes gewesen sein, als du denkst.«
Sie sagt nichts, scheuert nur.
Einen Moment lang bleibt er mitten in der Küche stehen. Sie weigert sich, zu ihm hochzublicken, und dreht den Kopf weg, als sie an ihm vorbeigeht, um den Lappen über dem Spülbecken auszuschütteln.
Müde und niedergeschlagen geht er ins Bad und macht sich zum Schlafen fertig.
Stella wischt noch einmal die Arbeitsfläche ab, bereitet alles für den Kaffee am nächsten oder vielmehr eigentlichen Morgen vor und hängt die Küchentücher auf. Dann geht sie in den Keller, zieht die saubere Wäsche aus dem Trockner und beginnt sie zusammenzulegen.
Als sie endlich ins Bett geht, kündigt das kalte Grau draußen schon die Dämmerung an. Ihr ganzer Körper schmerzt, ihr Mann schläft fest.
Sie denkt wieder an ihre Kookom und möchte sie am liebsten anrufen. Ihre Kookom steht immer früh auf. Wahrscheinlich ist sie schon auf den Beinen, kocht Tee und schaut aus dem Fenster. »Zusehen, wie es Tag wird«, nennt sie das. Wann hat Stella ihre Großmutter das letzte Mal angerufen? Es ist schon zu lange her. Schuldgefühle überschwemmen sie. Sie kühlt ihren heißen Zorn mit noch mehr kalter Scham. Aber sie ruft nicht an, sie kann es nicht. Sie kann sich nur die Decke bis zum Kinn hochziehen und daliegen.
Hinter den Rollos breitet sich das graue Licht aus, und sie tut gar nichts. Bis sie hört, dass ihre Tochter aufwacht. Dann springt sie aus dem Bett.
2 EMILY
Emily hat noch nie einen Jungen geküsst.
Also, einmal, in der Fünften oder so, hat dieser eine Junge, dieser Sam, sie kurz neben den Mund geküsst – nicht richtig drauf, nur daneben. Aber das zählt nicht richtig, es war nur eine Mutprobe nach der Schule, vor allen anderen. Er hatte große vorstehende Zähne und aufgesprungene Lippen. Er schob die Lippen vor, aber sie drehte im letzten Moment das Gesicht ein kleines bisschen zur Seite, und so landeten seine Lippen auf ihrer Wange. Die anderen Kids johlten alle, als wär das sonst was gewesen. Sie hatte danach einen feuchten Fleck auf der Wange, aber das war auch schon alles. Ganz anders, als ein Kuss eigentlich sein sollte. Emily findet, das zählt überhaupt nicht.
Ihre beste Freundin Ziggy hat auch noch nie einen Jungen geküsst, aber sie ist anders. Zig ist tough und macht sich nichts draus, sie findet, die Jungs an der Schule sind alle Schwachköpfe. Wahrscheinlich hat sie recht, denkt Emily, aber einige von ihnen, ein paar, sind total süß.
Clayton Spence ist der Allersüßeste.
Emily ist dreizehn. Die meiste Zeit fühlt sie sich hässlich und fett und ist sich absolut sicher, dass kein Mensch sie je gemocht hat. Sie ist mehr oder weniger davon überzeugt, dass sie abstoßend ist und nie einen Freund finden und nie richtig geküsst werden wird.
Sie jammert Ziggy deswegen andauernd was vor, jedenfalls jammert Zig, dass sie ihr andauernd was vorjammert. Aber Emily findet, es ist jetzt an der Zeit. Mit dreizehn ist es an der Zeit, dass man einen Freund hat oder zumindest mal richtig geküsst wird.
Daran denkt sie, während Zig und sie mit hochgezogenen Schultern, die Ringbuchmappen an sich gedrückt, so schnell wie möglich den Peanut Park durchqueren auf dem Weg zu Emilys neuem Zuhause. Es ist so kalt, dass sie fast rennen. Emily hat schon wieder ihre Handschuhe vergessen, und die Ärmel ihrer Jacke sind nicht lang genug. Sie sind gerade mal einen Block von der Schule entfernt, und ihre Fingerspitzen sind bereits rot und taub. Sie laufen, so schnell sie können.
»Hey, Emily«, ruft eine Stimme von dem alten Klettergerüst herüber, eine Männerstimme.
Emily fährt zusammen, als sie ihren Namen hört. Sie schaut zu Ziggy rüber, die auch erschrocken aussieht, als wollte sie gleich davonlaufen. Aber dann sieht Emily zu ihrer Verblüffung, dass er es ist.
»Hab ich euch erschreckt?« Clayton springt von dem Gerüst und kommt auf sie zu, seine Haare wippen mit jedem Schritt.
»Nein.« Emily zuckt dümmlich mit den Schultern. Ziggy starrt sie an, als wäre sie völlig bescheuert. Ziggys Brille beschlägt in der Kälte.
»Lüg doch nicht. Natürlich hab ich das.« Clayton lacht, aber nicht gemein. Er bleibt direkt vor ihr stehen. Er riecht nach Zigaretten, aber nicht unangenehm. »War keine Absicht.«
Emily findet, Clayton ist der bestaussehende Junge, den sie je gesehen hat. Das hat sie gesagt, als sie mal abgestimmt haben. Ziggy hat sich für Jared Padalecki aus Supernatural entschieden, aber Emily wollte jemanden nehmen, den sie tatsächlich mehr oder weniger kannte. Jemanden, dem sie persönlich begegnen und von dem sie herausfinden konnte, wie er riecht. Clayton ist älter, vor einer Weile ist er mal sitzen geblieben, das heißt, er ist mindestens vierzehn, wahrscheinlich aber fünfzehn. Er hat einen unregelmäßigen braunen Flaum über der Oberlippe, die ganz weich aussieht und schimmert, und wenn er grinst, sieht man all seine Zähne. Clayton lächelt nicht, sondern er grinst, und zwar breit. Und er hat perfekte rosa Lippen. Aus der Ferne hat Emily ihn schon ausgiebig betrachtet, aber jetzt, wo er vor ihr steht, kann sie ihn nicht direkt anschauen. Immerhin fällt ihr wieder auf, dass er groß ist, aber auch wieder nicht zu groß. Emily ist es gewohnt, größer als die Jungs zu sein, aber so ist es besser. Er hat genau die richtige Größe.
Sie zuckt noch einmal mit den Schultern, und weil ihr nichts einfällt, was nicht total lahm klingen würde, schaut sie einfach nur auf seine Füße. Seine Joggingschuhe sind nicht zugebunden, sie sind nagelneu und strahlend weiß.
»Wo geht’s denn hin?« Er grinst. Emily spürt es, sein Grinsen. Plötzlich macht es ihr nichts mehr aus, dass ihr vor Kälte fast die Finger abfallen und dass die Mountain Avenue noch zwei Blocks entfernt ist. Sie fröstelt, aber sie will sich nicht von der Stelle rühren.
»Bloß nach Hause.« Sie presst die Ringbuchmappe fester an sich.
»Ah.« Er grinst immer noch, und irgendwo lacht jemand. »Hey, hast du Lust, auf eine Party zu gehen?« Wieder lacht jemand, diesmal lauter. Ein Freund von Clayton, dessen Namen Emily aber nicht kennt. Clayton kennen alle.
»Was?« Sie schaut zu ihm hoch, etwas angespannt.
»Eine Party. Komm doch, echt.« Er redet ziemlich schnell. »Bring deine Freundin mit.« Er nickt zu Ziggy hinüber, die ihn nur über ihre beschlagene Brille hinweg anschaut, kein Lächeln, gar nichts. Ziggy kann so was von peinlich sein.
»Okay«, sagt Emily, und dann fällt ihr ein: »Wo denn?«
»Selkirk Avenue«, sagt er. »Hast du einen Stift dabei?«
»Klar.« Sie öffnet ihre Ringbuchmappe, so schnell sie kann, und fast wäre der ganze Inhalt in den Schnee gefallen. Allein bei der Vorstellung, wie das alles rausfliegt, alles, was sie aufgeschrieben hat, bleibt ihr fast das Herz stehen. Sie wäre gestorben. Es gelingt ihr, einen Stift herauszuziehen und ihn Clayton zu reichen.
»Wusst ich doch, dass du einen Stift dabeihast.« Wieder dieses Grinsen.
Emilys Wangen glühen, vor Verlegenheit und von der beißenden Kälte. Es ist blöder, kalter Februar, und ihr Gesicht ist wahrscheinlich feuerrot. Sie lächelt zurück, so gut es geht, und er zieht ihren Arm sanft in seine Richtung und hält ihn dicht vor seinen Körper, während er 1239 auf ihr Handgelenk schreibt. Die Tinte fließt erst nicht richtig, also zieht er die Eins noch mal nach. Fährt behutsam mit der Spitze über ihre Haut, hoch und runter. Seine Finger sind eisig, aber er hält ihre Hand ganz sanft und lässt sie zu schnell wieder los.
Sie wendet sich ab, um zu gehen, ganz belämmert, aber dann dreht sie sich noch mal um.
»An welchem Tag denn überhaupt?«
»An welchem Tag? Tja – eigentlich an jedem«, sagt er lachend. »Aber wahrscheinlich solltest du am Freitag kommen. Ja, komm am Freitag, da bin ich auch da.«
Sein Freund lacht wieder und ruft: »Los, Alter, komm jetzt, ich frier mir hier die Eier ab!«
»Also Freitag, okay?« Er lächelt sie lieb an, diesmal ist es nicht das Grinsen. Diesmal ist es nett. Er sieht so gut aus, und er ist so nett. Und er will, dass sie auf eine Party kommt. »Du kommst doch, oder?«
Emily nickt unwillkürlich. Sie sagt nicht Ja, findet nicht rechtzeitig ihre Stimme wieder, aber sie weiß sofort, dass sie sich das nicht entgehen lassen wird. Um nichts in der Welt.
Küsse sollen süß sein. Sanft und mitten auf die Lippen. Sogar feucht, aber nur ein bisschen. Sie sollen einen so aufgeregt und glücklich machen, dass man alles und jeden vergisst. Ab diesem Moment unterteilt sich alles in vorher und nachher, denkt Emily, und der Moment soll perfekt sein.
»Das erlaubt dir Paulina garantiert nicht!«, sagt Ziggy zu laut, als sie bei Emily sind, in dem noch nicht eingerichteten, mit Kisten vollgestellten neuen Haus. Emily kann es immer noch nicht fassen. Sie ruft sich die Szene wieder und wieder vor Augen, versucht sich an jedes noch so winzige Detail zu erinnern, damit es ihr nicht entfällt. »In tausend kalten Wintern nicht!«
Sie hat recht. Emilys Mutter wird ihr das niemals erlauben.
»Ich könnte ja sagen, dass ich bei dir übernachte«, schlägt Emily vor. Ihre langsam auftauenden Fingerspitzen tun weh, aber sonst ist ihr immer noch ganz heiß. Clayton Spence.
»Ach – und was sagen wir dann Rita?«, antwortet Ziggy, die sich auf den Boden gesetzt hat und gerade ihre Bücher auf den Kaffeetisch legt.
»Die geht doch bestimmt selbst aus. Ist doch Freitag.« Emily fühlt sich gerade sehr mutig, sie schaut aus dem Fenster und denkt. Denkt. Das wird einfach. »Meine Mom checkt das bestimmt nicht. Die ist zu sehr damit beschäftigt, mit Sniffer an der Bar rumzuknutschen.«
Ziggy wirft ihr einen Seitenblick zu. Sniffer ist Emilys Spitzname für Pete, den Typ, mit dem ihre Mutter und sie gerade zusammengezogen sind. Emily weiß nichts über diesen Typ, außer dass er nach Benzin riecht, weil er den ganzen Tag an Autos herumbastelt, deshalb nennt sie ihn Sniffer. Aber Zig hat da keinerlei Mitgefühl. »Ach, komm – Paulina ist nicht halb so schlimm wie Rita, wenn sie einen neuen Mann aufgegabelt hat.«
»Aber deine Mom zieht dann wenigstens nicht mit dem zusammen. Ich meine, riechst du das nicht? Es stinkt voll nach Benzin, und ich muss hier wohnen.«
»Immerhin hat er Arbeit. Erinnerst du dich noch an Freddie? Der hat einen Monat lang bei uns auf der Couch geschlafen. Und er hat auch gestunken, aber bei dem war das Körper- und Mundgeruch. Ich schwör’s dir, der hat nie auch nur einen Fuß vor die Tür gesetzt.«
»Ja, der war echt eklig.« Emily zieht ihre Bücher hervor, und dann fällt ihr Clayton wieder ein. Zwischendurch vergisst sie ihn immer wieder für eine Sekunde oder so, und danach freut sich jedes Mal wieder von Neuem. Clayton.
»Und er hat dauernd Wrestling im Fernsehen geguckt. Ich hasse Wrestling.« Ziggy verzieht das Gesicht und schaut weg.
Emily fragt sich, ob ihre Freundin eifersüchtig ist, ob sie vielleicht auch gern von einem Jungen eingeladen worden wäre. Zig ist voll süß und könnte echt was hermachen, wenn sie sich einfach nur ein bisschen schminken und ihre Brille weglassen würde. Sie tut immer so, als wäre ihr das alles egal, aber wahrscheinlich ist es das nicht, jedenfalls nicht völlig. Arme Zig.
»Waaas, du magst kein Wrestling ?« Emily verstellt ihre Stimme, um ihre beste Freundin zum Lächeln zu bringen. Sie lachen beide, eigentlich wegen gar nichts, vergessen alles und lachen richtig lang.
Einmal hat Clayton in Mathe bei Emily mit ins Buch geguckt. Das war Anfang des Jahres, er erinnert sich also bestimmt nicht mehr daran.
Er hatte sein Buch vergessen und meldete sich, um es Mr. Bell zu sagen.
Der Lehrer seufzte, als wäre er voll genervt.
»Kann ich bei dir mit reingucken?« Clayton beugte sich grinsend zu Emily rüber.
»Klar.« Das Wort schoss regelrecht aus ihr raus.
»Danke«, sagte er, kam noch näher und schaute ins Buch.
Sie konnte nichts weiter sagen. Sie wagte es nicht mal, auch nur zu versuchen, mit ihm zu reden. Ja, sie wagte kaum zu atmen.
»Danke«, sagte er noch einmal, nachdem er all die Zahlen abgeschrieben hatte. Sein Grinsen war so ansteckend, dass Emily gar nicht anders konnte als ebenfalls zu lächeln, aber sie wandte sich schnell ab, denn sie war sich sicher, dass es ein dümmliches, zu glückliches Lächeln war.
Danach kam Clayton nicht mehr in die Schule. Eine Weile rief Mr Bell seinen Namen noch auf, aber nur etwa eine Woche lang. Dann verschwand er von der Liste.
Emily vermisste den Klang seines Namens und dachte immer daran, dass er zwischen Roberta Settee und Crystal Swan gekommen war. Und dann kam sie, Emily Traverse.
»Okay, also, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir an alles denken«, sagt Ziggy, die endlich einlenkt. Das Sozialkundebuch liegt aufgeschlagen, aber unbeachtet auf dem Tisch.
»Das wird schon klappen, Zig.« Emily versucht, sich cool zu geben, cool zu fühlen. »Meine Mom will am Freitag weggehen, ich hab sie mit meiner Aunty Lou darüber reden hören. Wenn sie denkt, dass ich bei dir bin, kümmert sie sich da nicht weiter drum, und deine Mutter geht doch zu dieser Galeriegeschichte von meiner Kookom, oder? Das passt alles.«
»Ich will aber trotzdem spätestens um elf wieder zu Hause sein, oder sogar um zehn, denn das ist hinter der McPhillips Street, das ist ein ganz schönes Stück zu laufen. Wir müssen echt verdammt vorsichtig sein! Bei Reet weiß man nie, die ist wie ein Ninja.« Ziggy rückt ihre Brille zurecht, und Emily denkt wieder einmal, wie gut sie ohne Brille aussehen würde.
»Du bist so eine Schisserin, was deine Mom angeht!« Emily lacht und stupst Ziggy am Arm.
»Du doch ganz genauso!« Zig stupst zurück, lächelt aber auch. »Du bist doch nur deswegen gerade so mutig, weil du scharf auf Clayton bist.« Sie lässt den Namen wie einen tiefen Seufzer klingen.
»Sei still!« Emily schubst sie wieder.
»Clayton!« Ziggy sinkt zu Boden. »Oh Clayton!«
Emily schlägt nach ihr und lacht. »Pass bloß auf, sonst dreh ich dich durch die Mangel.«
»Du weißt doch gar nicht, was eine Mangel ist!« Ziggy lacht ebenfalls, und Emily stößt ihr den Ellbogen in die Seite.
»Clayton!«, ruft Ziggy, während sie sich auf dem Boden herumwälzt. »Oh Clayton!«
Lachend ringt Emily mit ihr, nicht sehr erfolgreich.
Sie ist so glücklich. Sie weiß, weiß es einfach, dass er sie küssen wird.
3 PHOENIX
Phoenix schleppt sich die verschneiten Türstufen hoch und reißt die Vortür auf. Sie wusste, dass sie nicht abgeschlossen sein würde, aber während der letzten paar Schritte hat sie plötzlich gedacht, vielleicht ist sie ja doch zu, ausnahmsweise. Das wär doch typisch, oder? Aber nein, die Tür ist offen, und sie kann ins Warme stolpern. Ein Scheißglück.
Im Haus ihres Onkels riecht es nach Zigaretten, Dope und altem Essen, aber das ist voll okay. Und warm ist es. Phoenix streckt die Hände aus den Ärmeln ihrer Jacke und reibt sie aneinander, bläst darauf, damit das Gefühl wiederkommt. Die Hände sind rot und wund, aber sie reibt trotzdem weiter.
Ein mageres Mädchen hängt komabesoffen auf der Couch, ein anderes im Armsessel. Sie sehen aus, als wären sie mitten im Reden umgekippt und keiner hätte sich die Mühe gemacht, sie zuzudecken. Die eine schnarcht leise, das Gesicht an ihrem nackten Arm, auf dem Einstichspuren und ein grausiges Rosentattoo zu sehen sind, über die jetzt ihr Sabber rinnt. Phoenix riecht den Alk, diesen Tag-danach-Gestank. Fuck. Sie sehen ziemlich tough aus. Die meisten Leute sehen so friedlich aus, wenn sie schlafen, aber diese Mädchen wirken einfach nur ein bisschen weniger abgefuckt.
Sonst ist niemand zu sehen. Das ganze Haus scheint zu schlafen. Aus dem Zimmer ihres Onkels hört Phoenix leise Musik, er ist also da. Er kann ohne Musik nicht einschlafen, meistens sind es die alten Rock-Sachen: Aerosmith, AC/DC. Klassiker, sagt er und zieht jedem eins über, der zu sagen wagt, dass doch kein Mensch mehr diesen Scheiß hört. Phoenix hat diese Musik immer gefallen. Sie muss dabei an ihn denken, wie er früher war, als sie noch klein und er ein anständiger Kerl war, bevor all diese anderen Leute anfingen, mit ihm abzuhängen, und er hart werden musste.
Sie ist so verdammt froh, hier zu sein.
Auf ihren pochenden Füßen humpelt sie in die versiffte Küche, sinkt auf den erstbesten Stuhl und lässt ihre Tasche auf den Boden fallen. Ihre Ohren brennen. Ihr Gesicht taut langsam auf, ein beißender Schmerz auf ihren breiten Wangen. Sie zieht ihre abgenutzten Joggingschuhe aus und reibt sich die Zehen. Sie prickeln schmerzhaft, so wie wenn sie eingeschlafen sind und wieder aufwachen. Sie hat schon vor Stunden das Gefühl darin verloren, es waren nur noch zwei Klumpen an ihren Beinen. So hat sie sich stundenlag durchs North End geschleppt. Sie legt die Füße auf einen anderen Stuhl. Sie schmerzen und zucken, und sie versucht sie nicht zu bewegen.
Der Tisch ist voller Take-away-Verpackungen, überquellenden Aschenbechern, Flaschen und leeren Bierkartons. Sie wühlt in den Kippen herum und findet eine, die noch relativ lang ist. Fünf Feuerzeuge sind über den Tisch verteilt, aber nur eins funktioniert. Sie inhaliert hastig. Ihr Kopf dröhnt und wird dann ganz leicht. Es ist ewig her, dass sie mal in Ruhe eine geraucht hat. Sie lehnt sich zurück, lässt den Blick schweifen, versucht, warme Gedanke zu denken.
Die Küche ist ein einziger Saustall. Berge von Abfall auf der Arbeitsfläche, zerbrochene Gläser, klebrig vom Alk. Auf dem kaputten Linoleum trocknet eine dunkle Pfütze an, und auf dem Herd schimmelt irgendwas vor sich hin. Genau, denkt sie, sie wird hier mal richtig sauber machen, bevor ihr Onkel aufsteht. Er mag es, wenn sie solche Mädchendinge tut.
In letzter Zeit fühlt sie sich öfter so nett. Wahrscheinlich, denkt sie, weil sie so viel allein war. Im Centre war es meistens total still. Die anderen Kids dort waren Durchgeknallte oder so verfickte Selbstmördertypen. Bitches wie sie kommen nur selten ins Centre. Die meisten Leute, die sie kennt, landen im Jugendknast. Da war sie auch schon mal, es ist härter, aber in der Mädchenabteilung ist alles einfacher. Das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, dass irgend so ’ne Scheißtusse versucht, einem eine runterzuhauen oder einen zu kratzen. Phoenix ist gut beieinander. Sie hat nie Probleme damit gehabt, sich durchzusetzen, meistens packt sie die andere einfach bei den Handgelenken und fixiert sie. Sie schlägt mit der geballten Faust zu. Es ist easy. Bei den Kerls ist es anders, die sind stark und müssen wirklich kämpfen, müssen befürchten, dass sie mit dem Messer angegriffen oder überfallen werden oder irgend so ’n Scheiß. Die Mädels versuchen einen psychisch fertigzumachen, oder sie schlagen um sich, als wären sie verrückt und könnten einen mit diesem lächerlichen Herumgefuchtel umbringen. Im Vergleich zum Jugendknast ging es im Centre zu wie in einem Planschbecken, das war einfach eine Truppe gestörter Kids mit zu viel Zeit, mit Depressionen und allem Drum und Dran. So jämmerlich wie die hat Phoenix nie dagestanden.
Aber sie hat öfter an ihren Onkel gedacht und daran, wie sehr sie ihn bewundert. »Denkt an jemanden, den ihr bewundert«, hatte die Betreuerin der Gruppe bei einem dieser verfickten therapeutischen Händchenhalten gesagt. Also hatte sie an ihn gedacht, Alex heißt er, Alexander, wie sein Dad, aber so nennt ihn jetzt keiner mehr. Die meisten Leute wissen nicht einmal, dass er so heißt, aber Phoenix weiß es, schließlich sind sie verwandt. Vor anderen Leuten nennt sie ihn Bishop, aber im Geist ist er für sie immer noch Alex.
Auch an Clayton denkt sie, aber bewundern ist nicht das richtige Wort für das, was sie ihm gegenüber empfindet.
Als ihre Füße sich fast wieder normal anfühlen, zwar noch pochen wie ein Herz, aber nicht mehr taub sind, geht sie an den Kühlschrank und schaut, was drin ist. Trotz all der herumliegenden Take-away-Verpackungen ist nicht mal ein vertrocknetes Stück Pizza übrig. Sie findet eine alte Packung chinesische Nudeln im Küchenschrank und sucht sich einen Topf, den sie sauber machen kann, um darin Wasser zu kochen. Während das Wasser heiß wird, stopft sie den ganzen Müll in alte Tüten, wischt mit einem nur mäßig widerlichen alten Geschirrtuch die Arbeitsflächen ab. Sie fischt noch ein paar längere Kippen aus den Aschenbechern und wischt auch die aus. Als sie sich schließlich hinsetzt, um ihre Nudeln zu essen, ist sogar der Tisch sauber. Sie isst die Nudeln pur, will das fiese Shrimp-Aroma-Pulver nicht dazugeben. So was Gutes hat sie seit Monaten nicht mehr gegessen.
Eins der Mädchen im Wohnzimmer streckt sich und stöhnt, und im Zimmer ihres Onkels regt sich etwas. Sie hört jemanden reden. Er ist nicht allein. Draußen vor dem Fenster verändert sich das Licht, es wird dunkler. Es ist später Nachmittag, Phoenix ist den ganzen Tag da draußen durch die Kälte gelaufen.
Sie hat das Centre verlassen, bevor irgendjemand auf war. Es ist die beste Zeit, um sich aus dem Staub zu machen. Die Wärter dort nennen sich »Mentoren«, aber es sind trotzdem verdammte Wärter, und morgens um sechs, wenn sonst noch keiner wach ist, haben sie Schichtwechsel. Da kontrollieren sie auch die Betten, und danach vergeht noch ungefähr eine Stunde, bevor die anderen Angestellten kommen. Phoenix hat das alles schon gleich am Anfang ihres Aufenthalts rausgekriegt und gleich gewusst, dass das die beste Zeit sein würde, um zu verschwinden. Und der beste Tag war Freitag, weil da meistens Henry Dienst hatte. Henry war ein fauler alter Sack, dem alles egal war. Um 6.30 Uhr war er meistens schon im Gemeinschaftsraum eingepennt. Es war ein guter Plan. Sie packte am Abend davor ihre Tasche und ließ ihre Kleider an. Bei der Bettkontrolle hatte sie die Decke bis zum Kinn hochgezogen und guckte schläfrig drein. Dann wartete sie hinter der Tür, bis ihre »Mentorin« fertig berichtet hatte, was am vergangenen Abend und in der Nacht alles Sinnloses passiert war, und sich endlich verpisste. Sie stellte sich vor, wie Henry nickte, als ginge ihm das alles am Arsch vorbei, und nur eins wollte, nämlich so schnell wie möglich weiterschlafen. Was er dann auch tat, um 6.45 Uhr war er fest am Schnarchen, und Phoenix schlüpfte aus der Eingangstür, als wäre es ein ganz normaler Tag und sie ein ganz normaler Mensch. Im Centre wurde nicht abgeschlossen, die taten dort gern so, als würden sie den Kids vertrauen. Die Tür piepte, was bedeutete, dass der Pager an Henrys Hüfte vibrierte, aber er schlief fest, und auch wenn es anderen Leuten vielleicht nicht egal gewesen wäre, war von denen keiner nah genug, um es zu bemerken.
Es war ein guter Plan.
Aber draußen war Februar, sie hatte kein Telefon und kein Geld, und sie war irgendwo am gottverdammten südlichen Rand von St. Vital. Sie versuchte sich zu erinnern, wo es langging, aber zugleich wollte sie sich von den großen Straßen fernhalten, falls die im Centre zu schnell bemerkten, dass sie abgehauen war. Sie irrte den ganzen Vormittag durch die gewundenen Straßen. Bei all den Kurven und Biegungen hätte man meinen können, die seien dazu gedacht, einen zu verwirren. All die weißen Yuppies kamen aus ihren Häusern, stiegen in ihre Autos und starrten sie ein bisschen zu lang und finster an, sie in ihrer dünnen Armeejacke, aber niemand fragte sie etwas oder hielt an. Sie bog immer wieder ab, nur für den Fall, dass jemand die Polizei rief, die in diesem Stadtviertel bestimmt nicht lang auf sich warten ließ.
Endlich stieß sie auf die St. Mary’s Road und ging in die Shopping Mall, um sich aufzuwärmen. Ihre Augen tränten, und ihre Ohren fühlten sich an, als würden sie jeden Moment abfallen. Im Ein-Dollar-Laden klaute sie eine Pudelmütze, dabei hätte sie sich besser etwas zu essen organisieren und ihren Onkel per R-Gespräch anrufen sollen, damit er sie abholte. Ja, hätte sie vielleicht sollen, aber sie wollte es allein hinkriegen, wollte bei ihm zu Hause auftauchen wie aus dem Nichts, das Ganze mit Stil durchziehen. Sie wollte ihn beeindrucken, er sollte sie abklatschen und an sich drücken wie einen seiner knallharten Freunde, wie jemand Ebenbürtigen. Sie wollte, dass er aus seinem Zimmer kam und überrascht war, freudig überrascht, sie zu sehen. Also lief sie immer weiter, durch die Innenstadt, die heruntergekommene Main Street und dann die Selkirk Avenue entlang bis auf die andere Seite der McPhillips Street. Quer durch die ganze verdammte Stadt. Sie war stolz auf sich, aber fuck, ihr tat alles weh.
Sie hört, wie ihr Onkel aufsteht und in seinem Zimmer laut redet, jemanden auffordert, endlich aufzustehen. Phoenix zündet sich noch eine Kippe an, löscht ihr Lächeln und lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück, bereit für ihn und sein erstauntes Gesicht.
»Fuck, Phoenix!«, sagt er, als er in die Küche kommt, fest in seinen Morgenmantel gewickelt, einen dunklen Knutschfleck am Hals, das Gesicht noch schläfrig. Es ist erst ein paar Monate her, dass sie ihn gesehen hat, aber er sieht älter aus, grauer im Gesicht, als hätte er zu viel geraucht. Er setzt sich ihr gegenüber und zieht eine Fluppe aus der Schachtel, die in der Tasche seines Morgenmantels steckt. Er ist nur zehn Jahre älter als sie, aber ihm fallen schon die Haare aus, seine Stirn ist höher als beim letzten Mal. Sein mageres Gesicht wirkt älter als die sechsundzwanzig Jahre, die er alt ist. Er sieht aus wie ihr Urgroßvater auf diesem Foto, das sie hat, Grandpa Mac nannte Elsie ihn. Er ist lange vor Phoenix’ Geburt gestorben, aber sie hat das Gefühl, ihn gekannt zu haben. Grandmère hatte so viele Bilder und Geschichten von ihm. Er war so ein gut aussehender, witziger Mann, sagte sie immer. Phoenix denkt sich, dass er genauso gewesen sein muss wie sein Enkel – Bishop. Alex.
»Fuck, du kannst hier nicht bleiben, Phoen. Deine Scheißbetreuerin hat schon rumtelefoniert und einen Riesenaufstand gemacht.«
»Warum hat die denn angerufen? Scheißschnüfflerin.«
»Weil du aus dem Knast abgehauen bist, Mann. Wenn die hierherkommt …« Er deutet mit der Fluppe und einem gelben Finger auf sie.
Phoenix nickt ihm zu, will lächeln, tut es aber nicht. Sie drückt ihre Kippe aus, nimmt sich eine andere.
»Fuck, Phoen, lass dieses widerliche Dreckszeug da liegen. Hier.« Er wirft ihr die Zigarettenschachtel zu.
Sie greift danach, und das Lächeln schlüpft doch heraus. Sie zündet sich eine an und nimmt einen schönen langen Zug.
»Wie bist du denn hergekommen?« Er beugt sich vor. Sein Gesicht ist faltiger geworden. Er hat ’ne Menge Sorgen, muss sich um so viel kümmern.
»Zu Fuß«, sagt sie und versucht, möglichst gleichmütig zu klingen, dabei ist sie tatsächlich verdammt stolz auf sich.
»Die ganze Strecke? Fuck!« Er lacht.
Fast hätte Phoenix wieder gelächelt, doch sie fängt sich und sagt: »Mhm«, als wäre es nicht der Rede wert, und nimmt noch einen langen Zug. Dann überlegt sie kurz und fragt: »Wo hat die Bitch denn angerufen?«
»Bei Ang, unter meiner alten Nummer.« Es klingt gereizt.
»Fuck, und was hat die gesagt?«, erwidert Phoenix genauso gereizt, die Schultern gestrafft, als wäre sie bereit, an Ort und Stelle auf die Ex ihres Onkels loszugehen, wenn es sein müsste.
»Ang hat überhaupt nichts gesagt, aber fuck.« Er schüttelt den Kopf. »Du kannst nicht hierbleiben, Phoen. Ich hab hier zu viel laufen. Mehr Stress kann ich grad echt nicht gebrauchen.«
Sie nickt, weiß, dass Angie, die Mama seines Babys, nichts sagen wird. Er vertraut ihr. Eigentlich liebt er sie auch noch. Das weiß Phoenix. Sie weiß, dass er Angie wirklich liebt, aber sie nimmt ihn zu hart ran, wenn sie zusammenwohnen, und er hat selbst genug um die Ohren. Aber er bezahlt ihre Wohnung in der Machray Avenue, und er kauft ihrer Tochter von allem nur das Beste, Markennamen auf all ihren Kleidern. Das ist Liebe, denkt Phoenix. Dann fällt ihr wieder ein, warum sie hier ist, und sie überlegt, was sie tun soll. Vielleicht kann sie bei Roberta oder Dez unterkommen.
»Kannst du sonst irgendwo hin?«, fragt ihr Onkel, der offenbar ihre Gedanken lesen kann.
»Ja, schon okay.« Sie nickt und korrigiert ihre Miene, wie immer, wenn sie das Gefühl hat, sie wird zu weich.
»Gut, okay«, sagt er und haut auf den Tisch. »Ich muss unter die Dusche.« Er steht auf, als würde er sie damit entlassen.
»Hast du vielleicht ein Telefon, das ich benutzen könnte?«, fragt sie. Ohne ein weiteres Wort wirft er ihr ein Wegwerf-Handy zu. Er bemerkt nicht, dass sie sauber gemacht hat.
Phoenix geht in den Keller, um ihre Sachen abzustellen und zu schauen, ob sie irgendwelche Kleider findet, die sie anziehen könnte. Es ist ein alter Keller mit Steinmauern und kalten Pfützen auf dem Boden. Ihr Onkel lässt einen Luftentfeuchter laufen, damit die Feuchtigkeit nicht all das Zeug ruiniert, das er hier unten lagert.
Phoenix schmeißt ihren Kram in eine Ecke hinter ein paar noch in Kartons verpackten Fernsehern, die so groß sind, dass sie sich selbst dahinter verstecken könnte. Kleider findet sie allerdings nirgends – nur Elektronik und ein paar Plastikbehälter ohne Aufschrift. Sie gibt es auf, hier wird sie nichts von dem finden, was sie braucht.
»Wann habt ihr euch am sichersten gefühlt?«, hatte die Mentorin gestern die Gruppe gefragt. Grace hieß sie. Groß, dünn, schön – Grace war alles, was Phoenix nicht war. Und reich. Grace hatte eine glänzende Uhr, wie Phoenix sie nur aus dem Fernsehen kannte. Wäre sie eine echte Diebin, hätte sie sich das Teil geschnappt, aber sie ist superungeschickt. Während all die anderen Kids sich einen abjammerten, überlegte sie also, wie sie an diese Scheißuhr rankommen könnte. Grace arbeitete nur tagsüber, und im Gegensatz zu manchen von den anderen »Mentoren« hätte man sie niemals schlafend erwischt. Die Uhr schien ziemlich gut an ihrem Handgelenk festgemacht zu sein. Phoenix beobachtete, wie Grace ihre Hände bewegte. Wie sie die anderen Kids umarmte, ihnen sagte, es sei okay, alles werde gut. Fuck. Es war unmöglich, das Teil zu stehlen, dachte sie schließlich.
»Wann hast du dich am sichersten gefühlt?«, fragte Grace und schaute sie dabei direkt an. Alle im Raum, sämtliche Augen waren auf sie gerichtet.
Phoenix war zu wütend, als dass ihr dazu etwas eingefallen wäre. Sie starrte bloß diese schöne, dünne Scheißtusse an und saß mit hochgezogenen Schultern da, als könnte sie hier rausstürmen, wenn es nötig wäre. Sie musste gar nichts sagen, schaute Grace nur an. Und selbst die reiche, schöne Grace begriff, dass sie besser zur nächsten Teilnehmerin überging.
Die Sachen in ihrer Tasche sind immer noch kalt, obwohl sie jetzt ja schon eine Weile im Haus sind. Phoenix stellt die Tasche auf einen Karton und zieht ein Hemd heraus, das fast sauber genug ist, um es auszuschütteln und anzuziehen. Sie schaut beim Umziehen nicht auf ihren widerlich fetten Körper, schlüpft einfach bloß aus der Jacke, zieht das eine Hemd aus und das andere an. Dieses ist etwas geräumiger. In diesem verfickten Centre hat man sie gezwungen, drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Sie ist dermaßen fett geworden. Die anderen Sachen lässt sie an. Diese Baggy Jeans ist ihre beste Hose, auch wenn sie inzwischen mieft. Sie schaut an sich herunter und versucht, ihre Kleider glatt zu streichen. Sie fühlt sich wie eine Tonne, aber trotzdem besser.
Sie hat eh nur wenige Kleider, die sie mitnehmen konnte. Die und ein paar alte Bilder, mehr hatte sie nicht einzupacken. Sie schaut sich die Bilder nicht an, tastet aber nach ihnen, um sicher zu sein, dass sie da sind, ehe sie die Tasche hinter dem größten Karton verstaut. Ein paar alte Abdeckplanen und ein Flickenteppich liegen nass auf dem Boden, und sie hängt sie vorausschauend zum Trocknen über die Kartons. Vielleicht muss sie ja doch hier schlafen.
Es ist kein schlechter Plan.
Oben hat ihr Onkel seine Fluppen auf dem Tisch liegen lassen. Phoenix lächelt – wenn keiner hinguckt, ist er echt ein anständiger Kerl. In ihrer Kindheit war er so ein guter Junge, so gut zu ihr. Er ging mit ihr im St. John’s Park Rad fahren, setzte sie auf den Lenker und fuhr dann ganz vorsichtig, hatte die Hände auf den Griffen und hielt sie zugleich mit den Armen fest, denn sie war klein und echt ungeschickt. Damals, bevor ihre kleinste Schwester Sparrow auf die Welt gekommen war, als er noch Alex war, da hatten sie alle zusammen in dem braunen Haus auf der anderen Seite des Flusses gewohnt, mit der alten Grandmère, Alex’ Eltern und Cedar-Sage, ihrer anderen Schwester, die damals noch ein kleines Kind und immer fröhlich war. Selbst ihre Mom, Elsie, war die meiste Zeit da gewesen. Es hatte Phoenix am Hintern wehgetan, so auf dem Lenker zu sitzen, besonders wenn sie über die alten Holzbretter der Brücke fuhren, die ungleichmäßig und voller Huckel waren, aber sie sagte nie auch nur ein Wort, sie hielt sich einfach fest, und Alex hielt sie auch fest.
Phoenix ruft zuerst bei Roberta zu Hause an, aber das Telefon ist außer Betrieb. Als Nächstes versucht sie es bei Dez, und die geht natürlich nach dem zweiten Klingeln ran.
»Fuck, Dez, wie geht’s denn so?«, fragt sie mit einem harten Lachen und nimmt noch einen langen Zug.
»Phoen?« Sie hört jemanden im Hintergrund, ein Lachen.
»Ja, ich bin’s. Wie geht’s?« Sie drückt ihre Fluppe aus und ist plötzlich nervös. Es ist ein halbes Jahr her, dass sie ihre Mädels gesehen hat. Sie ruft sie immer noch an, aber sie hat schon nach dem ersten Monat im Centre ihren Internet-Anspruch verloren. Sie ist nicht mehr auf dem Laufenden. »Was läuft?«
»Nichts. Abhängen.« Dez’ Stimme klingt komisch, fern. »Was machst du denn? Wem sein Telefon ist das?« Im Hintergrund sagt jemand etwas, was Phoenix nicht versteht.
»Eins von Bishop.« Sie versucht verächtlich zu klingen, tough. »Ship hat mir eins von seinen Wegwerfhandys gegeben.«
»Das heißt, du bist draußen?« Dez hat sich noch nie durch Intelligenz oder Klasse ausgezeichnet.
»Ja.« Diesmal gelingt Phoenix der verächtliche Ton besser. »Ist das Robbie?«
»Ja, und Cheyenne. Bleibst du dann dort?« Dez klingt immer noch komisch, vielleicht einfach nüchtern.
»Vielleicht. Weiß noch nicht.« Phoenix überlegt. »Kommt rüber. Ich brauch Gras.« Es klingt wie der Befehl, der es ist.
»Okay.« Dez zieht das Wort wie Kaugummi und hört auf, Fragen zu stellen. Endlich.
»Hey, hast du Clayton in letzter Zeit mal gesehen?« Phoenix wirft die Frage flüchtig hin, als bedeuteten die Wörter gar nichts.
»Ja, eigentlich täglich. Warum?« Dez’ Stimme klingt unbeschwert.
»Nur so. Sag ihm doch Bescheid, dass er auch kommen soll.« Phoenix schaut an ihrem fetten Körper hinunter und zieht den Bauch ein, obwohl ihn keiner sehen kann.
»Der ist wahrscheinlich eh da. Ist er meistens.«
»Warum denn das?«
»Ach, der verkauft seit ’ner Weile Gras für Ship.« Dez sagt das, als wäre es belanglos. Als sollte Phoenix das eigentlich wissen.
Aber ihr hat das keiner gesagt. Es tut ein bisschen weh zu erfahren, dass ihr das keiner gesagt hat. Sie hat Clayton seit ein paar Monaten nicht mehr erwischt, vielleicht ist es also wirklich neu. Sie hört ihren Onkel aus der Dusche kommen und denkt, dass sie ihn später fragen wird. Er redet normalerweise nicht über seine Geschäfte, aber vielleicht sagt er ihr ja, was Sache ist.