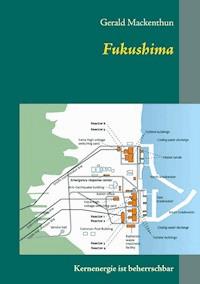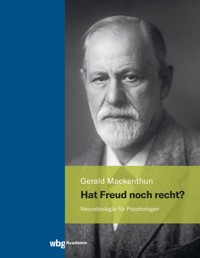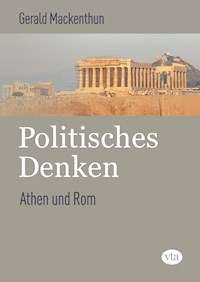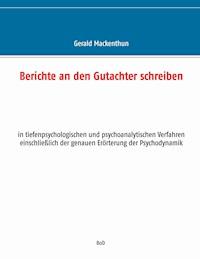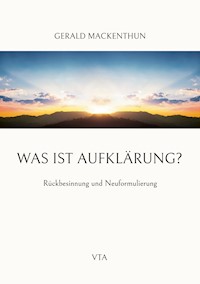
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vta-Verlag
- Sprache: Deutsch
1784 beantwortete der Philosoph Immanuel Kant in einem berühmten Aufsatz die Frage: Was ist Aufklärung? Seine viel zitierte Antwort: Der aufgeklärte Mensch denkt selber. Aber kann es wirklich nur darum gehen? In fünf Kapiteln wird Kants Aufsatz vorgestellt, die Begriffe "Vernunft" und "Verstand" diskutiert, die Kritik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno zurückgewiesen, eine neue Definition von Aufklärung formuliert und über Aufklärung heute nachgedacht. Wir leben in einem aufgeklärten Zeitalter. Niemand glaubt ernsthaft mehr an Hexen, Werwölfe und Blutwunder. Wir benutzen Smartphones und sind an demokratische Verhältnisse gewöhnt. Trotzdem wird die Rationalität der Aufklärung gern in Zweifel gezogen: Hat sie nicht zur Atombombe geführt? Richtig, aber auch zu Antibiotika und sauberem Trinkwasser. Wer möchte darauf verzichten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
1784 beantwortete der Philosoph Immanuel Kant in einem berühmten Aufsatz die Frage: Was ist Aufklärung? Seine viel zitierte Antwort: Der aufgeklärte Mensch denkt selber. Aber kann es wirklich nur darum gehen? In fünf Kapiteln wird Kants Aufsatz vorgestellt, die Begriffe „Vernunft“ und „Verstand“ diskutiert, die Kritik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno zurückgewiesen, eine neue Definition von Aufklärung formuliert und über Aufklärung heute nachgedacht.
Wir leben in einem aufgeklärten Zeitalter. Niemand glaubt ernsthaft mehr an Hexen, Werwölfe und Blutwunder. Wir benutzen Smartphones und sind an demokratische Verhältnisse gewöhnt. Trotzdem wird die Rationalität der Aufklärung gern in Zweifel gezogen: Hat sie nicht zur Atombombe geführt? Richtig, aber auch zu Antibiotika und sauberem Trinkwasser. Wer möchte darauf verzichten?
„Es wird den Menschen insgesamt besser gehen. Wir werden riesige Fortschritte im Kampf gegen Krebs sehen, die Kindersterblichkeit wird niedriger sein und die Menschen werden länger leben.“
Bill Gates, Microsoft-Gründer und Philanthrop, 2023
Inhalt
Vorwort
1 Kant und Mendelssohn
Kants Aufsatz
Mendelssohn über Aufklärung
Diskussion
2 Geschichtlicher Rückblick
Der erste Skandal der Aufklärung: Jean-Jacques Rousseau
Das Zeitalter der Aufklärung
Vernunft und Verstand
Die Rolle der Naturwissenschaften
Aufklärung in der Defensive
3 Horkheimer und Adorno: Dialektik der Aufklärung
Die Persönlichkeit des Aufgeklärten
4 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
5 Nachwort
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Kürzlich fiel mir wieder einmal Immanuel Kants kleine Schrift „Was ist Aufklärung?" aus dem Jahr 1784 in die Hände, in der er behauptet, dass derjenige unmündig sei, der nicht ohne Anleitung eines anderen denken könne. Ich erinnerte mich an die vielen Menschen, die mich unterrichtet und gelehrt haben: meine Eltern, Dutzende von Lehrern, Dozenten und andere Menschen, denen ich begegnet bin, mit denen ich gesprochen und von denen ich gelernt habe. Meiner Frau erinnerte an die vielen Menschen, die uns im Alltag helfen: die Friseure, Bäcker, U-Bahn-Fahrer und Automechaniker, ohne die wir nicht über die Runden kämen.
Ich hatte den Eindruck, dass Kant das „Selberdenken“ überschätzte, und machte mich daran, die Frage: Was ist Aufklärung? neu zu überdenken. Das Ergebnis ist dieser Text. Sein Herzstück ist das 4. Kapitel mit dem Titel „Antwort auf die Frage: Was ist Aufklärung?“ Darin versuche ich, den großen Prozess der Aufklärung in zeitgemäßer Weise zu beschreiben.
Im ersten Teil werden die Texte von Immanuel Kant und einem zweiten bedeutenden Aufklärer, Moses Mendelssohn, vorgestellt und inhaltlich diskutiert. Teil 2 gibt in Auszügen einen historischen Rückblick auf die Geschichte der Aufklärung, ihre beiden zentralen Begriffe „Vernunft“ und „Verstand“ und die Rolle der Naturwissenschaften für den raschen Fortschritt der Aufklärung. Die Aufklärung hatte auch Feinde und Kritiker. Teil 3 beschäftigt sich mit ihnen, insbesondere mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die in ihrer Dialektik der Aufklärung die Aufklärung für gescheitert erklärten. Davon bin ich keineswegs überzeugt, im Gegenteil, die Idee der Aufklärung blüht und gedeiht. Aber sie ist nicht selbstverständlich. Deshalb formuliere ich die Anforderungen, die eine aufgeklärte Haltung an den Einzelnen stellt. In Teil 4 komme ich zum Kern meines Essays, der Neubeantwortung der Frage: Was ist Aufklärung. In einem Nachwort (Teil 5) werde ich über den heutigen Stand der Aufklärung nachdenken.
Berlin, März 2023
Gerald Mackenthun
1 Kant und Mendelssohn
Kants Aufsatz
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? So lautet der Titel eines kurzen Essays des berühmten deutschen Philosophen Immanuel Kant aus dem Jahre 1784. Der Text erschien in der Dezember-Nummer der Berlinischen Monatsschrift. Bereits im ersten Absatz formulierte er seine bis heute klassische Definition der Aufklärung:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
Dieser Aufsatz hat eine Vorgeschichte. Ein gutes Jahr zuvor, im September 1783, war in der Berlinischen Monatsschrift ein Aufsatz mit dem Titel Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung der Ehen zu bemühen erschienen. Autor war der Mitherausgeber der Zeitschrift, Johann E. Biester. Darauf reagierte der Berliner Pfarrer Johann F. Zöllner in der Dezemberausgabe mit dem Aufsatz Ist es rathsam, das Ehebündniß nicht ferner durch die Religion zu sanciren? In einer Fußnote stellte er die provozierende Frage: „Was ist Aufklärung?“ Damit wurde die so genannte Aufklärungsdebatte eröffnet, die sich als äußerst folgenreich und fruchtbar für die Geschichte der Philosophie, besonders in Preußen, erwies.
Noch bevor Kant antwortete, hatte bereits der Berliner Philosoph und Humanist Moses Mendelssohn als Antwort auf die Frage des Pfarrers einen Aufsatz mit dem Titel Ueber die Frage: was heißt aufklären? reagiert. Das war in der Septemberausgabe der Berlinischen Monatsschrift von 1784. Drei Monate später erschien in der Dezemberausgabe der Aufsatz von Immanuel Kant Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Kant schrieb seinen Aufsatz, wie er selbst betonte, ohne den Mendelssohnschen zu kennen.
„Sapere aude!“ rief Kant seinen Lesern zu. Das bedeutet in etwa: „Wage es, zu wissen!“ oder, wie Kant auch sagte: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“. Später gab Kant an anderer Stelle eine weitere, einfache Definition der Aufklärung: „Die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist Aufklärung.“ (Kant, 1786)
Anlass war, wie gesagt, der Vorschlag, bei der Trauung auf einen Geistlichen zu verzichten. Das war damals gewagt. Es berührte einen Kernpunkt der Aufklärung, nämlich die Zurückdrängung des kirchlichen Einflusses auf die Gesellschaft, letztlich die Trennung von Staat und Kirche.
Kant arbeitet in seinem kurzen Aufsatz „Was ist Aufklärung?" mit dem Gegensatz von „Nichtdenkern" und „Selbstdenkern". Mit den unmündigen Nichtdenkern geht er hart ins Gericht. Nicht selbst denken zu wollen, sei Faulheit und Feigheit. Er nennt drei Beispiele: Wer ein Buch hat, hat den Verstand des Autors; wer einen Seelsorger hat, braucht kein Gewissen; wer einen Arzt hat, braucht seine Diät nicht selbst zu beurteilen. Mit einem Wort: Wer bezahlen kann, braucht sich nicht zu bemühen. Die Folgen sind gravierend. Diese Menschen geraten in die Fänge von Vormündern oder von Menschen, die sich wegen der leichten Beeinflussbarkeit der Nichtselbstdenkenden zu deren Vormündern aufschwingen, nur um sie um so nachdrücklicher davon abzuhalten, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Kant vergleicht hier die Unaufgeklärten drastisch mit „Hausvieh“, das man dumm gemacht habe. Derart in Gewohnheiten getrieben, sei es für jeden Einzelnen schwer, sich aus eigener Kraft aus der Unmündigkeit zu befreien – zum einen, weil man sie „liebgewonnen“ habe, weil sie bequem sei, zum anderen, weil man inzwischen zumeist wirklich unfähig geworden sei, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
Diese pessimistischen Ausführungen beziehen sich auf die Einzelperson. Für das breite „Publikum“ sah Kant bessere Chancen, „wenn man ihm nur Freiheit lässt“. Aber auch das Publikum, die Öffentlichkeit, unterliege überall Einschränkungen. „Daher kann das Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen.“ Freiheit aber bedeute, „von seiner Vernunft in allen Stükken öffentlichen Gebrauch zu machen.“ Das betrifft, Kant sagt es deutlich, den „Gelehrten“, der von seinem Verstande „vor dem ganzen Publikum der Leserwelt“ Gebrauch macht. „Öffentlichkeit“ ist für Kant die größere Bühne, der „Privatgebrauch“ steht den kleineren Amtsträgern zu. Aber manchmal sei es notwendig, dass die Amtsträger gehorchen und mit dem „räsonniren“ aufhören, wenn nämlich staatliche Belange auf dem Spiel stehen. Kant legt dem Monarchen die Worte in den Mund, „räsonnirt so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht!“ Er bringt ein Beispiel: Ein Offizier, dem ein Befehl erteilt wurde, darf nicht „im Dienste über Zweckmäßigkeit oder Nützlichkeit dieses Befehls laut vernünfteln ..., er muß gehorchen. Es kann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden, als Gelehrter, über Fehler im Kriegsdienste Anmerkungen zu machen.“ Bürger wiederum können sich nicht weigern, staatlich festgesetzte Leistungen zu erbringen, aber sie können, „als Gelehrte“, über Sinn und Unsinn solcher Maßnahmen öffentlich Gedanken äußern. Dieser Unterschied gelte sogar für Geistliche. Er habe „volle Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle seine sorgfältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über das Fehlerhafte in jenem Symbol [dem Ritus der Kirche], und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religions- und Kirchenwesens, dem Publikum mitzutheilen.“ Wenn der Priester seinen Dienst aber nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann, müsse er sein Amt niederlegen. Insofern ist der Priester nicht völlig frei. Aber als „Gelehrter“, in seinen Schriften fürs Publikum, dürfe er in allen Stücken von seiner Vernunft Gebrauch machen.