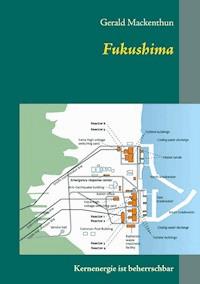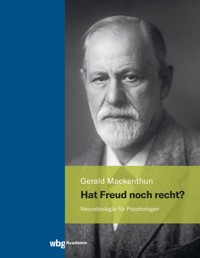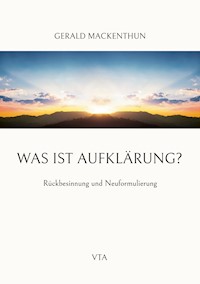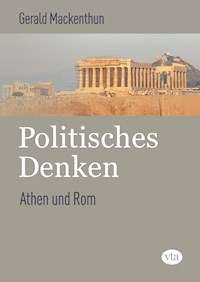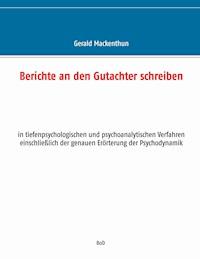Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 2020 war außergewöhnlich. Die Welt wurde von einem neuartigen Coronavirus mit dem Namen Sars-CoV-2 heimgesucht. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren waren wie früher schon die fast einzigen Möglichkeiten, die Verbreitung einzudämmen und das Risiko der Erkrankung zu minimieren. Corona war dennoch nicht durchgängig tonangebend. Deutschland leistete sich zeitgleich einige bizarre Auseinandersetzungen über angeblich "strukturellen Rassismus", über Diversität, über vermeintlich ungerechte Ungleichheit, über unrealistische Gerechtigkeitsforderungen. Wir erlebten fortgesetzte Versuche, eine mutmaßlich gendergerechte Sprach- und Schreibweise ebenso wie Fake News durchzudrücken sowie "den Kapitalismus" und die soziale Marktwirtschaft zu diskreditieren. Trat die Klimadebatte zunächst in den Hintergrund, wurde sie in der zweiten Jahreshälfte erneut aufgegriffen. Alte Ideen von Verzicht und Askese wurden ausgegraben. Neue Ideen waren kaum auszumachen. Sachlich fundiert, ist das Tagebuch gleichzeitig ein persönliches Zeitdokument von Februar bis Mitte November 2020. Herausgekommen ist ein einzigartiges Buch, meinungsstark, liberal und einem rationalen und humanistischen Denken verpflichtet. Das Tagebuch endet mit der Aussicht auf einen Impfstoff und die Abwahl des irrlichternden US-Präsidenten Donald Trump. So ergibt das Tagebuch ein faszinierendes Panoptikum an Ideen und Streitgesprächen, die uns im Jahr 2020, als Corona das öffentliche Leben lahmlegte, beschäftigte. Erinnert wird dabei an den Londoner Beamten Samuel Pepys, der vor 360 Jahren, 1660, sein geheimes Tagebuch begann, das er fast neun Jahre lang führte, auch während der Pest im Jahre 1665. Was wird die Leser in 360 Jahren an diesem hier vorgelegten Tagebuch interessieren? Trotz Sars-CoV-2: Die Menschheit wird im Wesentlichen weitermachen wie bisher. Der Autor mahnt: Wir sollten schätzen, was wir an Menschenwürde, Humanismus und Wohlstand haben, denn wir können es leicht verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tagebuch des Corona-Jahres 2020
TitelseiteEinleitungFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberPostskriptumÜber den AutorWeitere Bücher vom AutorImpressumGerald Mackenthun
Tagebuch des Corona-Jahres 2020
Geschrieben für Leser des Jahres 2380
vta-Verlag Berlin
MOTTO
Es gibt an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten.
Albert Camus in „Die Pest“
Inhalt
Einleitung 9
Februar 22
März 54
April 83
Mai 128
Juni 177
Juli 228
August 282
September 309
Oktober 344
November 383
Postskriptum 397
Über den Autor
Weitere Bücher vom Autor
Einleitung
Um die Jahreswende 2019/2020 erreichten Meldungen Europa, dass ein grippeähnliches Virus von der chinesischen Großstadt Wuhan aus sich durch Flugreisende in der ganzen Welt verbreite. Nach einigen Tages des Vertuschens und Zögerns wurde die Stadt von den Behörden abgeriegelt; nur in dringenden Fällen durfte sie betreten oder verlassen werden. Doch es war zu spät. Wo immer das SARS-CoV-2 genannte Virus auftauchte, wurde das öffentliche Leben heruntergefahren, wurden Ausgangssperren verhängt, die Schulen, Universitäten, Museen, Theater und viele Geschäfte geschlossen, die Grenzen dichtgemacht, der Flugverkehr eingestellt und private Feiern ebenso wie Versammlungen unter freiem Himmel verboten. Fast alle Regierungen der Welt verordneten ähnliche Maßnahme, nur einige Diktatoren und Autokraten leugneten die Gefahr. In Deutschland sollte spätestens mit der Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2020 der Ernst der Lage allen klar geworden sein. Die mit einer SARS-CoV-2-Infektion einhergehende Erkrankung wurde Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) genannt. Die weltweite Corona-Pandemie bzw. Corona-Krise war da.
Das Buch der Stunde war Albert Camus’ RomanDie Pest aus dem Jahre 1947. Camus schildert den Verlauf der Pestseuche in der fiktiven Stadt Oran an der algerischen Küste aus Sicht der Hauptfigur des Arztes Bernard Rieux. Einige tote Ratten und ein paar harmlose Fälle einer rasch zum Tode führenden Erkrankung sind die Anfänge einer schrecklichen Pestepidemie, welche die Stadt in den Ausnahmezustand versetzt, sie von der Außenwelt abschneidet und tausende Todesopfer fordert. Die handelnden Personen nehmen den schier ausweglosen Kampf gegen den Schwarzen Tod auf jeweils eigene Weise auf.
Das BuchDie Pest ist Teil der Philosophie von Camus, welche um „das Absurde“ kreist, eine existenzielle Gegebenheit. Das Absurde ist steter Begleiter des Menschen. So auch in Die Pest. Der Tod ist absurd, er kennt keine Begründungen und Argumente. Er trifft Kinder ebenso wie Erwachsene, gute Menschen gleichermaßen wie Verbrecher, Vorsichtige genauso wie Lässige, Egoistische wie Solidarische. Viele Menschen, die im Frühjahr 2020 diesen offensichtlich wieder aktuell gewordenen Roman lasen, fühlten sich angesprochen.
Eine Lehre des Buchs lautet1, „dass … die unheimliche Bedrohtheit unaufhebbar zum Wesen des Lebens gehört“. „Der Alte hatte recht“, heißt es im letzten Absatz der Pest, „die Menschen blieben sich immer gleich. Aber das war ihre Kraft und ihre Unschuld“. Der Arzt Rieux, dem der Bericht über die Pest in der Stadt Oran zugeschrieben wird, „wollte schlicht schildern, was man in den Heimsuchungen lernen kann, nämlich dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt.“ Der Leser nimmt die Gewissheit mit, dass Mut, Willenskraft und Nächstenliebe auch ein scheinbar unabwendbares Schicksal meistern können.
In dem Buch verschwindet die Pest, wie sie gekommen ist. Die Absperrungen werden aufgehoben und die Beschränkungen fallen fort. Die befreite Einwohnerschaft verbrüdert sich in einem Freudenfest, und das alte Leben fängt wieder an. Der Arzt Rieux steht abseits und weiß, dass diese Fröhlichkeit immer bedroht ist. Er weiß, dass der Bazillus niemals stirbt noch verschwindet. Die traumatische Erfahrung kollektiver Verwundbarkeit gehört zur Menschheitsgeschichte.
Die Medien erinnerten an weitere klassische Werke und Berichte über Pandemien. Im Alten Testament gibt es die Passage, in der Ägypten mit zehn Plagen überzogen wird, weil der Pharao Moses und die Juden nicht auswandern lassen wollte. Moses verständigte sich mit seinem Gott JHWH, dass dieser nach jeder Weigerung Ägyptens eine weitere Plage schicken wird, darunter schwarze Blattern (Geschwüre) und eine Viehpest. Die fantastische Vielfalt desDecamerone (um 1350), der Novellensammlung von Giovanni Buccaccio, war aus der Not der Absonderung geboren. Die zehn jungen Erzähler flohen vor der Pest aus Florenz in die Hügel von Fiesole, wo sie sich gegenseitig zehn mal zehn Geschichten erzählten.
Die Cholera, die Paris im Frühjahr 1832 heimsuchte, war von Russland nach Europa getragen worden. In Paris fielen ihr im Jahre 1832 etwa 20.000 Menschen zum Opfer. Der aus Deutschland stammende politische Schriftsteller Heinrich Heine, der sich zu der Zeit in Paris aufhielt und die Stadt bewusst nicht verließ, ging von 35.000 Toten aus. Sobald es die ersten Toten gab, verließen die Lebenden, die es sich leisten konnten, die Stadt. Heine blieb, weil er einen kranken Freund pflegen wollte und weil er bei der allgemeinen Panik als Journalist interessante Geschichten für seine Leser in Deutschland erwartete.
Auch wenn die Cholera als bakterielle Infektionskrankheit, die vorrangig auf verunreinigtes Trinkwasser zurückgeht, unter medizinischen Gesichtspunkten nicht mit dem Corona-Virus vergleichbar ist, sind Heines Beobachtungen von vor 188 Jahren in großem Umfange auf die heutige Zeit übertragbar. Der anfänglichen Sorglosigkeit folgt Verwirrung, die Gesichter werden ernster, die Plätze und Straßen leerer, man zweifelt an den Erkrankten- und Todeszahlen, man misstraut den Quellen. Schon zu Heines Zeiten ging die Pandemie mit der Verbreitung von Fake News einher. „Was sich heute vor allem in den Sozialen Medien zusammenbraut, wurde in Paris des Jahres 1832 per Mundpropaganda verbreitet“, schreibt Tim Jung in seinem Vorwort zu Heines insgesamt nur kurzem Bericht, der den TitelIch rede von der Cholera trägt. „So machte das Gerücht die Runde, dass das Volk gezielt vergiftet würde; in der Folge wurden zwei Menschen auf offener Straße ermordet, die ein weißes Pulver mit sich führten – wie sich herausstellte, nachdem die Unschuldigen bereits vom Mob zu Tode geprügelt worden waren.“
Der wenig bekannte Schweizer Pfarrer Jeremias Gotthelf schriebDie schwarze Spinne (1842), eine gruselige Geschichte, die ich als Kind im Schulunterricht zu lesen hatte. Die schwarze Spinne wird in einem Loch in einem Bettpfosten mit einem Propfen eingeschlossen und kann jederzeit wieder ausbrechen. Und Thomas Mann beschrieb 1911 in der Novelle Der Tod in Venedig den Tod eines berühmten Schriftstellers in einer Cholera-Epidemie in Venedig. Die Behörden verschweigen den Ausbruch der Krankheit. Aber selbst, als er über die Gefahr informiert ist, verlässt er die Stadt nicht, weil er sich in einen schönen Knaben verliebt hat. Der Schriftsteller stirbt an der Cholera, während er aus seinen Liegestuhl am Strand ein letztes Mal den jungen Mann beobachtet.
Schon zweimal in der Neuzeit haben Corona-Viren die Welt gelähmt – die Russische Grippe von 1889 bis 1895 und die Spanische Grippe von 1918 bis 1921. Die Russische Grippe war die erste globale Pandemie, von der man einigermaßen zuverlässig weiß. Diese war mit bis zu einer Million Opfern weltweit die bis dahin schwerste Virus-Epidemie, übertroffen erst durch die Spanische Grippe, die ab 1918 weltweit über 25 Millionen Opfer forderte. Insgesamt sollen ab 1918 global etwa 500 Millionen Menschen infiziert worden sein, was eine Letalität von 5 bis 10 Prozent ergibt, die damit deutlich höher lag als bei Erkrankungen durch andere Influenza-Erreger.
Die Strukturähnlichkeiten traumatischer Pandemie-Erfahrungen in der Geschichte können indessen nicht die großen Unterschiede zwischen damals und heute einebnen. Im Mittelalter war die Nähe zwischen Magie, Medizin und Scharlatanerie groß. Heute fällt es selbst in der katholischen Kirche nur noch wenigen ein – dem Churer Bischof Marian Eleganti zum Beispiel –, die Corona-Krise als Strafe Gottes anzusehen.
Was offenbar unvermeidlich dazugehört, ist die Versuchung, einen Sündenbock zu finden, der die Seuche angeschleppt hat. Im Mittelalter galten Fremde, Prostituierte, Juden und die Armen als Kandidaten. Heute bezichtigen Amerika und China einander, für die Corona-Pandemie verantwortlich zu sein. Man muss wohl skeptisch bleiben gegenüber der romantischen Vorstellung dieser Tage, die Pandemie löse vor allem eine Welle der Solidarität aus. Sie löst mindestens gleichzeitig auch Egoismus, Nationalismus und Wellen des Autoritarismus aus. Einige meinen, die Globalisierung mit ihrem stetig ausgeweiteten Warenverkehr sei der wahre Urheber, aber auch das scheint nur eine Variante des Suchens nach einem Sündenbock zu sein.
Von den historischen Berichten angeregt und erfasst von der überall spürbaren Besorgnis und Nervosität lasen meine Frau und ich gemeinsam eine Reclam-Auswahl aus demTagebuch des englischen Marine-Staatssekretärs Samuel Pepys der Jahre 1660-1669. Pepys erlebte die Wiedererrichtung der Monarchie (mit einem an Politik gänzlich uninteressierten König), die Pest 1665 in London, am Ende des selben Jahres eine verheerende Feuersbrunst, die die halbe Stadt in Schutt und Asche legte, und den Seekrieg zwischen Holland und England. Pepys, der unter anderem für das Beschaffungswesen der Marine zuständig war und einen gewissen Einfluss erlangte (auch war er von Korruption nicht gänzlich frei), kam uns über die Distanz von 360 Jahren menschlich nahe. Was werden die Menschen in 360 Jahren von uns wissen und denken? Das war die Frage, die mich zum Untertitel meines Tagebuches inspirierte.
*
Der Anlass, ein Tagebuch des Corona-Jahres 2020 zu schreiben, lag indes woanders. Kaum nahm die Pandemie an Fahrt auf, meldeten sich nervöse Feuilletonisten zu Wort mit der nachdrücklich geäußerten Behauptung, „nach Corona wird nichts mehr so sein wie zuvor“. Das kam mir sowohl voreilig als auch fraglich vor. Als Psychologe erwarb ich die Erkenntnis, dass sich der Mensch als Spezies durch eine Pandemie nicht ändern wird. Er wird nicht besser oder schlechter durch sie; er bleibt sich immer ähnlich. Die menschliche Psyche ändert sich über die Zeit kaum, weder im Kollektiv noch im Individuum. Die Geschichte zeigt menschliches Handeln in allen seinen Facetten, den guten wie den schlechten. Wahn und Würde des Menschen liegen eng beieinander und laufen parallel. Zu allen Zeiten gab es Egoismus und Niedertracht, und zu allen Zeiten gab es Großherzigkeit und Hilfsbereitschaft. Mit einer grundlegenden Verbesserung der psychisch-ethischen Grundausstattung des Menschen ist nicht zu rechnen.
Gleich bleibt sich auch das stete Gefühl der Überforderung. Viele Kommentatoren empfinden die Zeit ab etwa den Anschlägen am 11. September 2001 in den USA (oder ab irgendeinem anderen Zeitpunkt) als eine Krisenzeit. Die Zahl der Konflikte scheint seit Jahren im gleichen Maße zu steigen, wie die Chancen auf Lösungen sinken. Zu Beginn der Pandemie und den Kontaktbeschränkungen schien es, dass alle Solidarität, Nachbarschaftshilfe und Verständnis für die harte Arbeit in den Krankenhäusern erfasste. Das ging schnell vorüber. Zwar protestierten ab Spätsommer einige kleine, aber lautstarke Gruppierungen gegen die „Diktatur“ der Kontaktbeschränkungen, aber die große Mehrheit schickte sich in das Notwendige. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung reagierte mit Vernunft und Sachverstand auf die neue Lage, fand sich in diese neue Situation schnell ein und begriff die Relevanz dieses Geschehens. Man stellte das Verhalten ohne große Proteste um.
Wir leben in einem Land und in einem politischen Klima, in welchen eine vernünftige Ansprache der Politik und der verantwortlichen Institutionen gute Wirkung zeigt. Es war ein überraschender und auch großer Moment zu sehen, wie unsere Nation in der Lage ist, kollektiv vernünftig zu handeln. Die Coronakrise lehrte uns den Wert von Solidarität und Vernunft, sie lehrte uns wohltuende Entschleunigung und Verzicht. Sie zeigte auch, wie falsch das ständige Krisengerede ist und wie weit entfernt dieses Gerede von einem Großteil der Bevölkerung stattfindet. Viele sahen sich darin bestätigt, dass unsere Konsumgesellschaft fragwürdig ist. Die Lernfähigkeit in den Despotien und unter erratischen Führungspersönlichkeiten (USA, Russland, China) war deutlich geringer. Nicht alle sind bereit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, wo die politischen Führungsfiguren bereit sind, die Realität wahrzunehmen und rational darauf zu reagieren.
Corona ist wie ein Traum oder Alptraum, der vorübergehen wird. Es werden Menschen sterben, das ist richtig. Es werden aber noch viel mehr Menschen an ganz anderen Dingen sterben. Corona wird niemals den Tod dominieren. Andererseits, es sind richtige Tote, nicht die fragwürdigen Hochrechnungen über vorzeitig Gestorbene wegen Stickoxid und Feinstaub. Corona ist keine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Das war in früheren Jahrhunderten die Pest, als in ganz Europa ein Drittel der Einwohner starb, in einigen Städten bis zu drei Viertel. Die Menschheit heute ist dem Virus gegenüber nicht ohnmächtig. Wir bleiben ohnmächtig nur dem Tod an sich gegenüber.
*
Entgegen der obigen These von der weitgehenden Unveränderbarkeit der Psyche ist seit Mitte des vorigen Jahrhunderts eine erstaunliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in globalem Maßstab zu beobachten. Es scheint, als hätte sich die Menschheit im Großen und Ganzen mehr auf ihre kooperativen, mitfühlenden und einsichtsvollen Fähigkeiten besonnen. Heute sind die Menschen weltumfassend gesehen gesünder, wohlhabender und sie leben länger als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte desHomo sapiens. In den vergangenen 70 Jahren, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es einen kolossalen Ausbruch aus Armut, Kindersterblichkeit und Analphabetismus. Immer mehr Mädchen gehen zur Schule, die Schulzeit verlängert sich, Milliarden Menschen genießen einen Komfort, der vor 100 oder 200 Jahren noch unvorstellbar war. Einkommen und Gesundheit haben sich fast überall verbessert. Die Lebenserwartung hat sich in etwa verdoppelt, was die Chancen auf Freiheit und Selbstbestimmung deutlich ausweitet.2 Dieser Fortschritt beruht ganz überwiegend auf einem Zurückdrängen von Kirchenmacht und einer weiten Verbreitung des freien Gedankenaustausches und von marktwirtschaftlichem Handel unter demokratischen, wohlfahrtsstaatlichen Staatsverfassungen, die sich der Friedenssicherung als einer obersten Maxime verschrieben haben.
Betrachtet man die Welt nicht nur durch die verzerrte Brille der Apokalyptiker3, könnte man mit einigem Recht zu dem Ergebnis gelangen, dass sich die Menschheit seit einigen Jahrzehnten im Aufwind befindet. „Die Aufklärung funktioniert“, betont der amerikanisch-kanadische Psychologe Steven Pinker in einem Beitrag für die Neue Zürcher Zeitung (21. Februar 20184). Die Fortschritte seien kein bloßer Zufall. Vielmehr handelt es sich um die Fortsetzung eines Prozesses, der Ende des 15. Jahrhunderts durch die Wiederentdeckung der kulturellen Leistungen der griechischen und römischen Antike in der Renaissance angestoßen, im späten 18. Jahrhundert durch die Aufklärung und im 19. Jahrhundert durch Religionskritik fortgesetzt wurde und der im 20. Jahrhundert die menschlichen Lebensverhältnisse in fast jedem Bereich verbessert hat.
Hat die Menschheit also doch aus der Geschichte gelernt? Die Regierungen und die Gesundheitssysteme vieler Staaten zeigten sich angesichts der Bedrohung durch das neuartige Virus erstaunlich reaktionsschnell und anpassungsfähig. Die offenbar ebenfalls unvermeidliche Kritik an der angeblichen Unfähigkeit der Herrschenden gehört seit jeher zur politischen Folklore. Was das Gesundheitssystem angeht, so wird seit Jahren behauptet, dass es kaputtgespart wird. Nun zeigte sich die Politik erstaunlich handlungsfähig. Das Gesundheitssystem hatte sich innerhalb weniger Tage auf die neue Lage eingestellt, planbare Behandlungen und Operationen zurückgestellt und Tausende von Intensivbetten für schwer an Corona Erkrankte bereitgestellt.
Die Zuständigkeit für Seuchen freilich ist an Virologen und Epidemiologen übergegangen: ein Segen für die Menschheit. Dass es so kam, verdanken wir einem evolutiven Prozess, der gespeist wird aus wissenschaftlicher Neugierde, medizinischem Erfolg und kapitalistischer Fortschrittsdynamik. Gesundheit ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern verdankt sich einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, die auch künftig nicht abbrechen darf. Neu und beruhigend ist die internationale Zusammenarbeit der Virologen. Normalerweise stehen sie in heftiger Konkurrenz zueinander.
Der Rationalität der wissenschaftlichen Medizin können wir vertrauen. Gewiss ist es nötig, auf die Knappheiten (Betten, Beatmungsgeräte, Mundschutz, Desinfektionsmittel) hinzuweisen. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, was alles in Fülle und zugleich flächendeckend da ist – nicht vom Himmel gefallen, sondern als Frucht unseres Wohlstands.
Theodor Dostojewski hat gesagt, „den Grad einer Zivilisation kann man abschätzen, wenn man ihre Gefängnisse betritt“. Deutschland hat eine vergleichsweise niedrige Kriminalitätsrate und eine niedrige Zahl von Häftlingen. Die Zahl der Morde ist in den USA neunmal höher als in Deutschland. In Kalifornien gibt es mehr Menschen in Haftanstalten als Studenten an Universitäten. Deutsche Gefängnisse sind relativ klein und beherbergen nie mehr als 1200 Gefangene. Diese tragen ihre eigene Kleidung und sind nicht uniformiert wie in den USA. Es gibt viel weniger Gewalt in deutschen Gefängnissen als in amerikanischen, unter anderem, weil in Deutschland die Gefangenen Einzelzellen haben. Die Todesstrafe ist abgeschafft.
Der Ökonomen Robert Fogel erhielt 1993 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. 2011, im Alter von 85, schrieb er unter dem TitelThe Changing Body ein Buch über die Beziehung von Kapitalismus und Körper: Die Fortschrittsgeschichte besserer Ernährung, guter medizinischer Versorgung, einfallsreicher Ingenieurskunst (nicht zuletzt der Erfindung der Kanalisation, die die Cholera zum Verschwinden brachte) und wirtschaftlichen Wachstums war es, die diesen grandiosen Verbesserungsschub für die Gesundheit ermöglicht hat. Impfen, anfangs sehr teuer, wurde immer günstiger und für viele erschwinglich. Man ist geneigt, die Gesundheit ausschließlich als individuelles Gut zu betrachten, das sich aus genetischer Prägung, persönlichem Lebensstil und achtsamer Ernährung ergibt. Dabei wird übersehen, wie sehr die „Volksgesundheit“ sich seit 200 Jahren für alle verbessert hat.
Die Einsicht, dass Kriege unter allen Bedingungen verhindert werden müssen, ist breit akzeptiert. Menschenrechte, Demokratie und Umweltschutz haben sich in weiten Teilen der Welt durchgesetzt. 1945, gegen Ende der Nazi-Herrschaft, existierten nur noch drei demokratische Staaten in Europa: Großbritannien, die Schweiz und Schweden. Nach 1945 war Osteuropa unter sowjetischer Herrschaft. Heute sind so gut wie alle 49 europäische Staaten Demokratien. Weißrussland, Ungarn, Polen und Serbien werden autokratisch geführt, doch sie sind weit entfernt von Zuständen wie im nationalsozialistischen Deutschland. In Lateinamerika verschwanden die Militärdiktaturen, in Osteuropa die Einparteiensysteme. Einige Staaten Afrikas und Asiens lassen Wahlen und Aktivitäten der Zivilgesellschaft zu. Der demokratische Wohlfahrtsstaat minimiert durch Daseinsvorsorge und -fürsorge Lebensrisiken und erhöht Freiheitschancen.
Gerade im Überblick und aus der Rückschau zeigen sich die großen Unterschiede von damals und heute. Davon möchte ich meinen Lesern im Jahre 2380 berichten5:
Vor 100 Jahren waren die sanitären Zustände für den Großteil der Bevölkerung primitiv, Lebensmittel und Kleidung waren knapp. Nur reiche Familien verfügten über Waschmaschine, Telefon, Kühlschrank oder Auto. Einen Fernseher besaß nach dem Zweiten Weltkrieg niemand. Die folgende Generation profitierte im Laufe der Zeit von erstaunlichen medizinischen Fortschritten. Ihr kamen der durch ein hohes Wirtschaftswachstum ermöglichte Aufbau des Sozialstaats und seine ständige Ausweitung zugute. Ein Maß an sozialer Sicherheit wurde erreicht, wie es frühere Generationen nicht gekannt hatten. Der materielle Fortschritt seit jener Zeit ist atemberaubend.
Heutige Familien wären entsetzt, wenn man ihnen eine Wohnung ohne Badezimmer und mit einer (häufig mit anderen Familien gemeinsam genutzten) Toilette im Hof oder Treppenhaus anbieten würden. Annehmlichkeiten, die einst einen Luxus darstellten, dessen sich nur eine winzige Minderheit erfreuen konnte, sind heute alltäglich. Sämtliche Bewohner der Bundesrepublik (mit ganz wenigen Ausnahmen) haben ein Dach über dem Kopf. In ihren Wohnungen und Häusern haben sie es warm, Tag und Nacht gibt es Strom und fließend kaltes und warmes Wasser. Die meisten Familien besitzen ein Auto; auch Haushalte mit zwei Autos sind nichts Ungewöhnliches. Die anderen benutzen ein weitverzweigtes Netz des öffentlichen Personennahverkehrs. Das Vorhandensein von Kühlschrank und Smartphone wird als selbstverständlich betrachtet. Heute kann man auf mobilen Smartphones Fernsehen schauen, das war noch vor 20 Jahren unvorstellbar. Auslandsreisen, die in den 1950er Jahren ein Privileg der Reichen waren, sind heute für Millionen erschwinglich. Fast alle fahren mindestens einmal im Jahr in den Urlaub.
Nicht nur der materielle Besitz, auch Einstellungen und Mentalitäten haben sich erheblich geändert. Rassistische Ansichten und offen rassistische Diskriminierung wurden noch vor einem halben Jahrhundert weithin akzeptiert und kaum als der Rede wert betrachtet. In Europa lebten nur wenige Menschen nichtweißer Hautfarbe. Die Todesstrafe war noch in Kraft und wurde bei schwersten Verbrechen auch vollstreckt. Homosexualität war kriminalisiert, Abtreibung verboten. Die christlichen Kirchen besaßen beträchtlichen Einfluss, und die Gottesdienste waren noch recht gut besucht.
Heute bildet die multikulturelle Gesellschaft die Norm. Gleichgeschlechtliche Ehen und Abtreibung werden weithin akzeptiert. Frauen sind prinzipiell und faktisch geleichgestellt. Ausbildung und Einkommen der Kinder wurden besser und höher als die der Eltern. Westliche gesellschaftliche und kulturelle Fortschrittsmuster verbreiteten sich in der gesamten entwickelten Welt.
Sind die utopischen Energien erschöpft, wie es Jürgen Habermas schon 1985 mutmaßte? Mit dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums verloren Kommunismus und Sozialismus die letzte Legitimation. Der westliche Lebensstandard und die im Westen ausgeformte repräsentative Demokratie wurden nach 1990 der einzige realistische Maßstab für die zukünftige Entwicklung von Gesellschaften und Staaten. Doch nun stellte sich dem Glauben an ein unendliches Wachstum mit unendlichen Ressourcen und unendlicher Güterproduktion die Warnung vor einer Überforderung und dem Zusammenbruch des ökologischen Systems entgegen. Zugleich bedrängen autokratische Regierungen wie in China, Polen oder Weißrussland die freiheitliche Demokratie. Zu dieser Bedrohung von außen gesellt sich im Innern eine Lust an der Destruktion der Demokratie (die nicht als solche anerkannt wird) und ihren Institutionen (die angeblich permanent „versagen“). Es scheint, als sei ein Teil der Bevölkerung des Friedens und des Wohlstandes überdrüssig. Ein links-feministisch-ökologisches, hegemoniales Milieu wird zunehmend von nationalistisch-rechten Bevölkerungsteilen herausgefordert. Es ist noch nicht auszumachen, wer diese Auseinandersetzung für sich entscheiden wird.
Statt einer Utopie gewann eine Dystopie an Einfluss und beherrscht das Feuilleton. Es ist die Erzählung vom nahen Untergang, wenn nicht alle sofort umschwenken und – ja, was eigentlich machen sollen? Um den Ausstoß des Treibhausgases CO2 auf ein angeblich erdgemäßes Niveau zu senken, müssten Produktion und Konsumtion um ungefähr die Hälfte heruntergefahren werden. Seit 1973, seit dem Bericht des Club of Rome, wird vor dem Zusammenbruch des globalen Ökosystems gewarnt. Die Regierungen vor allem der westlichen Welt haben seitdem mit vielfältigen Maßnahmen Luft und Wasser sauberer gemacht. Aber viele bleiben interesselos. Die einfache Erkenntnis, dass ein unendliches Wachstum auf einen endlichen Planeten logisch nicht möglich ist, dringt nicht wirklich durch. Das Hauptproblem, die ständig wachsende Bevölkerung – jährlich 80 Millionen mehr, die Einwohnerzahl Deutschlands –, wird nicht thematisiert. Die Freiheit, Kinder zu bekommen, wird nicht angetastet. Noch gibt es keinen neuen Wachstumsbegriff, es gibt kein Konzept für Konsumreduktion und Askese, es gibt noch keinen allgemein anerkannten neuen Wohlstandsbegriff, der an die Stelle des Bruttoinlandsproduktes treten könnte.
*
Die Corona-Pandemie des Jahres 2020 bot Anlass für einen erneuten Anlauf, ein globales Schicksal zu denken. Aber auch diesem alle Menschen ohne Unterschied betreffende Ereignis wird nach alten Mustern begegnet: Die übliche Mischung aus erstaunlicher Solidarität und Kooperation auf der einen und dem Weiterwurschteln und dem nur allzu menschlichen Egoismus auf der anderen Seite. Die simple Einsicht, dass der Mensch ein Lebewesen unter vielen anderen, auch winzigen Lebewesen ist, wird verdrängt. Immerhin: Die meisten Regierungen handelten zwar national, aber in der Regel rational und überlegt. Die Politik, nicht die Wirtschaft oder die Wissenschaft nahm das Heft in die Hand und verordnete nie dagewesene, radikale Maßnahmen der sozialen Isolation. Saturierte Bürger waren durchaus zu solidarischem Handeln und temporären Verzichtsleistungen bereit. Sozialromantiker sahen in dem verordneten Lustverzicht schon den Beginn des Untergangs des Kapitalismus; Soziologen sahen die Chance zu Besinnung auf das Wesentliche.
Jede Krise ist eine Chance, aber nur für die, die sie nutzen. Auch in dieser Corona-Krise traten neue Gedanken auf. Aber werden sie über den aktuellen Schockmoment hinaus wirken? Haben sich die politischen Kräfteverhältnisse verändert? Es sieht nicht danach aus. Wird sich der ökonomische Produktionsprozess verändern? Vermutlich nur wenig. Einige Betriebe und Unternehmen werden insolvent gehen, einige Arbeitnehmer werden arbeitslos werden. Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich? Es wird vielleicht mehr Heimarbeit und mehr Video-Konferenzen geben. Alle westlich geprägten Staaten wollen möglichst schnell zum früheren Status zurückkehren und wenden dafür Milliarden auf. Alle wollen wieder reisen und ins Restaurant gehen. Die fast grenzenlose Mobilität gehört zum heutigen Lebensstandard.
Man findet Trost darin, dass sich das Verhalten der Menschen zu Seuchenzeiten und auch sonst über die Jahrhunderte nicht groß verändert. Es gibt die Ängstlichen, die Vorsichtigen, die Panischen, die Rationalen, die Tatkräftigen, die Besonnenen, die Klagenden, die sich Fügenden. Was sich stark verbessert hat, das ist die Einflussmöglichkeit und die Schlagkraft staatlicher Institutionen, ferner die Rationalität der zu treffenden Maßnahmen. Es scheint dabei unvermeidlich, dass ein kleinerer Teil der Bevölkerung auch nach Monaten noch nicht an die Existenz eines neuartigen, gefährlichen Virus glauben kann oder will. Sie stellen alles infrage und dünken sich schlau. Es wird immer jene geben, die die verordneten Maßnahmen für zu spät und für zu lasch halten, und jene, die sie für verfrüht und zu harsch halten. Irgendwo dazwischen laviert die Politik.
Die Kontroversen über die Corona-Gegenmaßnahmen waren heftig, aber letztlich steril. Es folgte nichts Neues daraus. Es gab keine Alternative zur sozialen Distanz in der Pandemie. Für Detailregelungen gibt es immer einen Ermessensspielraum, daraus muss man keine Ideologie machen.
*
Die Rede, „nichts wird so sein wie vorher“, provozierte meinen Widerspruch, und ich begann, ein Corona-Tagebuch zu schreiben, in Gedanken an meine Leser in 360 Jahren.
Die Entscheidung fiel Mitte März 2020. Von da an galt es, die Ereignisse nach vorne zu verfolgen und nach hinten zu rekonstruieren. Da Archive und Bibliotheken geschlossen waren und blieben, hatte ich Mühe, die Zeit bis Anfang Januar 2020 zu rekonstruieren. Ich verzichtete schließlich kurzerhand auf den Januar. Und ich brach das Tagebuch Mitte November 2020 ab. Ich war erschöpft von der Arbeit und zugleich erleichtert, dass der mieseste Präsident, den die Vereinigten Staaten jemals hatten, abgewählt war und ein Impfstoff gegen das Covid-19-Virus unmittelbar vor der Zulassung stand.
Herausgekommen ist kein Tagebuch im engeren Sinne. Dieses müsste intimer und erzählerischer sein. Es ist eher ein Denk-Tagebuch, ein Arbeitsjournal, dessen Inhalte vielleicht später einmal in einen Aufsatz oder ein Buch übernommen werden können. Die Notizen erscheinen in chronologischer Folge, zusammengehalten von einem generellen Interesse am Politischen.
Es fällt schwer, Leuchtmarken der Vergangenheit und der Gegenwart festzuhalten. Oft gelingt dies nur mit erheblicher Gedächtnisarbeit. Dabei können Notizen und Aufzeichnungen immerhin ein wenig helfen. Es geht um den Versuch, flüchtige Gedanken für später festzuhalten. Es stellte sich heraus, dass die politischen Debatten mein Hauptinteresse fanden und – zu meiner eigenen Überraschung – die persönlichen Ereignisse stark in den Hintergrund traten.
Ich verarbeitete die drei Zeitungen, die ich regelmäßig lese, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung und den Tagesspiegel Berlin. Parallel dazu beschäftigte ich mich mit politischen und psychologischen Fragen, zu denen ich meine Gedanken und Kommentare aufschrieb. Man wird rückblickend im Lichte des Geschichtsverlaufs sicher auch an diesem Tagebuch die relative Nichtigkeit des Tagesgeschehens feststellen müssen. Was davon wird die Leser in 360 Jahren interessieren? Es könnte sein, dass ich sie langweile oder enttäusche. Aber was ich hier aufschreibe war das, was einige von uns in diesem denkwürdigen Jahr beschäftigte.
Berlin, Dezember 2020
das schrieb Otto Friedrich Bollnow in einem langen Essay über Camus`Pest, abgedruckt in der Zeitschrift „Die Sammlung“, dritter Jahrgang 1948, Heft 2, S. 103-113
Angus Deaton (2017)Der große Ausbruch. Von Armut und Wohlstand der Nationen. Stuttgart: Klett Cotta. Der britisch-amerikanischer Ökonom ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Princeton University. Er erhielt 2015 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt.
beispielsweise der frühere EU-Parlamentarier Hans-Peter Martin:Game over. Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle – und dann? München 2018. Sein Kompendium der Ausweglosigkeit erzeugt ein Gefühl der Lähmung.
https://www.nzz.ch/feuilleton/die-aufklaerung-funktioniert-ld.1358560. Von Pinker er-schienen unter anderem:The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. Viking Adult, 2011. Übers. Sebastian Vogel: Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit. Frankfurt am Main 2011. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Allen Lane, 2018. Übers. Martina Wiese: Aufklärung jetzt: Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung. Fischer, Frankfurt/M. 2018. Pinkers Bücher erfahren in der Öffentlichkeit breite Aufmerksamkeit.
Ich orientiere mich an den Anfangskapiteln von Ian Kershaw:Achterbahn: Europa 1950 bis heute (München 2019)
Februar
1. 2. Schreibe eine Rezension zu Bernhard Haslinger, Bernhard Janta (Hg.): Der unbewusste Mensch. Zwischen Psychoanalyse und neurobiologische Evidenz (2019), für das Deutsche Ärzteblatt, Ausgabe PP. Die Autoren sind ausgewiesene Experten auf den Gebieten der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychoanalyse, Neurologie und Neurobiologie. Die Unterscheidung von explizit-deklarativem und implizitem Gedächtnis 1957 veränderte das Bild vom Menschen ebenso wie die Psychoanalyse als Therapieform. Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Otto F. Kernberg äußert im Vorwort die Hoffnung, dass das Verständnis von moderner Neurobiologie und den seelischen Strukturen des Selbst die Kompetenz der Behandler in Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen stärkt.
Fange an, das Buch von Alexander Kluy (2019)Alfred Adler. Die Vermessung der menschlichen Psyche. Biografie. München, zu lesen. Die erste Biographie Adlers seit 25 Jahren!
2. 2. Das globale Bevölkerungswachstum müsste eigentlich zur Klimadebatte gehören, tut es aber nicht. Die Übervölkerung kommt nicht einmal am Rande vor. Im aktuellen Bestseller der deutschen Klimaaktivisten Luisa Neubauer und Alexander Repenning (Vom Ende der Klimakrise, Oktober 2019) findet sich zum Bevölkerungswachstum auf rund 300 Seiten kaum mehr als ein Nebensatz. Und das Handbuch der Extinction Rebellion (bedeutet: Rebellion gegen das Aussterben) diskutiert Kolonialismus, veganes Kochen und Massentierhaltung, nicht aber die Frage der Bevölkerungsentwicklung. Die „ökologische Grenze der Erde“ wird nicht mit der Belastung der Ressourcen durch immer mehr Menschen in Verbindung gebracht. Auch das Pariser Abkommen schweigt dazu, ebenso die 17 Prioritäten in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Und auch in den Programmen deutscher Parteien sucht man vergeblich nach einer konkreten Stellungnahme. Selbst die Grünen bleiben vage. In den wenigen Stellungnahmen, die es überhaupt gibt, ist ein Unbehagen zu spüren, das Problem genauer in den Blick zu nehmen. Alle wissen, dass in wenigen Jahrzehnten neun oder gar zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Wie die versorgt werden sollen bei gleichzeitiger CO2-Neutralität, ist ein Buch mit sieben Siegeln. Wer überhaupt darüber nachdenkt, scheint des Problem als unlösbar anzusehen. Das wird nicht zugegeben und nicht ausgesprochen.
Vor einigen Jahrzehnten war das Thema der Bevölkerung in politischen Debatten präsent. Werke wieDie Bevölkerungsbombe des Engländers Paul R. Ehrlich erschien Ende der 1960er Jahre in hoher Auflage. Bis etwa um die Jahrtausendwende erschienen Bücher wie Kriege der Zukunft: Die Bevölkerungsexplosion gefährdet den Frieden (1998) oder Die dritte Revolution: Antworten auf Bevölkerungsexplosion und Umweltzerstörung (1994). In diesem Jahrhundert sind es kaum ein Dutzend Bücher auf dem deutschen Büchermarkt, die sich mit dem Thema befassen. Dabei dürfte klar sein, dass das anhaltende Bevölkerungswachstum in einen bedrohlichen Raubbau an der Natur mündet. Aber insgesamt wird Bevölkerungswachstum nicht als katastrophales Risiko angesehen. Und muss man wirklich besorgt sein? Die Ernährungslage hat sich global gesehen in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert. Können also im Jahre 2050 knapp zehn Milliarden Menschen ernährt werden? Aber es geht ja nicht nur um Ernährung, sondern auch um Wohnungen, Arbeitsplätze, Infrastruktur, Bildung, Kultur und steigenden Lebensstandard, nicht zu reden von der Friedenssicherung.
Die Debatte wird vielleicht auch deswegen nicht geführt, weil im links-alternativen-grünen Milieu eine direkte Zusammenhang zwischen westlicher, komfortabler Lebensweise und Armut und Hunger in anderen Weltteilen gesehen wird. Eine Konsequenz wäre, im Westen auf Komfort zu verzichten und den Lebensstandard zu senken, damit genügend Ressourcen für arme und Schwellenländer zur Verfügung stehen. Verbal ist die Solidarität mit den Armen und Ausgebeuteten schnell zu haben, was aber nicht zu Verhaltensänderungen führt. Vielleicht ist dieser Zusammenhang auch schlicht falsch? Er wird zwar behauptet, aber niemand scheint so richtig daran zu glauben. Tatsächlich ist es falsch anzunehmen, dass wir im Westen den Entwicklungsländern etwas wegnehmen. Der steigende Lebensstandard dort orientiert sich an den Erfolgen im industrialisierten Norden. Wir sind Vorbild. Uns am Lebensstandard der Dritten Welt zu orientieren, scheint völlig absurd.
Viele Länder auf der Erde probieren unterschiedliche Rezepte aus, um die Reproduktionsquote zu senken. Es gibt kein einheitliches Konzept, die nationalen Unterschiede sind zu groß, auch was das Kräfteverhältnis zwischen Befürwortern von Frauenrechten einschließlich der Empfängnisverhütung und den konservativen, meist religiösen Gegenkräften angeht. Werden CO2-Einsparungen im industrialisierten Norden nicht im Handumdrehen von der Zunahme der Bevölkerung im Süden ausgehebelt? Andere halten Ermahnungen westlicher Staaten an die Länder mit hoher Geburtenrate für grundsätzlich unerwünscht. Wir dürften uns nicht anmaßen, das Kinderkriegen in anderen Ländern für bedenklich zu erklären. Das gelte selbst für Länder mit starkem katholischen Einfluss. Manche weisen darauf hin, dass mit zunehmendem Lebensstandard in der Regel auch die Geburtenrate sinkt. Das Wachstum von Bevölkerungen nimmt ab, wenn Frauen über die Zahl ihre Kinder frei entscheiden können und einen freien Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Das müsse ausreichen. Und halten die Vereinigten Nationen nicht das Einpendeln der Weltbevölkerung bei elf Milliarden für möglich? Das bedeutet freilich auch, dass diese Lawine nicht aufzuhalten ist.
Das Erstarken rechter Bewegungen in einigen Ländern, darunter den USA, bedeutet allerdings auch, dass vehement das Recht auf Abtreibung und Familienplanung bekämpft wird. Selbst Linksliberale halten die staatliche Ein-Kind-Politik Chinas für verwerflich. Der Staat dürfe nicht in die Familienplanung eingreifen. Es sieht nicht so aus, dass sich die Regierungen und Gesellschaften weltweit sachlich mit einer verantwortungsvollen Geburtenkontrolle befassen. Ohne massiven politischen Eingriff in die Produktionsrate vor allem in Schwarzafrika und in Teilen Asiens steuert die Menschheit in 80 Jahren auf elf Milliarden Erdbewohner zu, 60 Prozent mehr als heute. Für alle diese Probleme hat die Umweltschutz- und Klimabewegung weder ein Sensorium noch eine Antwort.
Die Schülerin Greta Thunberg hat es innerhalb von zwei Jahren vermocht, aus ihrem Einzelprotest vor dem schwedischen Parlament eine scheinbar weltweite Jugendbewegung zu machen. Sie bekommt Schlagzeilen auf der ganzen Welt, aber das ist kein politisches Handeln. Sie glaubt, dass alles erreichbar ist, „wenn wir es wirklich wollten“. Sie glaubt, dass die Rede vom ewigen Wirtschaftswachstum nur Opportunismus ist, um nicht Wählerstimmen zu verlieren. Das einzig sinnvolle wäre es aber, jetzt und sofort „die Notbremse zu ziehen“. Wenn man nur wüsste, was sie darunter versteht.
Vielleicht Runterfahren der Produktion, weniger Konsum, kleinere Wohnungen, weniger Reisen und in den geburtenstarken Gesellschaften Gleichberechtigung der Frauen und freier Zugang zu Verhütungsmitteln sowie das Recht auf Abtreibung? Davon ist bei Thunberg und der Fridays for Future-Bewegung nirgends die Rede. Sie überlässt es den Politikern, Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen sind ihr aber nicht weitreichend genug. So beißt sich die Katze in den Schwanz. Thunberg und Fridays for Future fordert sofortige Maßnahmen, ohne zu sagen, welche es sein sollen. Und wenn auf die Erfolge in der Klimapolitik hingewiesen wird, ist ihnen das zu wenig.
Im September 2019 hielt Thunberg eine kurze, hochemotionale Rede in New York vor Delegierten der Vereinten Nationen: „Sie haben mit ihren leeren Worten meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Menschen leiden. Menschen sterben. Das Ökosystem kollabiert! Wir befinden uns im Anfang eines Massenaussterbens, und alles, woran ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem wirtschaftlichem Wachstum. Wie könnt ihr es wagen wegzuschauen!“
Thunberg und Fridays for Future irren in mehrfacher Hinsicht. Der Planet wird nicht einer kleinen Gruppe von Menschen geopfert. Vielmehr profitieren Milliarden von höherer Bildung, besserer Gesundheit und steigendem Lebensstandard. Die dafür notwendigen Gegenstände müssen natürlich produziert werden. Thunberg hält höhere Bildung, bessere Gesundheit und hohen Lebensstandard, von dem nicht zuletzt sie selbst profitiert, für „Luxus der Wenigen“. Sie stellt die rhetorische Frage, was sie, wenn sie selbst alt sein wird, ihren Kindern und Enkeln erzählen soll, wenn diese danach fragen, warum die heutigen Lebenden „nichts unternommen haben“.1 Abgesehen davon, dass nicht recht klar ist, an wen sie sich wendet – die Politiker, ihre Eltern, die Menschheit insgesamt –, so kann man ihr schon heute die Antwort geben:
„Liebe Greta, Sie selbst gehen davon aus, dass Sie ihren 75. Geburtstag im Jahre 2078 feiern werden. Bitte bedenken Sie dabei, dass sie nicht in den ersten Lebensjahren gestorben sind, weil das schwedische Gesundheitssystem ausgezeichnet funktioniert und Sie geimpft wurden. Wir Erwachsene, die Sie so stark für angebliches Nichtstun kritisieren, haben Ihnen Ihre Schule, Internet, Autos, Flugzeuge und Konferenzsäle zur Verfügung gestellt. Noch bevor Sie geboren wurden, wurden in vielen westlichen und industrialisierten Ländern wirksame Maßnahmen zur Luftreinigung und zur Verbesserung der Wasserqualität eingeleitet. Bitte sagen Sie Ihren Kindern und Enkeln, dass dieser hohe Lebensstandard durch den Erfindungsreichtum und die Tatkraft von Abermillionen Menschen geschaffen wurde. Ja, wir haben es gewagt, ihnen eine sicheres Heim, eine gute Schulbildung, Wärme und Elektrizität rund um die Uhr und eine Zukunft mit guten Aussichten zu schaffen! Immer weniger Menschen leiden, weil westliche Staaten sich bemühen, dass der ökonomische Aufschwung auch ärmeren Ländern zugute kommt. Ökonomische Prosperität finanziert vieles, auch Schulen, Kraftwerke und Krankenhäuser. Vielleicht klären Sie Ihre Kinder und Enkel darüber auf, dass es nur allzu menschlich ist, steigenden Wohlstand zu genießen, und dass es kaum einen gibt, der darauf freiwillig verzichtet. Wir, die wir etwas älter sind als Sie, haben Ihnen und Ihren Kindern nicht die Zukunft gestohlen, sondern vielmehr einen sicheren Weg in die Zukunft bereitgestellt, mit ausreichender Nahrung, einem hohen medizinischen Standard, guter Schulbildung für alle und einem sicheren Rechtssystem. Sie und Ihre Kinder können guter Hoffnung sein. Die industrialisierten Staaten sind dabei, langsam aber sicher fossile Brennstoffe durch regenerative Energien zu ersetzen. Das System muss nicht geändert werden. Der Wandel ist bereits eingeleitet. Mit freundlichen Grüßen, Gerald Mackenthun (Berlin)“
3. 2. Gängige Elitenkritik: Die Elite könne nur ein Klub von Etablierten sein, die sich selbst ernennt, gegenseitig begünstigt und mit Macht ausstattet. Wenn die herrschenden Eliten die Welt nicht vor dem Untergang bewahren kann, müsse die Welt eben von ihr befreit werden. Für Kapitalismuskritiker gibt es keine Leistungsträger, es gibt bloß kapitalistische Schmarotzer, die den Armen das letzte Hemd wegnehmen. Neue Eliten wettern gegen „die Elite“ als Institution, um selbst die bestehenden Positionen der Macht zu besetzen. Donald Trump in den USA, die Partei Alternative für Deutschland und Matteo Salvini in Italien haben vorgemacht, wie das geht.
Tatsächlich aber herrschten und herrschen Eliten selbst in den egalitärsten aller Gesellschaften – weil es stets Menschen gibt, die mehr leisten und klüger sind oder überlegter entscheiden als andere. Sie sind meist irgendwie besser und agieren erfolgreicher. Die Frage ist deshalb nicht, ob es Eliten geben darf – es gibt sie eben. Es war der Sozialphilosoph Friedrich August von Hayek, der hier einen grundlegenden Unterschied hervorhob: Während in geschlossenen Gesellschaften die Auserwählten sich tatsächlich wechselseitig autorisieren, ist es in offenen, liberalen Gesellschaften gerade die größere Zahl aller anderen, die daran mitwirken, wer zur kleinen und stark be-obachtete Gruppe der Elite zählt. Bürger und Konsumenten belohnen durch ihre Wahl- oder Kaufentscheidungen jene Leute, die ihrer Meinung nach die anstehenden Aufgaben besser erledigen als andere. Die liberale Elite verdankt ihre Position zunächst nicht Privilegien, sondern hat sich zu bewähren. Die Elite kann nicht versagen, denn sonst wäre sie keine. Allerdings gibt es immer wieder Versager, die aus dem Club der Elite absteigen. Der Kreis der Elitären wechselt sich aus, die Elite als Gruppe bleibt. Die öffentliche Rhetorik spricht zwar antielitär immer wieder vom Versagen der Eliten, die Gesellschaft aber wird von Leistungsfähigen getragen wie eh und je.
Die aktuellen Eliten sind intellektuell tätig, auch wenn sie keine Intellektuellen im engeren Sinne sind, sie arbeiten im gehobenen Angestelltenverhältnis oder selbständig und sind hypermobil. Der amerikanische Historiker Christopher Lasch analysierte 1995 die Eliten des globalen Zeitalters in seinem postum erschienenes BuchThe Revolt of the Elites and The Betrayal of Democracy (deutsch Die blinde Elite. Macht ohne Verantwortung). Sie leben angeblich nicht in Gemeinschaften, sondern in Netzwerken. Lokale Verankerung ist ihnen scheinbar ebenso fremd wie eine Verpflichtung gegenüber Nachbarn und Mitbürgern. Sie wollen sich ihre Freunde und Kollegen selbst aussuchen, sie folgen angeblich dem Sirenengesang der Opportunitäten und blicken auf alle herab, die sich konservativ nicht bewegen. Sie geben sich betont tolerant unter ihresgleichen, sondern sich aber vom Rest der Bevölkerung hochnäsig ab.
Der Leser sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Text sich mit den Verhältnisse in den USA befasst und eine gewisse Kenntnis der Kulturgeschichte des Landes voraussetzt, die sich erheblich von der Europas unterscheidet. Lasch stellt die Abgehobenheit der modernen US-Eliten in einen starken Kontrast zu den Gepflogenheiten früherer Oberschichten, die sich um die Entwicklung ihrer Heimat, insbesondere im Lokalen, verdient gemacht hätten, wofür sich heute kaum noch jemand interessieren würde. So recht Lasch bei vielem möglicherweise hat, so kann man allerdings auch den Eindruck einer gewissen Nostalgie gewinnen.
In der Gegenwart setzt sich die unpräzise Kritik der Eliten fort. Nassim Nicholas Taleb nennt sie polemisch „Intellektuellen-Idioten“, die sich in der eigenen Blase aus Statistiken, Denkfabriken, Startups, Medien und Fakultäten aufhalten – also ziemlich weit herumkommen. Der britische Journalist David Goodhart prägte die Unterscheidung zwischen den „Anywheres“ und den „Somewheres“. Mit Ersteren meint er jene rund 20 Prozent der Menschen in entwickelten Gesellschaften, die aufgrund ihrer Kompetenzen überall auf der Welt gefragt und auch zu Hause sind, und mit Letzteren alle anderen, die tendenziell da sterben, wo sie auch geboren wurden.
Der israelische Psychoanalytiker Carlo Strenger trug 2019 mit einen längeren selbstkritischen Essay – denn er zählt sich selbst zu dieser Elite – aus der Innensicht zum Thema bei (unter dem TitelDiese verdammten liberalen Eliten). Die neuen Eliten sind akademisch gut ausgebildet, sind in Medien, Digitalwirtschaft, Kunstszene und Wissenschaft übervertreten und wirken dadurch meinungsbildend. Trotz hohem Bildungsgrad sind sie keine Bildungsbürger: Sie achten nicht den Kanon und die Tradition. Sie sind Gewinner der Globalisierung, haben nichts gegen Migration (solange diese Menschen ihnen nicht zu nahe kommen) und verfechten als Universalisten die Menschenrechte. Man sieht sie geschäftig und mit ernsten Gesichtern in den Innenstädten herumlaufen, den Hochleistungslaptop im Rucksack und einen Kaffeebecher in der Hand. Ist ihnen ein ausgeprägtes soziales Gewissen zu eigen, wie Strenger meint? Sie blicken auf Menschen herab, die sich von Populisten verführen lassen, und tun sich doch zugleich schwer mit ihrem hochreflexiven Habitus, der sie dazu anhält, alle Lebensentscheidungen kritisch zu hinterfragen, vom Fleischkonsum bis zum Kinderkriegen.
Sind sie arrogant und blind für die Lebensweise und die Bedürfnisse der „normalen“ Menschen, die Angst vor der Globalisierung und einer Masseneinwanderung haben? Ihre globale Perspektive bringt es mit sich, dass sie sich weniger um einzelne Menschen aus Fleisch und Blut als um das Schicksal der Menschheit als solcher kümmern. Strenger nimmt die Eliten in die Pflicht. Sie sind es, die auf die Nicht-Eliten zugehen und ihnen zuhören müssen. Was werden die Eliten dort hören? Vorurteile, Ressentiments und unerfüllbare Wünsche?
4. 2. Vormittags Beschäftigung mit der Wahlrechtsreform der Bundesrepublik, die nicht vorankommt. Das Bundeswahlrecht ist recht kompliziert. 299 Abgeordnete werden direkt nach dem Mehrheitswahlrecht in ihren Wahlkreisen gewählt, 299 weitere werden nach dem Proporz der an der jeweiligen Bundestagswahl beteiligten Parteien vergeben. Diese an sich klare Trennung wird ausgehebelt durch die Vorgabe, dass die insgesamt 598 Sitze in Gänze dem prozentualen Anteil der Stimmen entsprechen müssen. Wenn kleinere Parteien keine Direktmandate in den Wahlkreisen erringen, aber auf Bundesebene relativ gut abschneiden, wie beispielsweise die Parteien Die Linke und die Grünen, erhalten diese sogenannte Ausgleichsmandate. Das führte dazu, dass der Bundestag auf 709 Abgeordnete angeschwollen ist. Auf der von mir ansonsten nicht besonders geschätzten Petitionsplattform change.org habe ich eine Petition an alle im Bundestag vertretenen Parteien formuliert, mit dem Ziel, dem Bundestag wieder auf seine ursprünglichen 598 Sitze zu reduzieren. Dazu schlage ich eine strikte Trennung zwischen den Wahlkreisen und den 299 proportional zum bundesweiten Wahlergebnis zu vergebenden Sitze vor. Natürlich sind schon andere auf diese Idee gekommen, die sich bislang dennoch nicht durchsetzen konnte. Sie benachteiligt die Kleinparteien, deren Chancen gering sind, Direktmandate zu gewinnen. Deswegen sind die Parteien in ihren Gesprächen über eine Wahlrechtsreform noch nicht zu einem Ergebnis gelangt.
5. 2. Vormittags wie so oft schwimmen und anschließend ein Kaffee im Lieblingscafé „Lotte am Platz“.
Lese Wolfgang Röd,Der Weg der Philosophie. Bd. 1: Altertum, Mittelalter, Renaissance. München: Verlag C.H. Beck 1994, für mein großes Liberalismusthema. Daraus ein Gedanke:
Die Annahme eines Gottes und eines Jenseits bringt unendlich philosophische Schwierigkeiten mit sich, denen sich Philosophen gleichwohl mit Begeisterung stellten. Zu ihnen gehört Plotin (205-270 n. Chr.). Wie verhalten sich Diesseits und Jenseits zueinander? Wie konnte die materielle Welt aus dem Göttlichen hervorgehen? Warum hat Gott überhaupt die minderwertige, materielle, die menschliche Welt geschaffen? Warum blieb er nicht bei sich? Plotins Antwort lautet, das Vollkommenste und Mächtigste könne sich nicht auf sich beschränken, sondern müsse aus sich hervorgehen. Die Fülle der göttlichen Macht floss über zunächst in den Geist, so wie die Wärme aus dem Feuer kommt (Emanation). Die Seele ist die nächste Stufe unterhalb des Geistes. Der Abstieg der Seele in die sinnliche Welt ist bei Plotin immerhin kein Sündenfall oder Fehltritt.
„Obwohl Plotin die christliche Lehre vom Sündenfall verwarf, drückte er sich gelegentlich so aus, als hätte die Seele durch die Verbindung mit der Materie Schuld auf sich geladen.“ (Röd, 1994, S. 248) Wurde sie nicht von Gott in die materielle Welt herabgeschickt? Wie kann Plotin dann von den Qualen der Seele nach dem Tod unter Aufsicht von Dämonen sprechen? Hat Gott auch die Materie geschaffen? Nach Plotin ist die Materie das Böse schlechthin. Aber fließt dieses Etwas nicht auch aus dem Vollkommensten und Mächtigsten? Und wie kann Materie erkannt werden, da doch Erkenntnis stets Gleichartigkeit von Erkennendem und Erkanntem voraussetzt? Wenn der Geist materielle Gegenstände erkennen kann, müsse der Geist materiell sein. Das widerspricht seinen Grundannahmen. Plotin gab allen Begriff – Gott, Geist, Seele, Sein, Nichtsein, Materie, Einheit bzw. das Eine, Vielheit, Gut, Böse – neue Inhalte, in denen er sich heillos verstrickte. (Röd, 1994, S. 249ff.) Unbeantwortbar bleibt die Frage, wie das Eine (Gott) die Vielheit aus sich heraus erzeugt, sich also von sich selbst entfremdet. Das Bild vom Überfließen ist nur ein Bild, kein Beweis.
6. 2. Vormittags viele Patienten. Abends Schreibgruppe. Thema heute: „Ein winterlicher Spaziergang“.
Ein winterlicher Spaziergang am Meer
Schwer hängen die grauen Wolken über der See und der Insel. Der Wind kommt von Westen. Zum Strand ist es nicht weit. Der Sand an den Dünen ist weich, wir laufen gegen den Wind. Wir streben an die Wasserkante, dort ist der Sand nass und hart. Darauf kann man gut gehen. Links herum oder rechts herum? Ist egal. Richtung Süden haben wir den Wind auf dem rechten Ohr, Richtung Norden auf dem linken. Wir ziehen die Pudelmützen tiefer und sprechen nicht viel. Wir machen uns aufmerksam auf besondere Wolkenformen, auf Möven, auf eine tote Scholle oder eine glitschige Qualle. Möwen langweilen sich in Gruppen. Sie halten ihre Nasen in den Wind. Wenn der harte Sandstreifen direkt am Wassersaum breit genug ist, gehen wir nebeneinander, sonst hintereinander. Der Untergrund ist auch hier direkt an der Wasserlinie unterschiedlich, je nachdem, ob gerade eine Welle abzog oder die Wellen noch nicht das Niveau der letzten Flut erreicht haben. Bei Hochwasser ist das Laufen am Meer mühsamer. Dann muss man auf den trockenen Sand ausweichen, er setzt einem Widerstand entgegen. Zudem ist der Streifen feuchten Sandes schmal. Wenn man nicht aufpasst, bekommt man nasse Füße. Hat mich eine Welle erwischt, erkundigt sich meine Frau, ob ich nasse Füße habe und ob ich noch weiterlaufen könne und ob wir nicht besser umkehren sollten, weil ich mir sonst den Tod hole. Wenn ich nasse Socken habe, schwindele ich und sage, die Schuhe seien trocken.
Seit ich laufen kann, laufe ich auch am Meer. Ich kenne die Geschwindigkeit der Wellen und mein implizites Gedächtnis sagt mir, wenn ich einen grossen Schritt zur Seite machen muss. Ich kenne die Wellen ganz genau, auch die doppelte Welle, die auf dem Rücken einer anderen schneller als sonst heranschiesst. In den Wellen habe ich schwimmen gelernt. Je älter ich wurde, desto höher durften die Wellen sein. Ich tauchte unter ihnen durch und liess mich von ihnen wiegen und überrollen und nutzte ihre Physik, um ohne große Anstrengung ans Ufer zu schwimmen. Meine Oma, die auf uns aufpasste, lief aufgeregt am Ufer hin und her und rief: Schwimm’ nicht so weit raus!
Jetzt gehen wir also am Meeresstrand spazieren, mit uns einige andere, meist in Paaren, oft mit Hunden, die im Zickzack über den Strand laufen, die Nase dicht über dem Sand. Die Häuser bleiben zurück. Auf der einen Seite die stets durch Sturmfluten gefährdeten Dünen, auf der anderen Seite das wechselhafte Meer. Bei ablandigem Wind ist es sandig grün und still und nach ein paar Tagen kommen die Quallen. Bei seeseitigem Wind vermehren sich die weißen Schaumkronen auf dem dunkelgrünen Wasser mit zunehmender Windstärke. Böse können die Nord- und Südwinde sein, die Schleier aus feinem Sand über den Strand ziehen. Die fliegenden Sandkörner zwicken Haut und Augen. Dann muss man schauen, dass der Wind von hinten kommt.
Meditativ schlecken die Wellen in monotonen Rhythmus am Strand, der Körper setzt mechanisch einen Schritt vor den nächsten. Halb unbewusst achte ich auf die anzischenden Wellen, um ihnen notfalls auszuweichen. Die Augen lockern sich durch den Blick in die Ferne. Wenn ich jetzt ins Wasser steige und immer geradeaus schwimme, komme ich irgendwann in England an. Oder der Blick senkt sich auf die eigenen Füße und lässt den Sand unter sich vorbeiziehen. Schön ist es, wenn es etwas wärmer ist. Dann ziehe ich Schuhe und Strümpfe aus und überlasse meine Füße dem Wasser. Es macht nichts, wenn sie kalt werden. Barfuß im Sand wirkt wie eine Massage. Das Meeresrauschen dämpft die Nerven. So vergehen gedankenverloren die Minuten und Stunden.
Wenn wir nicht mehr können, steuern wir quer über den Strand durch die Strandkörbe hindurch einen Dünenübergang an und schauen, wo die nächste Bushaltestelle ist. Bevor wir mit müden Beinen zu Hause ankommen, gönnen wir uns einen Cappuccino und ein Stück Butterkuchen.
7. 2. Eine teure Reparatur meines geliebten Diesel-Automatik-Autos bei einer Volkswagen-Fachwerkstatt brachte kein nachhaltiges Ergebnis. Erneuter Werkstatttermin. Ergebnis: die Einspritzdüsen sind defekt bzw. undicht. Der Kostenvoranschlag liegt bei knapp über 4000 €! Ich recherchiere, wie viel der Wagen noch wert wäre und komme auf 4400 €. Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr. Ich stelle den Wagen auf der Plattform mobile.de zum Verkauf. Es meldet sich ein freundlicher, türkischstämmiger Berliner, der Interesse zeigt.
8. 2. (Sonntag) Beim Kieser-Krafttraining. – Rezensionen für das Deutsche Ärzteblatt/Ausgabe „PP“ (Psychologische Psychotherapeuten) geschrieben.
Es starb mein Cousin E.L., Sohn meiner Tante mütterlicherseits, im Alter von 69 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Immer mehr versagten seine Muskeln; zum Schluss konnte er nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen und nicht mehr schlucken. Es war grauenhaft mit anzusehen. Für diese Krankheit könnte ich Gott verfluchen, wenn es ihn denn gäbe. Meine Frau und ich besuchten ihn zuletzt kurz nach Weihnachten 2019.
9. 2. Unsere polnische Putzfrau berichtet freudestrahlend, dass sie für 50 Euro hin und zurück nach Mailand fliegt, um dort Tango zu tanzen Sie hat die Haltung, die so viele haben: Der Preis ist zwar verrückt niedrig, aber ich mache es trotzdem!
Allen, die sich jetzt um die Demokratie sorgen, möchte ich sagen: Was am 5. Februar im Thüringer Landtag stattgefunden hat, ist eine freie Wahl, und darüber hinaus hat ein liberaler und bürgerlicher Kandidat diese Wahl gewonnen. Es gibt keinen Grund, das Ergebnis moralisch zu verurteilen. Anders läge der Fall, wenn FDP-Mann Kemmerich nun mit dem Thüringer AfD-Chef eine Regierung angestrebt hätte. Aber er hat sich von Björn Höcke und dessen Partei eindeutig und unmissverständlich distanziert.
Beunruhigend ist der Gedanke, dass bürgerliche Politiker in Deutschland nicht mehr kandidieren, aus Angst, von der rechtslastigen „Alternative für Deutschland“ (AfD) gewählt zu werden. Die AfD ist der Paria unter den Parteien. Man stelle sich vor, die Rechtspopulisten hätten sich einen Spaß daraus gemacht und Bodo Ramelow (Partei Die Linke) ins Amt gewählt – wäre es dann ein Tabubruch, ein Dammbruch gewesen? Da die FDP in Erfurt eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, wirken auch die Hinweise auf die thüringische Geschichte von 1930 unangebracht. Die AfD ist nicht durch die FDP „an die Macht gekommen“.
In der Demokratie geht es um Mehrheiten. Sie müssen zustande kommen und sie sollten eindeutig sein. Sofern das Verfahren korrekt abläuft, was in Thüringen der Fall war. Wäre es anders, dürften im Bundestag Grüne, Liberale und Linkspartei nie gegen die schwarz-rote Koalition stimmen, wenn es die AfD auch tut. Das wäre das Ende jeder wirkungsvollen Opposition und ein Schaden für die Republik. Es wäre fatal, wenn eine demokratische Partei gegen ihre Überzeugungen handeln müsste, nur weil jemand mit weniger lauteren Absichten in einer Sachfrage dieselben Positionen vertritt. Damit würde man Kräften wie der AfD ein Vetorecht zubilligen, weil sie durch ein taktisches Abstimmungsverhalten den Ausgang jeder parlamentarischen Entscheidung manipulieren könnten.
Nun gilt es als Sakrileg, dass das Bündnis aus Christdemokraten und Liberalen seinen Kandidaten Thomas Kemmerich mit Unterstützung der AfD-Rechtspopulisten zum Ministerpräsidenten machte. Die Duldung durch die AfD rief einen Entrüstungssturm hervor, auch bei der SPD. 1994 plagten Reinhard Höppner, den Landeschef der SPD in Sachsen-Anhalt, weniger Skrupel. Er ließ sich mit den Stimmen der SED-Nachfolgepartei PDS zum Ministerpräsidenten wählen. Die Abgeordneten sind eben frei in ihrer Entscheidung.
Eine andere Frage ist, ob die Wahl taktisch klug war. Kemmerichs Vorgänger, Bodo Ramelow, ist in Thüringen beliebt. Eine Mehrheit der Bürger hätte ihn weiterhin gern als Ministerpräsident gesehen. Ob sie die Überrumpelung durch FDP, CDU und AfD goutieren werden, ist fraglich. Hinzu kommt: Nur fünf Prozent der Thüringer wählten die FDP. Dass Kemmerich den Landesvater Bodo abserviert hat, dürfte ihm übel genommen werden. Die Linken in Thüringen ebenso wie die AfD werden eine schwarz-gelbe Regierung bekämpfen, während sich die bürgerlichen Kollegen in Berlin von ihr distanzieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Regierung bald scheitert und es Neuwahlen gibt, ist groß.
Ob folgende Generationen diese Entwicklung in Thüringen noch verstehen werden? Ich denke, schon in einem Monat wird man die ganze Sache vergessen haben. Alle Parteien hatten sich mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen selbst festgenagelt. So konnte Ramelow von der Partei Die Linke (die SED-Nachfolgepartei, wie gerne polemisch gesagt wird) nicht die notwendige Mehrheit erhalten. Im dritten Wahlgang trat dann überraschend Kemmerich an, der – ebenso überraschend, was aber von einigen bezweifelt wird – mit den Stimmen der AfD eine knappe Mehrheit erhielt.
Der Vorgang animierte mich dazu, ein fiktives Interview mit dem im November 2015 gestorbenen ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) zu führen. An ihm erkannte man den Unterschied zwischen Politiker und Staatsmann. Er war wie wenige in der Lage, ein Problem präzise zu benennen, Er besaß einen lebenstüchtigen Pragmatismus. Für ihn gab es kein schlimmeres Unglück als die Vorstellung, Deutschland könnte in Diktatur und Krieg zurückfallen. Zugleich wies er den Anspruch zurück, auf allen Gebieten und ein ganzes Leben lang Vorbild sein zu müssen. Das betraf vor allem sein Rauchen.
Sehr geehrter Herr Schmidt, das Schicksal hat uns unfreiwillig zusammengewürfelt, damit wir ein Interview führen. Mir wurde aufgetragen, Sie zu interviewen, damit scheinen die Rollen erst einmal klar. Lassen Sie uns versuchen, das Beste aus der unangenehmen Situation zu machen.
Ich bin einverstanden. Antworten zu geben ist ohnehin besser beleumundet als Fragen zu stellen. – Gestatten Sie, dass ich rauche?
Warum müssen Sie so viel rauchen?
Das gehört zu meiner persönlichen Entfaltung und meinem persönlichem Wohlbefinden.
Stößt es Sie ab, wenn das Suchthafte des Rauchens zu offensichtlich ist?
Sie stellen mir Fragen, die ich mir nie gestellt habe und die mich eigentlich nicht interessieren.
Wie erklären Sie sich, dass ein rauchendes Papierröllchen erotisch wirken kann?
Das müssen Sie die Frauen fragen.
Was halten Sie von der These, dass Frauen durch das Tragen hoher Schuhe erhöhte Paarungsbereitschaft signalisieren?
Angeblich haben Frauen, die hohe Absätze tragen, mehr Orgasmen.
Herr Schmidt, Sie haben unendlich viele Interviews gegeben. Was macht für sie ein gutes Interview aus?
Dazu gehört einiges. Der Kritiker Benjamin Henrichs nannte die Interviews von André Müller „dramatisches Kunstwerk für zwei Personen“. Sie entstehen, wenn existenzielle Fragen behandelt werden. Größte Zurückhaltung ist bei Gesprächen über Privates angebracht. Aber ich sehe auch, dass Journalisten in kurzer Zeit viel Text produzieren müssen. Ich hatte meistens Verständnis, wenn der Gesprächspartner nicht so gut vorbereitet ist.
Sie schätzen es also, wenn der Interviewer weiß, wovon er redet?
Natürlich. Ich hatte mal ein Buch geschrieben, und jemand rief an und wollte mich dazu befragen. Er hatte das Buch nicht gelesen. Ich musste ihm sagen, er möge sich wieder melden, wenn er es durch hat.
Das wird den Chefredakteur nicht gefreut haben, wenn der Mitarbeiter meldet, Schmidt habe ein Interview verweigert.
Das ist, frei heraus gesagt, nicht mein Problem. Ich denke, wir können uns darauf verständigen, dass bei den beiden Protagonisten zumindest in einigen bestimmten Kategorien von Interviews, die ich eher als Gespräch oder als intellektuellen Austausch ansehen möchte, eine gewisse Expertise vorausgesetzt werden darf.
Und was ist mit der Kurzform, der reinen Abfrage, der Form „Drei Fragen an Helmut Schmidt“?
Kann man natürlich auch machen. Unangenehm sind freilich suggestive Fragen, die nur allzu deutlich die Vormeinung des Fragers durchscheinen lassen.
Nach meinem Dafürhalten sind sehr viele Interviewte passiv gegenüber der Form und manchmal sogar gegenüber den Inhalten. Ich meine damit, dass sie sich die Form vorgeben lassen und nicht – wenn nötig – den Rahmen sprengen.
Ich glaube, Sie haben Recht. Ich darf aber für mich in Anspruch nehmen, eigene Akzente gesetzt zu haben, wenn es mir angebracht schien.
Wie haben Sie reagiert?
Ich habe Fragen als unsinnig oder auf falschen Voraussetzungen beruhend bezeichnet. Ich habe die zugrunde liegenden Implikationen zurückgewiesen, wenn sie mir falsch erschienen. Ich habe die Frage umformuliert und für meine Zwecke zurechtgelegt. Das hat manchmal Stirnrunzeln hervorgerufen und so manche Augenbraue ging hoch. Und ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen.
Wie meinen Sie das?
Es war üblich, wird es aber immer weniger, das Interview-Transskript vom Interviewten gegenlesen zu lassen, mit der Chance der Korrektur. Heute wird vieles einfach abgedruckt oder gesendet, der angeblichen Authentizität wegen.
Die Journalisten schätzen die darin enthaltene Spontanität.
Und sie schätzen es, einen unbedachten Halbsatz herauszuklauben, in die Überschrift zu setzen und einen Empörungssturm anzufachen, oft mit dem Ziel, den Interviewten zu desavouieren.
Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass sich Interviewte aus Unerfahrenheit in Schwierigkeiten bringen.
Wenn Gesprächspartner wissen, dass sie vor der Veröffentlichung noch mal auf das Interview schauen können, dann zensieren sie sich nicht schon im Gespräch.
Beim Interview ist mein Ziel, dass beide Seiten glücklich damit sind.
Je älter die Gesprächspartner sind, desto freier reden sie, desto grösser ist ihre Neigung, in einem Interview auch eine Art Vermächtnis zu sehen, desto grösser auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie keine Pressesprecher mehr haben, die ihre Aussagen abschwächen könnten.
Sie waren sehr viele Jahre Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit. Fühlten Sie sich nicht wenigstens ein bisschen als Journalist?
Ich fürchte nicht, und wissen Sie warum? Weil ich es mir einfach nicht abgewöhnen kann, gründlich zu arbeiten.
Haben Sie ein Beispiel aus letzter Zeit, wo ein Interview aus Ihrer Sicht falsch lief?
Ja, die Interviewrunden nach den letzten Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Der Moderator im Fernsehen wiederholte wie betrunken mehrmals, dass die Parteien „klare Kante“ gegen die AfD zeigen.
Was kritisieren Sie daran?
Alle Studiogäste waren wie hypnotisiert von der Situation. Ich hätte dem Moderator gesagt: Nun hören Sie doch mal auf mit der „klaren Kante“. Wie die Analyse der Wählerwanderungen zeigt, hat die AfD viele CDU- und SPD-Sympathisanten auf ihre Seite gezogen. Da sind auch viele konservative Bürgerliche darunter. Die müssen CDU und SPD zurückgewinnen. Um Gespräche mit der AfD kommen wir gar nicht herum.
Wo liegt Ihre Grenze, wenn es um die AfD geht?
Wir müssen unterscheiden zwischen strafrechtlich relevanten und grundgesetzwidrigen Haltungen und Handlungen einerseits und rechten sowie konservativen Haltungen und Forderungen andererseits. Einer Forderung nach Abschaffung unserer demokratischen Grundrechte werde ich mit allen legitimen Mitteln entgegentreten. Intoleranz ist geboten gegenüber Hass und Menschenfeindlichkeit, egal woher sie kommen.
Was bedeutet das für die Bundesrepublik?
Erneut fordere ich eine Differenzierung. Es muss unterschieden werden zwischen sozusagen harmlosen politischen Forderungen der AfD und Aussagen dieser Partei, die böswillig, verdrehend, hetzerisch und rassistisch sind. Eine partielle Zusammenarbeit ist möglich, solange sich deren Politiker an die hierzulande geltenden Standards der Höflichkeit und des Respekts halten. Die demokratischen Parteien brauchen davor keine Angst zu haben. Es ist die AfD, die sich über kurz oder lang von ihren extremistischen Positionen verabschieden muss. Das gleiche gilt für die Partei die Linke und die Grünen. Viele AfD- und Linke-Positionen sind wenig aufregend. Wir sollten uns freuen, ein Mehrparteiensystem zu haben, dass uns eine politische Auswahl anbietet. Und wir sollten uns von keiner Seite in ein Meinungskorsett oder Begrenzungswettbewerb zwingen lassen. Man kann Fahrradfahrenund Atomstrom für gute Ideen halten.
Halten Sie die Forderung „Kein Islam in Sachsen“ für legitim?
Auf alle Fälle, sofernnicht gleichzeitig und zusätzlich Hass auf Muslime geschürt wird. Mich hat immer irritiert, dass politische Forderungen vermeintlich mit einer Entwertung des Gegners einhergehen müssen. Mir hat diese Verknüpfung nie eingeleuchtet. Haben die Hasser so wenig Vertrauen in ihre Argumente?
Wie stellen Sie sich gegen die AfD ein?
Zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft gehören Auseinandersetzung und Streit. Ich selbst sympathisiere nicht mit der AfD. Aber ich kann es auch nicht gutheißen, wenn man alle Wähler der AfD als Faschisten bezeichnet. Solange die Partei nicht verboten ist, müssen wir sie am politischen Diskurs teilhaben lassen. Andererseits stört mich eine Verrohung der politischen Auseinandersetzung, nicht nur bei der AfD. Auch andere Parteien und Gruppierungen sind nicht frei davon.
AfD und Pegida behaupten, sie seien das Volk. Sie haben eine Aversion gegen so gut wie alle Institutionen, die unsere Demokratie ausmachen.
In der Tat, das ist absurd. Es ist absurd zu behaupten, „die“ Politiker seien korrupt, „das“ Parlament sei eine Schwatzbude, „die“ Journalisten Handlanger der Regierung und Deutschland eine Diktatur. Es ist absurd, so zu tun, als werde das Land mit Muslimen „überschwemmt“, es ist absurd zu behaupten, wir stünden kurz vor einer „Islamisierung“. Aber sind diese Parolen so viel absurder als die, die auf der anderen Seite des Stammtisches verbreitet werden? Was ist mit dem „totalitären Überwachungsstaat“, in dem wir angeblich leben, mit dem „Finanzkapital“, das uns beherrscht, mit der „Finanzoligarchie“, die Griechenland kaputt sparen will, was mit dem Freihandelsabkommen, das uns angeblich mit Chlorhühnchen vergiften will?
Mich stört noch etwas anderes an den Journalisten, eigentlich sehr viel.
Lassen Sie hören.
Viele versuchen, der interviewten Politiker anhand objektiver Dilemmata in die Enge zu treiben. Manchmal wünschte ich mir die Gegenfrage: Was würden Sie denn machen? Was schlagen Sie vor? Journalisten sind in der bequemen Rolle zu kritisieren, ohne sich um Lösungen kümmern zu müssen.
Diese Unwucht ist tendenziell gefährlich. Sie kommt über Kritik nicht hinaus und lässt Politiker als dumm oder überfordert erscheinen. Ich habe Verständnis dafür, dass Helmut Kohl dem „Spiegel“ nie ein Interview gegeben hat.
Politiker haben allerdings gelernt, mit den Gepflogenheiten umzugehen. Viele ergehen sich in Floskeln. Da vermisse ich die kritische, sachkundige Nachfrage.
Bitte erlauben Sie mir zu sagen, dass ich diese Konstellation akzeptiere, manchmal geradezu dankbar war, wenn unbedarft fragende Journalisten nicht nachbohrten. Die Reporter bekommen ihr Interview und ich meine Ruhe, um die nächsten Entscheidungen vorzubereiten.
Welche Interviewform schätzen Sie am meisten?
Das Gespräch, den Austausch, bei dem sich etwas entwickelt, die Lust am Nachdenken, das Herausschälen von Problemen, das Abgleichen von Positionen, so dass als Höhepunkt eventuell eine Meinungsänderung herauskommt – zumindest ein differenziertes Urteil.
Herr Schmidt, ich danke Ihnen für das Interview.
Gerne. Ich bekomme die Abschrift von Ihnen doch zum Gegenlesen?
10. 2. Schrieb eine Rezension über Klaus-Jürgen Bruder, Christoph Bialluch, Bernd Leuterer, Jürgen Günther (Hg.)Paralyse der Kritik – Gesellschaft ohne Opposition? Psychosozial Verlag Gießen 2019, erneut für das Ärzteblatt/Ausgabe PP.
Man kann dieses Buch nur verstehen, wenn man sich klarmacht, dass die Autoren aus einer linken, kapitalismuskritischen Position heraus die deutsche Gesellschaft und darüber hinaus gesellschaftliche Entwicklungen in der ganzen Welt betrachten. Sie stellen mit Erstaunen fest, dass ihre Kritik am Kapitalismus, der ihrer Ansicht nach im Gewande des Neoliberalismus die Demokratien unterwandert, nicht mehr die einzig mögliche fundamentale Oppositionshaltung ist. Eine grundsätzliche Kritik an der Demokratie werde zunehmend von einer konservativen und rechten politischen Warte aus übernommen. In einigen Staaten, darunter auch Demokratien, würden sich Protestwähler nationalistischen und rassistischen Parteien zuwenden, die sich zugleich globalisierungskritisch geben. Dies ist die erste These der Herausgeber.
Die zweite These lautet: Der sogenannte Neoliberalismus werde durch die „politischen Eliten zu unrecht als Garant von Demokratie und Freiheit präsentiert“. Zugleich unterstellen die vier Herausgeber den neoliberalen Eliten, dass sie die rechten, nationalistischen und rassistischen Bewegungen hervorgerufen und gestärkt haben. Neoliberalismus und rechte Parteien werden von ihnen umstandslos in eins gesetzt. Auch sonst hantieren die Autoren manipulativ mit Begriffen. Unversehens mutiert der Neoliberalismus zu einer rechten, dann zu einer rechtsradikalen und ganz schnell zu einer nationalistischen und rassistischen politischen und ökonomischen Haltung.
Dritte These: Es gebe im öffentlichen Diskurs keine Alternative mehr zum neoliberalen Mainstream. Gemeint ist: Eine sozialistisch-marxistisch-leninistische Fundamentalopposition gegen einen neoliberalen Kapitalismus ist derzeit nicht auszumachen. Man kann das Fehlen einer Opposition beklagen, wenn man nur sich selbst als Opposition sieht und alle anderen kapitalismuskritischen Positionen ausblendet.
Viertens scheint den Herausgebern und einigen der über 30 Autoren des Sammelbandes eine Art Revolte und „große Verweigerung“ als Reaktion auf diese Entwicklung vorzuschweben. Sie beziehen sich dabei auf Herbert Marcuse, dem Kritiker des modernen Kapitalismus zur Zeit der westdeutschen Studentenbewegung vor 50 Jahren. Die Entwicklung seitdem erscheint Herausgebern und Autoren als „verschärfte Krise des Kapitalismus“ in Verbindung mit einem „allgemeinen Niedergang sämtlicher sozialer Beziehungen“. Wissenschaft, Bildung und Gesundheitswesen unterstünden dem direkten Diktat der Kapitalakkumulation. Die „große Verweigerung“ blieb aber schon unter Marcuse verschwommen. Wem oder was soll man sich verweigern?
Seltsamerweise gebiert dieser angeblich hegemoniale Kapitalismus eine unübersehbare Fülle von oppositionellen Bewegungen und Projekten, von Occupy über Fairtrade bis zur ökologischen Landwirtschaft. Obwohl es diese bunte Opposition nach den Gesetzen des Kapitalismus (wie sie sich die Autoren vorstellen) nicht geben dürfte, erhoffen sich die Autoren von ihr eine antikapitalistische Gegenöffentlichkeit. Was aber fehle – dies die fünfte These – sei ein Zusammenschluss dieser Gegenöffentlichkeit, um die Schlagkraft zu erhöhen. Die Autoren wollen nichts weniger, als das gesamte „System“ zum Einsturz zu bringen, und dies unter den Schlagworten von Solidarität, Kooperation, Gemeinsinn und einer ominösen „Wiederaneignung des Lebens“.
Damit wird psychologiehistorisch angeknüpft an die Gesellschaftskritik Sigmund Freuds, dessen Religionskritik und Analyse des „Unbehagens in der Kultur“ (1930) legendär sind. Freud setzte das über sich selbst aufgeklärte Individuum als Antipode zu einer mehr oder minder bewusstlosen Massenexistenz. Einige Autoren des Sammelbandes erhoffen sich von einem bedingungslosen Grundeinkommen (anstrengungslose staatliche Alimentierung, ASA) die Entfesselung des vermeintlich vorhandenen kreativen Potenzials in der Bevölkerung. Ob damit die allenthalben diagnostizierte Spaltung der Gesellschaften in links und rechts, oben und unten, reich und arm, Mann und Frau, Homo und Hetero usw. aufgehoben werden kann? Der Mensch erscheint in den Aufsätzen durchgängig als Opfer einer finsteren kapitalistischen Macht und von manipulierenden Eliten. Wie daraus ein selbstbefreites Subjekt entstehen soll, bleibt schleierhaft.
Der Denkfehler der meisten dieser Autoren besteht darin, dass sie den Grund für den mangelnden Zuspruch für ihre marxistisch-leninistischen Ideen in einem großen Verblendungszusammenhang und einer neoliberalen Unterdrückungsverschwörung sehen. Die Idee, dass einfach kein Interesse am Sozialismus besteht und die Ablehnung dagegen eventuell begründet ist, kommt ihnen nicht in den Sinn. Das Internet als bidirektionales Medium scheint der Hauptthese von der Paralyse der Kritik und der oppositionslosen Gesellschaft fundamental zu widersprechen. Hier können sich Einzelstimmen größtenteils frei äußern und sich zu Meinungsstürmen zusammenballen. Anfänglich feierten wir das Internet als Durchbruch zu einer weltweiten Kommunikation. Heute entpuppt es sich als Maschinerie der weltweiten Manipulation.
Die linke Intelligenzija, die politische Linke, steht nach dem Scheitern des marxistischen Großprojekts und dem angenommenen Ende der Erzählung von Aufklärung und Sozialismus vor einer fundamentalen Legitimationsfrage. Die politische Linke ist unwillig zum Kompromiss, verweigert den Konsens und stellt auch keine Tröstung in Aussicht. Schon länger scheinen linke Psychoanalyse und linke Kapitalismuskritik nicht mehr als eine marginale Partisanenrolle ausfüllen zu können.
11. 2. Am 29. Juni 2019 wandte sich eine Gruppe von Ausbildungskandidaten der Psychotherapie an offenbar alle Ausbildungsinstitute in Deutschland mit der Bitte, ihre Initiative „Psychotherapists/Psychologists for Future" zu unterstützen. Ihr Vorbild ist die Bewegung „Fridays for Future". Die Initiative will diese Bewegung unterstützen, unter anderem durch eine „Verwandlung von Angst in aktive Veränderungsprozesse“. Die Initiatoren betreiben eine eigene Web Page und sind international vernetzt. In der August-Ausgabe desDeutschen Ärzteblattes/Ausgabe für Psychologische Psychotherapeuten (Ausgabe PP, S. 354) veröffentlichte ich einen kurzen Kommentar mit einigen Bedenken gegen die Initiative:
Ich sehe die Initiative der Ausbildungskandidaten aus fachlichen Gründen kritisch. Ein erster Einwand richtet sich gegen die Annahme der Initiatoren, nur die Leugner einer Klimaveränderung würden jene bekannten psychischen Verhaltensweisen an den Tag legen, die Abwehr und Verdrängung genannt werden. Doch Verleugnung und Verdrängung und alle andern Abwehrmechanismen treten ubiquitär auf. Man findet sie mehr oder weniger bei allen Menschen. Es ist leicht nachzuweisen, dass auch Klima-Aktivisten nicht das gesamte Spektrum der Wirklichkeit im Auge haben. Ginge es wirklich darum, die Klimaerwärmung zu begrenzen, so müssten die fast emissionsfreien Kernkraftwerke länger laufen und neue gebaut werden, es müsste die Kohlendioxid-Verpressung in den Untergrund forciert und die Grüne Gentechnik gefördert werden, um schneller als mit herkömmlichen Methoden hitze- und trockenresistente Pflanzen zu züchten. Die angebliche Verdrängung und Verleugnung ließe sich auch damit erklären, dass in Deutschland und Europa die Auswirkungen eine Klimaerwärmung bislang kaum spürbar sind. Der Klimawandel wird in verschiedenen Teilen der Erde unterschiedliche Effekte haben. In Deutschland wird man eher wenig davon bemerken.