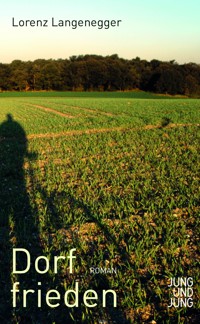Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet im Urlaub erreichen Manuel schlechte Nachrichten von zu Hause: Sein Vater ist tot. Dabei wollte er die Ferien nutzen, um sich klar zu werden, was er mit seinem Leben anfangen soll, bevor es für einen Anfang zu spät ist. Aber nicht nur die Zeit drängt, auch seine Freundin Sonja, die ihm, zumindest was ihre Beziehung angeht, eine Entscheidung abzunehmen droht. Dass der Vater eine Firma für Schlüssel hinterlässt, macht es nicht einfacher: Denn erstens ist sie so gut wie bankrott, und zweitens steht er nun mit drei Tonnen Rohschlüssel da. Der Versuch, sie loszuwerden, führt ihn bis nach Tansania. Und er stellt ihn auch vor die Frage: Was wollte ich immer schon werden – und was kann ich jetzt noch dafür tun? Lorenz Langenegger hat einmal mehr ein zutiefst menschenfreundliches, optimistisches Buch geschrieben. Mit liebevoller Gelassenheit gibt es uns eine Ahnung davon, dass es das Glück gibt, und erzählt mit feinem Humor von den Umwegen, bis wir es gefunden haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2022 Jung und Jung, Salzburg und Wien
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
eISBN 978-3-99027-188-9
LORENZ LANGENEGGER
Was man jetztnoch tun kann
Roman
Inhalt
TEIL I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
TEIL II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Blasser und Söhne, Nachfolger. In großen Lettern stand der Name über dem Schaufenster der Eisenwarenhandlung. Als Manuel eintrat, schlug die Tür gegen eine Glocke. Ein älterer Herr in blauem Arbeitskittel suchte für einen Kunden die richtige Schraube aus einer Lade. Er schob die Brille in die Stirn, um Länge und Durchmesser zu vergleichen. Als er die passende Größe gefunden hatte, rollte er aus einer Zeitungsseite eine Tüte, in die er zwanzig Stück abzählte. Er tippte den Preis in die Registrierkasse, die mit dem hellen Echo der Türglocke aufsprang. Der Kunde packte die Schrauben und das Wechselgeld ein. Manuel wartete, bis er sich verabschiedet hatte, dann stellte er sich vor und legte das Musterset seiner Schlüssel auf die Theke.
Er versuchte, die Rolle des Vertreters so gut wie möglich auszufüllen, aber das Lächeln auf seinem Gesicht fühlte sich fremd an. Es erinnerte ihn an einen Nachmittag in seiner Kindheit. Er ging noch nicht zur Schule. Sein Vater nahm ihn an der Hand, er bildete sich ein, den Druck zu spüren, warm und weich. Weshalb begleitete er ihn? Wohin fuhren sie? Sie traten durch ein riesiges Tor in eine Lagerhalle und warteten an einer Rampe. Ein Mann mit einem langen Bart kam auf sie zu, und als sein Vater ihm die Hand gab, erschrak Manuel. Das Gesicht seines Vaters hatte sich verändert, sein Lächeln und seine Stimme waren plötzlich fremd.
Manuel räusperte sich. Der Nachfolger von Herrn Blassers Söhnen drehte den Schlüssel zwischen den Fingern, wie um zu prüfen, ob er sich gut drehen ließ. Manuel glaubte, ein Bedauern in seinem Blick zu erkennen, und der Mann schüttelte den Kopf. Beschläge führe er noch, Schlüssel und Zylinder habe er aus dem Sortiment genommen. Heutzutage baue sich niemand mehr selbst ein Schloss ein, und für die wenigen Ausnahmen gebe es Ware aus China, aber damit wolle er nichts zu tun haben. Er wies mit dem Kopf nach draußen: Hundert Meter die Straße hinunter, Billig und gut.
In dem Laden mit dem anmaßenden Namen gab es auf knapp hundert Quadratmetern alles, was man für einen funktionierenden Haushalt brauchte. Die übervollen Regale, die bis zur Decke reichten, machten aus ihm ein Labyrinth, in dem wohl schon mancher Kunde auf der Suche nach einer Seifenschale oder einem Putzschwamm verloren gegangen war. Das Geschäft ersetzte die Eisenwarenhandlung, die Papeterie, das Elektrofachgeschäft und den Laden mit Küchenbedarf. Aschenbecher stapelten sich neben Bilderrahmen, Töpfe wurden im Dreierset angeboten, Kugelschreiber, Buntstifte und Haftnotizen lagen neben Hochzeits- und Kondolenzkarten. Manuel nahm einen Block mit Notenpapier in die Hand. Bunte Instrumente mit lachenden Gesichtern zierten den Deckel. Kalender gab es nicht nur vom kommenden Jahr, sondern zum halben Preis auch vom aktuellen und für neunundneunzig Cent sogar vom vergangenen Jahr. Er überlegte, wer sich für Kalender vom letzten Jahr interessieren könnte. Schriftsteller vielleicht? Er blätterte darin, für jeden Tag eine Seite, alle schon vergangen, trotzdem noch leer, die Wochenenden, die Feiertage und Vollmonde, das ganze letzte Jahr, in diesem schlichten schwarzen Büchlein hatte es nicht stattgefunden. Er nahm es mit, das war ihm neunundneunzig Cent wert.
Schachteln mit Elektrogeräten, vom Wasserkocher bis zum Bügeleisen, stapelten sich zu schwindelerregenden Türmen. Und natürlich gab es auch Schlüssel. Ein fertiges Set, zwei Schlüssel, ein Zylinder, sogar die Schrauben dazu, wurde für 4.99 Euro angeboten. Er drehte die Packung um: Made in China. Die Schlüssel hatten keine Bohrlöcher, sie waren auch nicht horizontal gespiegelt. Sie hatten Zacken, wie sie Linus Yale in Anlehnung an das altägyptische Fallstiftriegelschloss vor über einhundertfünfzig Jahren entwickelt hatte. Manuel fürchtete, dass die Eleganz seines Wendeschlüssels neben dem Preis des Zackenschlüssels nicht bestehen konnte. Er legte einen Euro für den Kalender auf die Theke, dann fragte er die junge Frau mit Kopftuch, die an der Kasse stand, ob sie die Geschäftsführerin sei. Sie musterte ihn mit ihren wachen, fast schwarzen Augen. Ob er sich beschweren wolle?
»Ich möchte ein Angebot machen.«
Sie stützte sich mit den Händen auf dem Ladentisch ab.
»Worum geht es?«
»Ich habe Schlüssel, die ich verkaufen möchte.«
Sie lachte.
»Schlüssel. Wie viele?«
»So viele Sie wollen.«
Die Frau drehte sich um, zog einen Vorhang zur Seite, hinter dem eine Treppe in den ersten Stock führte, und rief etwas, das Manuel nicht verstand.
»Warten Sie, mein Vater kommt gleich.«
Wenig später trat ein eleganter Mann in einem hellen Leinenanzug und Sandalen durch den Vorhang.
»Was sind das für Schlüssel, die Sie verkaufen wollen?«
»Horizontal gespiegelte Bohrmuldenschlüssel.«
Manuel zog das Musterset aus seiner Jackentasche und überreichte es ihm. Der Mann drehte einen Schlüssel prüfend zwischen den Fingern, seine Tochter nahm ihm das Lederetui aus der Hand und strich über die glatte Oberfläche. Manuel machte Werbung für die Qualität, die Beständigkeit und die einfache Handhabung der Schlüssel. Zufrieden registrierte er, dass der Mann das eingeprägte Schweizerkreuz entdeckte. Er nahm seiner Tochter das Etui aus der Hand, legte den Schlüssel hinein und gab es ihm zurück.
»Woher haben Sie diese Schlüssel?«
»Von meinem Vater.«
Mit einer einladenden Geste schob der Mann den Vorhang zur Seite und bat Manuel voranzugehen.
I.
1
Die Fähre legte ab, die Taue wurden eingezogen. Manuel stellte sich an die Ecke über den Seilzügen und lehnte an der Reling. Die Autos und Menschen am Hafen wurden kleiner. Niemand winkte, kein Kind hoffte, die Aufmerksamkeit eines Fremden auf sich zu ziehen. Fähren gehörten auf Procida zum Alltag wie anderswo Nahverkehrszüge. In der Marina Grande kreuzten sich die an- und ablegenden Traghetti und Aliscafi, Manuel waren die Fähren lieber. Sie waren langsamer. Sie hatten ein offenes Deck, auf dem ihm der Wind die Haare in Unordnung brachte, auf dem er das Meer roch und die dreckig schwarzen Abgase des Schiffsdiesels, die der Wind von den Kaminen riss.
Der Anruf hatte ihn am Vorabend kurz nach zehn Uhr erreicht. Er saß auf der Dachterrasse, wie so oft, seit Sonja und er ihre Koffer vor zehn Tagen die Treppe in die Ferienwohnung hinaufgetragen hatten. Sein Weinglas war leer. In der Ferne tauchten die Lichter von Neapel den Abendhimmel in ein schmutziges Gelb. Er gähnte und hielt sich dabei die Nase zu. Seit ihrer Ankunft irritierte ihn ein leises Geräusch. Er hatte verschiedene Erklärungen dafür gefunden, die ferne Brandung, der Wind, die Mauersegler, die über der Terrasse kreisten. Wenn der Lieferwagen vor dem Gemüseladen den Motor startete, der Händler seine Ware anpries oder eine Passantin mit der schwerhörigen Vermieterin plauderte, hörte er es nicht. Jetzt aber war es still, kein Motorboot hüpfte über die Wellen, kein Hund bellte, die Glocken hingen stumm im Turm. Er horchte in sich hinein. Am ehesten glich das Geräusch einem leisen, gleichmäßigen Schnaufen, das angenehm faule Geräusch eines friedlich schlafenden Menschen, der gleichzeitig durch die Nase und den halb geöffneten Mund atmet.
Manuel stieg die Stufen hinunter in die Wohnküche, um sich Wein nachzuschenken. Sonja hob den Blick von ihrem Buch, lächelte und legte die Hand über ihr Glas. In ihrem Gesicht sah er erste Zeichen von Müdigkeit. Manuel beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss auf die Lippen. Ihm ging die Frage nicht aus dem Kopf, die sie ihm am Nachmittag gestellt hatte.
»Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht?«
Sie waren nebeneinander an einer Abschrankung aus Holz gestanden und hatten in den Hof eines Hauses geschaut, wie schon in so viele Häuser und Tempel an diesem Nachmittag. Die Tafel erklärte, dass es sich um die Villa eines reichen Kaufmanns handelte, der an einem verhängnisvollen Spätsommertag im Jahr 79 mitsamt seiner Heimatstadt untergegangen war.
»Wie meinst du das?«, fragte Manuel, obwohl er genau wusste, was sie meinte.
»Die letzten Monate. Was hast du gemacht?«
»So einfach ist das nicht«, wich er aus.
»Es hat niemand behauptet, dass es einfach ist.«
Als Manuel mit dem vollen Weinglas wieder auf der Dachterrasse stand, klingelte sein Telefon. Eine Schweizer Nummer. Er dachte an seinen Vater, der sich am Tag zuvor selbst ins Krankenhaus eingeliefert hatte. Am Abend hatte er Manuel angerufen, wie ihm schien mehr aus Langeweile, als um ihm mitzuteilen, dass er im Krankenhaus lag. Eine Streifung, nichts Ernstes, Lähmungserscheinungen im linken Arm, Kopfschmerzen, er werde zur Beobachtung über Nacht bleiben, seine Blutdruckmedikamente würden neu eingestellt, eine Routinesache. Manuel hatte ihm nicht widersprochen. Der Gedanke, dass eine Streifung nur ein netteres Wort für einen Schlaganfall war und dass ein Schlaganfall in seinem Alter durchaus gefährlich sein konnte, kam ihm erst jetzt. Er nahm den Anruf entgegen.
Der behandelnde Arzt fragte, ob er mit Manuel Keller spreche, dem Sohn von Helmut Keller, und teilte ihm dann in trocken professionellem Ton mit, dass sein Vater gestorben sei. Ein zweiter Schlag hatte ihn im Garten des Krankenhauses niedergestreckt. Jede Hilfe war zu spät. Das Gespräch mit dem Arzt dauerte keine Minute. Was hatte sein Vater um diese Zeit im Garten gemacht? Warum war er nicht medizinisch überwacht worden? Hatte er die richtigen Medikamente bekommen? Von all den Fragen, die er hatte, stellte Manuel keine. Er starrte sein Telefon an und wusste, dass er seinen Bruder Matthias anrufen musste, seinen Onkel, ein Bestattungsunternehmen, den Pfarrer, die Friedhofsbehörde, den Anwalt, den Notar. Er musste eine Todesanzeige aufgeben, eine Adressliste erstellen. Er musste einen Trompeter finden, der am Grab das Krakauer Trompetensignal spielte. Er musste ein Restaurant für das Leichenmahl reservieren, sich für eine Speisenfolge entscheiden, einen leichten Rotwein aussuchen, mit dem die Freunde vom Segelclub und die Geschäftspartner zufrieden sein würden. Er musste sich setzen.
Manuel ließ sich auf den Stuhl sinken. Er befahl sich, das Telefon auf den Tisch zu legen, damit es ihm nicht aus der Hand fiel. Dann stützte er den Kopf ab und starrte auf den leeren Bildschirm, sicher, dass ab sofort nichts mehr sein würde, wie es gewesen war. Gleichzeitig ahnte er, dass die Dinge ihren Lauf nehmen würden, dass um ihn herum alles weiterginge wie bisher.
Anders als mit dem Schiff war Procida nicht zu erreichen. Neben dem kleinen Krankenhaus gab es zwar einen Hubschrauberlandeplatz, ein gelbes, eingekreistes H auf dem Asphalt, aber in den zehn Tagen, die sie auf der Insel verbracht hatten, war das Brummen der Fähren kein einziges Mal vom Flappen der Rotoren übertönt worden. Überhaupt sah der schlichte weiße Bau so verlassen aus, dass man sich schwer vorstellen konnte, dass es hier Kranke und Gebrechliche gab, dass hier geboren und gestorben wurde.
»Manuel?«
Er konnte nicht sagen, ob eine Minute oder eine Stunde vergangen war, bis Sonja auf die Terrasse kam, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Sie hatte noch die Spange im Haar, mit der sie beim Abschminken die Strähnen über der Stirn fixierte.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Vater ist tot.«
Sie schauten einander an. Manuel nickte.
»Ein zweiter Schlag.«
Sonja schossen die Tränen in die Augen. Er wusste nicht, wie er sie trösten könnte.
»Sein Arzt hat angerufen.«
»Er hat mir vor einer Woche von der Regatta erzählt, die er beinahe gewonnen hätte.«
»Du redest mit meinem Vater?«
»Manuel!«
»Hat Helmut dich angerufen?«
»Er war nie krank.«
»Er war schrecklich, wenn er krank war.«
»Das tut mir so leid. Ich …«
Sonja brach den Satz ab. Sie ging auf Manuel zu. Er hielt ihr die Hand hin. Sie drückte sie und blieb hilflos neben ihm stehen.
»Kommst du mit nach Zürich?«
»Natürlich.«
»Und Venedig?«
»Venedig ist egal.«
Sonja stellte sich neben ihn an die Reling und legte ihm den Arm um die Hüfte. Die Berührung tat gut, ihre Wärme linderte den Druck auf seiner Brust.
Er las ein letztes Mal die blaue Schrift auf dem weißen Haus über dem Hafen: Istituto Nautico. Die Italiener um sie herum wendeten sich vom Hafen ab. Sie schnippten die Stummel der Zigaretten, die sie sich bei der Abfahrt angezündet hatten, ins Meer, und nahmen das Kommende in den Blick. Arbeit, Besorgungen, ein Gespräch mit dem Bankberater in Neapel, Vorlesungen an der Universität, Besuche bei Verwandten, die aufs Festland gezogen waren. Ob sie aus Sicht der Insulaner Gemachte oder Gescheiterte waren?
Sonja und ihm war Procida trotz mancher Widrigkeiten ans Herz gewachsen. Eine Handvoll kleine Hotels gab es auf der Insel, dazu einige Ferienwohnungen. Die Gassen waren eng, die Autos und Motorräder zahlreich. Abgesehen von der Hauptachse waren alle Straßen Einbahnen. Als Fußgänger waren sie gezwungen, sich an Hauswände und Mauern zu drücken. An einer Ecke mit eingeschränkter Sicht waren zwei Polizisten damit beschäftigt, alle fünfzehn Minuten für einen der kleinen Linienbusse den Verkehr aufzuhalten. Weil die vier Quadratkilometer große Insel, die wie eine versteinerte Riesenkrake im Golf von Neapel lag, von zehntausend Menschen bewohnt wurde, gab es auf der Insel kaum einen Flecken Grün, zumindest keinen öffentlich zugänglichen. Hinter ihren Mauern und Häusern hatten die Bewohner von Procida prächtige Gärten angelegt. Die Zitronenbäume blühten das ganze Jahr. Anders aber als das große Ischia und das berühmte Capri, die für so viele Sehnsüchte herhalten mussten, fristete die Insel ein ruhiges und zurückgezogenes Dasein.
Sonja schob ihren Koffer neben eine Bank und setzte sich. Manuel blieb stehen. Sein Blick klammerte sich an die Häuser, die kleiner wurden, an die flanierenden Menschen auf der Hafenstraße, deren Lachen und Rufen er nur noch in der Erinnerung hörte, an den Eisverkäufer, das Fischrestaurant, an die zwei kleinen roten Türme in der Hafeneinfahrt. Er starrte das alles an, als ob es sich um ein Kippbild handelte, das er nur lange und konzentriert genug betrachten musste, damit die Häuser wieder größer wurden und die Italiener sich zurück an die Reling stellten, eine Zigarette anzündeten, um zuzuschauen, wie die Fähre anlegte. Die zwei Wochen würden noch einmal von vorne beginnen. Sein Vater lebte. Er hatte Zeit, sich eine Antwort auf Sonjas Frage zu überlegen, was er die ganze Zeit gemacht hatte. Und wenn sein Vater anrufen würde, um ihm mitzuteilen, dass er sich zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben hatte, würde sich Manuel nicht beruhigen lassen. Er würde sich mit dem behandelnden Arzt in Verbindung setzen und ihm klarmachen, dass er den Ernst der Lage nicht unterschätzen durfte, nur weil sein Vater seine Beschwerden kleinredete.
Es war umsonst, das Bild kippte nicht. Die Zeit auf der Insel war vorbei. Helmut Keller war tot.
Manuel machte sich Sorgen, als er Matthias anrief. Wie würde sein kleiner Bruder auf die Nachricht reagieren? Matthias hatte seinen Anruf schon erwartet. Er war auf dem Weg ins Krankenhaus, obwohl er nicht wusste, was er da tun sollte. Er wirkte gefasst.
»Ich komme morgen nach Zürich.«
»Gut.«
»Kann ich bei euch wohnen?«
»Bei uns?«
Sein Bruder schwieg und hoffte, dass Manuel die Frage zurücknahm, damit er ihn nicht enttäuschen musste.
»Du weißt doch, das Gästebett steht im Büro, und Sybille muss lernen, sie hat in einem Monat ihre Anwaltsprüfung. Ich bin ohnehin ständig im Institut. Kannst du nicht im Haus wohnen?«
Ihre Eltern hatten das Einfamilienhaus, das in den sechziger Jahren erbaut worden war und den ersten Besitzern kein Glück gebracht hatte, erworben, als seine Mutter mit Manuel schwanger war. Das Haus lag in einer ruhigen Wohnstraße mit automatischen Garagentoren und war umgeben von abgezäunten Vorgärten. Wenn er in der Schweiz war, wohnte er meistens ein, zwei Tage zu Hause. In seinem Kinderzimmer hatte er die Poster von den Wänden genommen, die Einrichtung aber war noch die gleiche. Das Zimmer daneben gehörte seinem kleinen Bruder. Matthias war neun Jahre jünger. Er wurde gezeugt, als ihre Eltern die Hoffnung auf ein zweites Kind aufgegeben hatten. Diesen trotzigen Schalk hat er sich bis heute erhalten. Für Manuel war es aufregend, mit neun Jahren einen Bruder zu bekommen, aber zu gebrauchen war er nicht. Als er endlich einen Ball halten konnte, fing Manuel an, sich für Mädchen zu interessieren.
»Kein Problem. Jemand muss die Pflanzen gießen. Und wie ich Vater kenne, ist der Kühlschrank voll.«
Matthias seufzte.
»Es tut mir leid. Ich habe keine Zeit.«
»Wir schaffen das.«
»Nächste Woche präsentieren wir unser Forschungsprojekt. Das ist jahrelange Arbeit.«
»Ich bin ja da. Mach dir keine Sorgen.«
»Danke.«
Eine knappe Stunde später schickte er ihm eine Nachricht: Fast ganz der Alte. Das weiße Haar aufwändig zerzaust. Die Brille trüb und dreckig wie immer.
Die Brille seines Vaters, Manuel musste lachen, es war seit Jahrzehnten das gleiche Modell. Ein für die dicken Gläser viel zu feiner Goldrand, Plastikflügel, die vom Talg und Schweiß nach wenigen Monaten vergilbten und mit den Jahren brüchig wurden. Er tauschte die Brille erst gegen eine neue ein, die möglichst gleich auszusehen hatte, wenn es nicht mehr anders ging, wenn ein Bügel abgebrochen oder so verbogen war, dass sie von der Nase rutschte. Sein Optiker war ein ehemaliger Schulfreund, wobei sie beide nicht mehr mit Sicherheit sagen konnten, welche Klasse sie gemeinsam besucht hatten.
Sonja hob den Blick von ihrem Buch. Sie blinzelte in die Sonne und schloss die Augen. Sie hatten die Ausgrabungen von Pompeji besucht. Sie waren eine Nacht in Sorrent geblieben. Sie staunten im Museo Archeologico in Neapel über die prächtigen Fresken des Isistempels und wunderten sich über die jungen Frauen, die auf einem Laufsteg im Prunksaal vor dem prüfenden Auge einer Kamera auf und ab gingen, entschlossen, den Außenbezirken der Hafenstadt zu entkommen. Auf dem Rückweg von Procida nach Wien hätten Sonja und er drei Tage in Venedig bleiben wollen. Es kam anders, statt in die Lagune reisten sie überstürzt ab. Manuel flog von Rom nach Zürich, Sonja nach Wien. Sie hatte dringende Termine vorgezogen, andere abgesagt. Die Beerdigung fiel in die erste Woche nach ihrem Urlaub. Manuel hatte sie darin bestärkt, in Wien zu regeln, was geregelt werden musste, und dann erst nach Zürich zu kommen.
Im Zug von Neapel nach Rom redeten sie wenig. Sonja zeigte aus dem Fenster, wenn ihr draußen etwas besonders gut gefiel. Manuel versuchte sich zu erinnern, wie es sich angefühlt hatte, als seine Mutter gestorben war. Die Ereignisse waren merkwürdig weit weg. Vielleicht war es der Schock, der sie in die Ferne rückte? Die Nachricht vom Tod seines Vaters hatte nicht die gleiche Wucht. Er hatte ihn aus dem Krankenhaus angerufen. Sie hatten darüber geredet, wann Manuel das nächste Mal in Zürich sein würde. Hatte er eine Vorahnung gehabt?
Sonja legte die Stirn in Falten und schaute knapp an seinem Kopf vorbei, als ob hinter ihm jemand säße.
»Hast du …«
»Habe ich was?«
»Nichts.«
»Sag doch.«
»Es ist nichts. Ich wollte nur …«
»Ja?«
»Nichts. Wirklich.«
Manuel schaute über die Schulter, um sich davon zu überzeugen, dass hinter ihm niemand war.
»Bist du sicher, dass du das alleine schaffst? In Zürich?«
»Ich bin nicht alleine. Matthias ist auch da.«
»Ich komme, so schnell ich kann.«
»Möchtest du auch einen Kaffee?«
Sie schüttelte den Kopf und vertiefte sich in ihr Buch. Er blieb sitzen und verschob den Besuch im Speisewagen auf später.
»Matthias präsentiert nächste Woche sein Forschungsprojekt.«
Sonja verstand nicht, was er ihr damit sagen wollte. Sie hatten sich auf Venedig gefreut und in ihrem Lieblingsrestaurant einen Tisch reserviert. Sie wollten den Abschluss des Urlaubs feiern, ein letztes Mal ausgelassen sein, bevor sie in Wien der Alltag wieder einholte. Jetzt war alles anders.
Manuel stand auf und fragte Sonja noch einmal, ob sie einen Kaffee möchte. Sie schaute verständnislos von ihrem Buch auf, als ob er eine fremde Sprache sprechen würde. Breitbeinig, wie auf unsicherem Boden, ging er durch den Zug. Im Zwischengang vor dem Speisewagen blieb er stehen. Er lehnte mit der Stirn gegen die kühle Scheibe. Die Vorstellung von seinem Alltag in Wien lag wie eine schwere Last auf ihm. Sein Vater war tot, aber sonst war alles wie immer. Er hatte Zeit, viel Zeit, aber noch mehr Fragen. War es ein Fehler gewesen, die Stelle in Zürich zu kündigen? Machte er sich etwas vor, wenn er glaubte, noch einmal neu anfangen zu können? Und wenn doch, wie könnte dieser Anfang aussehen? Er war den Antworten nicht näher gekommen, im Gegenteil, die Zweifel wurden mit jedem Tag größer. Erst als er sich in Erinnerung rief, dass er auf dem Weg nach Zürich war, wurde ihm leichter. Er freute sich und hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Die Reise war kein Grund zur Freude.
Sonja saß mit unveränderter Miene da, als er mit dem Kaffee aus dem Speisewagen zurückkam.
»Ich komme mit dir nach Zürich. Ich fahre nicht nach Wien.«
»Natürlich fährst du nach Wien.«
»Du willst, dass ich nach Wien fahre?«
»Nein.«
Sie schauten einander an.
»Ich habe nichts gemacht.«
»Was hast du?«
Sonja wusste nicht, wovon er redete. Manuel setzte sich und nahm den Deckel vom Kaffeebecher. Sonjas Buch lag aufgeschlagen auf ihrem rechten Knie. Seit sie im Zug saßen, hatte sie noch keine Seite gelesen.
»Die letzten Monate. Ich habe nichts gemacht.«
»Schade.«
Einmal noch, kurz vor Rom, nahm Sonja das Buch zur Hand. Als sie in den Bahnhof einfuhren, blätterte sie zwei Seiten zurück und legte die Postkarte mit den Fresken aus dem Isistempel, die sie im Museo Archeologico gekauft hatte, an den Anfang des Kapitels.
2
Manuel hatte sich nie überlegt, was er einmal werden wollte. Als Kind schrieb er in die entsprechende Zeile der Freundschaftsbücher seiner Klassenkameraden: Komponist. Als er zwölf Jahre alt war, erklärte ihm Daniela, dass Komponist kein richtiger Beruf sei, nichts, was man werden könne. Um Komponist zu sein, müsse man tot sein. Ob er nicht lieber Bankdirektor werden wolle?
Daniela war seine erste Freundin. Wenn er die zwei Tage dazuzählte, in denen sie im Klassenzimmer heimlich Zettelchen austauschten, dauerte ihre Beziehung eine Woche. Vielleicht hätte sie länger gehalten, wenn er nachgegeben hätte, aber in seiner Klasse wollten bereits Martin und Heinz Bankdirektor werden, und Heinz mochte er nicht. Er war der Einzige, der in der Reihe vor ihm stand, wenn sie sich der Größe nach aufstellen mussten. Roman, sein bester Freund, wollte Programmierer werden, aber weil Manuel nicht wusste, was das bedeutete, konnte er sich ihm nicht anschließen. Als er Daniela viele Jahre später bei einem Klassentreffen wiedersah, war aus ihr eine Chefsekretärin in einem Beratungsunternehmen geworden. Heinz war kein Bankdirektor, aber er fuhr ein schnelles Auto und machte etwas mit Finanzen.
Obwohl ihre Beziehung das erste Wochenende nicht überdauerte, ging Manuel nicht aus dem Kopf, was Daniela gesagt hatte. Er fragte seine Mutter, ob Komponist ein richtiger Beruf sei. Sie zögerte, weshalb er das wissen wolle. Seine Mutter war die Letzte, mit der er über seine unglückliche Liebe reden wollte. Er lernte, dass es noch zu früh war, um sich über Berufswünsche den Kopf zu zerbrechen.
Als Manuel mit zwanzig aus dem Elternhaus auszog, kam er in einer Wohngemeinschaft mit einem Fotografen und einer Mathematikstudentin unter. Er schrieb sich an der Universität ein, Politikwissenschaft und Publizistik, mehr Zeit als in den Seminarräumen und Hörsälen verbrachte er aber in den Lokalen um die Universität herum, wo das Bier nicht zu teuer und die Musik laut genug war. Obwohl er nach dem Grundstudium immer noch nicht wusste, was er einmal werden wollte, war er überzeugt, dass er an der Universität nicht lernte, was er für das Leben brauchte. Er rief seinen Vater an, um ihm mitzuteilen, dass er die Rechnung für die Studiengebühren nicht weiter bezahlen musste.
»Was bedeutet das?«, wollte der wissen.
»Ich unterbreche mein Studium.«
»Und was machst du stattdessen?«
Manuel fing bei Roman an. Sein Freund hatte noch vor dem Abschluss seines Informatikstudiums eine Restaurantplattform gegründet, die hungrige Gäste und freie Tische zusammenbrachte. Manuel brauchte keine Überredungskünste, um Roman davon zu überzeugen, ihn einzustellen. Es war unmöglich, im gleichen Tempo, wie die Plattform wuchs, vertrauenswürdige und fähige Mitarbeiter zu finden.
Ein paar Monate später lernte Manuel bei einem neuen Italiener, über den er eine Restaurantkritik schreiben sollte, Sonja kennen. Sie saß mit einer Freundin am Nebentisch und wunderte sich, dass er eine Flasche Wein und ein fünfgängiges Menü für sich allein bestellte. Als sich die Freundin mit einem Gähnen verabschiedete, nutzte Manuel den Moment und lud Sonja an seinen Tisch ein. Die Weinflasche sei noch halbvoll, wie er betonte. Er freute sich, dass sie BestResto kannte und auch nutzte. Übermorgen würde sie dort lesen können, wie das Essen heute geschmeckt habe. Dass er sie zum Lachen brachte, machte ihm Mut.
Als der Wirt sie kurz vor der Sperrstunde höflich aufforderte, den Garten zu verlassen, waren Sonja und Manuel sich einig, dass es zu früh war, um nach Hause zu gehen. Am nächsten Morgen blieben sie lange im Bett und frühstückten ausgiebig. Anschließend führte Sonja ihn über den Friedhof in die tropischen Palmenhäuser der Stadtgärtnerei. Sie saßen mehr als eine Stunde auf zwei Stühlen am künstlichen Teich und schauten den Schildkröten und Kois zu, die sich darin tummelten. Es genügte ihnen, dass sich die Fische mit vereinzelten Flossenschlägen in Position hielten, dass eine kleine Schildkröte den Panzer einer größeren bestieg, um der Wärmelampe näher zu kommen.
Was aus ihm schließlich geworden war, erfuhr Manuel, als er seine Anstellung kündigte, weil Sonja und er nach Wien zogen. Roman bat ihn, das Inserat gegenzulesen, das er in den einschlägigen Portalen schalten wollte. Die Firma suchte einen Content Manager (m/w), 50 Prozent. Geboten wurde ein attraktives Arbeitsumfeld in einer jungen Firma, flexible Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Von den Bewerbern wurden selbständiges, genaues und effizientes Arbeiten, sehr gute Sprachkenntnisse und ein abgeschlossenes Studium erwartet. Wer Manuels Stelle übernehmen wollte, musste besser qualifiziert sein als er, er musste belastbar sein und durfte auch in hektischen Zeiten die gute Laune nicht verlieren. Manuel druckte das Inserat aus und klopfte an Romans Bürotür.
»Ist das dein Ernst?«
»Kannst du mir die Korrekturen bitte schriftlich schicken.«
»In hektischen Zeiten die gute Laune nicht verlieren?«
»Das hat Annika so formuliert.«
»Wer ist Annika?«
»Annika macht seit einem Monat für uns die HR.«
»Was macht sie?«
»Schick es einfach raus.«
»Warum nur eine halbe Stelle? Das muss ein Fehler sein.«
Manuel hatte sein Arbeitspensum längst aufgestockt. Beim letzten Mitarbeitergespräch hatte er Roman darum gebeten, Administratives ans Sekretariat abgeben zu dürfen, um genügend Zeit für die inhaltliche Arbeit zu haben.
»Ich habe mit zwanzig Stunden angefangen. Du weißt, was seither alles dazugekommen ist.«
»Du tippst immer noch mit zwei Fingern.«
»Ich bin mit zwei Fingern fast so schnell wie…«
»Die jungen Leute sind fix.«
»Die jungen Leute?«
BestResto war eine klassische Garagenfirma, mit dem Unterschied, dass diese in Zürich nicht in Garagen, sondern an der Technischen Hochschule gegründet wurden. Roman, der sein Informatikstudium in Rekordzeit abgeschlossen hatte, wollte eigentlich Diplomat werden. Weil er aber in der zweiten Runde des Aufnahmetests beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten nicht weiterkam, konzentrierte er sich auf seine andere Leidenschaft: das gute Essen. Sein Programm entsprach den Bedürfnissen von Gästen und Restaurantbesitzern gleichermaßen. Schon in den ersten Jahren verbreitete es sich tausendfach, bald sprangen Großbrauereien und Lebensmittelkonzerne auf. Vordergründig vermittelte BestResto freie Tische an hungrige Gäste, veröffentlichte Speisekarten und pries Aktionen an, aber natürlich wurde es mit steigenden Klickzahlen und Nutzern zu einer immer attraktiveren Werbeplattform. Manuel war für launige Kritiken und die redaktionelle Betreuung von Nutzerkommentaren zuständig.
»Willst du den Rest deines Lebens Gastrokritiken schreiben?«
Sonja hatte sich bei einem großen Verlag erfolgreich um die Stelle als Vertreterin in Österreich beworben. In Zukunft würde sie zweimal im Jahr durch das Land reisen und Buchhandlungen zwischen dem Bodensee und dem Neusiedler See besuchen. In Wien hätte Manuel endlich Zeit, das zu machen, was er schon immer wollte. In Wien würde er, befreit vom Büroalltag, zu dem werden, der er war. Jahrelang hatte er für Roman gearbeitet, Tag für Tag, Woche für Woche saß er in seinem Büro, anfangs in einer Altbauwohnung nahe des Hauptbahnhofs, später in einem umgebauten Bogen eines stillgelegten Eisenbahnviadukts. Zu lange, wenn es nach Sonja ging. Manuel sträubte sich. Die Gründungsjahre der Firma waren aufregend gewesen. Er schätzte die Zusammenarbeit im Team und den kollegialen Umgang untereinander. Wenn er mit einem Text nicht vorankam, fand sich immer jemand für eine Partie Tischfußball. Die Strategiesitzung am Mittwoch brachte Abwechslung in den Alltag. Jeden ersten Freitag im Monat heizte Roman pünktlich um achtzehn Uhr den Grill an, bei jeder Witterung und Jahreszeit.
Sonja ermutigte Manuel, den Schritt nach Wien zu wagen.
»Du interessierst dich nicht wirklich für die Gastronomie.«
»Das stimmt so nicht, ich esse gerne gut.«
»Solange die Portionen groß genug sind.«
Ihrer Meinung nach bestand seine Arbeit in erster Linie darin, die Kommentarspalten zu moderieren. Eine Aufgabe für Sisyphos. Aber egal, ob man sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellte, für Manuel, so ihre Überzeugung, war es nicht das Richtige.
Sonja malte Wien in den schönsten Farben aus, die Kaffeehäuser, die Theater und Museen, die Psychoanalyse, wo würde Manuel bessere Voraussetzungen finden? Er schrieb seit Jahren, er hatte einen Stil entwickelt, seine Spitzen waren gefürchtet, sein Witz wurde geschätzt. In Wien würde er die Freiheit haben, zu schreiben, was er schreiben wollte. Im Vergleich zu Zürich waren die Lebenshaltungskosten niedrig. Er hatte einige Ersparnisse. Sie hatte eine sichere Anstellung. Und er würde endlich Zeit für das Wesentliche haben.
Manuel musste Sonja Recht geben, die Moderation der Kommentare nahm einen immer größeren Teil seiner Arbeitszeit in Anspruch, und es war keine erfreuliche Aufgabe, die Leute daran zu erinnern, höflich und rücksichtsvoll zu sein. Was aber war das Wesentliche?
3
Während er durch die Gänge des Flughafens ging, überlegte Manuel, woher das Heimatgefühl kam, das ihn befallen hatte, kaum war er aus dem Flugzeug gestiegen. Er war bestimmt nicht mehr als ein Dutzend Mal hier gelandet, oft gemessen an seinen Großeltern, die in ihrem Leben nie geflogen waren, selten aber im Vergleich zu den unzähligen Malen, die er aus den verschiedenen Himmelsrichtungen im Hauptbahnhof eingefahren war. Weshalb fühlte sich das Ankommen am Flughafen anders an? Waren es die glänzenden Oberflächen? Schnurgerade, makellose Fugen, kein loses Kabel, kein ungenauer Abschluss. Sein Vater war immer stolz gewesen auf die heimische Qualität und konnte sich maßlos ärgern, wenn Unbefugte mit dem Schweizerkreuz warben. Wenn Manuel die hohen Preise ansprach, schlug sein Vater auf den Tisch. Nicht teurer sei die Schweiz, sondern beständiger. Vielleicht wohnte Manuel deshalb nicht mehr hier, dachte er, weil ihm das Improvisierte lieb war, weil er dem Perfekten misstraute?
Bin gelandet und warte auf meinen Koffer. Fahre nach Hause. Wo und wann treffen wir uns?
Wie um seinen Vater zu widerlegen, drehte das Rollband der Gepäckausgabe auch nach dem Signalton leer seine Runden. Manuel schaute sich um. Grußbotschaften von Industriefirmen, digitaler Kuhglockenklang, Vogelgezwitscher. Er war erstaunt, dass ausgerechnet der Flughafen dieses wohlige, wehmütige Gefühl auslöste. Vielleicht war es die Trauer, die ihn dafür empfänglich machte? Obwohl Flugzeuge längst ein Fortbewegungsmittel für die Massen waren, bemühten sich viele Fluggesellschaften weiterhin, ihren Passagieren durch Zuvorkommenheit das Gefühl von Exklusivität zu vermitteln.