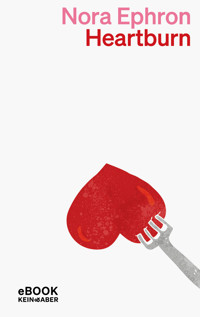13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Ich bin ein Riesenfan, fast schon Ephronologin." Dolly Alderton Nora Ephron ist Kult und dies ist ihr Kultbuch: Darin schreibt sie darüber, was es bedeutet, eine moderne Frau zu sein, deckt Tücken und Freuden, Hürden, Probleme und Chancen auf, und die kleinen Details, die wir alle zu gut kennen – vom ideellen Wert einer Handtasche über Diskriminierungen im Job bis hin zu grenzenloser Liebe zu Essen und den ersten Falten: ehrlich, klug, witzig und keineswegs gradlinig romantisch. Nicht zuletzt sind Ephrons Geschichten eine große Liebeserklärung an ihre Wahlheimat New York City. Ein absolutes Muss für jede Frau jeden Alters!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Ähnliche
Nora Ephron
Was nie im Trend lag, kommt auch niemals aus der Mode
Und andere Wahrheiten aus dem Leben einer Frau
Aus dem amerikanischen Englisch von Maria HummitzschMit einem Vorwort von Dolly Alderton
Atlantik
Vorwort
In ihrem Essay Serielle Monogamie: Ein Erfahrungsbericht schreibt Nora Ephron über ihre zahlreichen Liebschaften mit Kochbüchern und deren Autor*innen. Sie schildert, wie sie die Rezepte von Michael Field und Julia Child nachgekocht und dabei »in Gedanken Gespräche mit beiden« geführt hat. Zufälligerweise führe ich, seit ich mit Anfang zwanzig zum ersten Mal Was nie im Trend lag, kommt auch niemals aus der Mode gelesen habe, in Gedanken Gespräche mit Nora Ephron.
Wenn ich eine Kolumne beendet habe, lese ich sie Nora laut vor und höre, wie sie mich auf übertrieben blumige Passagen oder lahme Pointen hinweist. Schreibe ich einen Dialog, lässt sie mich wissen, welche Stellen unglaubwürdig klingen. Während der Arbeit an meinem Memoir habe ich sie immer wieder gefragt, ob ich ihre perfekte Balance zwischen weich und hart hinbekomme – zwischen Zynismus und Begeisterung, das richtige Verhältnis von Ausführlichkeit zu Kürze, die passende Dosis Realität, gemischt mit der passenden Dosis Romantik.
Ich frage sie in fast jeder Angelegenheit um Rat, und in meinem Alltag habe ich einzelne Sätze aus diesem Buch immer im Hinterkopf. Ich muss bei der Pediküre an sie denken (»Das Drittbeste an einer Pediküre ist, dass die Füße danach wirklich bezaubernd aussehen«), beim Kleiderkauf (»Man sollte niemals etwas kaufen, das zu hundert Prozent aus Wolle besteht«), wenn ich im Flugzeug nervös werde (»Das Flugzeug wird nicht abstürzen«) oder im Restaurant sitze (»Man sollte immer zu viel Trinkgeld geben«).
Alle vertrauen Nora. Ihre Stimme ist beruhigend und wunderbar direkt – vor allem in dieser Essaysammlung. Sagt sie einem, man solle Limabohnenauflauf mit Birnen kochen, kocht man Limabohnenauflauf mit Birnen. Sagt sie, man könne gar nicht zu viele schwarze Rollkragenpullover besitzen, kauft man bei Marks & Spencer die Kaschmirabteilung leer. Sagt sie, man brauche einen in den Schreibtisch eingebauten Papierkorb, geht man die IKEA-Möbel mit der Säge an. In einer Welt der verwirrend vielen Möglichkeiten versprechen Nora Ephrons anspruchsvolle, genaue, lehrreiche und praxiserprobte Weisheiten aus dem Mund einer gebildeten, stets in Schwarz gekleideten Frau Trost und Entlastung. Aus diesem Grund habe ich Was nie im Trend lag, kommt auch niemals aus der Mode öfter verschenkt als jedes andere Buch. Ich kaufe es so regelmäßig nach, dass ich es einigen Freundinnen doppelt überreicht habe, an zwei aufeinanderfolgenden Geburtstagen.
Und obwohl ich es auch an meine männlichen Freunde verschenke, sind diese mutig ausgesprochenen Wahrheiten über die triviale und politische Unübersichtlichkeit weiblichen Lebens vor allem ein Leitfaden für Frauen. Nora Ephron hat ihre Essays in einer Zeit vor den sozialen Medien geschrieben (um deren Moralmafia sie sich, davon bin ich überzeugt, nicht gekümmert hätte), und über die Anforderungen an die moderne Frau äußert sie sich erfrischend offen. Sie schildert einerseits ihre Verwirrung darüber, andererseits ihre stellenweise Anpassung daran – ein verwirrendes Dilemma, in dem sich viele Frauen täglich wiederfinden und das in jedem Fall Schuldgefühle erzeugt. Nora Ephron führt uns den Wahnwitz des Ganzen vor Augen und zeigt uns, wo sie sich fügt und wo sie rebelliert. Beispielsweise will sie sich nicht zu einer Handtasche überreden lassen, weil Handtaschen teuer und unpraktisch sind: »Weshalb sich der Handtaschentrend bei Männern auch nicht durchsetzt. Wenn die eine Hand mit dem Tragen irgendeiner Tasche ausgelastet ist, ist sie nicht frei für all die aufregenden Dinge, die man womöglich mit ihr anstellen könnte: sich durch Menschenmassen drängeln zum Beispiel, geliebte Menschen umarmen, sich die glitschige Kletterstange zum Erfolg hochkämpfen oder aufgeregt ein Taxi heranwinken.« Haarentfernung in der Bikinizone braucht nur, wer einen Bikini tragen möchte, aber wenn es so weit ist, empfiehlt sie Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs: »Ich kann den Kurs sehr empfehlen, wenn auch nicht zur Geburtsvorbereitung, denn dafür ist er praktisch nutzlos.« Sie lässt sich zweimal wöchentlich die Haare machen, denn das ist »weit billiger als eine Psychoanalyse und macht viel mehr Spaß«. Und sie rät zur ständigen Instandhaltung, denn »sollte man im Supermarkt einem Typen begegnen, der einen irgendwann mal abgewiesen hat, muss man sich nicht hinter einem Stapel Dosen verstecken«.
Solche bescheidenen und selbstironischen Beobachtungen bilden den leisen Grundton ihrer unverwechselbaren Komik. Sie braucht uns nicht zu erklären, wie schick, intelligent und beliebt sie ist, denn all das kommt in ihren Sätzen und Geschichten ganz unangestrengt zum Vorschein. Stattdessen enthüllt sie beherzt auch ihre weniger anziehenden Eigenschaften, egal ob sie uns beichtet, dass sie und ihre Freundinnen Stehkragen tragen, um die alternden »Truthahnhälse« zu verstecken, und am Ende aussehen wie »die weiße Version der Ladys aus Töchter des Himmels, oder ob sie uns mitteilt: »Leider muss ich Ihnen sagen, dass ich einen Bart habe.« In Die Geschichte meines Lebens in 3500 Wörtern oder weniger erklärt sie: »Wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht, lachen die Leute über einen; aber wenn man den Leuten erzählt, dass man auf einer Bananenschale ausgerutscht ist, lacht man selbst. So wird man nicht zum Opfer, sondern zur Heldin des Witzes.« Nora Ephrons Komik steht beispielhaft nicht für einen Schreib-, sondern für einen Lebensstil. Für den unbändigen, gut gelaunten, risikofreudigen Elan, Erfahrungen zu den eigenen Bedingungen zu machen.
Ihr treffsicherer und wortgewandter Witz lebt auch von ihrer Liebe zum Detail. Sie war eine große Anhängerin der Kunst der Genauigkeit, die aus sämtlichen ihrer Texte spricht – den journalistischen Arbeiten, den Filmdialogen und selbst den Kochrezepten. In ihren Essays zeigt sich diese Besessenheit immer wieder und garantiert ein großes Lesevergnügen, egal ob sie eine kurze Abhandlung über die Geschichte der Salatmoden schreibt, über ihre emotionale Hinwendung zu, Enttäuschung über und einseitige Beziehung mit Bill Clinton oder über ihre leidenschaftliche Affäre mit ihrem Wohngebäude, die sich, als die Mietpreisbindung ausläuft, als ein typischer Fall von unerwiderter Liebe entpuppt. Es sind diese bis ins Kleinste ausgearbeiteten Details, die ihre Kunst so originell machen, und ganz nebenbei umschifft sie selbst bei vielfach bearbeiteten Themen elegant alle Klischees.
Ihr Timing macht die Geschichten hochspannend, denn selbst in der Rolle der Essayistin bleibt Nora Ephron im Grunde eine Drehbuchautorin. Das Kino war nicht nur ihr Beruf, sie hatte es im Blut (beide Eltern schrieben Hollywooddrehbücher), und sie wusste, wie man ein Narrativ durchgestaltet: Ungewissheit, Spannung, Höhepunkt, Überraschung, Finale. In der Kolumne vom verlorenen Krautstrudel gelingt es ihr, die Suche nach einem bestimmten New Yorker Gebäck als fesselnden Mysterykrimi darzustellen. In Ich und JKF: Jetzt kann ich es ja erzählen testet sie ihre Fähigkeiten als Storytellerin in einem wohl getakteten Stück mit absolut antiklimaktischem Ende aus, und es gelingt ihr mit Bravour.
Doch auch die Journalistin Ephron ist immer mit dabei. Nora Ephron hat ihre Karriere in einer Nachrichtenredaktion begonnen, und sie hat die Zunft und den Zusammenhalt geliebt. Die Herausgeberin Tina Brown schrieb in ihren Vanity Fair Diaries, eine gute Journalistin sei eine Person, die das Entscheidende wahrnehme – ein Talent, das sich nicht erlernen lässt und das Nora Ephron im Übermaß hatte. Ihre Essays sind angereichert mit Anekdoten von Freundinnen (besonders gut gefällt mir die von Jane, die mit einem berühmten Schriftsteller schlief; er bewahrte eine Kiste mit seinen Büchern direkt neben der Haustür auf und forderte seine Geliebten auf, sich auf dem Weg nach draußen eins mitzunehmen) und mit Zufällen, denen sie aus reiner Neugier weiter nachging, wie beispielsweise der Entdeckung, dass Nancy Reagan in LA in derselben Boutique einkauft wie sie, woraufhin sie sich plötzlich furchtbar alt fühlt. Sie beobachtete pausenlos, und es wurde zu ihrem Mantra: »In allem steckt eine Story.« Das hatte ihre Mutter früher immer zu ihr gesagt. In diesem Buch findet sich noch ein weiterer Ratschlag ihrer Mutter, den diese ihr gab, als sie im Krankenhaus im Sterben lag: »Du bist eine Reporterin, Nora. Mach dir Notizen.«
In Was nie im Trend lag, kommt auch niemals aus der Mode geht es um das Altern, wie es in der Reflexion früherer Lebensentscheidungen und möglicher Reue erforscht wird; um Lektionen, die gelernt, Weisheiten, die gesammelt, und Fehler, die gemacht wurden. Das Thema passt perfekt zu Ephrons typisch bittersüßer Herangehensweise, und schon auf den ersten Seiten warnt sie uns, dass ihr Ausblick aufs Altern kein Lobgesang wird: »Hin und wieder lese ich ein Buch übers Altern, und egal von wem es stammt, es heißt immer, es sei großartig, alt zu sein. Es sei ein Gewinn, weise und klug und milde zu sein; es sei ein Gewinn, sich im Leben an einem Punkt zu befinden, wo man wisse, was wirklich zähle. Ich kann Leute nicht ausstehen, die so reden. Was denken die sich? Haben die keinen Hals?«
In Was wäre denn die Alternative?, dem letzten und meiner Ansicht nach stärksten Essay des Bandes, setzt unsere Heldin ihren Kummer über das Älterwerden in ein Spannungsverhältnis zum Glück, noch am Leben zu sein; und hinzu kommt der Frust, über keins von beidem reden zu dürfen, ohne gleich als »morbide« zu gelten. Das ist ebenso schonungslos wie tröstlich, eine leise Klage und gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Leben selbst. Denn all das – das Leben – hat Nora Ephron spürbar geliebt, was das letzte Kapitel dieses Buches umso schöner und trauriger macht. Über die Alternative nachzudenken, fiel ihr schwer, denn ihr Leben mitsamt seinen Freuden und Enttäuschungen, den zufälligen und den schicksalhaften Begegnungen, den alltäglichen und den bedeutsamen Momenten hat sie sehr genossen. Sie sucht eine ganze Stadt nach einem bestimmten Krautstrudel ab, belauscht einen aufregenden Nachbarschaftsstreit, kippt zu viel von ihrem Lieblingsöl ins Badewasser, kocht erfolgreich Rezepte nach, schwelgt in den Anekdoten ihrer Freundinnen und sammelt Geschichten. Nora Ephron hat es geliebt zu leben und zu lernen. Dass sie uns ihre Aufzeichnungen überlassen hat, ist ein großes Glück.
Dolly Alderton, 2020
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Ich schäme mich für meinen Hals
Ich schäme mich für meinen Hals. Oh, und wie. Wenn Sie ihn sehen würden, würden Sie sich vielleicht auch für ihn schämen, aber wahrscheinlich wären Sie so höflich, es zu überspielen. Wenn ich Ihnen gegenüber etwas zu dem Thema sagen würde, beispielsweise »Ich finde meinen Hals furchtbar«, würden Sie sicher etwas Nettes erwidern, beispielsweise »Ach was, so ein Unsinn«. Das wäre natürlich gelogen, aber ich verzeihe Ihnen. Lügen wie diese kommen mir ständig über die Lippen, meist bei Freundinnen, die aufgelöst sind, weil sie kleine Tränensäcke unter den Augen haben oder hängende Wangen oder Falten oder Speckröllchen, und wissen wollen, ob ich nicht auch fände, dass sie eine Lidstraffung oder eine Gesichtsstraffung oder Botox oder eine Fettabsaugung bräuchten. Meiner Erfahrung nach ist der Satz »Ach was, so ein Unsinn« ein Code für »Ich sehe, was du meinst, aber glaub ja nicht, dass ich mich in die Sache hineinziehen lasse«. Wie wir alle wissen, ist es gefährlich, sich in solche Themen verwickeln zu lassen. Denn wenn ich sagen würde: »Ja, ich sehe, was du meinst«, zieht meine Freundin vielleicht los und lässt sich zum Beispiel die Augen machen, und vielleicht klappt es nicht, und vielleicht endet sie dann wie die Leute aus der Klatschpresse, die ihren Schönheitschirurgen verklagen, weil sie die Augen nicht mehr schließen können. Außerdem, und das ist der Punkt, wäre es Alles meine Schuld. Ich bin ein gebranntes Kind, was diesen Alles meine Schuld-Aspekt angeht, da ich einer Freundin nie verziehen habe, dass sie mir 1976 davon abgeraten hat, eine völlig passable Wohnung in der East 75th Street zu kaufen.
Manchmal treffe ich mich zum Mittag mit den Mädels – an der Stelle ertappe ich mich. Ich meine natürlich meine Freundinnen, allesamt gestandene Frauen. Wir sind keine Mädels mehr, und das schon seit über vierzig Jahren. Jedenfalls treffen wir uns manchmal zum Mittag, und wenn ich dann einen Blick in die Runde werfe, merke ich, dass wir alle Rollkragenpullover tragen. Manchmal tragen wir auch alle Tücher wie Katharine Hepburn in Am goldenen See. Oder wir tragen Mandarinkragen und sehen aus wie die weiße Version der Ladys aus Töchter des Himmels. Irgendwie ist es lustig und irgendwie auch traurig, denn wir sind nicht neurotisch, was das Alter betrifft, keine von uns gibt sich jünger aus, als sie ist, und keine von uns zieht sich unpassend an. Wir haben uns alle gut gehalten für unser Alter. Bis auf den Hals.
Ach, Hälse! Es gibt Hühnerhälse und Truthahnhälse und Elefantenhälse. Es gibt Hälse mit Lappen und Hälse mit Falten, die bald zu Lappen werden. Es gibt dürre Hälse und dicke Hälse, schlaffe Hälse und kreppartige Hälse, wulstige Hälse und zerfurchte Hälse, sehnige Hälse, schlabbrige Hälse, wabblige Hälse und fleckige Hälse. Und es gibt Hälse, die eine erstaunliche Kombination aus all dem Genannten sind. Meiner Hautärztin zufolge fängt der Hals mit dreiundvierzig an, sich zu verabschieden, und dann ist es vorbei. Man kann Make-up auftragen und Abdeckstift unter den Augen verteilen, man kann sich die Haare färben und sich Kollagen, Botox und Restylane in die Falten spritzen lassen. Aber es gibt absolut kein Mittel gegen einen alternden Hals, es sei denn, man begibt sich unters Messer. Der Hals ist ein verräterisches Indiz. Unser Gesicht lügt, aber unser Hals sagt die Wahrheit. Einen Mammutbaum muss man aufschneiden, um zu sehen, wie alt er ist; hätte er einen Hals, müsste man das nicht.
Meine eigene Geschichte mit meinem Hals begann kurz vor meinem dreiundvierzigsten Geburtstag. Ich hatte eine Operation, von der ich eine schreckliche Narbe zurückbehielt, direkt über dem Schlüsselbein. Es war ein Schock, denn ich lernte auf die harte Tour, dass eine Ärztin zwar eine berühmte Chirurgin sein kann, deshalb aber noch lange keine Expertin im Zunähen sein muss. Wenn Sie von der Lektüre dieses Essays irgendetwas mitnehmen, dann bitte das: Lassen Sie sich niemals an irgendeinem Teil Ihres Körpers operieren, ohne einen Schönheitschirurgen hinzuzuziehen, der das Geschehen im OP überwacht. Denn selbst wenn man wegen etwas Ernstem oder etwas potenziell Ernstem an Ihnen herumoperiert, selbst wenn Sie tatsächlich glauben, dass Ihre Gesundheit wichtiger ist als Eitelkeit, selbst wenn Sie im Krankenhauszimmer aufwachen, unendlich froh, dass es kein Krebs war, selbst wenn Sie sich beschwingt fühlen, dankbar, am Leben zu sein, voller verblendeter Einsichten darüber, was wirklich zählt und was nicht, selbst wenn Sie sich schwören, auf ewig beglückt darüber zu sein, auf dieser Erde wandeln zu dürfen, und beteuern, sich nie wieder über irgendetwas zu beschweren, verspreche ich Ihnen, dass Sie irgendwann, und zwar schneller, als Ihnen lieb ist, in den Spiegel schauen und denken werden: Ich hasse diese Narbe.
Vorausgesetzt natürlich, dass Sie überhaupt in den Spiegel schauen. Das ist noch so eine Sache ab einem gewissen Alter, die ich bemerkt habe: Ich versuche, so wenig wie möglich in den Spiegel zu schauen. Wenn ich an einem Spiegel vorbeikomme, schaue ich weg. Wenn ich doch hineinschauen muss, kneife ich die Augen zusammen, damit ich sie, falls irgendwer ganz Schlimmes zurückschaut, möglichst schnell wieder schließen kann, um den Anblick abzuwehren. Und wenn das Licht gut ist (was ich nicht hoffe), tue ich oft das, was so viele Frauen meines Alters tun, wenn man sie vor den Spiegel zwingt: Ich ziehe sanft die Haut an meinem Hals zurück und starre wehmütig auf die jüngere Ausgabe meines Ichs. (Im Übrigen habe ich noch etwas bemerkt: Wenn Sie sich wegen Ihres Halses mal so richtig in Depressionen stürzen wollen, setzen Sie sich in einem Auto direkt hinter den Fahrer und betrachten Sie sich im Rückspiegel. Was es mit Rückspiegeln auf sich hat? Ich weiß nicht, warum, aber für den Hals ist es der gemeinste Spiegel überhaupt. Es ist zweifellos eines der faszinierenden Rätsel des modernen Lebens, dicht gefolgt von der Tatsache, dass kaltes Wasser im Bad kälter ist als kaltes Wasser in der Küche.)
Aber zurück zu meinem Hals. Schließlich dreht sich dieser Essay um ihn. Und ich weiß, was Sie denken. Warum geht sie nicht zum Schönheitschirurgen? Ich erzähle Ihnen, warum. Wenn Sie zu einem Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich möchte, dass nur mein Hals in Ordnung gebracht wird, wird er Ihnen unmissverständlich sagen, dass er das nicht tun kann, ohne auch Ihrem Gesicht ein Lifting zu verpassen. Und das ist nicht gelogen. Es ist nicht der Versuch, Ihnen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Tatsache ist, es hängt alles zusammen: Wenn man den Hals strafft, muss man auch das Gesicht straffen. Aber ich will kein Facelifting. Wenn ich ein Muffingesicht mit runden, vollen Zügen hätte, würde ich es riskieren: Frauen mit vollem Gesicht sind die perfekten Kandidatinnen für eine solche OP. Aber ich habe leider ein Vogelgesicht, und wenn ich mir die Haut straffen lassen würde, sähe mein Hals zweifellos besser aus, aber mein Gesicht wäre zum Zerreißen gespannt. Lieber schiele ich im Spiegel auf meinen bedauernswerten Hals, als einer Fremden gegenüberzustehen, die verdächtig aussieht wie ein Drum Pad.
Hin und wieder lese ich ein Buch übers Altern, und egal von wem es stammt, es heißt immer, es sei großartig, alt zu sein. Es sei ein Gewinn, weise und klug und milde zu sein; es sei ein Gewinn, sich im Leben an einem Punkt zu befinden, wo man wisse, was wirklich zähle. Ich kann Leute nicht ausstehen, die so reden. Was denken die sich? Haben die keinen Hals? Haben sie diese ganze Kaschiererei nicht satt? Stört es sie nicht, dass neunzig Prozent der Kleidung, die sie normalerweise kaufen würden, allein wegen des Ausschnitts wegfällt? Macht es sie nicht traurig, dass sie sich Chokers zulegen müssen? Am meisten bedaure ich – mehr noch, als mir die Wohnung in der East 75th Street nicht gekauft zu haben, mehr noch als meine schlimmste Beziehungskatastrophe –, dass ich in meiner Jugend nicht ständig liebevoll auf meinen Hals geschaut habe. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dankbar dafür zu sein. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich irgendwann wegen eines Körperteils wehmütig sein könnte, den ich als absolut selbstverständlich betrachtet habe.
Natürlich ist es wahr, dass ich jetzt im fortgeschrittenen Alter weise und klug und milde bin. Und es ist auch wahr, dass ich inzwischen ernsthaft verstanden habe, was im Leben wirklich zählt. Aber wissen Sie was? Es ist mein Hals.
Ich hasse meine Handtasche
Ich hasse meine Handtasche. Ich hasse sie wie verrückt. Wenn Sie eine dieser Frauen sind, die Handtaschen für das Größte halten, ist dieser Essay nichts für Sie, und Sie können sich die Lektüre sparen. Das hier ist für Frauen, die ihre Handtaschen hassen, die keinen Sinn für Handtaschen haben, die verstehen, dass Handtaschen ein Spiegelbild einer nachlässigen Haushaltsführung, einer chronischen Unfähigkeit, Sachen wegzuschmeißen, und des ständigen Versagens sind, den Verpflichtungen eines fordernden und schwierigen Accessoires nachzukommen (zum Beispiel der, dass die Handtasche möglichst zur Kleidung passen sollte). Das hier ist für Frauen, deren Handtaschen ein Wust aus verstreuten Tic Tacs, einzelnen Ibuprofen, Lippenstiften ohne Kappe, Labellos unbekannten Alters, Tabakkrümeln trotz jahrelanger Rauchabstinenz, aufgedröselten Tampons, britischen Münzen von einer Londonreise im letzten Oktober, Boardingkarten von längst vergessenen Flugreisen, Hotelschlüsseln von keine Ahnung was für Hotels, auslaufenden Kulis, Taschentüchern, von denen man nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, ob sie benutzt sind oder nicht, zerkratzten Brillen, alten Teebeuteln, aus dem Scheckbuch gerissenen und nun zerknitterten und beschmierten Barschecks und einer Zahnbürste sind, die aussieht, als hätte man sie zum Polieren von Silber benutzt.
Das hier ist für Frauen, die mitten im Juli merken, dass sie noch immer keine Sommertasche gekauft haben, oder die mitten im Winter noch immer eine Basttasche spazieren führen.
Das hier ist für Frauen, die es unfassbar finden, dass eine Handtasche fünf- oder auch sechshundert Dollar kosten kann – ganz zu schweigen von diesem Edelteil namens Birkin-Bag, die zehntausend Dollar kostet, was im Grunde irrelevant ist, da man noch nicht einmal auf die Warteliste für eine kommt. Auf die Warteliste! Für eine Handtasche! Für eine Zehntausenddollarhandtasche, die am Ende voller Tic Tacs ist!
Das hier ist für diejenigen von Ihnen, die verstehen, dass ihre Handtasche auf schlimmste Weise ihr Ebenbild ist. Oder, wie Ludwig XIV