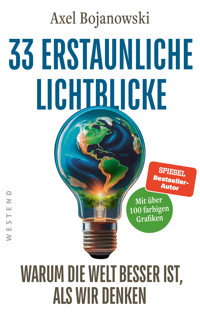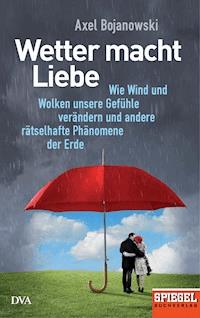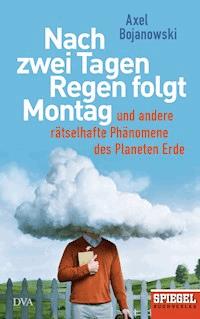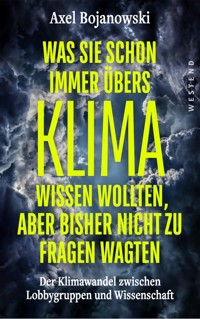
Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten E-Book
Axel Bojanowski
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Es gibt massenhaft Lektüre über den Klimawandel, doch zwei Arten bestimmen das Genre: die eine, die auf dramatische Weise vor der Apokalypse warnt, und die andere, die den Alarmismus als trojanisches Pferd politischer Kräfte entlarven will. Beide blenden Wesentliches aus: Einerseits hat die Wissenschaft überzeugend dargelegt, dass es ein Klimaproblem gibt, andererseits wird es tatsächlich politisch ausgebeutet. Anstatt also eine der beiden Kategorien zu bedienen, erzählt dieses Buch, wie aus dem Nischenfach der Meteorologie das bestimmende Thema unserer Zeit wurde. Das liegt keineswegs nur daran, dass die globale Erwärmung manifeste Risiken mit sich bringt, sondern auch daran, dass Wissenschaft als Vehikel für Macht, Einfluss und Geld missbraucht wird. Während der Klimawandel voranschreitet, eskaliert zugleich ein Lobbykrieg, der Einzelinteressen dient, aber die Lösung des zugrundeliegenden Problems erschwert. Dubiose Studien und politisierte Wissenschaftler stärken global operierende Institutionen und unterwerfen Deutschland im Dienste des Umweltschutzes einer unbarmherzigen Agenda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Axel Bojanowski
Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten
Der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
3. Auflage 2024
ISBN 978-3-86489-461-9
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Cover
Prolog
1. Ignorierter Pionier: Der erste Klimaforscher
2. Zwischen Militär und Katastrophe: Die Relevanz-Falle
3. »Earth Day«: Umweltschutz wird links
4. Umweltschutz als Statuskampf: Alte Reiche gegen neue Reiche
5. Eiszeit-Alarm: Wissenschaft als Autoritätsressource
6. UN-Umweltkonferenz: Neue Bühne für Rivalen
7. Ölkrise: Rohstoff-Waffe gegen den Westen
8. Erwärmung statt Eiszeit: Geniale Propheten
9. Polarisierung: Konservative Gegner der Klimaforschung
10. Erste Klimakonferenz: Auf Konfrontationskurs
11. Kalter Krieg ums Klima: Der verschollene Klimaforscher
12. Medien als Adjutanten: Wie die Atomlobby die Klimakatastrophe in Deutschland populär gemacht hat
13. Villach-Treffen ’85: Der Wow-Effekt
14. Gründung des Weltklimarats: Ausgetrickste USA
15. »Global Warming Has Begun«: Der Sündenfall
16. CO2-Woodstock: Die NGO-Industrie entdeckt das Klima
17. Eklat an der Ostsee: Ringen um Deutungshoheit
18. Erdgipfel ’92: Die neue Weltordnung
19. Frankenstein-Syndrom: Wissenschaft, zum Liefern verdammt
20. Bedrohte Geschäftsmodelle: Angriff der Skeptiker
21. Forscher-Triumph über Skeptiker: Die Überwindung des Trotz-Positivismus
22. Gefährliche Nähe: »Noble Cause Corruption«
23. »Bäume sind mir wichtig«: Deutschland will Klima-Musterschüler sein
24. Windige Werbung: Immer-schlimmer-ismus
25. Überfrachtete Klimaforschung: Der Knacks
26. Das ersehnte Ergebnis: Klaus Hasselmann und die Entdeckung des Menschensignals
27. UN-Klimaverhandlungen: Der Placebo-Effekt
28. Misslungener Putsch: Die verflixte Chef-Rochade
29. Krieg um den Hockeyschläger: Tribalistische Konkurrenz
30. UN-Klimarat: Kleine Fehler, großer Skandal
31. Attacken der Klimalobby: Die Mär von den schlimmeren Wetterkatastrophen
32. Befangenheit beim Klimarat: Kabale und Stürme
33. Hurrikane: Falsche Maskottchen des Klimawandels
34. Nicht neutrale Boten: Klimaschützer verhindern Klimaschutz
35. Kulturelle Kognition: Wir gegen sie
36. Regierungsbericht: Bestellter Weltuntergang
37. Klima-Klientelismus: Die Unterdrückung der Kernfrage
38. Extremszenarien: Kühler Klimarat
39. Autorität der Klimamodelle: Verheißung von Kontrolle
40. »Burning Embers«: Die wirkungsvolle Glut-Grafik
41. Konsens-Behauptung: Die Mär von den 97 Prozent, die sich einig sind
42. 1,5-Grad: Niemand weiß, wie das UN-Ziel in den Klimavertrag gelangt ist
43. Greta Thunberg: Das Geheimnis des einsamen Schulstreiks
44. Masterplan: Der Aufstieg der Klimalobby
45. Deutschlands Klimalobby: Die Große Transformation
46. Eingebettet: Journalisten und die Klimalobby
47. Zweifelhafte Klimawandel-Beweise: Den Nachrichtenzyklus schaffen
48. Klimanotstand: »Ich bin nicht radikal. Die Situation ist radikal.«
49. »RCP8.5«: Nützliche Horrorprognosen
50. »ESG«: Klimadiktat für Unternehmen
51. »Planetare Grenzen«: Die Behauptung von Knappheit verleiht Macht
52. Kipppunkte: Erkämpfte Drohkulisse
53. Verfassungsgericht: Fragliche Klimathesen als Corpus Delicti
Nachwort: Was nottut
Danksagung
Quellen
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Der Autor freut sich über Lob und Kritik: [email protected]
Die Grafiken in diesem Buch können Sie auf www.westendverlag.de/bojanowski farbig abrufen.
In Erinnerung an meinen Vater Günther Bojanowski
Für Alicia, Axel, Ariana
»Es ist egal, was wahr ist; es zählt nur, was die Leute glauben, was wahr ist.«
– Paul Watson, Mitbegründer von Greenpeace
»Menschen fürchten sich mehr vor Isolation als vor Fehlern.«
– Alexis de Tocqueville
Prolog
Warum dieses Buch?
In einem kurzen Werbefilm, verbreitet von Fridays for Future, wimmert ein Kind, als der Vater es ins Bett bringt – ein Monster sei im Schrank. Der Vater beruhigt: So etwas gibt es nicht. Kaum ist das Licht aus, zwängt sich jedoch das Ungetüm aus dem Schrank. »Das Monster gibt es wirklich, lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Klimawandel allein«, heißt es am Ende des Spots. Auch Greta Thunberg möchte, dass wir in Panik verfallen. Mit Erfolg: Internationale Umfragen zeigen ein erschreckendes Maß an »Klimaangst« unter jungen Leuten. Dennoch befand es der WDR für notwendig, eine »Klima App« für den Schulunterricht zu entwickeln, die »dank Augmented Reality«, wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender mitteilt, Schüler im Klassenzimmer in einen brennenden Wald und in Flutkatastrophen hineinversetzen kann, »fast als wären sie mittendrin«. Im Kindergarten, in der Schule, auf YouTube, in Hörspielen, im Theater und im Fernsehen wird Kindern der klimabedingte Weltuntergang eingebläut. »Papa«, sagte mein fünfjähriger Sohn vor Kurzem, »wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir«. Was soll man antworten? Selbstverständlich: »Nein.« Aber darüber hinaus?
Im Sachstandsbericht des UN-Klimarats kommen Wörter wie »Katastrophe«, »Notstand« oder »Krise« nicht vor. Das internationale Expertengremium erwartet eine prosperierende Welt (Kapitel 37), allerdings gleichzeitig das Aufziehen erhöhter Wetterrisiken (Kapitel 38, 40, 52). Sozialforscher haben herausgefunden, dass Wissen über den Klimawandel umgekehrt proportional zur Angst vor dem Klimawandel ist. Eine Studie mit 2066 Teilnehmern zum Beispiel, veröffentlicht im März 2023 in der Fachzeitschrift Climate Change, ergab, dass Menschen umso weniger Sorge in Hinblick auf die globale Erwärmung hatten, je mehr sie über das Thema wussten.
Das Klimaproblem ist zu bedeutend, um darüber nachlässig oder effekthascherisch zu berichten. Doch spätestens mit dem Aufkommen der Klimabewegung Fridays for Future 2018 – ein Aufbrausen jenes Milieus, aus dem viele Journalisten stammen – haben die Medien ihren Kurs in Richtung politisch-moralischem Aktivismus (Kapitel 46) verschärft. Das ist nicht verboten: Privatwirtschaftlich finanzierte Medien dürfen politisch agieren, der sogenannte Tendenzschutz sichert das gesetzlich ab. Wissenschaftsferne Apokalyptik aber erscheint mir verantwortungslos. Die Kaltblütigkeit, mit der Journalisten und Publizisten, ja sogar »aktivistische« Forscher im Eigeninteresse insbesondere Kindern Angst machen, erfordert Aufklärung und Widerspruch.
Am 19. Dezember 2018 drängten sich im weiten Atrium des Spiegel-Hauses in der Hamburger Hafencity Hunderte Angestellte und Redakteure – darunter auch ich. Auf einer improvisierten Bühne standen die Chefs mit finsteren Mienen. Ihre Ansprachen klangen wie Reden auf einer Beerdigung. Niemand im Saal tuschelte. Sie verkündeten mit matter Stimme, dass einer der erfolgreichsten Reporter des Magazins, Claas Relotius, viele seiner Reportagen ganz oder teilweise erfunden habe. Weder den Redakteuren noch der Faktenkontrolle des Spiegels, der »Dokumentation«, war der jahrelange Betrug aufgefallen. Relotius, für zahlreiche Journalistenpreise gefeiert, galt als beliebt und wurde vielfach bewundert. Kaum jemand im Atrium wagte, nach der Verkündung zu sprechen. Ausweichende Blicke, feuchte Augen, schweigsames Auseinandergehen. »Die Berichterstattung von Relotius hat sich in weiten Teilen als gefälscht herausgestellt«, gestand das Magazin.
Ich dachte an Claas Relotius’ letzte große Reportage. Sie handelte vom Meeresspiegelanstieg und war Ende November 2018 als Titelgeschichte erschienen: »Nass«. Ich hatte sie vorab gelesen und die zuständigen Kollegen vor der Veröffentlichung gewarnt. Eine Kernthese des zwölf Seiten langen Artikels entsprach nicht der Wahrheit. In dramatischen Szenen beschreibt Relotius darin, wie die Menschen auf der Südseeinsel Kiribati ihre Siedlungen wegen des steigenden Meeresspiegels verlassen mussten; ganze Ortschaften seien untergegangen. Der Autor lässt einen Bewohner vor dem schwellenden Meer erzählen, er könne »nicht errechnen, wie viel Land es Jahr für Jahr von seinem Strand verschlingt«. Dabei sind die Pegel auf Kiribati seit Beginn der Messungen Anfang der 1990er-Jahre ziemlich stabil und zahlreiche Inseln der Region haben sich sogar vergrößert. Sie sind mit dem schwellenden Ozean mitgewachsen, sodass das Wasser nicht vordringen konnte. Studien und der Vergleich von Satellitenbildern belegen das geologische Phänomen. Ich schrieb den Kollegen meine Bedenken und klärte über die Fakten auf, doch der Artikel wurde trotzdem veröffentlicht.
Warum, so habe ich mich gefragt, kommt mein eigener Sohn auf die Idee, er müsse sterben, weil der Meeresspiegel steigt, obwohl in seinem Elternhaus kein Klima-Alarmismus herrscht? Und wie konnte Relotius’ Geschichte ausgerechnet in einem Magazin erscheinen, zu dessen behaupteter DNA das Motto »Sagen, was ist« gehört? Um mir diese Fragen zu beantworten, habe ich das vorliegende Buch geschrieben.
Es gibt massenhaft Lektüre über den Klimawandel, doch zwei Arten bestimmen das Genre: die einen, die auf dramatische Weise vor der Apokalypse warnen, und die anderen, die den Alarmismus als trojanisches Pferd politischer Kräfte entlarven wollen. Beide blenden Wesentliches aus: Einerseits hat die Wissenschaft überzeugend dargelegt, dass es ein Klimaproblem gibt, andererseits wird es tatsächlich politisch ausgebeutet. Anstatt also eine der beiden Kategorien zu bedienen, versuche ich zu erzählen, wie aus einem Nischengebiet der Meteorologie das bestimmende Thema unserer Zeit werden konnte. Das liegt nämlich keineswegs nur daran, dass die globale Erwärmung manifeste Risiken mit sich bringt, sondern auch daran, dass Wissenschaft missbräuchlich als Vehikel für Macht, Einfluss und Geld herhalten muss. Während der Klimawandel voranschreitet, eskaliert zugleich ein Lobbykrieg, der Einzelinteressen dient, aber die Lösung des zugrunde liegenden Problems erschwert. Dubiose Studien und politisierte Wissenschaftler stärken global operierende Institutionen und unterwerfen Deutschland im Dienste des Umweltschutzes einer unbarmherzigen Agenda.
Schon lange wissen wir, dass die Menschheit mit Treibhausgasen den Wärmehaushalt der Erde verändert (Kapitel 1) und die Temperaturen wohl auf Jahrzehnte hinaus weiter steigen werden. Dadurch ausgelöste Umweltveränderungen sollten bis mindestens ins nächste Jahrhundert spürbar sein. Manche Arten von Extremwetter werden häufiger; nicht ausgeschlossen sind gravierende längerfristige Umwälzungen wie das Abschmelzen des Westantarktischen Eisschilds. Auch ohne dieses Ereignis dürften die Ozeane über Generationen langsam weiter steigen. Zwar könnte die Menschheit solche Veränderungen meistern, doch bräuchte es mehr Grundlagenforschung über das Klima, um besser zu verstehen, was wirklich vor sich geht. Denn nicht ausschließen lassen sich nach wie vor Extremszenarien, die katastrophale Entwicklungen heraufbeschwören (Kapitel 38, 52). Gerade weil das Wissen lückenhaft und die Vorhersagen nicht verlässlich sind und weil die Erwärmung Überraschungen zur Folge haben könnte, erscheint es mir sinnvoll, schnellstmöglich auf eine klimaschonende Energieversorgung umzustellen. Aber das ist leicht gesagt.
Industrielobbys haben versucht, das Klimaproblem kleinzureden (Kapitel 20, 21), doch der Einfluss der Skeptiker erklärt nicht allein, warum die CO2-Wende stockt. Die Versorgung mit fossilen Energien lässt sich nicht auf Kommando stoppen. Der Bedarf an günstiger Energie steigt weltweit. Momentan verbrauchen drei Milliarden Bewohner der Erde pro Jahr weniger Strom als ein handelsüblicher Kühlschrank, und diese Menschen wollen ihren Lebensstandard zu Recht steigern. Dafür brauchen sie mehr Energie, ebenso wie die wachsende Weltbevölkerung und die voranschreitende Elektrifizierung der bereits entwickelten Staaten. Das Menschheitsproblem Klimawandel ist also in Wahrheit ein Menschheitsdilemma: Globalen Wohlstand zu gewährleisten und gleichzeitig die Industriegesellschaft zu dekarbonisieren – ein komplexeres Problem kann man sich kaum ausdenken, denn es betrifft alle Lebensbereiche.
Die Klimadebatte wirft grundsätzliche Fragen darüber auf, wie wir leben wollen, und zieht deshalb die gleichen Frontstellungen nach sich wie andere Debatten: Technologie-Skeptiker gegen -Optimisten, Kollektivisten gegen Liberale, Egalitäre gegen Hierarchische, extrinsisch gegen intrinsisch Motivierte – allgemein jeden denkbaren Wertekonflikt. Je nach persönlichem Temperament und Interesse lesen Teilnehmer die Wissenschaft anders und bevorzugen unterschiedliche Maßnahmen (Kapitel 34, 35). Der Kampf gegen die globale Erwärmung bietet Trittbrettfahrern jeder Couleur Gelegenheit, ihre Ziele durchzusetzen: Umweltschutz und Klima sind bewährte Mittel in politischen Interessenkämpfen. Die »Bewahrung der Schöpfung« respektive »Bewahrung der Natur« ist dabei das stärkste Argument, mit dem schon grausame Vertreibungen und »Bevölkerungskontrolle« durchgesetzt wurden (Kapitel 48).
»Klima« funktioniert auch gut als Ausrede für politisches Versagen, beispielsweise im Katastrophenschutz oder bei Missernten (Kapitel 47). Seit einigen Jahren knüpfen sogenannte »Philanthropen«-Stiftungen intransparente politische Netzwerke, die sich mit dem Klima-Trumpf kritischer Befragung entziehen (Kapitel 44). Angefeuert von opportunistischen Medien (Kapitel 46) und gierigen Umweltorganisationen (Kapitel 16) droht fehlgeleitete Politik knappe Ressourcen falsch zu verteilen, sodass die Erderwärmung nicht gebremst und obendrein die Lösung anderer Probleme erschwert wird. Dabei schält sich ein fundamentales Problem heraus: Feinde westlicher Lebensart, die im Herzen der liberalen Demokratien einen Kampf schüren, kapern eigennützig das Klimathema. Auch hier wirken keine Verschwörungen, sondern Individuen, die kurzfristige Möglichkeiten für persönliche Vorteile ausbeuten (Kapitel 3).
Wie kein anders Thema ist die globale Erwärmung zum identitätsstiftenden Motiv geworden für viele, die an der öffentlichen Debatte teilnehmen. So hängen der soziale Status und die Karrieren etlicher Journalisten davon ab, wie sie sich positionieren (Kapitel 35). Bestätigt ein Artikel gängige Narrative, die dabei helfen, Akzeptanz im Berufsumfeld zu erlangen, muss der Text keine Kritik fürchten. Daraus ergibt sich ein interessanter Widerspruch: Einerseits betonen wir Journalisten die Bedeutung des Klimawandels als »wichtigstes Menschheitsthema«, andererseits herrscht unter vielen von uns ein erstaunliches Desinteresse an Fakten. Selbst eindeutige Fehler werden trotz nachdrücklicher Hinweise nicht korrigiert, sofern sie die Haltung der eigenen Bezugsgruppe unterstützen und sich kein Widerstand in karriererelevanten Milieus regt. Auch »Faktenchecker«-Medien sind vor diesem Hintergrund allzu oft politisch motivierte Instrumente, die ihrerseits Falschinformationen verbreiten (Kapitel 46).
Jedes Kapitel in diesem Buch will einen Mechanismus entschlüsseln, der zur Eskalation des »Krieges um das Klima« beigetragen hat, und erklären, inwiefern wissenschaftliche Debatten als Stellvertreter für schwelende gesellschaftliche Konflikte über Werte, Vorlieben und politische Ziele dienen. Über jeden Abschnitt ließe sich ein ganzes Buch schreiben, aber ich habe versucht, die wesentlichen Aspekte mithilfe kurzer, pointierter Erzählungen zu schildern. Die Geschichte der Klimadebatte spielt sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten ab, wo sowohl die moderne Forschung als auch die großen Konflikte ihren Ursprung haben. Das Land bestimmt wesentlich die Geschicke der UN-Klimapolitik, der globalen Energietransformation und aufgrund seiner dominierenden Wissenschaftslandschaft, der englischen Sprache und des politischen Einflusses folglich auch den Forschungsdiskurs.
Wissenschaft hat sich als die beste Erkenntnisressource und als die erfolgreichste Methode erwiesen, um herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Aber sie ist keine Bastion des interessenlosen Erwerbs und der Vermittlung von Wissen, sondern weist ein erhebliches Mobilisierungspotenzial auf. Insbesondere die Umweltforschung ist zu einem bestimmenden Element politischer und gesellschaftlicher Diskussionen geworden und damit zu einem Faktor, der über die Legitimität politischer Macht entscheiden kann (Kapitel 6). Die Klimadebatte offenbart, wie Wissenschaft für partikulare Interessen missbraucht werden und wie dieser Prozess eskalieren kann, weil der Kreis der Profiteure kontinuierlich wächst und sich deshalb immer schwerer eindämmen lässt – auf Kosten der seriösen Klimaforschung, auf Kosten des Gemeinwesens und auf Kosten effektiver Reaktionen auf die fortschreitende globale Erwärmung.
Axel Bojanowski, Hamburg im Mai 2024
Auf meinem Blog erzähle ich ergänzend zum Buch Kurzgeschichten zum Thema, die Texte lassen sich abonnieren unter:
axelbojanowski.substack.com
I. Kampf um Einfluss
1. Ignorierter Pionier: Der erste Klimaforscher
Die Entdeckung der menschengemachten Erwärmung wurde zurückgewiesen, sie versprach keinen politischen Nutzen.
Am Mittwochabend des 16. Februar 1938 – es herrschten eisige Minusgrade – schritt der 40-jährige Kraftwerksingenieur und Sohn eines renommierten Physikers, Guy Callendar, in die Royal Meteorological Society in London, um die globale Erwärmung korrekt vorherzusagen. Sechs Gutachter, allesamt strenge Meteorologen, erwarteten seinen Vortrag im Gebäude des altehrwürdigen Vereins. Fürchten musste Callendar vor allem den Vorsitzenden, George Simpson, der bereits Jahre zuvor herausgefunden zu haben glaubte, Kohlendioxid, chemisches Formelzeichen CO2, übe keinen Einfluss auf das Klima aus. Dass ihm nun jener Hobby-Meteorologe ohne Doktortitel vom Gegenteil überzeugen wollte, irritierte ihn. Callendar hatte über Jahrzehnte Daten von rund 200 Wetterstationen weltweit gesammelt. Sie zeigten, dass das Klima Ende der 1930er-Jahre seit dem vergangenen Jahrhundert bereits um 0,3 Grad Celsius wärmer geworden war. Callendar hegte die Vermutung, dass die zu diesem Zeitpunkt 150 Milliarden Tonnen CO2-Abgase des Menschen aus der Verbrennung von Kohle, Holz und Öl dazu beigetragen hatten. Die Hälfte der Erwärmung seit Beginn des 20. Jahrhunderts schrieb er der Zunahme des Kohlendioxidgehalts in der Luft zu. Callendar prognostizierte steigende Temperaturen – und sollte damit recht behalten. Seine Gutachter an jenem kalten Winterabend in London aber konnte er mit seinem Vortrag nicht überzeugen. Dem Vorsitzenden der Anhörung, George Simpson, erschien die Theorie abwegig: Der Anteil des Treibhausgases in der Luft sei zu gering für eine nennenswerte Erwärmung, sogar falls sich die CO2-Konzentration in der Luft verdoppeln sollte, so glaubte er. Überschüssiges Kohlendioxid werde von den Ozeanen absorbiert. Selbst Meteorologen könnten sich wohl noch nicht vorstellen, dass der Mensch das Klima verändert, schrieb der Ingenieur resigniert; der Einfluss sei nicht nur theoretisch plausibel, sondern »passiere tatsächlich gerade«. Guy Callendar hatte als Erster mit seinen Messungen den bereits eingetretenen menschengemachten Treibhauseffekt entdeckt – aber niemand glaubte ihm.
Seine Erkenntnis kam nicht von ungefähr: Wissenschaftler hatten schon im 19. Jahrhundert zeigen können, dass der Treibhauseffekt real ist: Der französische Physiker Jean-Baptiste Fourier berechnete 1824, dass die Erde mit ihrer Entfernung zur Sonne nicht so warm sein dürfte, wie sie in Wirklichkeit war. Er vermutete, dass die von unserem Zentralgestirn kommende Energie die Atmosphäre durchdringen, aber nicht so leicht abgestrahlt werden kann und sie dadurch aufheizt. Bald fiel der Verdacht auf das Kohlendioxid. 1856 ergaben Experimente der US-Amerikanerin Eunice Newton Foote, dass sich Luft mit hohem CO2-Gehalt erwärmt. Mit ihren Worten: »Eine Atmosphäre dieses Gases würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen.« Sie hatte Glaskolben mit Gasgemischen gefüllt und ihre Temperaturveränderung unter Sonneneinstrahlung gemessen. »Den größten Effekt der Sonnenstrahlung fand ich bei Kohlendioxid«, berichtete Foote. »Wenn, wie einige annehmen, in gewissen Zeiten der Erdgeschichte der Anteil dieses Gases in der Luft höher gewesen wäre als heute, müsste das notwendig zu einer höheren Temperatur geführt haben.« Drei Jahre später zeigte der irische Naturforscher John Tyndall ebenfalls mit Experimenten, dass Wasserdampf und CO2 Wärme zurückhalten.
Ende des 19. Jahrhunderts berechnete der schwedische Wissenschaftler Svante Arrhenius, wie sich die Temperatur auf der Erde mit der Konzentration von Kohlendioxid verändert. In einer berühmten Studie aus dem Jahr 1896 kam auch er zu dem Schluss, dass CO2 eine Erwärmung bewirkt. Die Clausius-Clapeyron-Gleichung, wonach eine ein Grad wärmere Luft sieben Prozent mehr Wasserdampf enthalten kann, bedeute zudem, dass sich diese verstärke, stellte Arrhenius fest: Eine Verdopplung der Kohlendioxidkonzentration erwärme die bodennahe Luft um fünf bis sechs Grad, schrieb er. Heutzutage gilt Arrhenius’ Schätzung als um das Doppelte zu hoch und seine gesellschaftliche Konsequenz als bestenfalls optimistisch: Eine Erwärmung sei eine gute Entwicklung, meinte er, denn sie verhindere eine Eiszeit, die die Europäer sonst womöglich zur Flucht nach Afrika gezwungen hätte.
Seine Kollegen Arvid Högbom und Nils Ekholm knüpften an Arrhenius’ Rechnungen an. Sie folgerten, dass die Verbrennung von Kohle wegen des damit einhergehenden CO2-Ausstoßes zu einer globalen Erwärmung führen werde; Ekholm sprach vom »Treibhauseffekt«. Der Blick ins Weltall brachte den nächsten Beleg: 1932 entdeckten Astronomen mittels einer Analyse des Lichts der Venus, dass die Atmosphäre des Nachbarplaneten große Mengen Kohlendioxid enthält. Der US-amerikanische Physiker Carl Sagan sagte voraus, dass der resultierende Treibhauseffekt dort für Temperaturen jenseits der 400 Grad sorgen müsste. Im Dezember 1962 erreichte die Raumsonde Mariner 2 die Venus – und bestätigte seine Prognose: In der Atmosphäre der Venus schmilzt bei einer Hitze von mehr als 450 Grad selbst Blei; und das, obwohl sie doppelt so weit von der Sonne entfernt liegt wie der nächste Planet, Merkur. Während es dort nachts auf unter minus 170 Grad abkühlt, hält sich die Tagestemperatur auf der Venus – wegen des Kohlendioxids.
Die Erde wäre ohne ihren natürlichen Treibhauseffekt gut 30 Grad kühler. Doch dieser allein erklärt nicht die Erderwärmung, wie Callendar seinen Gutachtern an jenem Wintertag 1938 vergeblich klarzumachen versuchte. Die CO2-Konzentration war seit Beginn der Industrialisierung angestiegen; und die sich anreichernde Menge in Luft und Meeren stimmte seinen Berechnungen zufolge gut überein mit dem, was durch menschliche Aktivitäten ausgestoßen worden war. Auf der Nordhalbkugel, wo es mehr Einwohner und Industrie gab, reicherte sich mehr Kohlendioxid als im dünn besiedelten Süden an. Und bald offenbarte die »isotopische Signatur« der Kohlenstoffatome – ihr atomares Gewicht – den Ursprung des CO2 in fossilen Lagestätten. Messungen zeigten außerdem einen winzigen Rückgang im Sauerstoffgehalt der Luft, den Callendar erwartet hatte: Die Verbrennung von fossilen Energieträgern verbraucht Sauerstoff.
Heute preisen Klimaforscher Guy Callendar, der seine Studie mit dem Titel »The Artificial Production of Carbon Dioxide and its Influence on Temperature« trotz der Skepsis anderer Wissenschaftler im April 1938 im Magazin der Royal Meteorological Society veröffentlichen durfte. Als Erster hatte er anhand weltweiter Temperaturmessungen entdeckt, dass sich die Erde erwärmt, und als Erster hatte er diese Erwärmung den Aktivitäten des Menschen zugeschrieben. Zudem gilt seine Prognose von zwei Grad Erwärmung bei einer Verdopplung der CO2-Menge in der Luft noch heute als realistisch. Callendar hatte alle Zutaten der modernen Theorie vom menschengemachten Klimawandel beisammen: Aufgrund seiner molekularen Struktur hält CO2 Wärmestrahlung zurück, die andere Moleküle, die in der Luft viel häufiger vorkommen, passieren lassen.
Am 28. Oktober 1956 erwähnte die New York Times den Klimawandel-Pionier in einem Artikel mit der hellsichtigen Überschrift »Wärmeres Klima könnte auf mehr Kohlendioxid zurückzuführen sein«. Eingeweihte sprachen mittlerweile vom »Callendar-Effekt«. Doch er hatte Pech mit dem Timing: Mitte des 20. Jahrhunderts sank die Temperatur weltweit, obwohl der Mensch weiterhin Treibhausgase in die Luft pustete – und niemand interessierte sich mehr für globale Erwärmung. Von der »Umkehrung des Wärmetrends« berichtete die New York Times am 25. Januar 1961. Die strengen Winter in England zu dieser Zeit und in den beiden Folgejahren, als dort zu Weihnachten fast überall Schlittschuh gelaufen werden konnte, ließen den »Callendar-Effekt« vergessen. Die CO2-Zunahme war weiter im Gange, aber niemand vermochte zu sehen, zu schmecken oder zu riechen, wie sich immer mehr Kohlendioxidteilchen in der Luft anreicherten. Erst in den 1980er-Jahren drehte sich der globale Temperaturtrend.
Dass Callendar nicht durchdrang mit seiner Theorie, lag wohl auch daran, dass er keine Klimakatastrophe vorhersagte, sondern das Gegenteil: Wie Svante Arrhenius hielt er eine globale Erwärmung für positiv, sie verhindere »die Rückkehr der tödlichen Gletscher«, begünstige Landwirtschaft im Norden und kurble das Pflanzenwachstum an. Künftige Generationen würden »uns danken« dafür, eine neue Eiszeit verhindert zu haben, meinte Callendar. Noch verbanden Wissenschaftler mit industriellem Fortschritt das Wohlergehen der Menschheit. Erst in den 1950er-Jahren änderten sie ihre Meinung zum CO2. Die berühmten Ozeanografen Roger Revelle und Hans Suess begannen zu zweifeln, ob die Meere wirklich all das Kohlendioxid aufnehmen könnten, das die Erdbevölkerung emittierte. Ihre chemischen Gleichungen offenbarten 1956, dass sie neunmal weniger aufnahmefähig waren als angenommen. Tatsächlich, resümierten Revelle und Suess, sei es möglich, dass sich das Gas in der Atmosphäre anreichere und eine wärmende Wirkung entfalte.
Guy Callendar erlebte die Anerkennung seiner These nicht mehr. Bis zu seinem Tod 1964 hatte er nach Indizien gefahndet dafür, dass eine stärkere globale Erwärmung durch CO2 von anderen Phänomenen maskiert worden war. Es sollte noch zwei Jahrzehnte dauern, bis Klimaforscher seinen Verdacht bestätigten. Sein Buch Klima und Kohlendioxid wurde nie veröffentlicht. Ein Foto zeigt Callendar kurz vor seinem Tod – beim Schneeschippen.
2. Zwischen Militär und Katastrophe: Die Relevanz-Falle
Klimaforschung gewinnt an politischer Bedeutung, wenn sie vereinnahmt werden kann.
Am Himmel über Boulder malten Flugzeuge an einem klaren Septembermorgen 1963 weiße Kondensstreifen, als sich der Chef des National Center for Atmospheric Research (NCAR), Walter Orr Roberts, im Hinterhof seines Instituts mit einem Journalisten der New York Times unterhielt. Roberts prophezeite, die Kondensstreifen würden sich bis nachmittags ausgebreitet haben und schließlich nicht mehr von Zirruswolken zu unterscheiden sein. In Regionen mit zunehmendem Luftverkehr dürften die künstlichen Wolken das Klima ändern, argwöhnte der Atmosphärenforscher. Der Einfluss des Menschen aufs Klima sei dann für das bloße Auge sichtbar. Die New York Times hievte seine Ideen auf die Titelseite: »Flugzeuge könnten Klima entlang der Routen ändern«. Roberts meinte das nicht negativ.
Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in die Erforschung der Kontrolle von Wetter und Klima investiert. Wolken erschaffen, Dürren verhindern, Stürme umlenken – solche Möglichkeiten gelte es auszuloten, betonte der Vorsitzende der National Academy of Sciences (NAS) in den USA, Detlev Bronk, im Jahr 1956. Der spätere Präsident Lyndon B. Johnson von der Demokratischen Partei warnte 1958 in einer Rede, die UdSSR könne das Wetter aus dem All ändern, Meeresströmungen manövrieren und das Klima der Vereinigten Staaten abkühlen. Nach der Explosion der ersten Atombombe 1945 mussten Meteorologen akzeptieren, dass menschliche Aktivitäten Einfluss auf das Wetter hatten. Die US-Regierung finanzierte Programme zur Erforschung möglicher Wetterfolgen von Nuklearschlägen. Mitte der 1950er-Jahre simulierten Wissenschaftler an der Princeton University nahe New York mit einem Computermodell die Folgen eines Atomkriegs: In drei Dimensionen zeigte das Modell, wie atmosphärische Zirkulation den radioaktiven Auswurf um die Erde verteilen würde. Der deutsche Meteorologe Fritz Möller, eigentlich Professor an der Universität Mainz, absolvierte Ende der 1950er-Jahre ein Sabbatical in Princeton. Er wollte von seinen Kollegen wissen, ob sie ihre Klimasimulation mit der doppelten CO2-Menge in der Luft laufen lassen könnten. »Warum versucht ihr das nicht mal?«, fragte Möller, der Guy Callendars Forschung studiert hatte. Ein paar Monate später präsentierten sie das Ergebnis: Um 3 bis 5 Grad würde es wärmer, das Resultat schwankte mit jedem neuen Modelllauf – 1,5 bis 4,5 Grad Erwärmung bei doppelter CO2-Menge spucken moderne Supercomputer aus.
Der Ozeanograf Roger Revelle schöpfte Verdacht. »Die Menschheit könnte ein großskaliges Experiment ausführen« mit ihren Abgasen, spekulierte er. Alarmiert wegen eines möglichen Klimawandels sei er indes nicht gewesen, erzählten seine Kollegen. Revelle wirkte auf Fotos in jungen Jahren mit seiner lässigen Attitüde wie eine Wissenschaftler-Version von James Dean. Sein Charme half ihm, Kontakte in Ministerien zu knüpfen. Im Mai 1957, während des »Internationalen Jahrs der Geophysik«, machte Revelle hohe Millionensummen bei der Regierung locker. Eines der kleinsten geförderten Projekte sollte das berühmteste werden: das CO2-Experiment. Revelle beauftragte einen Mitarbeiter namens Charles Keeling, einen Apparat zur Messung von Kohlendioxid in der Luft zu konstruieren. 1958 startete der junge Chemiker seine Messung vor einem Labor auf der Pazifikinsel Hawaii. Anfangs registrierte er 314 ppm (»parts per million«), also 314 Teilchen CO2 pro Millionen Luftteilchen. Die Datenpunkte von Keelings Kohlendioxidkurve ergaben mit der Zeit jene eindrucksvolle Grafik, welche aller Welt die menschengemachte Anreicherung von CO2 in der Luft demonstrierte, die berühmte Keeling-Kurve: eine im Takt der Jahreszeiten zitternde, dabei stetig steigende Linie, gerade so wie es Guy Callendar erwartet hatte. 1963 veröffentlichte er zusammen mit Kollegen und im Auftrag des Umweltverbands Conservation Foundation den Bericht »Implications of Rising Carbon Dioxide Content of the Atmosphere«, der eine globale Erwärmung von zwei Grad bei einer Verdoppelung des Kohlendioxidgehalts vorhersagte.
Im Frühjahr 1964 hörte die Linie plötzlich auf zu steigen. Nicht weil kein CO2 mehr in die Luft gelangte, sondern weil Keeling seine Finanzierung weggebrochen war. Im Mai 1964 hatte er die Mittel wieder sichergestellt, die Kurve kletterte weiter. Anfang der 1970er-Jahre fiel Keeling etwas Seltsames auf: Gemessen an der Kohlendioxidmenge, die mit Abgasen aus Industrie, Verkehr und Kraftwerken in die Luft gelangte, fehlte laut seinen Messungen CO2 in der Bilanz. Der Anteil des Gases in der Atmosphäre nahm nur halb so schnell zu, wie er es in Anbetracht des Inputs eigentlich müsste. Keeling erinnerte sich: Sein Chef Roger Revelle hatte 1956 vorgerechnet, dass Ozeane einen Teil des Kohlendioxids aufnehmen und den menschengemachten Treibhauseffekt abpuffern. 1965 warnte erstmals ein Regierungsbericht vor einer Erwärmung aufgrund des Ausstoßes von CO2: Das Science Advisory Commitee des US-Präsidenten Lyndon B. Johnson mahnte im Report »Restoring the Quality of Our Environment«, dass die fortgesetzte Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe »mit ziemlicher Sicherheit erhebliche Veränderungen bewirken« und »aus Sicht der Menschen schädlich sein könnte«. Wie schon Keelings Studie zwei Jahre zuvor ließ auch der Report Callendars Arbeit unerwähnt.
»Good bye New York, good bye Washington«, schrieb Patrick Moynihan, ein Regierungsberater des republikanischen US-Präsidenten Richard Nixon, im September 1969 in einem Memorandum an seinen Chef. Bereits der zu erwartende CO2-Anstieg um 25 Prozent bis zum Jahr 2000 könnte für einen Anstieg der Meere um drei Meter sorgen, Metropolen könnten versinken. Im Juli 1970 berieten Atmosphärenforscher vier Wochen lang in Williamstown, Massachusetts, über mögliche menschengemachte Umweltprobleme. In ihrem Abschlussbericht stellten sie fest, dass Kohlendioxidabgase »langfristig möglicherweise Effekte auf das Klima« haben könnten. Das Thema sollte besser erforscht werden, mahnte der Report. Hierzulande veröffentlichte die Deutsche Physikalische Gesellschaft anlässlich ihrer Jahrestagung Ende September 1971 eine Pressemitteilung. Eine Verdopplung des CO2-Gehalts in der Luft ziehe eine globale Erwärmung von 2,2 Grad nach sich, mahnte das Papier unter Berufung auf den Bonner Meteorologen Hermann Flohn, dessen klimatologische Weltkarten Schüler in der ganzen Bundesrepublik aus ihren Atlanten kennen: Flohns Linien markieren die Klimazonen.
Roger Revelle hatte in den 1970ern seinen James-Dean-Charme verloren und sah nun aus wie ein überarbeiteter Politiker. Seine Arbeit war die eines Forschungsmanagers geworden. Er übernahm Führungspositionen in der American Association for the Advancement of Science (AAAS), der weltweit größten wissenschaftlichen Gesellschaft, die unter anderem Science, die vielleicht einflussreichste Wissenschaftszeitschrift herausgibt. 1978 schrieb Revelle der Klimaforschung ihr politisches Schicksal auf. Eine Disziplin, die der Menschheit nicht helfen könne, sei wertlos: »Klimaforschung ist insofern eine besondere angewandte Wissenschaft, als ihre Daseinsberechtigung ihre Beziehung zum menschlichen Wohlergehen ist.« Revelle offenbarte den Zwiespalt, in dem die Klimaforschung bereits gefangen war: Sie kann nur prosperieren, solange ihr Thema relevant ist, und relevant ist sie nur, solange sie das Schicksal der Menschheit verhandelt.
3. »Earth Day«: Umweltschutz wird links
Bewegungen gewinnen Anhänger, indem sie ihre Interessen als die der anderen ausgeben.
Der Cuyahoga-Fluss im US-Staat Ohio brannte. Mitte Juni 1969 hatten Funken eines vorbeifahrenden Zuges Öllachen nahe der Stadt Cleveland entzündet, knapp eine Stunde loderten Flammen auf dem Wasser. Anwohner ignorierten den Vorfall, sie waren an ähnliche Brände auf dem Cuyahoga in ihrem Industriegebiet gewöhnt. Doch der Zeitgeist hatte sich verändert. Das Buch Der stumme Frühling der Biologin Rachel Carson war erschienen. Darin hatte sie Umweltverschmutzung als Vernichtungskrieg des Menschen gegen die Natur gedeutet. Carson schrieb von landwirtschaftlichen Chemikalien, die Menschen vergiften und Krebs verursachen. »Keine Hexerei, keine feindliche Aktion brachte die Wiedergeburt neuen Lebens in dieser geplagten Welt zum Schweigen. Das Volk hatte es sich selbst angetan«, dichtete die Biologin. Alles Natürliche sei ein Wert an sich, menschlicher Einfluss etwas Schlechtes:
Ich glaube, dass wir jedes Mal, wenn wir Schönheit zerstören oder wenn wir etwas von Menschenhand Geschaffenes und Künstliches an die Stelle eines natürlichen Merkmals der Erde setzen, einen Teil des geistigen Wachstums des Menschen verzögert haben […] Es ist eine von der Industrie dominierte Ära.
Der Spiegel phantasierte anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches: »Der immer dichter werdende Giftregen gleicht der Berieselung der Erde durch radioaktiven Staub, der bei den Atom-Explosionen aufgewirbelt wird, bis ins Detail.«
Anlässlich des brennenden Öls auf dem Cuyahoga erkannte der Bürgermeister von Cleveland, Carl Stokes, die Chance – und lud Journalisten ein. Der Fluss sickere eher, als dass er fließe, und Menschen könnten in der Brühe nicht ertrinken, sondern müssten verwesen, schrieb das Time Magazine, das Stokes ausführlich zu Wort kommen ließ. Andere Medien übernahmen, die Resonanz bestärkte Journalisten, Umweltthemen zu recherchieren. Der wirtschaftliche Aufschwung hatte Probleme verschärft: Ölkatastrophen, Müllberge, Artensterben, Waljagd, Gifte auf Feldern und Wiesen – Nachrichten dokumentierten die Schattenseiten des Wohlstands. In manchen Metropolen wie Los Angeles zwang der Smog zum Maske-Tragen, Menschen fürchteten die Verschmutzung von Gewässern und Umwelt. In Santa Barbara, Kalifornien, hatte eine Ölpest 1969 Tausende Vögel verklebt und getötet. Helfer weinten, als sie ihnen die schwarze Masse von den Federn wuschen. »Wir müssen die Ölbohrinseln stoppen, bevor sie uns zerstören«, sprach eine junge Frau in ein Radiomikrofon.
»Mir machten diese Dinge sehr zu schaffen«, erzählte Denis Hayes, der zur folgenden Revolution beitragen sollte: »All der Müll, all der Ressourcenverbrauch erschien mir bescheuert.« Der 25-jährige Student bekam die Zusage, dem damaligen Senator von Wisconsin, Gaylord Nelsen, in einem viertelstündigen Gespräch in Washington sein Anliegen vorzutragen. Aus den 15 Minuten im Dezember 1969 wurden mehrere Stunden. Nelsen beauftragte Hayes mit der Organisation eines »Nationalen Tags des Umweltunterrichts«, der im April 1970 stattfinden sollte; er hatte vier Monate Zeit. Seine erste Tat: den geplanten Anlass in »Earth Day« umzutaufen. Den Sitz seines Organisationskomitees legte Hayes in ein armes Viertel der Hauptstadt mit vielen farbigen Bewohnern. »Wir versuchten sie zu überzeugen, dass unser Plan in ihre Agenda passte«, berichtete er.
Zunächst schlossen sich Vogelschützer an, dann Autobahn-Gegner, Walfreunde, bald auch Antirassismus-Gruppen und andere soziale Bewegungen. Je näher der »Earth Day« rückte, desto mehr konzentrierte sich Hayes auf die Medien. Bilder ergaben sich schließlich von selbst: So gut wie überall in den Vereinigten Staaten zogen am 22. April 1970 Protestmärsche durch die Städte. 20 Millionen US-Amerikaner nahmen an 12 000 Demonstrationen und an unzähligen Vorträgen teil, allein in New York gingen eine Million auf die Straße. Linke Gruppen hatten mobil gemacht. Hinter Plakaten mit dem Slogan »End the Killing in Vietnam« rief eine Rednerin: »Wir zerstören systematisch unsere Luft, unsere Flüsse, unsere Meere!« Hayes stellte eine ähnliche Verbindung her: »Dieselben Leute, die unsere Umwelt verschmutzen, sind schuld an der Armut vieler Leute.« Die Demonstrationen in Washington, D.C. marschierten durch die Ghettos. »Wer leidet am meisten unter der Umweltverschmutzung?«, fragte eine Teilnehmerin und gab gleich darauf die Antwort: »Die Armen!« Der Zusammenschluss von Umweltaktivismus mit sozialen Gruppen sei der »entscheidende Schritt gewesen«, um seine Bewegung zu stärken, erzählte »Earth-Day«-Organisator Hayes. »Wir wollten die Gesellschaft ändern«.
Statt »Power to the People« skandierten Demonstranten auf dem ersten »Earth Day«: »People Pollute«, also »Menschen verschmutzen«. Eine linke Revolution brach sich Bahn. Karl Marx hatte die Ursache von Elend ebenfalls im Kapitalismus verortet, aber er wollte die Menschheit mittels technologischen Fortschritts florieren sehen. »Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes«, lautete Lenins Plan für große Kraftwerke und verlässlichen Zugriff auf günstigen Strom. Die Umweltbewegung übernahm das marxistische Konzept der Entfremdung, um die Arbeiterklasse von den Produktionsmitteln zu befreien. Linke forderten aber nicht mehr wie zuvor, Fabriken zu kontrollieren – sie wollten gar keine Fabriken mehr. Umweltschutz, bislang mit »Heimatschutz« und »Erhaltung der Schöpfung« noch die Domäne von Konservativen gewesen, gehörte bald den Progressiven, die ihr sozialdemokratisch geprägtes Paradigma des Fortschritts ablösten. Für Gewerkschaftsführer Tony Mazzocchi, einen der Organisatoren des ersten »Earth Day«, steckte hinter dem Begriff eine neue Form von Industriepolitik: »Wenn man anfängt, sich in die Produktionskräfte einzumischen, geht man ins Herz der Bestie.« Soziale Gerechtigkeit ließ sich im Namen von Umweltschäden gegen jede Art von Wirtschaftsaktivität einklagen.
Die USA reagierten, indem sie zahlreiche Naturschutzgesetze erließen und die Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) gründeten. Gewässer und Luft klarten auf, Grenzwerte verhinderten Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, Kreislaufwirtschaft linderte das Müllproblem, Tiere und Landschaften wurden unter Schutz gestellt, zusätzliche Spundwände erschwerten Ölleckagen bei Schiffen. Doch der Umweltbewegung ging es um mehr. Die Frankfurter Schule mit den Philosophen Max Horkheimer und Herbert Marcuse lieferte mit ihrer Kritischen Theorie das Rüstzeug für den Kampf der Neuen Linken. »Die Verletzung der Erde ist ein lebenswichtiger Aspekt der Konterrevolution«, sagte Marcuse 1972 auf einer Konferenz über Ökologie und Revolution. Die Marktwirtschaft führe Krieg gegen die Natur: »Je mehr die kapitalistische Produktivität steigt, desto zerstörerischer wird sie. Das ist ein Zeichen für die inneren Widersprüche des Kapitalismus«, ergänzte er und fügte noch hinzu: »Der völkermörderische Krieg gegen Menschen ist auch Ökozid.« Reiche Organisationen unterstützten die Frankfurter Schule. Die Rockefeller-Stiftung, getragen vom Vermögen der Erdöl-Dynastie, wollte das »Wohl der Menschheit verbessern« – und finanzierte Marcuses Forschung. Sie half auch, die Frankfurter Schule wieder in Deutschland anzusiedeln, wo sie ein Ausgangspunkt für die radikale Linke der 68er-Bewegung werden sollte. Marcuses Reden stachelten Studenten an. Das System sei »repressiv in jeder Hinsicht«, was sich letztlich nur verhindern lasse, indem das Verhalten der Menschen »vollkommen geändert« werde. Eine Revolution in seinem Sinne würde »der Industrie nicht erlauben, die Luft zu verschmutzen«.
Umweltpolitik sei »Sinnressource für delegitimierte und von Vertrauensverlust gezeichnete Politik«, erkannte der Soziologe Ulrich Beck. Als die Linke strauchelte – in Deutschland nach dem Zerfall der Studentenbewegung, dem Radikalenerlass, dem Deutschen Herbst 1977, dem vergeblichen Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss –, bot das Thema ein Vehikel, um Legitimationsprobleme zu kaschieren. »Der Preis war eine Aufladung der Umweltdebatte mit ideologischen Versatzstücken«, erläuterte der Historiker Frank Uekötter: »Entfremdung, Kapitalistenkritik, Ausbeutung der Natur als Analogon zur Ausbeutung der Arbeiterschaft.« Die Klimabewegung übertrug die Parolen in die Gegenwart: »Wir müssen den Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang und seinen Ausbeutungsmechanismen überwinden«, forderten Abgeordnete der Grünen und der Linken in einem Aufruf der Umweltgruppe »Ende Gelände« aus dem Jahr 2019. Bei einer Demonstration in Berlin zur gleichen Zeit posierten Aktivisten von Fridays for Future vor dem Reichstag mit einem überdimensionalen Transparent »Capitalism kills«.
In den 1980er-Jahren war allerdings nicht mehr zu leugnen, dass die reichen Staaten des Westens die sauberste Umwelt hatten. Drastisch zeigte sich der Unterschied im Vergleich der DDR mit der Bundesrepublik: Das kommunistische Deutschland mit seiner ineffektiven Wirtschaft musste alles aus dem Land herauspressen: Die Böden wurden überdüngt, man heizte mit minderwertiger Kohle und leitete ungefilterte Kloake in die Gewässer. Fast die Hälfte aller größeren Flüsse der DDR war biologisch tot und zu Abwasserkanälen degradiert. Umweltschutz kostet Geld, das erst durch eine wettbewerbsfähige Produktion erwirtschaftet werden muss. Die Innovationsschwäche der Planwirtschaft, in der das Streben nach Gewinn gänzlich fehlte, mündete in einen Mangel an Investitionsmitteln, der sich im Umweltschutz verheerend auswirkte. Der Bau von Rauchgasentschwefelungsanlagen und Staubfiltern blieb aus, ebenso Kläranlagen und funktionsfähige Kanalsysteme. Die industrielle Revolution hatte die Menschen von mühsamer Landwirtschaft befreit und dank Dünger, Bewässerung und Traktoren den Flächenbedarf reduziert; das Streben nach Nutzenmaximierung ermöglichte später eine Umstellung der Energieversorgung von Holz über Kohle auf Erdgas und Uran. Der Kapitalismus belohnt den effizienten Verbrauch natürlicher Ressourcen – aber auch seine Kritiker.
Den wunden Punkt hatte der Ökonom Joseph Schumpeter von der Harvard University in seinem Werk Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie aus dem Jahr 1942 beschrieben: Der Kapitalismus sei ein »ewiger Sturm der schöpferischen Zerstörung«, weshalb er schließlich auch sich selbst zerstören könnte. Im Gegensatz zu allen anderen Gesellschaftsformen schaffe er kraft seiner inhärenten Logik ein antikapitalistisches Intellektuellen-Milieu, das davon lebe, das System infrage zu stellen: »Kapitalismus bezahlt die Leute, die danach streben, ihn zu Fall zu bringen«, schreibt Schumpeter. Die Umweltbewegung wurde zur Kraft des Hasses auf den Westen in dessen Herzen: Technokraten und Intellektuelle warteten mit Diagnosen auf, denen zufolge die liberalen Demokratien eine globale Katastrophe schürten. Nun war es immer »5 vor 12«. Mit der Umweltbewegung werde die Linke bourgeoise, zur Partei der gebildeten Eliten, warnte der britische Sozialdemokrat Tony Crosland 1971: Teile der Umweltlobby stünden ihm zufolge »Wachstum grundsätzlich feindlich und den Bedürfnissen der einfachen Menschen gleichgültig gegenüber, was eine offensichtliche Klassenvoreingenommenheit und eine Reihe von Werturteilen der Mittel- und Oberschicht widerspiegelte«.
4. Umweltschutz als Statuskampf: Alte Reiche gegen neue Reiche
Das Establishment bremst wirtschaftliche Freiheit, weil sie die Kluft zu Aufsteigern verringert.
Die britische Königin Elisabeth II. posierte 1961 zusammen mit ihrem Gemahl und einer Jagdgesellschaft in Indien vor einem erschossenen Tiger. Prinz Philip war Präsident des World Wide Fund for Nature (WWF), den er gerade zusammen mit anderen Adligen und Reichen gegründet hatte, darunter Prinz Bernhard der Niederlande und Godfrey A. Rockefeller. Im »Morges-Manifest«, dem Gründungstext des Umweltverbands, versprach der WWF, sich für Wildtiere einzusetzen: »Überall auf der Welt verlieren heute unzählige feine und harmlose Wildtiere ihr Leben oder ihre Heimat in einer Orgie der gedankenlosen und nutzlosen Zerstörung.« Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Indien rund 100 000 Tiger, mittlerweile sind es nur noch wenige Tausend. »Natürlich habe ich vor, wenn möglich einen Tiger zu schießen, warum nicht?«, zitierten Medien Prinz Philip bei seinem Besuch in Südostasien 1961. Etwa 200 Treiber hatten die Raubkatzen auf eine Lichtung in die Nähe eines erhöhten Holzturms gescheucht, von wo aus der Herzog eine von ihnen mit einem Kopfschuss tötete. Der Leichnam wurde per Lastwagen zum Palast des Maharadschas in Jaipur transportiert und dort von Würdenträgern umringt fotografiert, darunter der stolze Prinz und die Königin.
Am folgenden Morgen organisierten die adligen Gastgeber für die Königin eine Jagd, damit sie einen weiblichen Tiger erlegen konnte. Laut einer Begleiterin habe sie ihre Waffe für den tödlichen Schuss einem ihrer Mitarbeiter übergeben. Der Maharadscha ließ den Trophäentiger des Prinzen häuten, ausstopfen und nach Windsor Castle verschiffen. Philip soll noch zwei Krokodile getötet haben, eines fünf Meter lang. Der damalige britische Außenminister Alec Douglas-Home, der die Royals begleitete, habe ein seltenes weibliches weißes Nashorn geschossen, meldeten Medien. Prinz Philip beugte sich schließlich dem öffentlichen Druck und gab die Großwildjagd auf, aber er verteidigte sie weiterhin: Man töte nicht, man keule.
Der Schutz von Wildtieren ging einher mit dem Schutz von Jagdrevieren der High Society. Dekolonialisierung und Bevölkerungswachstum bedrohten Afrikas Tierwelt, so die Sorge adliger Großwildfreunde. Mit dem WWF vergrößerten Reiche ihren Einfluss. Der »1001-Club«, gegründet Anfang der 1960er-Jahre von Prinz Philip und rund 1 000 überwiegend anonymen Wohlhabenden, unterstützte den Umweltverband. Das investigative Schwarzbuch WWF bezeichnete den verschwiegenen Verein als Netzwerk »alter Jungs« mit weltweitem Einfluss in Politik und Wirtschaft: Baron von Thyssen, der Fiat-Chef Gianni Agnelli, Autofirmen-Boss Henry Ford, Bier-Magnat Alfred Heineken, der dubioser Geschäfte verdächtigte Politiker Mobutu Sese Seko aus dem damaligen Zaire und der ehemalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Juan Samaranch. Der WWF konnte durch das Gewicht seiner Mitglieder Nähe zu Regierungen aufbauen. Anfang der 1990er-Jahre erhielt seine deutsche Zweigstelle rund die Hälfte ihrer Mittel von der Bundesregierung und diversen Hilfsorganisationen. Gleichzeitig verdiente der WWF Geld mit seiner Marke: »Wildlife-Taschentücher« mit dem bekannten Panda trieben den Umsatz der Papiertücher-Marke Kleenex um 76 Prozent nach oben. Das Geschäft lohnte sich: Der WWF zahlt seinen Angestellten mittlerweile Gehälter wie ein Spitzenunternehmen; die Chefs verdienen rund eine Million US-Dollar pro Jahr, hohe Angestellte viele Hunderttausend. Seine Filialen befinden sich in bester Lage beliebter Großstädte und sind mit dem Wort »pompös« zurückhaltend beschrieben. Trotz seines zur Schau gestellten Wohlstands freut sich der WWF jährlich über hohe Spendeneinnahmen und millionenschwere Zuwendungen aus Steuergeldern.