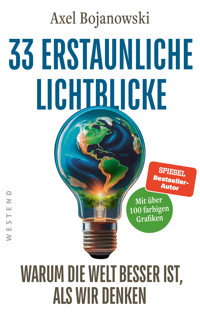5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Warum brummt die Erde leise eine Melodie?
Mächtige Felsen schieben sich durch die Wüste, doch selbst mithilfe moderner Messmethoden kann man nicht erklären, was sie antreibt. Immer wieder mal krachen Eisblöcke vom wolkenlosen Himmel, aber niemand weiß, weshalb dies geschieht. Der Planet Erde bietet so einige spannende Rätsel. Wann brechen die Vulkane in der Eifel aus? Warum liegen die Kontinente eher auf der Nordhalbkugel? Und wieso ist am Wochenende so oft schlechtes Wetter?
Axel Bojanowski, ein leidenschaftlicher Sammler geowissenschaftlicher Raritäten und unglaublicher Phänomene, hat die 30 erstaunlichsten in seinem Buch versammelt. Seine Stories handeln von gigantischen Wasserfällen im Atlantik, die sich Tausende Meter in die Tiefe stürzen, von riskanten Bohrungen ins Herz eines Supervulkans und vom wahren Klima Deutschlands. Präzise, unterhaltsam und verständlich erzählt er von den großen Themen der Geowissenschaften – mit wunderbarem Gespür für die schrägen Details.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Axel Bojanowski
Nach zwei Tagen Regen folgt Montag
und andere
rätselhafte Phänomene
des Planeten Erde
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Grafiken im Innenteil wurden gezeichnet von Peter Palm, Berlin, nach Vorlage von: Science (Abb. 1), Helmholtz-Zentrum Potsdam, GF2, Sektion 2.6, G. Grünthal (Abb. 2) und Universität Köln (Abb. 3). Die Tabellen in Kapitel 33 wurden erstellt nach Vorlage von: Institut für Wetter- und Klimakommunikation IWK, mit Ausnahme der Tabelle von Essen (Ruhrgebiet): Peter Wolf, Deutscher Wetterdienst, Regionales Klimabüro, Essen.
1. AuflageCopyright © 2012 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.und SPIEGEL-Verlag, HamburgAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Juliane MüllerTypografie und Satz: DVA/Brigitte MüllerISBN 978-3-641-07243-8V002
www.dva.de
Meiner geliebten Ulli gewidmet
»Geologen, in ihrem beinahe geschlossenen Gespräch, bewohnen Schauplätze, die niemand je gesehen hat, Schauplätze der weltweiten Flüchtigkeit, gekommen und vergangen, mit Meeren, Bergen, Flüssen und Archipelen von schmerzender Schönheit, die sich mit vulkanischer Gewalt erheben, um sich friedlich niederzulassen und schließlich zu verschwinden – fast zu verschwinden.«
John McPhee
Vorwort
Jeder kennt das andächtige Staunen von Touristen vor hohen Wasserfällen, Schluchten oder anderen Natursensationen. Oft fehlen ihnen die Worte, die Sehenswürdigkeiten zu deuten. Geoforscher könnten die Naturwunder begreifbar machen, den Touristen erläutern, was es zu sehen gibt. Doch seltsam: Wenn Wissenschaftler über die Natur reden, wird bei Zuhörern aus Sehen und Staunen oft Gaffen und Gähnen.
Ich erinnere mich zum Beispiel, wie ein Geologieprofessor an der San-Andreas-Erdspalte in Kalifornien versuchte, eine Reisegruppe zu begeistern. Die San-Andreas-Verwerfung prägt seit Langem die menschliche Geschichte – ähnlich der berühmten Totes-Meer-Verwerfung im Nahen Osten (Kapitel 30). Erwartungsvoll hatten sich etwa zwei Dutzend Touristen im Halbkreis um den renommierten Wissenschaftler gruppiert, als er seinen Vortrag begann. Er mühte sich um verständliche Begriffe: »Vor Jahrmillionen begannen tektonische Aktivitäten in dieser Region in Zusammenhang mit magmatischen Prozessen die Erdkruste auszudünnen.«
Bereits nach diesem ersten Satz verkleinerten sich die Augen der meisten Zuhörer. Nach fünf Minuten schweiften ihre Blicke in die Landschaft, auf der Suche nach Interessanterem. Bald freuten sie sich nur noch auf eines, nämlich auf das nächste Picknick. »Leben heißt Leiden, sagte Buddha«, flüsterte ein Teilnehmer lakonisch. »Wenn man hier zuhört, weiß man, was der Mann meinte.« Wie ist es möglich, dass viele Menschen sich zwar für die Natur begeistern, sich aber meist gelangweilt abwenden, sobald ihnen darüber berichtet wird?
Wissenschaftler schwärmen selten von ihrer Arbeit. Dabei hätten zumindest Geoforscher allen Grund dazu: Sie entdecken spektakuläre Landschaften mit bizarren Urzeitwesen, die längst untergegangen sind (Kapitel 17). Sie sind die einzigen Menschen, die Riesenwasserfällen im Ozean auf der Spur sind (Kapitel 7). Sie verfolgen Felsen, die wie von Geisterhand bewegt durch die Wüste streunen (Kapitel 15). Oder sie haben das Orakel von Delphi entschlüsselt (Kapitel 13).
Doch allzu oft verlieren sich Wissenschaftler mit ihrer Liebe zur Verklausulierung in einer Art Erhabenheitskitsch – Unverständlichkeit wird mit Klugheit gleichgesetzt. Der Chemie-Nobelpreisträger Irving Langmuir bezweifelte gar die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlerkollegen, die ihre Ergebnisse nicht verständlich erklärten: »Wer es nicht schafft, seine Arbeit einem 40-Jährigen zu erläutern, ist ein Scharlatan«, mahnte er. Aus Sicht von Außenstehenden gleichen Forscher mitunter einem exotischen Bergvolk, das einen lustigen Dialekt spricht.
Für interne Debatten haben Fachbegriffe, Formeln und Zahlen natürlich eine wichtige Funktion, sie sollen sicherstellen, dass die Arbeiten präzise dokumentiert und exakt nachvollziehbar sind. Jedoch verstellen die Wortungetüme oftmals den Blick auf die Schönheit der Dinge, die sie beschreiben. Wer soll beispielsweise ahnen, dass sich hinter der Überschrift »A record-high ocean bottom pressure in the South Pacific observed by GRACE« die Entdeckung einer riesigen Wasserbeule im Pazifik verbirgt (Kapitel 8)? Dass eine Studie namens »An updated climatology of surface dimethlysulfide concentrations and emission fluxes in the global ocean« davon erzählt, dass Meeresalgen hoch oben in der Atmosphäre Wolken sprießen lassen, die Schatten spenden, wenn es ihnen im Wasser zu warm wird (Kapitel 11)? Oder dass das Papier »Comparison of dike intrusions in an incipient seafloor-spreading segment in Afar, Ethiopia: Seismicity perspectives« davon berichtet, dass der afrikanische Kontinent von Vulkanausbrüchen und Erdbeben zerrissen wird (Kapitel 29)? Die Fachsprache verbirgt das Interessante wie eine dicke Erdschicht eine Goldader.
In jeder Universität, jedem Forschungsinstitut, ja im Grunde in jedem Labor verstecken sich ähnlich erstaunliche Geschichten. Man sollte annehmen, dass die Medien voll wären von solchen Storys. Das sind sie nicht, denn auch Journalisten tappen gern in die Erhabenheitsfalle. In Redaktionen hält sich eine kuriose Rechtfertigung für komplizierte Texte: Der Leser verlange nach kniffliger Sprache, um eine Herausforderung meistern zu können – komplizierte Sprache markiere den Unterschied zu Boulevardmedien, heißt es oft. Ein Vorteil dieser Haltung ist, dass man sich damit erfolgreich durch Verständnislücken mogeln kann.
An manchen Wissenschaftsgebieten kann die Öffentlichkeit schon seit Längerem Anteil nehmen: Es gibt bewundernswert unterhaltsame Bücher über Astronomie, Medizin oder Psychologie, vor allem in Großbritannien und den USA. Geowissenschaften jedoch spielen eine Nebenrolle, sie besitzen in den Massenmedien in etwa den gleichen Stellenwert wie Turmspringen in Sportsendungen – sie gelten oft als Skurrilitäten, die auf den hinteren Seiten stattfinden, falls gerade keine »bunten Meldungen« über eine Königsfamilie oder Ähnliches zu vermelden sind.
Wissenschaftler sind meist überrascht, wenn sie hören, dass die eigentliche Arbeit erst richtig losgeht, wenn die Studien verstanden sind. Dann müssen die Schichten aus Wort- und Zahlengerümpel abgetragen werden, damit die Goldadern der Forschung freiliegen und tatsächlich auch durchscheinen. Für dieses Buch – Nach zwei Tagen Regen folgt Montag – habe ich Geschichten aus der Geoforschung geschrieben; unglaubliche, mysteriöse, haarsträubende, witzige und spannende Geschichten. Los geht es mit einem Fall, der nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Polizisten beschäftigt. Es geht um Bomben aus Eis, die vom Himmel fallen. Vom blauen Himmel. Jeder Einschlag verwirrt aufs Neue: Die Eisklötze kommen nicht aus dem All, nicht von Attentätern und nicht aus Flugzeugtoiletten. Aber woher kommen sie dann? Lassen Sie sich überraschen!
Axel Bojanowski, Hamburg, im Winter 2011
1Frostbomben aus heiterem Himmel
Solch einen mysteriösen Fall hatten die spanischen Polizisten der Guardia Civil noch nicht erlebt. Tathergang und Motiv des Falls blieben im Dunkeln. Auch die Herkunft des Beweisstücks ließ sich nicht klären. Und anstelle eines Täters mussten die Ordnungshüter einen Eisklumpen mit auf die Wache schleppen. Es war am 13. März 2007 um kurz nach zehn Uhr morgens im Städtchen Mejorada del Campo, 20 Kilometer östlich von Madrid, passiert. Am Tatort hatte ein etwa 20 Kilogramm schwerer Frostbrocken ein Loch in das Dach einer Lagerhalle geschlagen. War der gefrorene Trumm etwa vom Himmel gefallen? Bei Sonnenschein? Wohl kaum, meinten die Arbeiter des Lagers; nur ein Anschlag käme infrage – sie riefen die Polizei. Doch weder Polizei noch Wissenschaftler konnten das Rätsel lösen. Untersuchungen im forensischen Labor ergaben, dass Menschen nichts mit der Eisattacke zu tun hatten. Besonders mysteriös ist, dass aus vielen Ländern ähnliche Fälle gemeldet wurden.
Der Geologe Jesús Martínez-Frías vom Zentrum für Astrobiologie in Madrid hat seit 2002 weltweit rund 80 Aufschläge von Rieseneisklumpen dokumentiert, auch aus den Jahrzehnten zuvor sind ihm Dutzende bekannt. Die Frostbrocken können zerstörerisch sein. Sie erreichen oft die Größe einer Mikrowelle, manche gar die eines Schranks. In Toledo, Spanien, sorgte 2004 gar ein 400-Kilo-Koloss für Aufsehen, der ein Mädchen nur knapp verfehlte; das Eis schlug einen beachtlichen Krater. Das Gruselige sei, so Jesús Martínez-Frías, dass anscheinend täglich solche Brocken auf die Erde prasseln. Aufschläge werden allerdings nur bekannt, wenn sie jemand beobachtet. Doch an den allermeisten Orten der Welt gibt es keine Menschen. Wie viele Einschläge also tatsächlich passieren, ist unklar.
Geheimnisvoll klingt auch die Bezeichnung der Eisbrocken: Mega-Cryo-Meteore nannte sie Jesús Martínez-Frías – auf Deutsch: »große eisige Himmelskörper«. Der umständliche Name soll die Brocken vom Hagel unterscheiden, erläutert der Geologe. Die meisten Eisklötze seien schließlich vom heiteren Himmel gestürzt – im Gegensatz zu Hagel, der sich in mächtigen Wolken bildet, wo Wassertröpfchen gefrieren: Hagelkörnchen werden wiederholt durch Aufwinde emporgehievt, wo sich vereisendes Wasser an ihnen niederschlägt und sie wachsen lässt. Größer als zehn Zentimeter werden Hagelkörner allerdings nicht – verglichen mit Mega-Cryo-Meteoren bleiben sie also klein.
Ein spektakulärer Fall aus Deutschland ereignete sich am 27. April 2010. Um 10 Uhr 17 schreckte schrilles Pfeifen, gefolgt von einem Knall, die Anwohner der Straße Brenndörfl in der Gemeinde Hettstadt bei Würzburg auf. Knapp 50 Kilogramm Eistrümmer lagen auf dem Boden, sie hatten eine Kindergartengruppe mit 15 Kindern nur knapp verfehlt. »Der Postbotin sind die Brocken regelrecht um die Ohren geflogen«, erzählte ein Anwohner, in dessen Garten ein dreieckiger Krater klaffte, 22 Zentimeter tief. Zudem war eine Gehwegplatte zersprungen, Äste von Sträuchern waren abgebrochen. Die Anwohner blickten gen Himmel, wo ein paar Schönwetterwölkchen schwebten – Hagel schien ausgeschlossen. Was war geschehen?
Die Eisbombe von Hettstadt war ein Sonderfall – ihre Herkunft ist inzwischen geklärt: Eine Boeing 737-700 auf dem Weg von Dortmund nach Thessaloniki überflog die Ortschaft um 10 Uhr 12 in 10.730 Meter Höhe, hat Frank Böttcher vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation ermittelt. »Bei freiem Fall von diesem Flugzeug aus ergibt sich ein Einschlag kurz vor 10 Uhr 17, dem beobachteten Zeitpunkt«, berichtet er. Luftfahrtexperten wissen, dass sich an Verkehrsmaschinen mitunter Eis bilden kann, etwa an undichten Ventilen. Die meisten Eisklötze jedoch stammen nicht von Flugzeugen. Nachdem etwa im Januar 2000 in Südspanien ein Eisklumpen die Windschutzscheibe eines Autos zertrümmert hatte, fragte Martínez-Frías umgehend bei der Luftaufsichtsbehörde nach – es hatte keine Überflüge der Region gegeben. Auch die Einwände anderer Wissenschaftler, möglicherweise seien kleine, nicht dokumentierte Privat- oder Militärmaschinen verantwortlich, weist Martínez-Frías zurück. Der Geologe hat Berichte über Rieseneisklumpen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt, aus einer Zeit also, als es noch gar keine Flugzeuge gab.
Allmählich gehen den Wissenschaftlern die Ideen aus, mit denen das Phänomen der Mega-Cryo-Meteore erklärt werden könnte, eine Theorie nach der anderen mussten sie fallenlassen. So gab es etwa die These, dass die Eisklumpen ihrem Namen Ehre machen und aus dem Weltall stammen. Diese Annahme wurde durch eine Isotopenanalyse der Eisbrocken jedoch längst widerlegt: Je nach Herkunft bestehen Wassermoleküle (chemische Formel: H2O) aus unterschiedlich schweren Wasserstoff- (H) und Sauerstoffatomen (O). Die Analyse der Frostbomben ergab, dass sie aus der Erdatmosphäre stammen: Mega-Cryo-Meteore haben die gleiche Isotopensignatur wie Regentropfen. Woher aber sollten die Eiskolosse dann kommen?
Berichte der NASA schienen zumindest die Attacke auf das Auto in Südspanien im Januar 2000 aufklären zu können. Satellitendaten der Raumfahrtbehörde offenbarten, dass die Ozonschicht über der Gegend in den Tagen vor dem Einschlag ausgedünnt war. Sonnenstrahlung drang deshalb vermehrt in die untere Atmosphäre, obere Luftschichten kühlten aus. Der Temperaturgegensatz erzeugte Extremwinde in der Höhe. Die NASA-Daten zeigten zudem, dass die Luft äußerst wasserdampfgeladen war. Die ungewöhnlichen Bedingungen hätten womöglich die Eisbrocken entstehen lassen, meinte Martínez-Frías: Der Sturm habe Eiskristalle so lange in der feuchten Luft gehalten, dass sie zu gigantischer Größe angewachsen seien.
Andere Forscher indes reagierten skeptisch: »Ich möchte nicht behaupten, dass irgendetwas absolut unmöglich ist«, erklärte etwa der Hagelexperte Charles Knight, »aber diese Theorie kommt dem doch schrecklich nahe.« Selbst nach langer Verweildauer in feuchter eisiger Luft entwickelten sich höchstens große Schneeflocken, jedoch keine Eisklötze, meinte er. Selbst Martínez-Frías zweifelt mittlerweile an seiner Theorie, seine Erklärung fällt äußerst vage aus. »Unsere Studien nach neun Jahren Forschung zeigen eindeutig, dass Mega-Cryo-Meteore atmosphärische Extremereignisse sind«, resümiert der Geologe. Genaueres weiß man nicht. Die Ratlosigkeit der Wissenschaftler über die Frostklötze mündet nun oft in Ironie: »Sind sie real? Kommen sie von Gott? Ist die Klimaerwärmung schuld?«, fragt der Verfasser des Blogs megacryometeors.com. Dabei nehmen Experten die Sache äußerst ernst: Es sei nur eine Frage der Zeit, sagt Martínez-Frías, bis Menschen verletzt oder Flugzeuge getroffen würden.
Ein anderes eisiges Geheimnis beschäftigt Geoforscher im nächsten Kapitel: Auf Gewässern bilden sich kreisrunde Eisschollen, manche sind Tausende Meter groß. Russische Forscher präsentieren eine erstaunliche Erklärung für die runden Giganten.
2Das Geheimnis der Eiskreise
»Sehr mysteriös«, notierte ein russischer Naturforscher im 19. Jahrhundert, als er die seltsamen Phänomene auf dem zugefrorenen Baikalsee begutachtete: Meterhohe weiße Schlote aus Eis erheben sich dort im Winter aus dem Gewässer. Wie sie sich bilden, ist bis heute ungeklärt. Immer wieder brechen auch tiefe Risse in die eisige Seeoberfläche, als ob Wellen das Eis spalten würden – Wasser gelangt jedoch nicht nach oben. Die Klüfte schließen sich mit lautem Krachen; es klinge »wie Kanonenfeuer«, schrieb ein Eiskundler 1882.
121 Jahre später, im Frühjahr 2003, entdeckten Forscher auf Satellitenbildern ein weiteres Mysterium auf dem zugefrorenen Baikalsee: Kilometerbreite Kreise aus Eis zeichneten sich ab. »Ungewöhnliche Ringstrukturen«, staunten Wissenschaftler in Wissenschaftlersprache. Sie sahen sich Satellitenfotos aus früheren Jahren an – auch darauf erkannten sie die Ringe.
Anderenorts haben Eiskreise die Wissenschaft ebenso vor ein Rätsel gestellt. In der Ostsee etwa wurden sogenannte Eispfannkuchen entdeckt. Ihre Entstehung meinen Forscher inzwischen erklären zu können: In unruhigem Wasser bilden sich Pfützen aus Eisschlamm. Weil sie nach allen Seiten gegeneinanderstoßen, formen sich an ihren Rändern runde Eiskrusten. Sie sehen also aus wie die Salzdekoration am Cocktailglas. Weit größeren Anlass zur Spekulation bot ein imposanter Eiskreis am Fluss Machra, 120 Kilometer nördlich von Moskau, den der Russe Alexey Yusupov 1995 entdeckte. »Der Kreis hatte eine derart ideale geometrische Form, dass alle Zuschauer geradezu magnetisiert wurden«, erinnert er sich. Schon am nächsten Tag war das Rund jedoch verschwunden. »Da eine alte Frau im Dorf zuvor einen Kugelblitz gesehen haben will, kursierten die wildesten UFO-Gerüchte«, berichtet Yusupov. Doch auch Naturwissenschaftler konnten das Phänomen lange nicht deuten. Inzwischen gibt es aber eine Erklärung: Auf manchen Flüssen entstehen im Winter meterbreite Eiskreise, die sich um die eigene Achse drehen. Sie bilden sich offenbar meist in Flusskurven; die Strömung bricht Eis aus der gefrorenen Wasseroberfläche und lässt es in Strudeln rotieren.
Die im Vergleich dazu riesigen Kreise auf dem Baikalsee lassen sich jedoch nicht auf diese Weise auslegen. Wie immer, wenn die Wissenschaft nicht weiterweiß, bieten sich abwegige Deutungen an: Blieben – wie lange Zeit bei den berühmten Kreisen in britischen Kornfeldern – wirklich nur Außerirdische als Verdächtige? Oder sollten Schlittschuhläufer die rätselhaften Gebilde geformt haben, zirkeln Kufenakrobaten die Kreise ins Eis? Das Phänomen trete im Spätwinter auf, berichtet Nikolai Granin vom Limnologischen Institut in Irkutsk. Er meint den Spekulationen ein Ende bereiten zu können. Nachdem am 4. April 2009 Satellitenbilder einen stattlichen Eiskreis auf dem Baikalsee gezeigt hatten, machte sich Granin mit Kollegen auf, das Phänomen vor Ort zu untersuchen. Drei Tage später stießen die Geoforscher einen Bohrer in den Eiskreis – das Gerät schälte mehrere Eisstangen heraus.
Die erste überraschende Entdeckung war, dass das Eis am Rand des Rings dünner war als im Zentrum. »Mit zunehmender Entfernung vom Mittelpunkt durchzogen immer mehr kleine Risse das Eis«, berichtete Granin. Temperatur- und Strömungsmessungen im Wasser unter dem Eis brachten einen weiteren wichtigen Hinweis: Strudel unterwandern die Kreise. Am Rand der Kreise erreichen die Wirbel ihre größte Geschwindigkeit. Durch die Turbulenz bilden sich die dunklen Ringe, folgerte Granin: Das Eis werde am Rand der Kreise schneller zerstört als im Zentrum – Wasser dringe in die Risse, es verdunkle das Eis.
Eine entscheidende Frage blieb zunächst aber offen: Warum gibt es solche ominösen Strudel gerade im Baikalsee? Offenbar verursachen mächtige Gaseruptionen am Grund des Sees die Wirbel, so Granin. Dort, im Boden des Baikalsees, wurden Erdgasvorkommen entdeckt. Teilweise liegen sie in Eisklumpen eingeschlossen. Zudem brodelten im Seegrund sogenannte Schlammvulkane, die neben Schlick auch Gas hervorstießen. Mit Schallwellen entdeckten Granin und seine Kollegen Gasfahnen, die vom Grund aus bis zu 900 Meter aufragten. An manchen dieser Stellen hätten sich im Winter Eiskreise auf dem zugefrorenen See gebildet. Die Theorie der russischen Wissenschaftler erscheint plausibel, bestätigt die Umweltforscherin Marianne Moore vom Wellesley College im US-Bundesstaat Massachusetts: Das Erdgas schieße vermutlich mit warmem Wasser aus dem Boden und werde beim Aufstieg in Drehung versetzt – ähnlich wie bei einem Tornado. Die Wirbel erzeugten schließlich die Eiskreise.
Die Erforschung dieses Naturphänomens hat ernste Konsequenzen für die Schifffahrt auf dem Baikalsee. Die russische Regierung warnt Kapitäne regelmäßig vor den Orten, an denen sich Eiskreise bilden. An diesen Stellen bestehe die Gefahr, dass Erdgaswolken sich entflammten, wenn sie mit offenem Feuer – etwa an Bord eines Schiffes – in Berührung kämen. Indessen warten Nikolai Granin und seine Kollegen gespannt auf neue Satellitenfotos. In den kommenden Wintern werden sich vermutlich wieder Eiskreise auf dem Baikalsee bilden. »Doch die Ringe«, sagt Granin, »sind keineswegs das letzte Rätsel des Sees.« Und so werden die Forscher wieder hinfahren, um auch die anderen winterlichen Mysterien der Gegend zu entschlüsseln. Die Herausforderung ist groß, schließlich stellt das Eis des Baikalsees Wissenschaftler seit Jahrhunderten vor Rätsel.
Nicht nur das Winterwetter hält Überraschungen bereit. Im nächsten Kapitel ergründen Meteorologen, warum ausgerechnet am Wochenende schlechtes Wetter herrscht.
3Nach zwei Tagen Regen folgt Montag
Die Natur kennt im Grunde weder Werk- noch Feiertage noch die Siebentagewoche. Sie folgt dem Takt von Tag und Nacht, den Jahreszeiten und langfristigen Klimaänderungen, die von Meeresströmungen gesteuert werden. Und doch zeigen Wetterdaten seltsamerweise einen Wochenrhythmus: In vielen Regionen ist das Wetter am Wochenende tendenziell schlechter als werktags. Auf die Frage, was nach zwei Tagen Regen folgt, gibt es oft eine sarkastische Antwort: Montag.
Der Verdacht fiel rasch auf Autos und Industrie, die unter der Woche mehr Abgase erzeugen. Bis zum Wochenende haben sich Messungen zufolge über Deutschland tatsächlich ein Viertel mehr Partikel in der Luft angesammelt. Die Abgasteilchen blockieren das Sonnenlicht und dienen als Keime für Regentropfen. Am Samstag und Sonntag regne es in Deutschland deshalb mehr, berichten Dominique Bäumer und Bernhard Vogel vom Forschungszentrum Karlsruhe nach der Auswertung von Wetterdaten aus den Jahren 1991 bis 2005.
Dass in Mitteleuropa am Wochenende tendenziell schlechteres Wetter herrscht, belegen weitere Studien: Am Samstag und Sonntag sei es in Europa kühler als Mitte der Woche, haben Forscher um Patrick Laux vom Karlsruher Institute of Technology (KIT) herausgefunden. Der Effekt sei nicht groß, aber durchaus spürbar: Im Durchschnitt fällt die Abkühlung mit etwa einem Viertel Grad im Schatten zwar klein aus – aber manchmal eben auch deutlich stärker. Zudem blockieren Abgaspartikel am Wochenende verstärkt das Sonnenlicht, sie können vor allem nahe den Metropolen den Samstag und den Sonntag trüben. Das gern besungene »Wochenend’ und Sonnenschein« gibt es also seltener als etwa Donnerstag mit Sonnenschein.
Sogenannte Wochenendeffekte stellten Meteorologen auch in anderen Ländern fest: Die USA etwa kühlen sich am Samstag und Sonntag im Durchschnitt ab, in China verändert sich das Wetter am Wochenende auf vielfältige Weise, je nach Region. Für die meisten Länder freilich steht eine entsprechende Analyse der Wetterdaten noch aus, umfangreiche Rechnungen sind nötig. Dabei ist es nicht einfach auszuschließen, dass der Wochenendeffekt mancherorts doch nur eine vorübergehende Laune der Natur ist. Einige Indizien irritieren: Seltsamerweise regnet es auch über dem Nordatlantik in Island und Grönland am Wochenende mehr, obwohl dort kaum Abgase schweben sollten. Die Partikelschleier wirken anscheinend auch indirekt: Indem sie für Kühlung sorgen, ändern sich Luftströmungen – die Abgase könnten sich fernab der Emissionsquellen bemerkbar machen. Oder zeigen Ozeanströmungen etwa doch einen Wochenrhythmus?
Das Rezept der Wetterküche ist komplizierter als die simple Formel »Mehr Abgase gleich schlechtes Wetter«. Der Wochenendeffekt wird von einem Zusammenspiel aus Abgasen, Winden und Wetterfronten verursacht. In Spanien und den USA gibt es gar einen umgekehrten Wochenendeffekt: Dort regnet es am Wochenende weniger – schuld daran scheinen die Abgase zu sein: Offenbar unterdrücken sie den Regen, sagen Experten. Zwar verdunkelt und kühlt der feine Staub die Luft, sodass die Wochenenden auch in diesen Ländern tendenziell weniger schön sind. Die Wassertröpfchen, die sich um die feinen Partikel in Wolken sammeln, scheinen jedoch zu klein, um als Regen zur Erde zu fallen – es ist bewölkt, ohne dass es regnet. Auf diese Weise kann Niederschlag für viele Wochen zurückgehalten werden: Luftverschmutzung habe in Nordamerika sogar gravierende Dürreperioden verursacht, haben Studien gezeigt.
Auch der Wochenendeffekt in Deutschland steht immer wieder zur Prüfung. Neueste Analysen haben zwar bestätigt, dass es hierzulande am Samstag und Sonntag kühler und schattiger ist als unter der Woche. Doch dass der vermehrte Regen am Wochenende tatsächlich mit den Abgasen zusammenhängt, sei schwer nachzuweisen, sagt Harrie-Jan Hendricks Franssen von der ETH Zürich. Mit der sogenannten Monte-Carlo-Methode hat der Forscher am Computer die Wetterdaten der letzten Jahrzehnte Dutzende Male willkürlich durcheinanderbringen lassen – wie beim Glücksspiel im Kasino von Monte Carlo eben. Dabei stellte sich heraus, dass sich 15 Jahre mit eher schlechtem Wochenendwetter durchaus auch per Zufall einstellen könnten. Damit geriet die Studie von Bäumer und Vogel ins Wanken, die die Tendenz zum Wochenendregen in Deutschland von 1991 bis 2005 auf Abgase zurückgeführt hat. Bäumer und Vogel machen aber geltend, dass ihr Ergebnis von zahlreichen Wetterstationen gestützt wird: Sie haben zwölf Messstationen in Deutschland untersucht, die übereinstimmend den Wochenendrhythmus gezeigt haben.
»Die hohe Variabilität der Niederschläge macht einen Nachweis so schwierig«, betont jedoch Hendricks Franssen. Das Wetter dominieren trotz aller Abgase die großen Regenfronten, die vom Atlantik nach Europa ziehen; sie überlagern alles andere. Ein endgültiger Beweis in naher Zukunft erscheint unwahrscheinlich, denn nur wenige Forscher untersuchen die Wochenendeffekte. Das Thema gilt unter Wissenschaftlern als wenig karrierefördernd, Forschungsgeldgeber halten es für statistische Spielerei. Bei ihrer nächsten verregneten Grillparty sollten sie vielleicht noch mal darüber nachdenken.
Der Einfluss des Wetters reicht jedoch weit über den Tag hinaus. Klimaumschwünge haben sogar Hungersnöte, Völkerwanderungen und Revolutionen befördert. Im nächsten Kapitel bieten Jahresringe von Baumstämmen überraschende Einblicke in die Kulturgeschichte Mitteleuropas.
4Wie das Klima Geschichte macht
Oft wurde die Geschichte von Hannibals Alpenüberquerung erzählt – aber stimmt sie auch? 218 vor Christus zog der Feldherr aus Karthago mit 37 Elefanten, Tausenden Reitern und Zehntausenden Soldaten übers Hochgebirge gen Rom, so steht es in jedem Geschichtsbuch. Die meisten Elefanten überlebten die Tortur. Kann das wahr sein?
Erst heute lässt sich die ganze Geschichte erzählen. Eine Studie liefert die erste aufs Jahr genaue Klimageschichte Europas für die vergangenen 2500 Jahre. Im Sommer 218 vor Christus war es demnach warm. Die Geschichte von Hannibals Alpenüberquerung könnte also stimmen. Auch andere historische Ereignisse können nun überprüft und möglicherweise begründet werden: Warum gab es Hungersnöte, Völkerwanderungen, Seuchen und Kriege? Oftmals haben Wetter und Klima geschichtliche Umbrüche befördert, sagen auch Historiker.
Aus beinahe 9000 Holzstücken von alten Häusern und Bäumen haben Forscher um Ulf Büntgen vom Schweizer Umweltforschungsinstitut WSL und Jan Esper von der Universität Mainz das Klima gelesen – ein weltweit einzigartiges Geschichtsarchiv ist entstanden. Die Wachstumsringe im Holz geben Auskunft über das Wetter früherer Zeiten: Jedes Jahr legt sich ein Baumstamm durch sein Wachstum im Frühjahr und Sommer einen weiteren Ring zu. Aus der Breite von Jahresringen im Holz von Eichen lesen Experten die Niederschlagsmenge im Frühjahr und Juni, aus den Ringen von Lärchen und Kiefern die Sommertemperaturen. Über das Wetter aus anderen Jahreszeiten können sie keine Angaben machen, denn Bäume wachsen nur im Frühjahr und Sommer. Jeder Baumring lässt sich einem Jahr zuordnen, weil Wissenschaftler inzwischen über eine datierte Reihe von Jahresringen aus den vergangenen Jahrtausenden verfügen. Dieser Musterreihe haben Büntgen und seine Kollegen ihre Holzfunde zugeordnet – ähnlich einem Memoryspiel, bei dem man gleiche Formen einander zuordnet.
Holzstämme für die Niederschlagsgeschichte fanden die Wissenschaftler in vielen Gebieten in Deutschland und Ostfrankreich, etwa in alten Flussbetten und bei archäologischen Grabungen. Als Temperaturarchive hingegen kommen nur Bäume an der Waldgrenze infrage, denn nur ihr Wachstum wird von der Temperatur bestimmt. Die Forscher um Büntgen und Esper konnten für ihre Temperaturrekonstruktion folglich nur Bäume aus den Alpen verwenden. Deren Daten gelten aber für weite Teile Mitteleuropas, Italiens, Frankreichs und des Balkans – das zeigen Vergleiche mit Temperaturmessungen aus dem 20. Jahrhundert.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind:
• Historische Epochen fügen sich in Klimazyklen: Blütezeiten des Römischen Reiches und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation fielen in Warmzeiten; Völkerwanderungen, Pest und Dreißigjähriger Krieg ereigneten sich in Zeiten rauen Klimas.
• Mitteleuropa erlebte in der Römerzeit und im Hochmittelalter ähnliche Warmzeiten wie heute.
• Die Regenmenge in Mitteleuropa schwankte im Altertum und Mittelalter deutlich stärker von Jahr zu Jahr als in der Neuzeit, zudem gab es stärkere Extreme.
»Den genauen Zusammenhang zwischen Klima und Geschichte müssen Historiker erforschen«, sagt Ulf Büntgen. Die Studie zeigt jedoch auffällige Parallelen zwischen Wetter und Historie. Und vieles, was sich in Deutschland und Europa in den vergangenen 2500 Jahren ereignet hat, lässt sich unmittelbar mit den Daten in Verbindung bringen.
Es war ein Aufbruch nach der Kälte: Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus hatte Europa gerade die frostigste Phase seit der Eiszeit hinter sich, die Jahresmitteltemperaturen lagen um bis zu zwei Grad* tiefer als heute. Es war eine Hochphase der Kriege, die viele Völker in den Untergang trieben, etwa Babylonier und Mykener. Als sich das Klima besserte, es 300 vor Christus allmählich wärmer wurde und gleichzeitig relativ viel Regen fiel, erblühte das Römische Reich. Das Klima half den Römern bei ihrem Aufstieg, wie Historiker festgestellt haben: Die Ernteerträge stiegen, Bergbaugebiete konnten erschlossen werden, Nordeuropa wurde vereinnahmt, sobald der Weg über die Alpen ganzjährig passierbar war. Selbst in England florierte der Weinanbau. Ab dem 4. Jahrhundert nach Christus zeigen die Daten jedoch eine gravierende Klimaverschlechterung: Es wurde kalt und trocken in Mittel- und Südeuropa. Historiker sprechen demnach vom »Klimapessimum der Völkerwanderung«. Sie wissen zwar, dass vor allem die Invasion der Hunnen die Wanderungen der Germanen, Goten und anderer Völker auslöste. Doch fest steht, dass klimatisch bedingte Missernten, Hungersnöte und Seuchen die Wanderungsbewegungen weiter antrieben. Die Temperaturen fielen, aber die Niederschläge ließen nach. Die zunehmende Trockenheit förderte die Erosion des Bodens, die Felder gaben immer weniger her. Im Jahr 375 brachen germanische Stämme nach Süden auf, sie überrannten die Römer. 410 eroberten die Westgoten Rom. Das Ende des Römischen Reiches war gekommen. Das »dunkle Zeitalter« hatte begonnen, ein durchaus zutreffender Begriff, wie sich zeigen sollte. Die Erkenntnisse und Errungenschaften früherer Kulturen gerieten in Vergessenheit. Unwissenheit, Angst und Aberglaube machten sich breit. Zwar setzte der Regen im Lauf des 4. Jahrhunderts wieder ein, aber es blieb kalt und die Gletscher wuchsen.
Die größte Krise erlebte Europa von 536 bis 546, als die Sommertemperaturen auf ein Rekordtief stürzten. »Unsere Daten zeigen in dieser Zeit eine außergewöhnliche zehnjährige Depression«, berichtet Ulf Büntgen. Frostige Winde und fehlende Sonneneinstrahlung ließen die Ernte verderben. Berichte aus dem Jahr 536 zeugen von dramatischen Geschehnissen: Der Himmel verdunkelte sich für lange Zeit, roter Regen ging nieder. Selbst am Mittelmeer kühlte es dramatisch ab. Die »Mysteriöse Wolke von 536« ging in die Geschichte ein: »Die Sonne leuchtete das ganze Jahr schwach wie der Mond«, schrieb der zeitgenössische Historiker Prokopios, »weder Krieg noch Seuche noch sonst ein Übel, das Menschen den Tod bringt, hörten auf.« Bewohner Roms berichteten, dass ein Jahr lang »eine bläuliche Sonne« selbst mittags keinen Schatten geworfen habe. Ähnliches wurde aus anderen Erdteilen geschildert.
Die frühmittelalterliche Klimakatastrophe könnte zu gravierenden weltpolitischen Umwälzungen in jener Epoche beigetragen haben, sagen Wissenschaftler: Hochkulturen in Indonesien, Persien und Südamerika verschwanden; Dürre hatte ihnen zugesetzt. Großstädte verfielen, in Byzanz kam es 536 zu andauerndem Vandalismus. Am Meeresgrund vor Australien glauben die Geologen Dallas Abbott von der Columbia Universität in New York und Cristina Subt von der Universität von Texas in El Paso die Ursache der Abkühlung gefunden zu haben: den Krater eines etwa 600 Meter dicken Meteoriten. Sein Einschlag habe die mysteriöse Wolke aufgeworfen. Der Meeresforscher Mike Baillie von der Queen ’s Universität in Belfast, Nordirland, meint sogar, es habe zwei Naturkatastrophen gegeben, einen großen Vulkanausbruch, gefolgt von einem Meteoriteneinschlag. Ein Jahrzehnt lang könnte die Welt von Staubwolken eingehüllt gewesen sein. Würde sich nur eine dieser Katastrophen in der modernen Welt wiederholen, kämen die Folgen denen eines weltweiten Atomkriegs gleich.