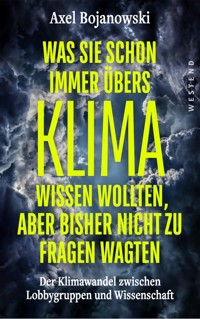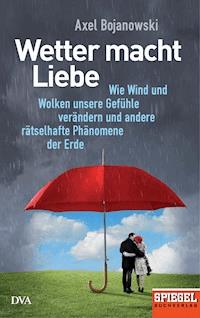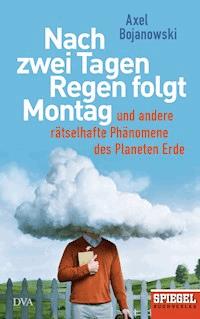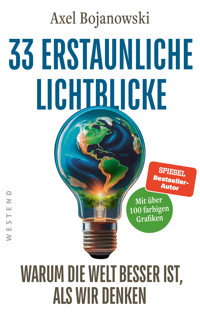
33 erstaunliche Lichtblicke, die zeigen, warum die Welt viel besser ist, als wir denken E-Book
Axel Bojanowski
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie, dass wir in der besten Welt aller Zeiten leben? Trotz Kriegen, Klimawandel und anderen Krisen - Daten offenbaren wunderbare Geschichten: Jeden Tag befreien sich Zehntausende Menschen aus extremer Armut, die ärmsten Länder verfügen pro Einwohner über so viel Nahrung wie die reichen vor 60 Jahren, nie starben weniger Menschen in Wetterkatastrophen. Und die meisten Inseln der Südsee gehen nicht unter - sondern werden größer. Dieses Buch erzählt auf Basis aktueller wissenschaftlicher Daten und erstaunlicher Grafiken die 33 besten Geschichten über unsere Welt. Sie machen Mut: Mit rationalem Optimismus schaffen wir eine bessere Zukunft!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Axel Bojanowski
33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© Die WELT / Axel Bojanowski
ISBN: 978-3-98791-082-1
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Für Ariana und Axel und alle jungen Menschenals Wappnung gegen Untergangspropheten
Inhalt
Titelbild
Vorwort
1 Neun Fragen, die Schimpansen besser beantworten als Politiker1
Leben
2 Extreme Armut war normal, dann geschah das Unglaubliche2
3 Bildung – das größte Potenzial der Menschheit3
4 Das unendliche Ernte-Wunder4
5 Aufstieg der Demokratien. Der fragile Sieg der Freiheit5
6 Die Mär vom knappen Trinkwasser6
Wirtschaft
7 Die Mär von den schwindenden Ressourcen7
8 Das ewige Wirtschaftswachstum8
9 Der Zauber der Waschmaschine – und wie sie das Leben verändert hat9
10 Work-Life-Balance – wie Deutschland Freizeit-Weltmeister wurde10
11 Warum wir alle Milliardäre sind11
12 Das erstaunliche Geheimnis glücklicher Nationen12
Medizin
13 Eine der größten Erfolgsgeschichten der Menschheit13
14 Das Wunder des immer längeren Lebens14
15 Wie Impfungen helfen, Krankheiten auszulöschen15
16 Guinea-Wurm – die Ausrottung eines unheimlichen Parasiten steht kurz bevor16
Wetter und Klima
17 Fortschritt statt Fatalismus – Der Meeresspiegel steigt, dennoch wächst das Land17
18 Überraschendes Phänomen: Südseeinseln wachsen – trotz Meeresspiegelanstieg18
19 Nie war die Welt sicherer vor Wetterextremen19
20 Unerwarteter Fortschritt – die Wettervorhersage ist fast immer richtig20
21 Bangladesch geht unter? Nein, es wird größer21
Umwelt
22 Warum Großstädte die Natur retten22
23 Naturschutz – Wirtschaftswachstum macht die Umwelt sauber23
24 Das erstaunliche Ergrünen Europas24
25 Utopie wird wahr – der Himmel über der Ruhr ist wieder blau25
26 Luftverschmutzung – wie sich ein Übel der Menschheit auf spektakuläre Weise eindämmen ließ26
27 Ozonloch – wie die Menschheit ein großes Problem verursachte – und es löste27
Tiere
28 Artenschutz – das geheimnisvolle Ende der Elefanten-Apokalypse28
29 Warum die Zahl einst fast ausgerotteter Wildtiere in Europa so rasant zunimmt29
30 Das Fisch-Wunder – wie es gelingt, die Bestände zu retten30
Ausblick
31 Entsalzung – die Ozeane werden trinkbar31
32 Die ewige Quengelei der Fortschrittsskeptiker32
33 Optimismus: Wer mehr weiß, ist zuversichtlicher33
Rüstzeug gegen Apokalyptik
Factfulness – 10 Tricks34
Anmerkungen
Navigationspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ein trister Wintertag, draußen stürmt und schneit es bei Minustemperaturen. Man liegt auf der Couch, nimmt vielleicht ein Buch zur Hand, schmökert unter Umständen sogar mal in Goethes Werk, was ein guter Anlass wäre, sich klarzumachen: Es ist eigentlich kein trister Tag, sondern im Gegenteil: einer von besonderem Glück. Noch zu Goethes Lebzeiten – im 18. und 19. Jahrhundert – dämpften kalte Wintertage nicht einfach die Laune, sie waren für zahlreiche Menschen lebensbedrohlich, denn Heizen war ein Problem. Selbst Privilegierte und Wohlhabende, wie der in den Adelsstand beförderte und spätere Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, hatten Mühe, ihre Gemächer zu wärmen. Heutzutage verfügen arme Menschen über mehr Komfort als reiche vor 200 Jahren. Offene Kamine, Kachelöfen oder Feuerstellen dienten zu Goethes Zeiten als Heizung, allerdings bestenfalls jeweils für nur einen Raum, sodass Herrenhäuser und Schlösser großenteils kalt blieben. Die Tinte der Schriftsteller konnte gefrieren, und wer an Holz oder Kohle sparen musste, fror. Selbst der Lebensstandard reicher Leute war näher an dem der Antike als an der Moderne.
Auch wer sich heute Wasser aus der Leitung zapft, verschwendet normalerweise keinen Gedanken daran, von welch großem Fortschritt er profitiert. Sauberes Trinkwasser war noch im 19. Jahrhundert nicht selbstverständlich, es konnte mit Bakterien belastet sein und krank machen. Das Wasser floss an den meisten Orten nicht durch Rohre direkt ins Haus, sondern es musste aus Brunnen und Zisternen geholt – und in Eimern nach Hause gewuchtet werden. Das Netz der Wasserleitungen, entstanden über Generationen seit dem 19. Jahrhundert durch die Arbeit Abertausender, würde eigentlich andächtige Lobpreisung verdienen wie imposante Kathedralen. Doch wir nehmen es wie selbstverständlich hin. Die Leitungen verbinden alle Häuser, unabhängig vom gesellschaftlichen Status ihrer Bewohner. Ebenfalls steht niemand andächtig vor Kläranlagen, dabei verhindern sie die Ausbreitung von Krankheiten. Der Fortschritt wegen Hygiene und moderner Medizin war revolutionär: Zu Goethes Zeiten starben zwei von fünf Kindern. Ihr Verlust war auch für Wohlhabende schreckliche Normalität, während der Tod von Kindern dank moderner Medizin heutzutage selten geworden ist – ein Reichtum, den wir uns kaum bewusst machen. Auch andere Bauten bestaunt niemand, obwohl sie das Leben revolutioniert haben: Stromleitungen, Kommunikationsnetze oder die Produktionsketten für Nahrungsmittel. Die Leute leben nicht nur in warmen Häusern, sondern auch in elektrifizierten, mit der ganzen Welt verbundenen. Und sie können sich auswählen, welches Essen sie sich liefern lassen. Komfort, den kein König vor 200 Jahren auch nur annähernd hätte genießen können. Und doch wird der Bau der Pyramiden als Weltwunder an Schulen gepriesen, die hochtechnisierten Konstruktionen, die den Luxus unseres Alltags erlauben, hingegen finden selten Erwähnung. Der Aufschwung begann in jener Zeit, als Goethe starb (1832). Noch lange nach der Zeit des Dichters aber lebten die meisten Menschen auch in Mitteleuropa in kalten Häusern mit lodernden Feuerstellen.
In den 1880er-Jahren ereignete sich eine stille Revolution, die bis heute die meisten technischen Neuerungen ermöglicht. Vielen gelten Smartphone und Internet als besondere Durchbrüche. In Wirklichkeit, schreibt der Technologie-Forscher Vaclav Smil, handele es sich bei den meisten technischen Neuerungen der letzten Jahrzehnte um Variationen zweier grundlegender Erfindungen aus den 1880er-Jahren: des Mikroprozessors und der Radiowellen. »Immer leistungsfähigere Mikrochips steuern heutzutage alles, vom Industrieroboter über den Autopiloten eines Passagierflugzeugs bis zu Küchenherden und Digitalkameras, und mobile Kommunikation nutzt ultrahochfrequente Funkwellen«, schreibt Smil. »Tatsächlich waren die vielleicht produktivste Blütezeit des menschlichen Erfindergeists die 1880er-Jahre«, resümiert er. In den 1880er-Jahren wies Heinrich Hertz experimentell die von James Maxwell vorausgesagte Existenz elektromagnetischer Wellen nach. Die von Mikrochips gesteuerte Welt ist auf Versorgung mit elektrischem Strom angewiesen, zunächst auf Dampf- oder Wasserkraft betriebene Kraftwerke; die Dampfturbine stammt ebenfalls aus den 1880ern. »Beide Grundtypen der Stromgewinnung gelangten 1882 zur Marktreife und liefern noch heute mehr als 80 Prozent des weltweit erzeugten elektrischen Stroms«, erläutert Smil. Hinzu kam eine Reihe kleinerer Innovationen aus den 1880ern: elektrisches Bügeleisen, reißfestes Packpapier, Straßenbahn, Fahrräder mit gleich großen Rädern, Drehtür, Stahlskelett-Wolkenkratzer, Fahrstuhl, Kugelschreiber – und Autos. »Die technischen Großtaten der Herren Benz, Maybach und Daimler, deren Erfolge Rudolf Diesel bei der Entwicklung benzingetriebener Motoren dazu inspirierten, gerade einmal ein Jahrzehnt später mit einer effizienteren Alternative zum Benzinmotor aufzuwarten«, schwärmt Smil. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann der effizienteste aller Verbrennungsmotoren erfunden: die Gasturbine.
Die Lebensspanne der Schauspieler-Brüder Paul und Attila Hörbiger, geboren 1894 und 1896, illustriert die darauf folgende Revolution. Beide lebten fast 90 Jahre, starben 1981 beziehungsweise 1987 und wurden Zeugen einzigartiger Umwälzungen. Ihre Geschichte erzählt der Ingenieurswissenschaftler und Philosoph Alexander Schatten von der Universität Wien in seinem empfehlenswerten Wissenschaftspodcast »Zukunft Denken«. Die Hörbigers lebten als Kinder in Budapest, später die meiste Zeit in Wien. »In den 1890er-Jahren gab es keinen elektrischen Strom, kein Fließwasser und keine Toiletten in den Wohnungen, kein Telefon und auch keine Autos und Flugzeuge«, erzählt Schatten. »Und es gab noch keinen Film, der die beiden später berühmt machen sollte.« Die Geschichte nahm Fahrt auf. Im Alter von ungefähr 15 Jahren genossen die beiden zum ersten Mal fließendes Wasser in einer Wohnung, warme Duschen folgten. Anfang des 20. Jahrhunderts bezeugten die Hörbigers die ersten bemannten Flugzeuge, die ersten Rennautos. Die Elektrifizierung revolutionierte den Alltag; Städte erleuchteten. Die Hörbigers erlebten die Goldenen Zwanziger, den euphorisierten Durchbruch der Moderne, als Schauspieler.
Ein entscheidender Fortschritt stand kurz bevor: die Entdeckung des Penicillins 1928 durch den britischen Mediziner Alexander Fleming. Zu spät für den 16-jährigen Sohn von US-Präsident Calvin Coolidge, der sich 1924 beim Tennisspielen eine kleine Blase am Zeh zugezogen hatte. Diese entzündete sich, der Junge starb binnen Tagen an einer Blutvergiftung – wie so viele Menschen: Antibiotika halfen bald, solche Tragödien zu verhindern. Auch Impfungen und andere medizinische Fortschritte verschafften Menschen bald ein längeres und besseres Leben mit weniger Schmerzen. In ihren Sechzigern begannen die Hörbigers den Komfort moderner Haushalte zu genießen: Kühlschränke, elektrische Geräte setzten sich durch in Europa, bald auch die Waschmaschine, die zur Bildungsrevolution beitrug. Eine Erfindung von 1908 revolutionierte ab den 1960er-Jahren die Ernährung: Das Haber-Bosch-Verfahren ermöglichte die Massenherstellung von Dünger aus Erdgas und Luft. Das ließ die Landwirtschaft weltweit erblühen, rettete Abermillionen das Leben und sorgte dafür, dass Menschen heutzutage weitaus mehr zu essen haben, trotz rasanten Bevölkerungswachstums. Auch die Zahl extrem armer Menschen ging dramatisch zurück. Die Entdeckung des menschlichen Erbguts, der DNA, erlaubte neue Formen der Medizin. 1969 wurden die Hörbigers, in deren Jugend man sich noch per Kutsche fortbewegt hatte, Zeugen der ersten Mondlandung. Die beiden Brüder erlebten auch noch, wie Ende der 1970er-Jahre die Pocken ausgelöscht wurden. Die Welt, in der die Hörbiger-Brüder ihr hohes Alter erreichten, hatte kaum noch Gemeinsamkeiten mit der ihrer Jugend. Es war nun eine Welt, in der es die meisten Menschen leichter hatten.
Ein Kind zu Goethes Zeit konnte nicht erwarten, älter als 30 Jahre zu werden. Es hatte höchstwahrscheinlich den Tod eines oder mehrerer Geschwister erleben müssen. Ein zehnjähriges von heute erreicht mit größerer Wahrscheinlichkeit das Rentenalter als seine Vorfahren ihren fünften Geburtstag. Vor 200 Jahren wuchsen viele ohne Mutter auf, weil sie bei einer Geburt gestorben war. Gewalt und gar Kriege gehörten zum Alltag. Die Umwelt wurde ausgebeutet, der tägliche Überlebenskampf erlaubte keine Rücksichtnahme auf die Natur – erst der zunehmende Wohlstand des 20. Jahrhunderts in marktwirtschaftlich organisierten Ländern änderte das. Aufklärung, Bildung und Meritokratie brachten einen nicht für möglich gehaltenen Aufschwung, der die Lebenserwartung verdoppelte und auch in armen Ländern den Zugang zu Nahrungsmitteln und Bildung erheblich verbesserte. Die Chance, in einer Demokratie zu leben mit individuellen Rechten, erhöhte sich ständig, das Risiko, in einer Naturkatastrophe zu sterben, hingegen ist um mehr als 95 Prozent gesunken. Im 19. Jahrhundert war Unterernährung normal, ebenso wie Hungersnöte; Kinder waren hager. Sie genossen keine Schulbildung, wurden stattdessen zur Arbeit eingesetzt. Sicherheit gab es nicht; Mädchen wurden an Fremde verheiratet, mussten im Haushalt arbeiten, Jungs schufteten lebenslang, mussten ihren Körper schinden, ohne Rechte auf Selbstschutz. In manchen Gegenden ist Kinderarbeit noch immer üblich, doch immer mehr Länder verzichten darauf. Der schwedische Politikwissenschaftler Johan Norberg erzählte die Geschichte der beiden Dokumentarfilmer Lasse Berg und Stig Karlsson, die in einem indischen Dorf die 12-jährige Satto kennenlernten, welche täglich auf dem Feld arbeitete. Die Filmer fotografierten die zerfurchten Hände des Mädchens. Als sie Jahre später zurückkehrten, machten sie ein Foto von Sattos 13-jähriger Tochter Sajani. Ihre Hände waren jung und weich. Die Hände eines Mädchens, das spielen und lernen durfte.
Der Aufschwung der vergangenen 200 Jahre ist atemberaubend, alle Lebensbereiche haben sich massiv verbessert. Die Industrielle Revolution, ausgehend von Westeuropa und den USA und getrieben von Energie aus Kohle, Erdöl und Erdgas, ermöglichte Erfindungen und Fortschritte sowie rasantes Wirtschaftswachstum. Zuvor hatte sich die Menschheit eine gleichbleibende Menge an Waren teilen müssen. Es herrschte Nullsummenwirtschaft: Wohlstandssteigerungen ließen sich nur auf Kosten anderer herstellen. Freie Marktwirtschaft ermöglichte Wachstum, sodass es allen besser ging – obwohl sich die Weltbevölkerung versiebenfachte. Freiheit zur Kreativität, wissenschaftliche Aufklärung und die Zusammenarbeit Abertausender Menschen in einem freien Markt, die sich nicht persönlich kannten, aber jeder für sich das Interesse verfolgten, erfolgreich zu kooperieren, erschufen Technologien, die das Leben einfacher und besser machten. Aus Sand kreierten sie Computerchips. Der Einfallsreichtum derer, die Technologie bauten, die Produktivität steigerten, moderne Transportgeräte und Produktionsmaschinen erfanden, machte ihre Urheber reich – und erhöhte gleichzeitig Produktivität und Einkommen anderer.
Ist die Welt nun ein guter Ort, sollte man überhaupt noch Kritik üben angesichts all der einst unvorstellbaren Fortschritte? Der Datenforscher Max Roser von der Internet-Plattform »Our World in Data«, von der die meisten Grafiken in diesem Buch stammen, hat die Lage exzellent auf den Punkt gebracht: »Die Welt ist schrecklich. Die Welt ist viel besser. Die Welt kann viel besser sein. Alle drei Aussagen gelten zugleich«, schreibt Roser. Die Diskussionen über den Zustand der Welt aber konzentrieren sich allzu oft auf die erste Aussage. Nachrichten unterstreichen, was schiefläuft, selten heben sie die positiven Entwicklungen hervor. Dabei könnten Medien seit 1990 täglich die Schlagzeile bringen: »Die Zahl der Menschen in extremer Armut ist seit gestern um 130 000 gesunken«, berichtet Roser. Gleichzeitig leben noch immer viele Menschen in Armut, der Fokus einzig auf Fortschritte würde also in die Irre führen. Naiver Optimismus lähmt ebenso wie naiver Pessimismus. Weiterer Fortschritt ist notwendig – die Welt kann noch viel besser sein; zahlreiche Probleme müssen gelöst werden. Und es gibt keine Garantie, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt. Doch der Aufschwung der vergangenen 200 Jahre lehrt, dass scheinbar Unmögliches möglich ist. Ausgebildete, hoffnungsfrohe Menschen in Freiheit haben die Kraft, Innovationen zu ihrem eigenen Nutzen und zum Wohle der Gesellschaft zu schaffen. Ihr Wissen, nicht materielle Ressourcen, ist der wahre Motor des Fortschritts. Die in diesem Buch versammelten Lichtblicke zeigen, dass es sich lohnt, für eine freie Gesellschaft und für die Freiheit des Einzelnen einzutreten, denn sie bildet die Voraussetzung für das Prosperieren der Welt.
Hamburg im Frühjahr 2025
Axel Bojanowski
1 Neun Fragen, die Schimpansen besser beantworten als Politiker1
Der Wissenschaftler Hans Rosling stellte Politikern und Journalisten Fragen über den Zustand der Welt. Die meisten rieten »so falsch, dass ein Schimpanse die Befragten übertrumpft hätte«. Der Versuch offenbart: Die Welt ist trotz all ihrer Unvollkommenheiten in keinem so schlechten Zustand.
Vor zehn Jahren konfrontierte der schwedische Mediziner und Katastrophenforscher Hans Rosling Politiker, Journalisten, Nobelpreisträger und Wirtschaftsvertreter mit dreizehn Fragen über den Zustand der Welt. Nur eine Minderheit der Befragten tippte mehr richtige Antworten – von jeweils drei vorgeschlagenen – als falsche; viele hatten kaum eine Frage korrekt beantwortet.
Die meisten rieten »so falsch, dass ein Schimpanse, der zufällig Antworten auswählt, die Befragten übertrumpft hätte«, stellte Rosling fest. Die Diskrepanz zeigte: Die Welt ist trotz all ihrer Unvollkommenheiten in einem erheblich besseren Zustand, als viele denken.
Seine Kinder haben die Fragen von Rosling, der 2017 gestorben ist, 2020 mit aktuellen Daten neu aufgelegt. Sie bieten einen interessanten Überblick über den Zustand der Welt, die unbedingt verbessert werden muss, aber nicht so schlecht ist wie von vielen angenommen. Neun dieser Fragen hier im Überblick:
Frage 1: Wie hoch ist weltweit der Anteil der Mädchen in armen Staaten, die eine Grundschule besucht haben?
Mögliche Antworten: 20 Prozent, 40 Prozent oder 60 Prozent
Korrekte Antwort: Mehr als 60 Prozent der Mädchen in Ländern mit niedrigem Einkommen schließen die Grundschule ab.
Frage 2: Wo lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung?
Mögliche Antworten: in armen Staaten, in Staaten mit mittlerem Einkommen oder mit hohem Einkommen
Korrekte Antwort: Die Mehrheit – 76 Prozent der Menschen – lebt in Ländern mit mittlerem Einkommen (1 006 bis 12 235 US-Dollar). Laut Weltbank repräsentieren die Länder mit niedrigem Einkommen nur neun Prozent (weniger als 1 005 US-Dollar Bruttonationaleinkommen pro Kopf). Aus Ländern mit hohem Einkommen kommen 16 Prozent der Menschen.
Frage 3: In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Anteil der in »extremer Armut« lebenden Menschen an der Weltbevölkerung … fast verdoppelt, ist ungefähr gleich geblieben, mehr als halbiert?
Korrekte Antwort: Der Anteil der Menschen, die von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben, ist laut Weltbank von 34 Prozent 1993 auf 10,7 Prozent 2013 gesunken – hat sich also mehr als halbiert.
Frage 4: Wie hoch ist weltweit die durchschnittliche Lebenserwartung? Mögliche Antworten: 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre