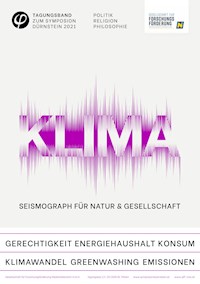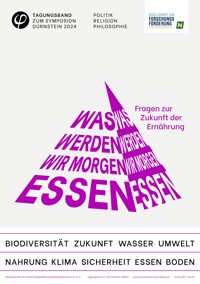
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Tagungsband zum Symposion Dürnstein
- Sprache: Deutsch
Dieser Tagungsband dokumentiert das Symposium Dürnstein 2024 zum Thema WAS WERDEN WIR MORGEN ESSEN? Fragen zur Zukunft der Ernährung, das vom 14. bis 16. März in Dürnstein in Niederösterreich stattfand. Er enthält Vorträge und Diskussionsrunden dieser Veranstaltung. Das Symposion Dürnstein ist ein transdisziplinärer Gedankenaustausch, bei dem sich Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, Haltungen, Religionen und Weltanschauungen zum Austausch und Diskurs treffen. Das 13. Symposion Dürnstein widmete sich der Frage nach der Zukunft unserer Ernährung. Die Frage nach der Ernährung von morgen ist drängend - nicht nur aus medizinischen oder demographischen Gründen, sondern vor allem wegen einer unheilvollen Mischung aus wirtschaftlichen, agrarischen und klimatischen Ursachen. Im Auftrag von Weltbank und UNO haben über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2008 den Weltagrarbericht erstellt, eine schonungslose und deshalb höchst unbequeme Analyse des planetaren Status quo. Das Ergebnis: Die industrielle Landwirtschaft strebt nach hohen Gewinnen und beutet dafür die natürlichen Ressourcen aus. Die Übernutzung des Bodens führt unter anderem zur Zerstörung des Humus - jener relativ dünnen Schicht, in der Milliarden von Bodenorganismen das Wachstum der Pflanzen ermöglichen. Durch die drastischen Eingriffe in die natürlichen Kreisläufe - Stichwort Mineraldünger und Pestizide - ist bereits im Jahr 2023 rund ein Fünftel der europäischen Tier- und Pflanzenwelt unmittelbar vom Aussterben bedroht. Die meisten dieser Arten dienen nicht unmittelbar der menschlichen Ernährung und sind für den Menschen oft lästige Insekten - aber für die Aufrechterhaltung der Lebenskette, als Bestäuber und Nahrung für andere Tiere unverzichtbar. Das Artensterben zerstört die natürliche Nahrungskette und damit die Lebensgrundlage des Menschen. Agrarwüsten und Saatgut- und Düngemittelkonglomerate sind nicht geeignet, das Überleben der Menschheit zu sichern, so der Weltagrarbericht. Ernährungssicherheit für die Weltgemeinschaft können nur kleine Bauern sichern, die Agroforstwirtschaft betreiben, also eine Mischwirtschaft mit Bäumen, Feldern. Tieren in kleinen Einheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
TAGUNGSBAND 2024 ZUM 13. SYMPOSION DÜRNSTEIN 2024
WAS WERDEN WIR MORGEN ESSEN? FRAGEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG
GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG NÖ
Für den Inhalt verantwortlich:
Ursula Baatz und Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H.
Die in der Publikation geäußerten Ansichten liegen in der Verantwortung der Autor*innen und geben nicht notwendigerweise die Meinung der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H. wieder.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40 – 44. 22359 Hamburg, 2020
ISBN Softcover: 978-3-384-36616-0
ISBN E-Book 978-3-384-36617-7
Koordination: Bettina Pilsel
Lektorat: Ursula Baatz
Impressum:
Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H., 3100 St. Pölten,
Hypogasse 1, 1. OG
www.symposionduernstein.at
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
GELEITWORT
VORWORT
EINLEITUNG ZUM TAGUNGSBAND
WAS ESSEN WIR MORGEN
PODIUMSDISKUSSION ERNÄHRUNGSSICHERHEIT IN ÖSTERREICH?
WAS WERDEN WIR ESSEN? FRAGEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG
Der gedeckte Tisch als Bühne
Fleischgeschichte im Spiegel des Zivilisationsprozesses
Fleisch als Basis und Achillesverse der vormodernen Ernährung
Tier und Fleisch in Zeiten der Industrialisierung
Fleisch: Vom Wohlstands- zum Krisensymbol
Eine Zukunft ohne Tiere?
BIODIVERSITÄT ALS VERSICHERUNG FÜR DIE ZUKUNFT 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BODEN – DAS AM STÄRKSTEN GEFÄHRDETE NATURGUT
1. Einführung: Mein Leben
2. Unsere historisch gewachsene Kulturlandschaft heute, ein ökologischer und sozialer Problemraum
3. Boden – das am stärksten gefährdete Naturgut
4. Das System der Agrarindustrie ist nicht nachhaltig und wirtschaftlich und damit nicht zukunftsfähig
5. Suche nach Auswegen – es gibt Alternativen! Das Ziel: Gesunde Böden, gesunde Nahrung, gesunde Menschen
6. Verträgliche (alternative) Nutzungsformen für ökologisch sensible Standorte
7. Schlussgedanken
ONE WORLD – ONE WATER – ONE HEALTH
Wie können Fische zukünftig nachhaltig auf unsere Teller kommen?
OLD WINES, NEW WINESKINS: INDIGENOUS PEOPLES’ KNOWLEDGE SYSTEMS AND PRACTICES AS KEY FOR SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS AND PLANET:
WELCHE ZUKUNFT WOLLEN WIR FÜR UNSERE ERNÄHRUNG?
DIE ZUKUNFT DER LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG IN ÖSTEREICH – VERSORGUNGSSICHERHEIT, SELBSTVERSORGUNG, GESETZLICHE ANFORDERUNGEN
Nun zur Transformation allgemein:
Inwieweit gilt Transformation auch für die sogenannten Subventionen:
Sichtwort Nachhaltigkeit:
Stichwort globale Entwicklungen:
WIE EIN WEG ZU EINEM NACHHALTIGEN ERNÄHRUNGSSYSTEM AUSSEHEN KANN
Produktion muss nachhaltiger werden
Transformation fördern und fordern
Alternative Lebensmittelnetzwerke unterstützen
GUT, SAUBER UND FAIR VOM FELD AUF DEN TELLER: DIE SLOW FOOD-PERSPEKTIVE FÜR EINE NACHHALTIGE, KLIMAFITTE ZUKUNFT UNSERER ERNÄHRUNGSUND ESSKULTUR.
SEPARATE THE SIGNAL FROM NOISE
Was Trendforschung leistet und wie man mithilfe von Food-Trends durch turbulente Zeiten navigiert11
Food-Trend-Map
KLIMAWANDEL UND LEBENSMITTELSICHERHEIT – DIE AGES ALS PARTNERIN VOM ACKER BIS ZUM TELLER
1. Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit
2. Ganzheitliche Betrachtung und Rolle der AGES
3. Nachhaltige Lebensmittelsysteme
NOCH NIE GAB ES IM LEBENSMITTELHANDEL EINE SO HOHE LEBENSMITTELSICHERHEIT FÜR KONSUMENTEN
AUFGETISCHT? – DIE WERBESCHMÄHS UND WAS DAHINTER STECKT.
Werbeschmäh des Monats - Produktbeispiele:
Werbeschmäh des Jahres
Was wäre für eine transparentere Produktgestaltung nötig?
Beispiel Herkunftsangaben:
Nicht alle geografischen Bezüge Lösen eine Kennzeichnungspflicht aus
ZUKUNFTSFÄHIG? ÜBER DEN KONSUM VON TIEREN UND TIERPRODUKTEN
1. Einleitung: Entdeckungen und Entwicklungen
2. Tierethik: Wen gibt es zum Abendessen?
3. Mitwelt- und Klimaethik: Fix Your Diet, Save the Planet
4. Schluss: Ein Vorschlag für Omnivoren
GOTT ZWISCHEN EINTÖPFEN – ERNÄHRUNGSETHIK IN DER CHRISTLICHEN SPIRITUALITÄTSGESCHICHTE
Einleitung
Ethisch-spirituelle Normierungen des Essens in Religionen
Transzendentale Gastrosophie im Christentum
Das vegane Paradies der Wüste
Benedikt und die Mahl-communio
Franziskus und die Sozialethik der Ernährung
Ressourcen der Ernährungsspiritualität
WAS KÖNNEN WIR VON DER NATUR LERNEN? BIONIK UND ERNÄHRUNG – NEUE WISSENSCHAFTLICHE WEGE IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT
1. Einleitung
2. Bionik in der Ernährungswissenschaft
3. Bionisches Wassermanagement für die Lebensmittelproduktion
4. Artenspezifische Insektenvertreibungsmittel basierend auf Wachskristallen
5. Bergbau mit Pflanzen
6. Zusammenfassung
KUNST UND ERNÄHRUNGSBILDUNG
Ernährungsbildung in der Primarstufe
„Das Auge isst mit“
Der Bildungsauftrag der Agenda 2030
Ernährungsbildung für eine Ernährungswende
Bildungsinhalte der Lehrveranstaltung
Gestaltungspraxis
Autor*innenverzeichnis
Programm Symposion Dürnstein 2024
Was werden wir morgen essen? Fragen zur Zukunft der Ernährung
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
GELEITWORT
Programm Symposion Dürnstein 2024
Was werden wir morgen essen? Fragen zur Zukunft der Ernährung
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
GELEITWORT
Vom 14. bis 16. März 2024 versammelten sich in der geschichtsträchtigen Stätte des Stifts Dürnstein renommierte Expertinnen und Experten, internationale Gäste sowie ein interessiertes Publikum, sowohl vor Ort als auch virtuell, um sich beim 13. Symposion Dürnstein dem hochaktuellen Thema „Was werden wir morgen essen? Fragen zur Zukunft der Ernährung“ zu widmen.
Wir möchten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Organisatorinnen und Organisatoren unseren herzlichen Dank für ihr Engagement und ihren Beitrag zu diesem erfolgreichen Austausch aussprechen. Möge der vorliegende Tagungsband dazu beitragen, die gewonnenen Einsichten und Impulse weiterzutragen, und die Diskussion über die Zukunft unserer Ernährung in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nachhaltig bereichern.
JOHANNA MIKL-LEITNER
Landeshauptfrau
STEPHAN PERNKOPF
LH-Stellvertreter
GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG
NIEDERÖSTERREICH M.B. H.
VORWORT
Vom 14. bis 16. März 2024 fand im Stift Dürnstein das 13. Symposion statt. Expert*innen, internationale Gäste und ein interessiertes Publikum – vor Ort und online – diskutierten zum Thema „Was werden wir morgen essen? Fragen zur Zukunft der Ernährung“.
Die Frage nach der Zukunft unserer Ernährung ist nicht nur eine wissenschaftliche und wirtschaftliche, sondern auch eine zutiefst gesellschaftliche Herausforderung. In einer Zeit, in der globale Krisen, Klimawandel und technologische Fortschritte unser tägliches Leben in nie dagewesenem Maße beeinflussen, ist es von zentraler Bedeutung, nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zu finden. Das Symposion Dürnstein hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen dringenden Fragen mit interdisziplinärem Ansatz und internationalem Austausch zu begegnen.
Dank der Präsenz namhafter Fachleute aus verschiedenen Disziplinen und der aktiven Beteiligung eines vielfältigen Publikums konnten während des Symposions wertvolle Erkenntnisse gewonnen und innovative Lösungsansätze diskutiert werden. Diese Begegnung der Ideen und der intensive Dialog sind essenziell, um die komplexen Zusammenhänge unserer Ernährungszukunft zu verstehen und gemeinsam konstruktive Wege zu beschreiten.
Wir möchten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Organisatorinnen und Organisatoren meinen herzlichen Dank für ihr Engagement und ihren Beitrag zu diesem erfolgreichen Austausch aussprechen.
GEORG PEJRIMOVSKY
Geschäftsführung
Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H.
BETTINA PILSEL
Projektleitung
URSULA BAATZ
Kuratorin Symposion Dürnstein
EINLEITUNG ZUM TAGUNGSBAND
Essen gehört zu den grundlegendsten menschlichen Lebensäußerungen – jede und jeder muss und will essen. Menschen sind Traglinge, sie kommen recht unfertig auf die Welt und müssen vieles lernen – auch die Nahrungsaufnahme. Wer jemals kleinen Kindern - und deren Eltern - beim Essen zugeschaut hat oder selbst als Elternteil dabei war, weiß, dass dies keine einfache Aufgabe ist. Essen hat viele Funktionen, nicht nur biologische oder medizinische, sondern auch soziale; Essen ist hochgradig emotional besetzt; Essen verbindet die Menschen mit der Welt um sie, und damit sind Themenbereiche wie Klima, Ökologie und soziale Gerechtigkeit auch Themen, wenn es um Ernährung geht. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Programmerstellung: was muss unbedingt vorkommen, was ist wichtig, aber geht sich nicht aus – die Zeit für das Symposion, aber auch die Aufnahmefähigkeit der Teilnehmenden ist begrenzt – usw. Das Ergebnis war, wie man den medialen Berichten und der Rückmeldung von Teilnehmenden entnehmen konnte, sehr zufriedenstellend. Die drei Tage Symposion waren ausverkauft und die Pausengespräche und allgemeine Stimmung intensiv und freundschaftlich, auch wenn man verschiedener Meinung war – ein Verdienst auch der Moderation von Joachim Schwendenwein. Die Kunstprojekte der Studierenden der KPH zu „Ernährungsbildung für eine Ernährungswende“, wie immer unter der Leitung von Sigrid Pohl, und der Initiative Children Charity Cooking der HLM/HLW Krems unter der Leitung von Claudia Hiermann trugen zur Konkretisierung der Fragen bei. All dies lässt sich in diesem Band – dem letzten, da das Symposion Dürnstein eingestellt wird und daher im Jahr 2024 zum letzten Mal stattgefunden hat – nicht vollumfänglich wiedergeben.
Auf den folgenden Seiten finden sich Vorträge und Impulse des Symposions ebenso wie die transkribierte und bearbeitete Eröffnungsdiskussion zum Thema Ernährungssicherheit in Österreich. Damit begann das Symposion am Donnerstag, 14. März 2024. Moderiert von Tanja Traxler (STANDARD Wissenschaftsressort, Preisträgerin für Wissenschaftsjournalismus 2023), diskutierten miteinander Franz Essl (Assoz. Prof. am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung und Mitglied des Biodiversitätsrates, Wissenschaftler des Jahres 2022), Otto Gasselich (Obmann von BIO Austria), Elisabeth Fabian (Assistenzärztin an der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 2 am Uniklinikum Krems und Ernährungswissenschaftlerin), Franz Raab (Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer) sowie Franz Sinabell (WIFO Forschungsgruppe Klima- Umwelt- und Ressourcenökonomie, Privatdozent an der BOKU Wien).
Der Freitag begann mit einem Überblick über die Geschichte der Ernährunsgewohnheiten im europäischen Raum, wobei die Frage des Fleischkonsums im Fokus der Aufmerksamkeit von Gunther Hirschfelder (Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg) stand.
Die darauffolgenden Impulse thematisierten den Zusammenhang von Biodiversität, Klima und Ernährung. Josef Settele, Leiter des Departments Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, erläuterte die Erkenntnisse und Beschlüsse von Weltklima- und Weltbiodiversitätsrat anhand seiner Forschung zur Ökologie von Kulturlandschaften. Der Agrarwissenschaftler Michael Succow, der als Umweltminister der DDR maßgeblich zur Etablierung von Naturschutzgebieten beigetragen hat, erklärte die Bedeutung des Bodens nicht nur für den Ernteertrag, sondern auch fürs menschliche Überleben – etwa durch die Bildung und Speicherung von Grundwasser. Am folgenden Podiumsgespräch zu „Knappes Gut Boden“ nahmen neben den beiden Referenten auch Isabella Lang (Geschäftsleiterin der Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung Via Campesina) und der Land- und Forstwirt Thomas Resl (Direktor der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen a.D.) teil.
Am Freitagnachmittag zeigte Martin Kainz (Wassercluster Lunz, Professor für Aquatische Ökosystemforschung und -gesundheit an der Universität für Weiterbildung Krems) am konkreten Beispiel der Fischzucht auf, was „One World – One Water – One Health“ bedeutet.
Ein nächster Block beleuchtete die internationalen Vernetzungen in Sachen Ernährung: Tania Eulalia Martinez-Cruz aus Oaxaca (Mexiko), Angehörige des Volkes der Ëyuujk und Expertin für indigene Ernährungssysteme bei der FAO (Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen), zeigte auf, wie der innovative Rückgriff auf traditionelle Anbauweisen Probleme von heute lösen könnte. Die Komplexität der Frage nach der Ernährung der Zukunft veranschaulichte Sofia Monsalve, Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation FIAN International (Food First Information and Action Network), anhand der fünf Pfeiler eines auf dem Menschenrecht auf Ernährung basierenden globalen Ernährungssystems. Christina Plank (Senior Scientist am Institut für Entwicklungsforschung der Universität für Bodenkultur Wien) und Christina Kottnig (Ko-Vorsitzende von Slowfood Österreich) zeigten auf, welche Möglichkeiten für alternativen Ernährungsformen und – gewohnheiten es gibt und geben kann. Am abschließenden Podium „Transformation der Landwirtschaft - ein glokaler Prozess“ nahm neben den Referierenden mit Karl Bauer (Landwirtschaftskammer Österreich) auch ein ausgewiesener Kenner der Agrarpolitik teil. Den Beginn machte am Samstag ein fulminanter Vortrag der Foodtrendforscherin und Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler zum Wandel der Esskultur zwischen Tradition und Innovation. Der zweite Teil des Vormittags beschäftigte sich mit Fragen der Lebensmittelsicherheit in Österreich. Florian Tschandl (AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Leiter Kompetenzzentrum Lebensmittelkette) erläuterte u.a. die Probleme, die durch den Klimawandel entstehen. Christian Prauchner, Obmann des Bundesgremiums des Lebensmittelhandels, wies darauf hin, dass es noch nie eine so hohe Lebensmittelsicherheit für Konsumenten im Lebensmittelhandel gegeben habe wie heute. Dem stellten Lisa Kernegger und Heidi Polsterer (Gründerinnen von Foodwatch Österreich) ihren Impuls „Aufgetischt? - Die Werbeschmähs und was dahintersteckt“ entgegen. Daraus entstand eine lebhafte Podiumsdiskussion zur Frage „Wie sicher sind unsere Lebensmittel?“
Der Samstagnachmittag war Fragen der Ethik gewidmet. Kurt Remele, em. Prof. Institut für Ethik und Gesellschaftslehre an der Katholisch Theologische Fakultät Graz, stellte den Konsum von Tieren und Tierprodukten aus ethischen Gründen infrage. Karl-Heinz Steinmetz, Privatdozent für Spiritualitätsforschung (Uni Wien) und Leiter des Instituts für Traditionelle Europäische Medizin in Wien, berichtete über „Gott zwischen Eintöpfen - Ernährungsethik in der christlichen Spiritualitätsgeschichte“ und das durchaus kritische Verhältnis zum Fleischkonsum.
Abschließend stellte Ille Gebeshuber, Professorin für Physik an der TU Wien mit den Arbeitsschwerpunkten Nanophysik und Biomimetik, ihr Forschungsgebiet der Bionik vor, in dem sich ganz neue Wege für den Umgang mit der Natur auftun. Um eine „Ethik der Ernährung“ ging es dann auch in der Schlussdiskussion unter der Moderation von Doris Helmberger-Fleckl (Chefredakteurin Die FURCHE).
Für das Gelingen dieses und früherer Symposien besonders zu danken ist Bettina Pilsel und Sigrid Rulitz (beide Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ) und Barbara Schwarz, der langjährigen Geschäftsführerin der GFF.
Mit diesem transdisziplinären Symposion, in dem wesentliche Fragen der Ernährung der Zukunft angesprochen wurden, ging das Projekt „Symposion Dürnstein“ nach dreizehn erfolgreichen Jahren zu Ende. Die Teilnehmenden, Referierende wie Zuhörende, konnten hier aktuellen Fragen nachgehen; Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Fragen, die gründliche Reflexion unter Einbeziehung relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfordern. Das Symposion Dürnstein hat sich als ein Ort der Begegnung und des Dialogs von Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen und Ansichten verstanden, als ein Ort, an dem Austausch zu relevanten Themen über Parteigrenzen hinweg möglich ist. Solche Orte sind für ein gedeihliches Zusammenleben einer demokratisch organisierten Gesellschaft unerlässlich.
URSULA BAATZ
WAS ESSEN WIR MORGEN
Sie haben es schon getan oder werden es noch tun: essen. Oder trinken, „weil Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seel zusammenhält“, wie der Dichter Heinrich Hinsch im 18. Jahrhundert reimte. Essen ist lebensnotwendig, denn ohne Nahrung gibt es kein Leben. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern für alle Lebewesen. Leben braucht Nahrung, angemessene Ernährung, fehlende oder mangelhafte Ernährung bringt Krankheit und Tod. Was werden, was können wir morgen essen? Das ist die Frage des Überlebens.
Menschen können von Natur aus nicht anders, als Kultur zu schaffen. Doch ohne Natur geht gar nichts, wenn es ums Essen geht. Selbst für Fleisch aus dem Labor oder dem 3-D-Drucker ist Natur notwendig: Muskelgewebe oder Bestandteile des Blutes von Tieren, auf jeden Fall Aminosäuren. Und Boden, Wasser, Sonne, Samen: Das sind unabdingbare Voraussetzungen für Wachstum und Nahrung.
Lebensmittel sind kulturell gestaltet – sie werden gekocht, gegart, gebraten, gewürzt, fermentiert, konserviert, flambiert usw. — menschliche Tätigkeiten, die gelernt und geübt werden müssen und die die rohe Natur der Nahrung nach bestimmten, kulturell verankerten Kriterien verändern. Geschmäcker werden schon mit der Muttermilch gelernt. Deswegen ist Essen nicht einfach nur Nahrung aufnehmen: Sich zu ernähren ist ein Prozess, der Identität schafft und bestätigt. Das angenehme Gefühl gut satt zu sein, ist weit mehr als die Summe der Aufnahme von chemischen Substanzen.
In Europa, so der Historiker Massimo Montanari, gab es in der Antike zwei große Ess-Kulturen: die mediterrane, wo man Weizenbrot, Gemüse, Käse und Fisch, Wein und Oliven und etwas Fleisch aß, und dies vor allem mit Maß – die antike Tugend des Maßhaltens prägte auch das Essverhalten. Weiter nördlich, bei Franken und Germanen, gehörten Fleisch, Milch und Gerste – Letztere als Brei und vergoren als alkoholisches Getränk – zu den Standards. Männlichkeit bewies sich hier im Vielessen und Fleischessen. Wer gern maßvoll oder vorwiegend Gemüse aß, wie etwa Nikephoros Kopas, Kaiser von Byzanz, galt als schwach. Karl der Große dagegen war ein begeisterter Viel- und Fleischesser. Solche kulturellen Muster bestimmen oft bis heute, was als angemessenes Essen gilt. Dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung seit Kurzem pflanzenbasierte Nahrung empfiehlt, ist ein bemerkenswerter Kulturwandel.
Das gemeine Volk litt bis ins 18. Jahrhundert oft an Hunger, wenn die Ernten durch Wetter, Kriege oder Seuchen schlecht ausfielen. Erst als Mais und vor allem Kartoffeln allmählich in Europa heimisch wurden und ab dem 18. Jahrhundert regulär angebaut wurden, war es für das gemeine Volk leichter, satt zu werden.
Wer was essen durfte, war ein sozialpolitisches Thema. Im Kunsthistorischen Museum in Wien zeigt das Breughels „Bauernhochzeit“: In großen Holztrögen wird das Festessen zu den Tischen getragen, nämlich - Hirse mit Safran. Bauern sollten einfach und billig essen, das luxuriöse Essen war dem Adel vorbehalten. Der Zugang zu Nahrung zementiert soziale Unterschiede – weswegen etwa in Venedig zu Beginn der Neuzeit Beamte die Haushalte kontrollierten, ob standesgemäß gekocht wurde.
Was werden wir morgen essen – das ist keine rhetorische Frage für die rund 30 Prozent der Weltbevölkerung, die von Hunger oder extremem Hunger betroffen sind, nach Angaben der UN-Organisation World Food Program. Alle vier Sekunden in etwa stirbt ein Mensch an Hunger, pro Tag rund 25.000 Menschen. Die Ursachen sind in fast der Hälfte aller Fälle direkte kriegerische Konflikte, zu etwas mehr als einem Drittel extreme Wetterbedingungen (Dürre oder Überschwemmungen etwa), und der Rest resultiert aus wirtschaftlichen Schocks wie etwa Covid 19 oder dem Stopp der Getreidelieferungen durch den Ukraine-Krieg (fsinplatform.org).
Die Eliten sind auch heute vom Hunger kaum betroffen. Global gesehen ist dies mehr als das eine Prozent, dem fast die Hälfte des weltweit verfügbaren Vermögens gehört. Dazu zählen auch die allermeisten Menschen, die in den nördlichen Industriestaaten leben, insgesamt etwa eine Milliarde. Auch der größte Teil der Menschen in Österreich gehört, global gesehen, zur wohlhabenden Hälfte. Doch verdienen in Österreich, einem der reichsten Länder der EU, rund 600 000 Menschen zu wenig Geld, um ausreichend ausgewogene Nahrung zu kaufen. Daher leiden 127 000 Kinder in Österreich unter Mangelernährung – was bleibende körperliche und psychische Probleme zur Folge hat, so Volkshilfe und Caritas. Weltweit gesehen leiden zudem fast zwei Milliarden Menschen an Übergewicht aufgrund von krankmachender Fehl- oder Mangelernährung.
Die Frage nach der Ernährung von morgen ist dringlich – nicht nur aus medizinischen oder demografischen Gründen, sondern vor allem wegen einer unheilvollen Mischung von ökonomischen, landwirtschaftlichen und klimatischen Gründen. Im Auftrag von Weltbank und UNO haben über 400 Wissenschaftler 2008 den Weltagrarbericht erstellt, eine schonungslose und daher höchst unbequeme Analyse des planetaren Status quo. Das Ergebnis: Die industrielle Agrarwirtschaft zielt auf hohe Gewinne und beutet dazu die natürlichen Ressourcen aus. Die Übernutzung von Boden führt u.a. zur Zerstörung des Humus – also jener relativ dünnen Schicht, in der Milliarden von Bodenorganismen das Wachstum von Pflanzen ermöglichen. Durch die drastischen Eingriffe in natürliche Kreisläufe – Stichwort mineralische Dünger und Pestizide – ist 2023 bereits rund ein Fünftel der europäischen Flora und Fauna unmittelbar vom Aussterben bedroht. Die meisten dieser Arten sind nicht unmittelbar menschliche Nahrung und oft für Menschen lästige Insekten – aber unverzichtbar zur Aufrechterhaltung der Kette des Lebens, als Bestäuber und Nahrung für andere Tiere. Das Artensterben zerstört die natürliche Nahrungskette und damit die Grundlagen menschlicher Existenz. Agrarwüsten und Saatgut- und Düngemittelkonglomerate sind nicht geeignet, das Überleben der Menschheit zu sichern, so der Weltagrarbericht. Ernährungssicherheit für die Weltgemeinschaft können nur kleine Bauern sichern, die Agroforstwirtschaft betreiben, also eine Mischwirtschaft mit Bäumen, Feldern. Tieren in kleinen Einheiten.
Die Upanishaden, die fast dreitausend Jahre alten heiligen Schriften indes, Indiens sind in puncto Nahrung sehr klar: „Aus Nahrung entstehen alle Lebewesen dieser Erde. Sie leben durch Nahrung und werden am Ende selbst Nahrung.“ Zerstört man die Nahrungskette, zerstört man die Menschheit. Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht.
FRANZ ESSL
OTTO GASSELICH
ELISABETH FABIAN
FRANZ RAAB
FRANZ SINABELL
PODIUMSDISKUSSION ERNÄHRUNGSSICHERHEIT IN ÖSTERREICH?
Podiumsdiskussion 1 moderiert von Tanja Traxler
TRAXLER: Herzlich willkommen! Beim Essen kommen die Leut z′samm, gleichzeitig lässt sich aber über fast nichts so leidenschaftlich streiten wie über das Essen. Es geht um viel, nicht nur um unsere eigene Gesundheit, sondern auch um das Wohl von Umwelt und Tieren, letztlich um die Zukunft des Planeten. Es war historisch immer eine große Herausforderung, Ernährungssicherheit zu gewährleisten.
Wie die Ernährungssicherheit in Österreich gewährleistet werden kann, auch in Zukunft, welche Herausforderungen und welche Chancen sich stellen, das werden wir hier Franz Essl fragen. Was sind denn da die größten Herausforderungen ökologisch oder in klimatischer Hinsicht, wenn es um die Sicherung der Ernährung in Österreich geht?
ESSL: Ich beginne mit einem Bild - ich glaube, dass die Landwirtschaft, der Klimaschutz bzw. die Leute, die sich für Klimaschutz und Naturschutz einsetzen, auch wenn es in der politischen Diskussion nicht so ankommt, eigentlich im selben Boot sitzen. Was sich verändert hat: Die Umgebung ist rau geworden und gleichzeitig das Boot leck geschlagen; und die Frage, die sich vehement stellt, heißt: Wohin steuern wir? Steuern kann man, wenn mehrere Personen im Boot sitzen, also mehrere Themen in einem Boot sitzen, nur, wenn man einigermaßen in dieselbe Richtung steuert, was voraussetzt, dass man auch fähig und willig ist, gemeinsame Positionen zu erarbeiten trotz vorhandener Unterschiede und Konflikte. Das ist ganz wesentlich, und ich meine, diese gemeinsamen Positionen müsste es auf einer hohen politischen Ebene geben. Gerade auf EU-Ebene sind ganz wichtige politische Entscheidungen passiert oder auch Weichenstellungen getroffen worden, aber es geht auch um eine persönliche Ebene. Das bedeutet, dass es verschiedenen Akteuren möglich sein müsste, gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Mich bewegt als Ökologe natürlich, und das ist auch wissenschaftlich unstrittig, der rasante Artenverlust; natürlich spielt hier die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Aber es gibt nicht nur diesen Verlust an Artenvielfalt mit all seinen wichtigen Folgen, es gibt einen genauso rasanten Rückgang an landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich und Europa. Gleichzeitig gibt es eine Form der Landwirtschaft, die ganz hohe Auswirkungen für die Natur mit sich bringt, die wir heute gar nicht sehen. Noch ein Punkt: 95 % des Soja, das in der EU konsumiert wird, und das bedeutet in der Regel verfüttert wird, der Großteil geht in die Tierproduktion, nicht in den menschlichen Konsum, stammt nicht aus der EU, sondern aus Argentinien, Brasilien und einigen wenigen anderen Ländern. Sie wissen, was das heißt: Dort, wo heute Soja wächst, war vor 20 oder 30 Jahren Regenwald oder ein anderer Lebensraum, der ist verschwunden, weil Europa und andere Länder des globalen Nordens häufig einen versteckten globalen Fußabdruck erzeugen, der für den Konsumenten nicht immer sichtbar ist.
TRAXLER: In Österreich wird seit vielen Jahren ein Bauernsterben beklagt, der Beruf scheint vielleicht nicht mehr so attraktiv zu sein wie früher, und auch gibt es die Notwendigkeit für immer größere landwirtschaftliche Betriebe. Franz Raab, was hat sich Ihrer Meinung nach in den letzten Jahrzehnten verändert?
RAAB: Die erste Wortmeldung kann ich nur unterstreichen, es geht um die gleichen Ziele, und das über Landwirtschaft und über Naturschutz hinaus. Zum Bauernsterben: Nach dem Krieg waren 40 % der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Das ist heute so nicht mehr realistisch möglich. Strukturentwicklung erleben wir in der Landwirtschaft in ganz Europa seit vielen Jahrzehnten, und eigentlich ist das ein langer ruhiger Fluss, der sich in den letzten 10, 15 Jahren in keiner Weise beschleunigt hat. Mir wäre es lieber, es gäbe mehr Betriebe, dafür müsste es aber auch eine wirtschaftliche Lebensgrundlage für diese Betriebe geben. Wir haben es allerdings in Österreich geschafft, dass diese Strukturentwicklung viel langsamer vonstattengeht als in anderen Ländern. Man braucht gar nicht so weit zu schauen, Es ist überall das gleiche Bild. In Österreichhaben wir diese Entwicklung – und das war durchaus, denke ich, politisch so gewollt – viel verträglicher und langsamer vollzogen, aber verhindern konnte man das auch in Österreich nicht.
TRAXLER: