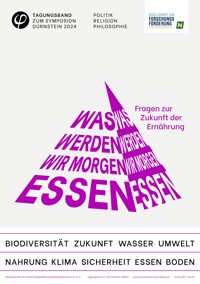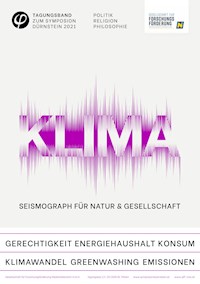
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tagungsband zum Symposion Dürnstein
- Sprache: Deutsch
Dieser Tagungsband dokumentiert das Symposion Dürnstein 2022, das zum Thema KLIMA - Seismograph für Natur & Gesellschaft vom 24. - 26. März in Dürnstein in Niederösterreich stattfand. Er beinhaltet alle Vorträge und Diskussionsrunden dieses Events. Das Symposion Dürnstein versteht sich als internationaler Gedankenaustausch, als Ort, an dem Menschen mit verschiedensten Ansichten, Haltungen, Religionen und Weltanschauungen einander zu Austausch und Diskurs treffen können. Es findet jährlich zu einer anderen Themenstellung statt. Das Symposion Dürnstein 2022 stand ganz im Zeichen des aktuellen "Krisen-Zeitalters": Menschliche Aktivitäten bringen das Geo-Klima, aber auch das gesellschaftliche und geistige Klima aus dem Gleichgewicht. Expert*innen verschiedener Disziplinen diskutierten über aktuelle Entwicklungen und mögliche Exit-Strategien. Welche Perspektiven gibt es für das Klima, in und mit dem wir alle leben? Das Themenspektrum umfasste Geo-Engineering genauso wie Naturschutz, alternative Konsumnetzwerke, Ethik, Raum- und Stadtentwicklung, Religion und Philosophie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
TAGUNGSBAND 2022ZUM 11. SYMPOSION DÜRNSTEIN 2022
KLIMA SEISMOGRAPH FÜR NATUR UND GESELLSCHAFT
GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG NÖ
Für den Inhalt verantwortlich:
Ursula Baatz und Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H.
Die in der Publikation geäußerten Ansichten liegen in der Verantwortung der Autor*innen und geben nicht notwendigerweise die Meinung der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H. wieder.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40 - 44. 22359 Hamburg, 2020
ISBN (Paperback): 978 3 347 73370 1
ISBN (E-Book): 978-3-347-73372-5
Koordination: Bettina Pilsel
Lektorat: Ursula Baatz
Impressum:
Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H., 3100 St. Pölten,
Hypogasse 1, 1. OG
www.symposionduernstein.at
INHALTSVERZEICHNIS
Johanna Mikl-Leitner Geleitwort
Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H. Vorwort
Ursula Baatz Einleitung zum Tagungsband
Ursula Baatz Dem Klima sind Grenzen egal. Und auch der Natur
Ursula Baatz, Sabine Herlitschka, Matthias Strolz, Katharina Rogenhofer Podiumsdiskussion „Österreich in der Klimakrise“
Bernhard Pörksen Die Verantwortung von allen
Helga Kromp-Kolb, Benedikt Narodoslawsky Der Preis der Zukunft
Sebastian Helgenberger Klima | generationen | vertrag: Wie schließen wir die Verantwortungslücke?
Mădălina Diaconu Der Druck der Atmosphäre
Blaž Gasparini Modifizierungen von Wetter und Klima: von Wetterläuten bis Geoengineering
Nils Matzner Müllabfuhr fürs Klima – Negative Emissionen als Zukunftsversprechen und Geschäftsmodell
Michaela Krömer Warum hat die Natur keine Rechte eine GmbH aber schon? Über das Verhältnis von Recht, Ethik und Natur
Sérgio Costa Konvivialismus, Konvivialität und die Klimakrise
Tonny Nowshin Climate-Crisis: Culmination of colonial exploitation
Mordecai O. Ogada Climate Change: A Global Crisis Used as a Tool for Oppression
Ernst Fürlinger „Kämpferische Hoffnung“. Religiöse Positionen zum Klimanotstand
Gernot Wagner Stadt, Land, Kompromiss
Sigrid Pohl Gut leben – statt viel haben
Autor*innenverzeichnis
Programm Symposion Dürnstein 2022
JOHANNA MIKL-LEITNER
GELEITWORT
Vom 24.-26. März 2022 trafen sich Interessierte und Vortragende zum 11. Symposion Dürnstein, das in diesem Jahr wieder mit Publikum und vor Ort im Stift Dürnstein stattgefunden hat. Die Veranstaltung unter dem Titel „Klima: Seismograph für Natur & Gesellschaft“ wurde im Prälatensaal sowie im Stiftshof bei strahlendem Wetter abgehalten, was die Begeisterung der Anwesenden noch verstärkte. Über die nunmehr elf Jahre seit dem Bestehen des Symposion Dürnstein konnte eine Vielzahl an Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Religion und Philosophie als Vortragende in dieser historischen Stätte in Niederösterreich gewonnen werden, was zur ausgezeichneten Reputation der Veranstaltung über die Landesgrenzen hinaus beiträgt. Ich wünsche der Veranstaltungsreihe Symposion Dürnstein weiterhin viel Erfolg.
JOHANNA MIKL-LEITNER
Landeshauptfrau
GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG NIEDERÖSTERREICH M. B. H.
VORWORT
Das Symposion Dürnstein fand vom 24. bis 26. März 2022 zum Thema KLIMA – SEISMOGRAPH FÜR NATUR & GESELLSCHAFT im Stift Dürnstein in Niederösterreich statt.
Allerorts finden Veranstaltungen, Vorträge, Diskussionen, Sendungen, Aktionen und Buchveröffentlichungen zum Thema KLIMA statt. Die Dichte der unterschiedlichen Veranstaltungen und die Intensität der Diskussionen zeigt, wie aktuell und vielschichtig das Thema KLIMA ist - wie sehr es alle betrifft und auch emotionalisiert.
Wie immer war es Anspruch des Symposions, das Thema interdisziplinär zu betrachten. Das Thema KLIMA wurde aus vielfältigen Blickwinkeln beleuchtet, bisher bekannten Perspektiven wurden neue, andere oder unkonventionelle Aspekte zugefügt und sie wurden über den Tellerrand der einzelnen Disziplinen hinausblickend betrachtet und diskutiert.
Wir diskutierten über Medienpolitik und die Macht von Desinformation sowie über Greenwashing. Ein Klimagenerationenvertrag wurde vorgeschlagen, aber auch Geoengineering als Methode zur Rettung des Klimas vorgestellt. Es wurde aufgezeigt, welche negativen Folgen Klimaschutz, ausschließlich europäisch gedacht, in der Umsetzung in Afrika oder Indien auf die dort lebende Bevölkerung hat. Zudem wurde auch erörtert, warum die Natur keine Rechte hat, eine GmbH aber schon, und warum sich das ändern sollte.
Alle beim Symposion Dürnstein 2022 vorgetragenen Perspektiven und Haltungen dokumentiert dieser Tagungsband.
BARBARA SCHWARZ
BETTINA PILSEL
Geschäftsführung
Projektleitung
Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m. b. H.
URSULA BAATZ Kuratorin Symposion Dürnstein
EINLEITUNG ZUM TAGUNGSBAND
Aktuelle Gegenwartsfragen in ihren Tiefendimensionen zu erkunden, ist der Auftrag des Symposions Dürnstein. Dazu gehören politische – das Gemeinwesen der Bürgerinnen und Bürger betreffende – Fragen genauso wie philosophische oder religionswissenschaftliche Perspektiven, aber auch soziologische Zugänge. Gerade bei dem Thema des 11. Symposions Dürnstein war dies besonders deutlich. Auch wenn sich Diskussionen um die Klimakrise sehr oft auf technisch-naturwissenschaftliche Forschung beziehen, ist gerade hier ein soziologischer Blick hilfreich und weiterführend. Wenn es ums Klima geht, dann reden wir über den Lebensraum der Menschen, global gesehen; oder anders gesagt: Es geht um Natur und die Menschen als Teil der Natur und Akteure ihrer Veränderung.
Das wurde schon in der Eingangsdiskussion deutlich: Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG und Vizepräsidentin der österreichischen Industriellenvereinigung, zeigte eindrucksvoll auf, was Firmen zur Bewältigung der Klimakrise beitragen können. Katharina Rogenhofer, Mitbegründerin von „Fridays for Future“ in Österreich, zeigte, was realpolitisch dringend umgesetzt werden soll, um Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Matthias Strolz, Ex-Politiker, Unternehmer und Buchautor, wies auf die weltanschaulichen Hintergründe der Klimakrise hin.
Die Diskussion um die Klimakrise wird nicht nur unter Wissenschaftler*innen, Politik und Industrie ausgetragen, sondern ist vor allem auch ein mediales Ereignis. Im Eröffnungsvortrag mit dem Titel „Fakt und Fake. Wissenschaftsskepsis, Verschwörungsmythen und die neue Macht der Desinformation im digitalen Zeitalter“ ging der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen auf „die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters und das Geschäft mit der Desinformation“ ein, die „im Zusammenspiel von alten und neuen Medien der Charakter von Debatten, unsere Idee von Wahrheit und Autorität verändern“, wie er schreibt. Helga Kromp-Kolb, em. Professorin für Meteorologie und Klima an der Universität für Bodenkultur in Wien, ist eine der führenden Klima-Wissenschaftlerinnen und eine der frühesten vor der Klimakrise warnenden Stimmen. „Der Preis der Zukunft“ war der Titel ihres Gesprächs mit „Falter“-Redakteur Benedikt Narodoslawsky (zuständig für die Bereiche Klima und Umwelt) über ihre Erfahrungen. Sebastian Helgenberger, Umweltwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam schlug einen Klima-Generationen-Vertrag vor – da junge Menschen und damit die Zukunft in den politischen Entscheidungsprozessen deutlich unterrepräsentiert sind.
Atmosphäre ist ein fundamentaler Begriff der Klima-Forschung. Dass Atmosphäre nicht nur geophysikalisch, sondern auch sensorisch und sozial ist, und dass dies auch für die Bewältigung der Klimakrise von Bedeutung ist, belegte Mădălina Diaconu, Dozentin für Philosophie an der Universität, in einem eindrucksvollen Vortrag. Technischer wurde es bei dem Überblick des Klimawissenschaftlers Blaž Gasparini (Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Wien), der über die Möglichkeiten und Gefahren des Geoengineerings berichtete. Nils Matzner, Wissenschaftssoziologe an der Technischen Universität München, diskutierte in seinem Beitrag die problematischen Möglichkeiten „Negativer Emissionen“, also der CO2-Reduktion mit technischen Mitteln. Die philosophische und vor allem auch juristische Grundfrage: „Warum hat die Natur keine Rechte, eine GmbH aber schon? Über das Verhältnis von Recht, Ethik und Natur“ erörterte die Rechtsanwältin Michaela Krömer (Kanzlei Krömer, St.Pölten), die sich unter anderem auf Klimafragen spezialisiert hat und international bestens vernetzt ist.
Für eine Bewältigung der Klimakrise ist Technologie und Naturwissenschaft hilfreich – doch unabdingbar braucht es eine Veränderung menschlicher Lebensformen. Sérgio Costa, Professor für Soziologie am Lateinamerika-Institut der FU Berlin und einer der Proponenten des „Konvivialistischen Manifests“, erläuterte dieses Konzept, das auf den Österreicher Ivan Illich zurückgeht. Neue Formen des Zusammenlebens sind nötig, sowohl innerhalb der Spezies Mensch als auch im Zusammenleben zwischen Menschen und allen anderen Spezies, der Natur also. Naturschutzgebiete gefährden dieses labile Gleichgewicht: denn sie basieren auf kolonialen Konzepten und arbeiten mit repressiven Maßnahmen. Indigene, die in diesen Gebieten immer schon gewohnt haben, werden vertrieben und die Gebiete für Tourismus geöffnet. Diese unheilvolle Entwicklung zeigte der kenianische Ökologe Mordecai Ogada (Executive Director of Conservation Solutions Africa) in seinem Vortrag: „Climate and Environment: The new instruments of injustice“ an rezenten Beispielen unter anderem aus Afrika auf. Ähnlich beschrieb die Wirtschaftswissenschaftlerin und Degrowth-Aktivistin Tonny Nowshin (Bangladesh/Deutschland) die Situation in ihrem Impuls „And the Global South. An urgent perspective“.
Religion ist global gesehen ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor, und auch die Religionsgemeinschaften melden sich in Sachen Klimakrise zu Wort. So hat der „Weltrat der Kirchen“ bereits 1988 auf den Zusammenhang von Klimakrise und konsumistischem Lebensstil hingewiesen, wie Ernst Fürlinger (Research Lab Democracy and Society in Transition, Donau-Universität Krems) in seinem Aufsatz zeigt. Dass möglicherweise gut organisiertes Leben in der Großstadt besser fürs Klima ist als das Landleben, mutmaßt der Klimaökonom Gernot Wagner (Columbia Business School). Den Abschluss des Bandes bildet die Dokumentation der künstlerischen Intervention, die Studierende der KPH Krems unter der Leitung von Sigrid Pohl für das Symposion Dürnstein konzipiert haben.
Abb. 1: Podium Eröffnungsabend mit Matthias Strolz, Sabine Herlitschka und Mari Lang, © Klaus Ranger
Abb. 2: Katharina Rogenhofer via Zoom zugeschaltet © Klaus Ranger
Abb. 3: Bernhard Pörksen beantwortet Fragen aus dem Publikum © Klaus Ranger
Abb. 4: Mittagspause im Hof des Stift Dürnstein © Klaus Ranger
Abb. 5: Michaela Krömer bei ihrem Vortrag im Prälatsaal © Klaus Ranger
Abb. 6: Podium mit Sérgio Costa, Mordecai Ogada, Tonny Nowshin (am Monitor) und Joachim Schwendenwein © Klaus Ranger
Abb. 7: Symposion Dürnstein 2022 Besucher*innen © Klaus Ranger.
URSULA BAATZ
DEM KLIMA SIND GRENZEN EGAL. UND AUCH DER NATUR.
Menschen sind eine invasive Spezies, sie dringen in neue, unbekannte Räume vor, physische wie mentale, freiwillig oder erzwungen, setzen sich dort fest, verändern und gestalten diese Räume - manchmal mit offener Gewalt, manchmal subtil. Diese invasiven Veränderungen wurden seit rund 200 Jahren immer mehr und umfangreicher. Manche sprechen deswegen von einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän, ein Ausdruck, den schon 1873 der italienische Anthropologe Stroppani vorschlug. 2008 erklärte die Geological Society of London, die älteste wissenschaftliche Gesellschaft für Geologie, dass die Zunahme an Treibhausgasen, die Übersäuerung der Ozeane und die Folgen der industriellen Landwirtschaft – also Artensterben, Verdrängung der Vegetation und Abwanderung von Arten - eine bisher noch nie dagewesene Veränderung des Planeten durch menschliche Aktivitäten geschaffen habe.
Das bekommt man hautnah zu spüren: Dieser Winter war laut ZAMG der achtwärmste Winter seit Beginn der modernen Messungen 1850. Allein im Februar legten Stürme dreimal den innereuropäischen Verkehr weitgehend lahm – Flüge und Züge fielen aus. Klimaerhitzung – so nennt es die ZAMG – ist nur ein Symptom der Veränderung des Planeten. Früher ärgerte man sich über die kleinen Insekten, die im Sommer abends an die Windschutzscheibe knallten oder einen beim Radfahren ins Auge flogen. Heute gibt es kaum mehr welche. Die fliegenden Edelsteine, die Schmetterlinge, sind in den letzten hundert Jahren um mehr als die Hälfte reduziert worden – wann haben Sie den letzten gesehen? In Österreich sind in den letzten 20 Jahren rund 40 % der Vögel verschwunden. Und so weiter. Massensterben gab es in der Erdgeschichte mehrere, aber dieses „Sechste Massensterben“ geht aufs Konto menschlicher Aktivitäten.
Der Kabarettist Franz Hohler schrieb 1973 seinen Song vom Weltuntergang: Ein unangenehmer Käfer auf einem fernen Atoll im Pazifik stirbt aus, alle freuen sich. Doch dies ist der winzige Beginn des Endes der Nahrungskette und es folgt ein großes Sterben. Die Ursache: In Hohlers Weltuntergangstext starb der Käfer an durch fossile Brennstoffe verseuchter Nahrung.
Das klang 1973 nach Satire. Tatsächlich warnten bereits 1965 amerikanische Wissenschaftler die US-Regierung vor den Folgen fossiler Treibstoffe. Exxon errechnete 1982, dass bei zunehmender Verwendung fossiler Brennstoffe 2060 die Temperatur global um 2 Grad gestiegen sein würde; 1988 errechnete Shell diesen Temperaturanstieg bereits für 2030 und warnte vor Überflutungen, Verlust von Wasserreserven und Erhitzung. Die Studien wurden von den Erdölfirmen unter Verschluss gehalten und gelangten erst in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit. 2030 - das ist heute in acht Jahren. Die Klimakonferenzen des letzten Jahrzehnts warnten, dass die Erhitzung des Planeten bald nicht mehr umkehrbar ist.
Ich frage mich, in welcher Welt die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, werden leben müssen. Überflutungen, Hitze, Stürme - sollen wir uns also auf eine Höllenfahrt vorbereiten? Von Alfred Polgar – aus einem Stück namens „Kasperles Höllenfahrt“ - soll der berühmte Satz stammen: Es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Diese Devise scheinen viele zu verfolgen – da es nicht mehr so leicht möglich ist, die Klimakatastrophe zu leugnen, haben sich große Firmen wie Shell und andere auf Greenwashing verlegt, also auf PR-Strategien, die das Firmen-Image „grün“ färben. Die heftigen Diskussionen in der EU, welche Energieformen als „nachhaltig“ gelten dürfen, sind durch den Überfall Putins auf die Ukraine rasch beendet worden. Man möchte aus dem russischen Gas heraus – aber als Ersatz fallen vielen Politikern nur Kohlekraftwerke ein. Oder: Die Pendlerpauschale ist nicht nur sozial ungerecht, sondern fördert die Klimaerwärmung. Mit anderen Worten: Wie eine lebenswerte Zukunft, und das heißt die notwendige Reduktion der Klimaerwärmung, aussehen könnte, darüber haben die Entscheidenden in der EU und in Österreich bisher offenbar nicht nachgedacht.
Damit eine wirkliche Veränderung möglich wird, braucht es mehr als Systemkosmetik und technische Lösungen, die wie „Schmerzmittel für den Klimawandel“ (Blaz Gasparini) funktionieren.
Auf der Suche nach den tieferliegenden Wurzeln, aus denen die Klimakrise erwachsen konnte, stößt man rasch auf die Anfänge der Naturwissenschaft. Der Staatsmann und Philosoph Francis Bacon schrieb 1620, man müsse die Natur gefügig und zur Sklavin machen; man solle sie auf ihren Irrwegen mit Hunden hetzen und solange auf die Folter spannen, bis sie ihre Geheimnisse preisgebe. Zudem galten Geiz und Gier im aufsteigenden Kapitalismus nicht mehr als Laster, sondern als Tugenden. Der Umgang mit dem Natürlichen ist – wie Bacons Bild zeigt – von ökonomischen Interessen geleitet: das Natürliche, Lebendige, hat nur Berechtigung als Produktivkraft im Dienste des (National-)Staates, der Herrschenden, des Geldes.
Statt die Natur als Sklavin und Gefangene weiter auszubeuten, muss man dem Lebendigen, Natürlichen, wieder eigene Rechte zugestehen. Bereits 1972 forderte der vor kurzem verstorbene bedeutende amerikanische Rechtswissenschaftler Christopher D. Stone, dass Bäume, Flüsse, Landschaften, die lebendige Natur, Rechtsstatus haben, also als juristische Personen anerkannt werden sollen. Dies hat nichts mit Romantik zu tun. Die Klimakatastrophe, die als Folge der Versklavung der Natur entstanden ist, führt – wie immer deutlicher zu sehen ist - zum Zusammenbruch der Bedingungen, unter denen Menschen gedeihen können. Die Eigenrechte der Natur zu berücksichtigen, heißt die Lebensbedingungen für die Gattung Mensch im Zusammenleben mit allen anderen Gattungen durch Rechtsnormen zu stabilisieren.
Dazu muss man Natur überhaupt erstmal wahrnehmen. Doch hat die Umgebung Auswirkungen aufs Denken: Längere Aufenthalte in freier Natur beruhigen und inspirieren, anders und freier zu denken. Doch die meisten Menschen in den Staaten des Nordens verbringen ungefähr 90 % ihrer wachen Zeit in geschlossenen Räumen, bestenfalls mit ein paar Zimmerpflanzen. Dabei geht es dringend um neue Formen des Zusammenlebens – Klimagerechtigkeit ist untrennbar mit sozialer Gerechtigkeit verbunden.
Das ökonomische Kalkül zerstört das Gemeinsame von Natur und Menschen. Deswegen geht es um neue Formen des Austauschs, um Anerkennung und Solidarität, sagen die Initiatoren des Konvivialistischen Manifests (www.konvivialisten.de). Convivium ist das antike Gastmahl, bei dem alle über Essen, Trinken und Gespräch miteinander in Beziehung kommen. Der Planet Erde gewährt den Lebewesen das Große Gastmahl, einen Austausch, der für alle reicht, wenn richtig geteilt und genossen wird. Der Planet Erde ist Heimat, „patrie“, sagt der französische Philosoph Edgar Morin, der heuer 100 Jahre wurde (auf ihn beruft sich die Kampagne „Heimatland Erde“ auf aspr.at).
Es ist dringendst nötig, über den nationalstaatlichen Tellerrand zu blicken und planetar orientiert zu denken, zu fühlen und zu handeln. Natur und Klima sind Nationalstaatsgrenzen egal.
URSULA BAATZ SABINE HERLITSCHKA MATTHIAS STROLZ KATHARINA ROGENHOFER
PODIUMSDISKUSSION „ÖSTERREICH IN DER KLIMAKRISE“
Podiumsdiskussion1 moderiert von Mari Lang
LANG: Ich freu mich sehr auf unsere Podiumsdiskussion zum Thema „Österreich in der Klimakrise“ mit Sabine Herlitschka, der Vorstandsvorsitzenden bei Infineon Technologies Austria AG und Vizepräsidentin der Österreichischen Industriellenvereinigung. Matthias Strolz ist österreichischer Unternehmer, Buchautor und ehemaliger Politiker. Sein Buch Gespräche mit einem Baum ist gerade erschienen. Online zugeschaltet ist außerdem Katharina Rogenhofer, Mitbegründerin von Fridays for Future, Sprecherin des Klimavolksbegehrens Österreich und Autorin des Buches Ändert sich nichts, ändert sich alles. Mit den beiden letztgenannten bin ich per Du, deshalb wird es einen Mix aus Du und Sie geben.
In Österreich ist die Klimakrise oder Klimakatastrophe, wie sie vielerorts bezeichnet wird, schon spürbar. Seit Beginn der Industrialisierung ist die Temperatur bei uns bereits um 2 Grad gestiegen. Laut dem Pariser Klimaabkommen dürfte es aber nur einen maximalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad im globalen Mittel geben, um die Katastrophe zu vermeiden. Wo stehen wir hierzulande in Bezug auf die Klimakrise?
ROGENHOFER: Danke, dass ich virtuell da sein darf, ich sitze noch in Corona-Quarantäne. Ja, Österreich ist von der Klimakrise betroffen, wir spüren das in den letzten Monaten mit Extremwettern; auch die Landwirtschaft spürt das, die Niederschläge gehen uns ab. Gleichzeitig hat Österreich keinen guten Track-Record, was die Klimapolitik betrifft: Wir haben es nämlich seit 1990 nicht geschafft, unsere Treibhausgasemissionen zu senken. Während die EU -Länder sonst im Durchschnitt ihre Treibhausgase um 20 Prozent reduziert haben, sind unsere Emissionen nicht einmal um ein, zwei, drei oder vier Prozent gesunken. Deshalb brauchen wir jetzt dringend verbindliche Maßnahmen, um die Klimaziele, die wir uns bzw. die Regierung sich als Ziel gesetzt hat, also 2040 Klimaneutralität, zu erreichen. Aber ich frage, wie kommen wir tatsächlich dorthin? Viele Gesetze, die es bräuchte, fehlen. Wir haben seit 2020 kein gültiges Klimaschutzgesetz, das festlegen würde, wie wir unsere Emissionen bis 2040 auf Null reduzieren wollen. Das alte Gesetz ist 2020 ausgelaufen, wir haben also seit über 450 Tagen kein Klimaschutzgesetz (Stand März 2022), keine Verbindlichkeiten, keine Verantwortungsteilung zwischen Bund und Ländern. Das Gesetz für Erneuerbare Wärme soll festlegen, wie wir in Österreich die 900 000 Gasheizungen und 600 000 Ölheizungen gegen erneuerbare Alternative tauschen wollen. Das müssen wir, wenn wir Klimaschutz ernst meinen. Gerade durch die Gasabhängigkeit von Russland merken wir, dass es keine gute Idee ist, uns von diesen Brennstoffen und Ländern abhängig zu machen, und trotzdem dürfen wir in Österreich heute noch Gasheizungen in Neubauten einbauen. Das, was wir gerade betreiben, würde ich als politisches Greenwashing bezeichnen. Wir stellen uns hin und diskutieren irgendwelche Ziele in der fernen Zukunft von 2040 Klimaneutralität, aber auf den Boden bringen wir viel zu wenig. In Salzburg, in Tirol, in Vorarlberg steht noch immer kein einziges Windrad, so viel zur Energiewende. Das heißt, wenn wir´s ernst meinen, dann müssten wir jetzt anfangen, tatsächlich vom Reden ins Tun zu kommen.
LANG: Vielen Dank. Das heißt, die Politik müsste viel rascher handeln und ins Tun kommen. Matthias Strolz, wie würdest Du die Bestandsaufnahme in Sachen Klimakrise in Österreich beurteilen?
STROLZ: Dass wir unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir so weitermachen, Ziele, die wir uns selbst gegeben haben im Rahmen des Pariser Abkommens. Dass jetzt auch die sogenannte sozial-ökologische oder ökosoziale Steuerreform wackelt, das halte ich für falsch, ich finde nicht, dass wir die geplante CO2-Steuer zurücknehmen dürfen, ich begreife mich natürlich als Mann der Wirtschaft, ich bin seit fast 20 Jahren Unternehmer. Ich war der Erste, der 2017 in Österreich ein durchgerechnetes CO2-Besteuerungsmodell präsentiert hat, von einem externen Wirtschaftsforschungsinstitut. Die Schweden haben schon lange eine CO2-Steuer, haben das Schritt für Schritt eingeführt, sodass die Wirtschaft auch umstellen konnte. Ich bin deswegen auch extra z. B. ins Gespräch gegangen mit dem damaligen VOEST-Chef. Mir war es als Obmann der NEOS ein Anliegen, dieses Oder zwischen Umwelt oder Wirtschaft rauszunehmen, weil ein Und ist möglich. Schweden hat es mit Einführung der CO2-Steuer geschafft, über einen Zeitraum von über zehn Jahren den CO2-Ausstoß vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Dabei hatten die Schweden im Vergleichszeitraum ein größeres Wirtschaftswachstum als Österreich und hatten trotzdem eine sinkende Emissions-Kurve, während Österreich eine steigende CO2-Kurve hatte.
Ich bin nicht mehr Politiker, sondern ich bin Bürger, Vater, auch Autor, und habe ein Buch im Gespräch mit einem Baum geschrieben. Ich bin an seinem Stamm gesessen, es war eine Föhre, und da ist mir klar geworden: Wir haben hier im globalen Maßstab ein weltanschauliches, ideengeschichtliches, philosophisch-spirituelles Thema; wir haben ein Haltungsproblem, das ein Kollateralschaden der Aufklärung ist. Als Gründer einer liberalen Partei habe ich kein Problem mit der Aufklärung, im Gegenteil, wir stehen auf den Schultern der Aufklärung, haben ihr so viel zu verdanken. Doch bin ich in der Tradition eines Theodor Adorno oder Max Horkheimer, die schon 1944 in ihrer Dialektik der Aufklärung gesagt haben, die Aufklärung ist totalitär. Oder vielmehr: Wir leben sie totalitär. Die Aufklärung hat uns Macht gegeben, um den Preis, dass wir uns von dem entfremden, über das wir Macht erlangen. Wir haben uns über die letzten Jahrhunderte zu einer Spezies entwickelt, die sich nicht mehr als Teil der Natur begreift. Ich halte das für grundfalsch. Selbst biblische Zitate wurden in den Dienst der Entfremdung von der Natur gestellt: „Macht euch die Erde untertan“. Wenn wir so auf Natur schauen, dann können wir sie schamlos knechten und ausbeuten, ohne an die Zukunft zu denken. Ich plädiere für eine Behebung dieses Haltungsschadens. Wir müssen in eine neue Qualität der Verbundenheit reifen und dann ist der respektvolle Umgang mit der Umwelt ein „no brainer“, dann kann ich nicht anders, als mit Ressourcen anders hauszuhalten. Das wird eine weite Reise sein, aber es gibt viele Anhaltspunkte, dass hier etwas im Umbruch ist, unter anderem Fridays for Future, draußen liegt ein Buch von der Greta Thunberg mit dem Dalai Lama. Zum Abschluss: 2017 haben´s gelacht, „CO2-Steuer -, ihr seid ja naiv, geht gar nicht“. Das Wort „geht gar nicht“ gilt nicht mehr als Ausrede, nach allem, was wir beispielsweise bei Covid an Maßnahmen umgesetzt haben, z.B. Milliarden Menschen im Lockdown. Es gilt nicht als Argument gegen eine CO2-Steuer, oder eine EU- und/oder weltweite Finanztransaktionssteuer im Gegenzug zur Entlastung das Faktors Arbeit und gegen anderes, was uns helfen würden, im internationalen Maßstab für positive sozialökologische Entwicklungen. Wir müssen nur wollen. Und dann tun.
LANG: Frau Herlitschka, Sie vertreten hier die Wirtschaft als Vizepräsidentin der Österreichischen Industriellenvereinigung, auch als Vorstandsvorsitzende von Infineon, einem der führenden Hersteller von Halbleitern. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht in Österreich in Bezug auf die Klimakrise?
HERLITSCHKA: Mein Blick auf die Welt ist grundsätzlich ein optimistischer, und ich finde es beachtlich, dass ambitionierte Ziele wie die Klimaneutralität bis 2040 in Österreich, also zehn Jahre früher als die EU, ohne es infrage zu stellen, festgelegt werden. Ich hatte schon Gelegenheit, eine Gruppe von Fridays for Future bei uns im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Eine Gesellschaft lebt davon, dass sich einzelne Gruppen engagieren für das, was wichtig ist. Wirtschaft oder Industrie sind keine abgesonderten Systeme. Wirtschaft und Industrie sind Teil der Gesellschaft: Arbeitsplätze werden geschaffen, Wertschöpfung wird generiert, Geld, das daraus entsteht, wird wieder investiert in unser Gemeinwesen. Es ist ein Kreislauf und deswegen ist es wichtig, systemisch zu denken. Fakt ist, dass die großen Herausforderungen, wie etwa die Klimakrise oder die Pandemie, sich alle durch zwei Punkte charakterisieren: sie sind echt komplex und sie sind wirklich systemisch.
LANG: Sie haben gesagt, es ist Gesetz, dass wir die Klimaziele einhalten. Wie wollen Sie das konkret bei Infineon schaffen?
HERLITSCHKA: Infineon ist ein Konzern mit über 50 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. In Österreich haben wir rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen als Konzern weltweit bis 2030 CO2-neutral sein und bis 2025 70 Prozent CO2-Reduktion erreichen. Nachhaltigkeit ist seit langem Teil der Unternehmensstrategie und wir sind auf Konzern-Ebene seit zwölf Jahren im Dow-Jones Sustainability Index gelistet. Wir gehören auch nicht zu den Unternehmen, die jetzt, weil es gerade schick ist, sich das Thema „grün“ auf die Fahnen heften. In der großen Krise 2008 und 2009 haben wir viele profitable Teile des Konzerns abgespalten und auf strategische Themen gesetzt, wie Energie-Effizienz, nachhaltige Mobilität, Sicherheit und alles, was mit Daten zu tun hat. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man an der Börse noch dafür geprügelt worden ist. Das ist der eine Aspekt – und der andere ist mir sehr wichtig, nämlich pragmatisch zu schauen, wie man zu Lösungen kommt. Wir haben bei Infineon in Österreich die Kombination von Produktion, Forschung und Entwicklung und globaler Geschäftsverantwortung. Unser Fokus sind Leistungselektronik für Energie-Effizienz-Anwendungen. Wir sagen daher auch Energiesparchips dazu. Wir haben letztes Jahr in Österreich etwas mehr als acht Milliarden Chips produziert. Damit tragen wir dazu bei, dass sieben Millionen Tonnen CO2 in den Anwendungen eingespart werden können. Diese Menge an CO2 einzusparen, entspricht in etwa 50 Prozent der Pkw-Emissionen pro Jahr – also ganz schön viel.
Unsere Energiesparchips werden in E-Autos, in der Photovoltaik, bei Windkraftanlagen, beim kontaktlosen Bezahlen oder beim Schnelladen eingesetzt. Im Kern geht es darum, Strom intelligent zu schalten. Die Kunst ist es, diese Elemente so zu bauen, um Energie möglichst effizient fließen zu lassen, Energieverluste zu minimieren. Das ist die Kernkompetenz von Infineon. Österreich hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Jetzt gilt es, weniger ideologisch zu diskutieren, sondern in die Umsetzung zu kommen und zu erkennen, welche Technologien wir bereitstellen können. In der Industrie würde man sagen, einen Masterplan erstellen und ihn mit Maßnahmen umsetzen. Das Tun ist entscheidend. Ich habe Ihnen Beispiele von uns gebracht, aber es gibt auch andere Beispiele. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Vor Jahrzehnten war das Thema Ozonloch bedrohend - heute ist das Ozonloch durch unsere gemeinsamen Anstrengungen kleiner geworden, das weiß kaum jemand. Die Dimension ist jetzt eine andere, aber schaffen können wir es. Jetzt gilt es, was tun wir jetzt wirklich, ganz konkret und gemeinsam.
LANG: Lösungen gibt sehr viele, wie Sie sagen, um uns vor einer Klimakatastrophe zu bewahren. In dem Film 2040 Wir retten die Welt (Netflix) schaut sich der Regisseur an, welche Lösungen es schon gibt, um eine zukunftsfähige Zukunft für seine gerade vierjährige Tochter im Jahre 2040 anbieten zu können, und da werden wirklich ganz tolle Innovationen präsentiert. Wenn die Lösungen quasi schon am Tablett serviert werden, woran liegt es, dass wir nicht ins Handeln kommen?
ROGENHOFER