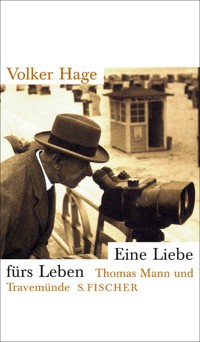Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Literaturgeschichte und Literaturkritik, brillant erzählt von einem Kenner und Liebhaber. Volker Hage vermag es, Literaturkritik und literarische Analyse erzählerisch darzustellen. So sind eingängige Texte entstanden, in denen Werke und Autoren lebendig und facettenreich präsentiert werden, ganz gleich, ob es moderne Klassiker oder Zeitgenossen sind. Die Begegnungen mit Schriftstellern zählen zu den journalistischen Höhepunkten seiner Tätigkeit als Redakteur. Immer wieder geht es Hage dabei um die Frage des autobiografischen Hintergrunds, der Mühsal des Schreibens und der Freude am fertigen Werk, der Krisen, Brüche und des Selbstverständnisses. Auch die Erfahrungen des Redakteurs im Umgang mit Schriftstellern fließen ein. Das macht die Porträts zu einem spannenden Spiegel der Wechselwirkung von Zusammenarbeit, Nähe und Distanz. Die Auswahl der Porträts zeigt die Vorlieben eines intimen Literaturkenners. Mit Texten zu Günther Anders, Jurek Becker, Karen Duve, Richard Ford, André Gide, Christoph Hein, Monika Maron, Friederike Mayröcker und Ernst Jandl, Bodo Kirchhoff, Erich Mühsam, Brigitte Reimann, Bernhard Schlink, Sofija Tolstaja, Leon de Winter sowie Momentaufnahmen von Herta Müller, Daniel Kehlmann, Navid Kermani, Michael Kleeberg, Terézia Mora und Zeruya Shalev.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Hage
Was wir euch erzählen
Schriftstellerporträts
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2022
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag
ISBN (Print) 978-3-8353-5177-6
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4856-1
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4855-4
Für Paul Anton (* 2021), für später
INHALT
Die heimliche DichterinSofja Tolstaja (1844–1919)
Kopfsprünge in die EinsamkeitAndré Gide (1869–1951)
Der Anarchist und die FrauenErich Mühsam (1878–1934)
Wir antiquierten MenschenGünther Anders (1902–1992)
Den menschlichen Dialog weiterführenFriederike Mayröcker (1924–2021) und Ernst Jandl (1925–2000)
Rebellisch aus LebenslustBrigitte Reimann (1933–1973)
Wie ich ein Deutscher wurdeJurek Becker (*unbekannt–1997)
Ich hab’ ein freies HerzMonika Maron (*1941)
Einer Stimme folgenRichard Ford (*1944)
Missglückte TräumereienChristoph Hein (*1944)
Wir NachgeborenenBernhard Schlink (*1944)
Abgrund plus HandwerkBodo Kirchhoff (*1948)
Vom Kino besessenLeon de Winter (*1954)
Ich stehe gern im RegenKaren Duve (*1961)
Schlussbild mit Momentaufnahmen
Herta Müller (*1953)
Zeruya Shalev (*1959)
Michael Kleeberg (*1959)
Navid Kermani (*1967)
Terézia Mora (*1971)
Daniel Kehlmann (*1975)
Nachwort
DIE HEIMLICHE DICHTERIN
SOFJA TOLSTAJA
Die Ehe von Sofja und Leo Tolstoi war schon lange keine Privatsache mehr, war es vielleicht nie gewesen. Sie war eine Angelegenheit von größtem öffentlichen Interesse. Schon zu Lebzeiten wurde der Dichter zur Legende, wurde in Russland verehrt wie ein Heiliger, seine Prominenz stand der des Zaren kaum nach – was dem nicht unbedingt gefiel.
Die letzte Station im Leben von Leo Tolstoi war eine Bahnstation. In Astapowo, mitten in der russischen Provinz, legte sich der 82 Jahre alte Dichter im November 1910 zum Sterben nieder. Zehn Tage vor seinem Tod war ihm gelungen, was er seit vielen Jahren angekündigt und sich immer wieder vergeblich vorgenommen hatte: seine Frau und das herrschaftliche Gut Jasnaja Poljana zu verlassen.
Er floh vor den ewigen Streitereien, vor dem Misstrauen und der Eifersucht, vor den wiederholten Selbstmorddrohungen Sofja Andrejewna Tolstajas, mit der er seit nahezu fünfzig Jahren verheiratet war, und er floh das Luxusleben, dessen sich der Gottsucher und Propagandist des einfachen Lebens seit langem schämte. Er gehe fort, hatte er seiner Frau im Abschiedsbrief geschrieben, um »in Zurückgezogenheit und Stille« seine letzten Tage zu verbringen, und er bat sie, ihm nicht nachzureisen. Hohes Fieber hatte ihn gezwungen, seine Flucht mit der Eisenbahn in Astapowo abzubrechen. Nur wenige Wochen zuvor war der zeitlebens vor Kraft und Gesundheit strotzende Dichter noch auf seinem Pferd durch die Wälder geritten, nun erwartete er in einem fremden Bett den Tod, in einem kargen Zimmer, das ihm der Stationsvorsteher eilig zur Verfügung gestellt hatte.
Die größte Moskauer Tageszeitung räumte die ganze erste Seite für die Nachricht von der Flucht frei. Das Blatt war sofort ausverkauft. Reporter, Fotografen und Kameramänner versammelten sich vor dem Bahnhofshaus. Die Angelegenheit entwickelte sich zu einem der ersten großen Medienereignisse der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg; es war ein Ereignis, das weit über Russlands Grenzen hinaus Beachtung fand. Um Unruhen und Menschenaufläufe zu verhindern, schickte die russische Regierung Ordnungskräfte zum Ort des Geschehens.
Auch die Ehefrau reiste an, trotz aller Bitten: Die Redaktion der Moskauer Zeitung hatte ihr in einem Telegramm anvertraut, wo sich der Sterbende aufhielt. Und sie kam unverzüglich mit einem eigens gemieteten Sonderzug angereist und stand dann hilflos vor der Tür, schaute durchs Fenster, schon damals von Fotografen und den ersten Kameraleuten gnadenlos verfolgt. Zu ihrem Mann wurde sie erst vorgelassen, als er kaum noch bei Bewusstsein war. Die dem Vater ergebene Tochter Alexandra, Sascha genannt, sowie einer der Söhne, der Arzt und andere Vertraute waren der Meinung, so den Willen des Sterbenden am besten zu respektieren.
Nach dem Tod von Leo Tolstoi wurde sie, Sofja Tolstaja, immer wieder als uneinsichtige und eigennützige, als hysterische Ehefrau hingestellt, die den großen Dichter und Sinnsucher in die Flucht, ja in den Tod getrieben hätte. Sie hatte das vorhergesehen und sogar ihrem Mann die Absicht unterstellt, »mit dem Geschick eines Schriftstellers die Zwietracht mit der Ehefrau zur Schau zu stellen und selbst als Märtyrer und Heiliger zu erscheinen«. Nicht umsonst gebe es die Legende von der Xanthippe, notierte sie wenige Wochen vor seinem Tod in ihrem Tagebuch, »auch mir schreiben törichte Leute diese Rolle zu«. Es gab aber auch andere Urteile über sie, so von Thomas Mann, der darauf verwies, dass immerhin sie es war, »die, ungeachtet ihrer beständigen Schwangerschaften und ihrer reichen Pflichten als Gutsherrin, Mutter und Hausfrau, Krieg und Frieden mit eigener Hand siebenmal abgeschrieben hat«.
Auch wenn das vielleicht übertrieben sein mag: Heute existiert ein differenziertes Bild von Sofja Tolstajas Persönlichkeit und der höchst komplizierten Ehe. So ließ etwa der amerikanische Literaturkritiker und Schriftsteller Jay Parini 1990 in einer Romanbiographie Tolstojs letztes Jahr (die deutsche Ausgabe erschien 2008) sechs Zeitzeugen aus unterschiedlichen Perspektiven von der sich immer weiter zuspitzenden Krise berichten, vom Ehekrieg im Hause Tolstoi. Er hat die Dramatik dieses letzten Jahres in fiktiven Monologen umkreist. Auch der Ehefrau gibt Parini eine Stimme, sie darf sich ausgiebig gegen die Vorwürfe verteidigen, die sie daheim von ihrem Mann und anderen zu hören bekommt. Neben ihr kommen zu Wort: der Leibarzt, ein Sekretär, die Tochter Sascha, Tolstois aufdringlicher Freund Wladimir Tschertkow und behutsam auch Tolstoi selbst. Parinis Roman diente später als Vorlage für einen Spielfilm, der 2009 in die Kinos kam: The Last Station (so auch der Originaltitel des Romans); Christopher Plummer und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren verkörpern darin das Ehepaar Tolstoi.
Entschieden Partei für die Ehefrau ergreift eine umfassende Tolstaja-Biographie, die die Slawistin Ursula Keller und die Kunsthistorikerin Natalja Sharandak gemeinsam geschrieben haben. Ziel der Autorinnen ist es, die Aufmerksamkeit endlich auch auf das schriftstellerische Werk der Ehefrau Tolstois zu lenken. Dazu werteten sie kaum bekannte und bisher unveröffentlichte Texte in russischen Archiven aus: eine fundierte und höchst überzeugende Lebensdarstellung.
Das bedeutendste der nachgelassenen Werke Sofja Tolstajas wurde 1994, mehr als hundert Jahre nach der Niederschrift, zunächst in Russland veröffentlicht, 2008 auch in deutscher Sprache: der Roman Eine Frage der Schuld. Die Verfasserin hatte ursprünglich diesen Titel im Sinn: »Wessen Fehl? Die Erzählung einer Frau. (Anlässlich der Kreutzersonate Lew Tolstois.) Niedergeschrieben von der Gattin Lew Tolstois in den Jahren 1892 /1893«. Den Roman zu veröffentlichen, traute sie sich nicht. Geschildert werden kaum verhüllt die frühen Jahre der Ehe mit Tolstoi.
Von »Scham und Abscheu vor den fleischlichen Gelüsten des Fürsten« ist die Rede, wenn es um die frisch verheiratete Heldin Anna geht – später beschließt die Ehefrau im Roman, »ihre Ideale der Keuschheit kurzerhand aufzugeben« und »Mittel« einzusetzen, mit denen sie den Fürsten, der hier Prosorski heißt, an sich binden will. »Von diesen Mitteln hatte sie nur eine dunkle Ahnung, sie waren ihr zuwider, doch was bot sich ihr denn Besseres?« Der Ehemann jedenfalls ist der jungen unerfahrenen Anna keine Hilfe gewesen: »Nicht ein einziges Mal hatte er daran gedacht, ihr zunächst jene Seite des Liebeslebens näherzubringen, der er bei den Hunderten von Frauen, mit denen er es bisher zu tun gehabt hatte, auf so vielfältige Weise zu begegnen gewohnt war.«
Aus Liebe wird Hass. Annas Erkenntnis: »Nichts und niemanden braucht er: weder die Kinder noch mich. Nichts an unserem Leben interessiert ihn. Mich braucht er nur als Gegenstand. Und dass bloß seine eigene Liebe nicht verletzt wird!« Eine Frage der Schuld ist ein schonungsloser Roman.
Sofja Tolstaja hatte schon in ihren Mädchenjahren Erzählungen und (seit ihrem elften Lebensjahr) Tagebuch geschrieben, alles aber vor der Hochzeit im Jahr 1862 verbrannt, was sie später sehr bereute. Der um die 18-jährige Arzttochter werbende adlige Tolstoi, selbst damals 34, war bereits ein anerkannter Schriftsteller, lange bevor er Krieg und Frieden und Anna Karenina schrieb – und die junge Ehefrau wollte ihn fortan bei seiner Arbeit unterstützen und ihm »dienen«.
Sie begann an seiner Seite ein neues Tagebuch, das sie ein halbes Jahrhundert hindurch weiterführte – parallel zu dem ihres Mannes, der ebenfalls ausführlich das gemeinsame Leben protokollierte. Beide Tagebücher sind ediert. Die seinen umfassen die Jahre von 1874 bis 1910, ihre die von 1862 bis 1910. Nicht selten werden dieselben Eheszenen aus unterschiedlicher Perspektive geschildert: Das erübrigt im Grunde jeden Roman über diese Ehe.
Als sie vierzig Jahre verheiratet waren, schrieb Sofja Tolstaja in ihr Tagebuch: »Er nimmt von seiner Umgebung nur das, was seinem Talent, seiner Arbeit dienen kann. Alles andere weist er ab. Von mir zum Beispiel nimmt er meine Arbeit des Abschreibens, meine Sorge um sein leibliches Wohl, meinen Körper …« Und sie klagt: »Mein ganzes geistiges Leben ist für ihn ohne Interesse, und er hat keine Verwendung dafür – denn er hat sich niemals die Mühe gemacht, es zu verstehen.« Sie zieht ein bitteres Fazit: »Es tut mir schrecklich weh – und dennoch verehrt die Welt einen solchen Mann.«
In seinen literarischen Texten hat Tolstoi mit autobiographischen Details nicht gespart, häufig zum Verdruss seiner Ehefrau. Und so ist ihr spät publizierter Roman Eine Frage der Schuld (deutsch in einer schönen, sorgfältig edierten Ausgabe bei Manesse) eine verzweifelte Reaktion und eine unverblümte Antwort auf einen der bekanntesten Texte Tolstois, auf die furiose und verstörende Kreutzersonate. Die Erzählung entstand 1889, nach 27 Ehejahren, und war Wutschrei und Selbstanklage gleichermaßen – dargeboten als fiktive Beichte eines Mannes, der zum Mörder seiner eigenen Frau geworden ist.
Der Protagonist der Kreutzersonate, der die Mutter seiner fünf Kinder aus wahnhafter Eifersucht erdolcht hat, zeigt in seiner Beichte ein Frauenbild, das zur Zeit der Niederschrift auch in der russischen Gesellschaft obsolet war. Einer Ehefrau, so spricht dieser Psodnyschew, sollte allein das Wohl der Familie am Herzen liegen, sie müsse sich versagen, im Manne die »stärkste, schlimmste und hartnäckigste Leidenschaft« hervorzulocken, nämlich »die fleischliche, die sexuelle Liebe«.
Die Kreutzersonate erregte bei den Zeitgenossen ungeheures Aufsehen. Die Erzählung, so rückwärtsgewandt und frauenfeindlich sie sich in Wahrheit gebärdet, wirkte radikal – für die damalige Zeit waren intime Vorgänge ungewohnt deutlich benannt. Auch die Ambivalenz irritierte nicht wenige: Psodnyschew nämlich klagt sich selbst als Wüstling an, als einer, der seiner jungen Frau das »Laster erst angewöhnen« musste, »um einen Genuss davon zu haben«, und der später vor Eifersucht vergeht. Schuld aber sei das lockende Weib – und eine Gesellschaft, die das »die Sinnlichkeit geradezu herausfordernde Zurschaustellen und Schmücken des eigenen Körpers« gestatte.
Es wären diese Ansichten wohl als literarische Zuspitzung und Rollenprosa durchgegangen, hätte Tolstoi sich nicht in einem Nachwort auf die Seite seines mörderischen Helden geschlagen. »Man soll weder vor noch in der Ehe ein ausschweifendes Leben führen, man soll die Zeugung von Kindern nicht künstlich unterbinden«, forderte der Dichter, und schon gar nicht solle man »eine Liebesvereinigung über alles stellen«.
Sofja Tolstaja musste die Kreutzersonate als Angriff auf sich verstehen. Zu deutlich waren die Parallelen zur eigenen Ehe. Wenn der Held der Erzählung, der vor der Ehe »mit mehreren Frauen verkehrt« hat und der der unerfahrenen Braut kurz vor der Hochzeit seine intimen Tagebücher zu lesen gibt (um damit, wie er glaubt, einen Schlussstrich unter sein ausschweifendes Leben zu ziehen), wenn er sich ein »für immer verdorbenes Geschöpf« nennt und sich vornimmt, »nach der Trauung keine andere Frau mehr anzusehen«, so kannte sie das alles nur zu gut.
Sie kannte auch die Folgen. Sie hat am eigenen Leib erfahren müssen, wie der Prediger der Enthaltsamkeit sich selbst Lügen strafte, indem Tolstoi, der erklärte Verhütungsgegner, mit ihr dreizehn Kinder zeugte (drei Fehlgeburten nicht mitgezählt). Übrigens befürchtete Tolstoi im hohen Alter, spätere Biographen könnten seine sexuellen Ausschweifungen vor der Ehe und die anhaltende Begehrlichkeit während der Ehe unterschlagen. Im Tagebuch klagt sich der Familienvater im Juli 1908 rückblickend an: Zwar sei er seiner Frau niemals untreu gewesen, dafür aber »von gemeiner, verbrecherischer Gier nun auf mein Weib beherrscht«. Und er schreibt: »Davon wird, wie üblich, nichts in den Biographien stehen. Doch dies ist sehr wichtig, und zwar deswegen, weil es das zumindest von mir am meisten erkannte Laster darstellt, das mehr als andere zur Besinnung zwingt.«
Viele bisher unbekannte Texte von Sofja Tolstaja kreisen um dasselbe Thema, um Tolstois Vergangenheit, »all das Unzüchtige«, von dem sie wenige Tage vor der Hochzeit aus seinen Tagebüchern erfuhr (»mein ganzes Leben litt ich darunter«). Es ist von »qualvollen Schmerzen und unerträglicher Scham« in der Hochzeitsnacht die Rede. Die Zeit, in der Tolstoi seine großen Romane schrieb, deren Entstehung seine Frau voll Enthusiasmus begleitete, war die glücklichste ihrer Ehe. Die Auseinandersetzungen und gegenseitigen Verletzungen flammten erst zwei Jahrzehnte später richtig auf, als der berühmte Dichter von der Literatur kaum noch etwas wissen wollte und religiös geprägte Schriften zu veröffentlichen begann.
Die Ehefrau konnte und wollte ihm da nicht folgen und begann, jene Jünger zu hassen, die sich um ihren Gatten versammelten und ihn umschmeichelten. In ihrer Angst, dass er sie verlassen könne, malte sie sich aus, »wie sinnlos und leer mein Leben ohne ihn wäre«. Gleichzeitig wurden ihre Attacken immer heftiger. Sie las heimlich in seinen Tagebüchern (wie auch er in ihren), fürchtete, dass er ihr und der Familie testamentarisch die Rechte an seinem Werk entziehen könnte. Und notierte: »Wer besiegt wen? Wenn man bedenkt, dass dieser verbissene Kampf zwischen zwei Menschen stattfindet, die einander einst so glühend geliebt haben!« Tolstoi beklagt in seinem letzten Jahr, dass sie nicht aufhöre, »mich zu kontrollieren, zu überwachen«, sie wühle in seinen Papieren: »Mit ihr zu leben ist unmöglich.«
Das Sterbejahr 1910 ist nicht allein durch das Ehepaar akribisch protokolliert worden, sondern von vielen Zeugen »gleichsam gegengezeichnet« (so Stefan Zweig). Im Hause Tolstoi scheint nahezu jeder Notizen angefertigt zu haben: die Kinder, der Sekretär, der Arzt, Freunde und gelegentliche Besucher. Aus diesem Fundus hat sich übrigens die Tochter Sascha bedient: Schon 1923 erschien ihr Erinnerungsbuch Tolstois Flucht und Tod mit Auszügen aus den »Briefen und Tagebüchern von Leo Tolstoi, dessen Gattin, seines Arztes und seiner Freunde«.
Anders der Romanautor Parini: Statt ebenfalls Dokumente für sich sprechen zu lassen, wollte er als Romancier glänzen und zugleich eine Filmvorlage liefern. So ergibt sich zwar ein plastisches Bild der Ehetragödie, aber kitschige Formulierungen beschädigen die im Nachwort betonte Nähe zu den Quellen. So wenn der Autor Sofja Tolstaja über ihren Mann mit diesen Worten sprechen lässt: »Er hob das feurige Schwert der Liebe und nahm mich.«
Die Geschichte dieser Frau an der Seite eines bewunderten, geliebten, gehassten und wieder geliebten großen Schriftstellers ist zugleich die Tragödie einer verkannten und sich selbst zeitlebens unterschätzenden Dichterin. »Meine Werke betrachtete ich stets mit einer gewissen herablassenden Ironie und sah in dieser meiner Beschäftigung Vorwitz«, schrieb sie drei Jahre nach Tolstois Tod in ihren knappen Memoiren, die 1921, zwei Jahre nach ihrem Tod, in einer russischen Zeitschrift erschienen. Doch nicht nur als Autobiographin und Diaristin, auch als Briefautorin stand sie ihrem Mann kaum nach. Die Briefe, die die Tolstois sich über Jahrzehnte hinweg schrieben, gehören ebenfalls zu den großartigen Dokumenten dieser Ehe.
Die Witwe nutzte seine Briefe später als Beleg dafür, dass die gegenseitige Liebe trotz aller zerstörerischen und selbstzerstörerischen Krisen bis zum Ende fortwährte: Sie selbst gab 1913 eine Auswahl heraus, was die öffentliche Wahrnehmung ihrer Person tatsächlich positiv beeinflusste. Der russische Tolstoi-Biograph Viktor Schklowski resümiert: »Wenn wir Briefe Sofja Andrejewnas an Tolstoi lesen, wird ersichtlich, dass sie ihren Gatten liebte und sogar auf ihre Art zu behüten suchte. Und trotzdem war das, was sich im Hause abspielte, entsetzlich.«
Ihre eigenen Briefe stellte Tolstaja ebenfalls druckfertig zusammen, versah sie sogar mit Anmerkungen, traute sich dann aber nicht, das Konvolut zu veröffentlichen – so wenig wie ihren Roman. Erst 1936 erschien in Russland eine Auswahl aus den rund 660 erhaltenen Briefen an ihren Mann. Dessen Briefe an sie, 840 an der Zahl, wurden 1938 in einem eigenen Band der gesammelten Werke Tolstois publiziert. Im Jahr 2010 erschien im Insel Verlag auf Deutsch eine gemeinsame Edition der Briefe von beiden unter dem Titel Eine Ehe in Briefen, ausgewählt und übersetzt von den Autorinnen der Tolstaja-Biografie. Es gibt wohl kaum eine Schriftstellerehe, die von Olga und Arthur Schnitzler vielleicht ausgenommen, die so gut dokumentiert ist, über die es derart viele schriftliche Zeugnisse gibt.
Noch ein halbes Jahr vor seiner Flucht ließ Tolstoi einen Brief mit den Worten enden: »Lebe wohl, meine liebe, alte Frau. Ich küsse Dich. Ich hoffe auf ein Wiedersehen.« Und im Oktober 1910: »Ich danke Dir für Dein getreues, achtundvierzig Jahre langes Leben mit mir, und ich bitte Dich, mir alles zu verzeihen, womit ich mich vor dir schuldig gemacht habe, ebenso wie ich auch Dir vom ganzen Herzen alles vergebe, womit Du Dich vor mir schuldig gemacht haben könntest.« Ein ambivalentes Fazit.
Wie anders die Antwort der Gattin auf den endgültigen Abschiedsbrief ihres Mannes. Verzweifelt bat sie ihn um Rückkehr: »Ljowotschka, Freund meines ganzen Lebens, ich werde alles, alles tun, was Du willst, jeglichem Luxus gänzlich entsagen; ich werde mit Deinen Freunden gut umgehen, ich werde mich ärztlich behandeln lassen, ich werde sanft sein.« Aber sie ahnte, dass es zu spät war, und schloss: »Nun lebe wohl, lebe wohl, vielleicht für immer.«
KOPFSPRÜNGE IN DIE EINSAMKEIT
ANDRÉ GIDE
Im Leben des französischen Schriftstellere André Gide gab es vier Leidenschaften: das Klavier, die Knaben, das Reisen und das Tagebuch. Alles andere waren Aufgaben aus Pflicht oder Neugier, allenfalls aus einer gewissen Neigung: Ehe, Vaterschaft, das politische Engagement, ja, selbst das literarische Werk außerhalb des Journals. Er hielt sich von den politischen Diskussionen und Kämpfen seiner Zeit nicht fern, zählte aber seine entsprechenden Schriften nicht zum literarischen Werk. Er war verheiratet, zeugte aber mit einer anderen Frau ein Kind und huldigte der Knabenliebe der alten Griechen, die er am liebsten zum Erziehungsideal erhoben hätte. Er war Nobelpreisträger, Naturbeobachter, Leser und Chronist.
Am Klavier brachte er es schon als Kind zu einiger Meisterschaft. Und zeitlebens sollte ihn der Gedanke nicht verlassen, dass ein Virtuose aus ihm hätte werden können, wenn er nur früh genug den richtigen Lehrer gefunden hätte. Zeitlebens hat er gespielt, geübt, oft stundenlang. Er suchte Perfektion; stümperhafte Darbietungen stießen ihn ebenso ab wie eine zur Schau gestellte Brillanz, die sich selbst und nicht die Musik in den Vordergrund rückte.
Das Tagebuch gab ihm, wie er schrieb, die Möglichkeit, mit sich selbst zu plaudern, »mich auf meine Seite zu stellen«, treuer Begleiter durch ein langes Leben. In welchem Alter Gide die ersten Notizen machte, ist unbekannt. Offiziell begann er sein Tagebuch im Jahr 1889, im Alter von zwanzig Jahren. Er hat aber auch schon davor ein Tagebuch geführt; einiges davon hat er später vernichtet, anderes ist in seinen literarischen Erstling eingeflossen, die 1891 publizierten Hefte des André Walter. Manche Seiten sind laut eigener Auskunft »wortwörtlich« aus den Jugendtagebüchern übernommen. Sechs Jahrzehnte umfasst der Korpus des von ihm für die Öffentlichkeit bestimmten Journals. Die letzten Eintragungen stammen vom Sommer 1949; damals notierte der Endsiebziger mit bezwingender Altersironie: »An gewissen Tagen scheint es mir, als könnte ich, hätte ich nur eine gute Feder, gute Tinte und gutes Papier bei der Hand, ohne Mühe ein Meisterwerk schreiben.« Es folgen noch ein paar kurze Eintragungen, dann – ein halbes Jahr danach, im Januar 1950 – eine Art Postskriptum samt Unterschrift: Er, Gide, glaube, dass die letzten Notate den Abschluss des Tagebuchs bilden. Damit ist gemeint: den Abschluss eines lebensbegleitenden Diariums – und den Abschluss des literarischen Werks überhaupt. Der letzte Teil des Tagebuchs erschien in Frankreich noch im selben Jahr, mithin – wie auch die vorausgegangenen Tagebuchbände – zu Lebzeiten des Autors, der am 19. Februar 1951 in seiner Geburtsstadt starb und in Cuverville beigesetzt wurde, jenem Landsitz im Pays de Caux in der Normandie, der sein Refugium war und über all die Jahre hin als Gegenpol zu Paris und der übrigen Welt im Tagebuch regelmäßig auftaucht. André Gide, am 22. November 1869 in Paris geboren, wurde 81 Jahre alt.
Von dem frühen Vorsatz Gides, »täglich einige Zeilen zu schreiben«, war es nur ein kleiner Schritt zur ersten grundsätzlichen Bekundung des Scheiterns: »Weiße Blätter seit über einem Monat. Von mir zu sprechen langweilt mich; ein Tagebuch ist nützlich bei bewussten, gewollten und schwierigen moralischen Entwicklungen. Man will wissen, wie man dran ist. Was ich aber jetzt sagen könnte, wäre nur ein Wiederkäuen meiner selbst.« Aber natürlich schrieb er weiter. Gides Tagebuch lebt aus und in seinen Widersprüchen. Ungeduld, ja Verzweiflung packte ihn häufig, wenn er Teile wiederliest oder – noch in der Anfangsphase im Jahr 1893 – sogar noch einmal alles bis dahin Geschriebene. Er könne nur Hochmut entdecken und empfinde »unbeschreiblichen Widerwillen« und verspürt den Wunsch, sich überhaupt nicht mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Er glaubt zu erkennen: »Der Wunsch, diese Tagebuchseiten gut zu schreiben, nimmt ihnen jegliches Verdienst, selbst das der Aufrichtigkeit. Da sie an keiner Stelle gut genug geschrieben sind, um literarischen Wert zu haben, bedeuten sie nichts mehr; schließlich spekulieren sie alle auf Ruhm, auf künftige Größe, die sie interessant machen würde. Das ist zutiefst verächtlich.« Folgt eine Anmerkung, ein neun Jahre später verfasster Zusatz: »Mittlerweile habe ich dieses erste Tagebuch fast vollständig verbrannt.«
Viel gelitten, viel genossen
Gide nahm sein Tagebuch überaus wichtig und versuchte von Anfang an, es in eine Form zu bringen, die vor den kritischen Augen der Öffentlichkeit standhalten könnte. Ob Literatur oder nicht: gelungen sollte das Geschriebene sein. Bisweilen aber versuchte sich Gide ganz entspannt zu geben, sein Tagebuch einfach zu genießen: »Ich empfinde von neuem das größte Vergnügen – und zwar ganz gleich, wie – in dieses Heft zu schreiben. Ich sehne mich schon, während aller Beschäftigung des Tages, nach dem Augenblick, wo ich mit ihm allein bin«. So 1905.
Im Jahr darauf fand er »keinerlei Geschmack mehr an diesem Tagebuch«. Mitten im Ersten Weltkrieg dann wieder – Gide musste nicht an die Front – war ihm das Tagebuch Stütze und Antrieb: »Täglich in dieses Heft schreiben: Gute Disziplin, die mir stets gutgetan hat.«
Nicht viel anders im Zweiten Weltkrieg. Im Februar 1943 las sich Gide durch, was er von Anfang 1942 bis zu diesem Zeitpunkt, wo er sich in Tunis aufhielt, in seinem Tagebuch notiert hat. Wieder einmal gab er sich entmutigt. Er könne sich nicht dazu beglückwünschen, dass er sich gezwungen habe, jeden Tag etwas einzutragen. Aber: »Dieses letzte Heft wurde mir zum Rettungsring, an den sich der Schiffbrüchige klammert. Man fühlt diese tägliche Anstrengung, um sich über Wasser zu halten.«
In dem von deutschen Truppen besetzten Tunis lebte Gide monatelang völlig zurückgezogen. Dennoch fiel ein Tagebuchheft, das zum Abschreiben außer Haus gegeben war, den Besatzungsbehörden in die Hände. Man fand anscheinend nur wenig zu beanstanden, wie Gide, der weit über Siebzigjährige, fast verschämt durchblicken ließ. Er sei abgeschnitten von fast allem: der französischen Heimat, den Freunden. Seine Frau lebte nicht mehr. Und er hatte kein Klavier zur Verfügung. Freilich ist ihm auch die Vorstellung, belauscht zu werden, unerträglich. Nur wenn ihn niemand hören könnte, würde er sich sofort wieder ans Üben machen, »und zwar sicher gleich stundenlang«. Er glaubte, kaum Mühe zu haben, sich oft gespielte Stücke von Bach und Chopin wieder ins Gedächtnis zu rufen.
In den vierziger Jahren war längst bekannt und anerkannt, dass hier ein wichtiges Tagebuchwerk in Arbeit war. In Auszügen hatte es der Autor der literarischen Öffentlichkeit präsentiert. Gide konnte sein Journal in dem Bewusstsein weiterführen, Beachtung und Wertschätzung erfahren zu haben. Der Umstand, dass immer wieder Passagen aus dem Tagebuch veröffentlicht worden waren, zum Teil relativ rasch nach der Niederschrift (in der Zeitschrift »Nouvelle Revue Française«), wirkte auf das Schreiben zurück. Gide war sich dessen bewusst. Zum Teil hatte es kuriose Folgen: So meldeten sich Personen, die ihm lange zuvor begegnet waren und nun in einer Veröffentlichung erfreut auf ihren Namen gestoßen waren. Im Tagebuch Gides aufzutauchen dürfte für die Prominenz des französischen Geisteslebens eine ähnliche Rolle gespielt haben wie heutzutage ein Talkshow-Auftritt. Andere Reaktionen auf sein Tagebuch blieben Gide vorenthalten, etwa wenn Thomas Mann im seinem Tagebuch hoch erfreut festhielt, eines seiner Bücher sei im Journal des Franzosen gelobt worden.
Ein geheimes Tagebuch war das, was Gide betrieb, nicht mehr. Das hat den Charakter dieses Werks entscheidend geprägt. Anfang der dreißiger Jahre notierte er, dass die Aussicht auf eine Veröffentlichung dieses Tagebuchs oder von Teilen davon dessen Sinn verfälscht habe. Sein Heft sei schon lange nicht mehr der intime Vertraute, der es eigentlich sein sollte. Eine erste Buchausgabe, die die Tagebücher seit 1889 umfasste, erschien 1939 in Paris. Klaus Mann in einer Würdigung dieser Ausgabe: »Tausende von Reflexionen, Fragen, Beobachtungen, Erkenntnissen, Klagen und Preisungen ergeben, in ihrer Summe, nicht nur das Bild des Menschen, der sich da immer strebend bemüht und viel gedacht, viel gelitten, viel genossen hat; sie wachsen über das Persönliche weit hinaus.«
Auch im amerikanischen Exil las man die Tagebücher. Ein zweiter Band, der nur knapp vier Jahre umfasste, war 1944 zugleich in Algier und New York erschienen. Nicht nur Thomas Mann, auch Bertolt Brecht nahm es zur Hand und schrieb darüber: »Ein verwirrendes, gespenstisches, reizvolles Ineinander der Sphären und Notate, über Kontinente hinweg, von Tagebuch zu Tagebuch, umschlossen von der Allgegenwart des Zweiten Weltkriegs.«
Der einzig Blinde
Jetzt ist eine andere Geschichte zu erzählen, eine sehr private Geschichte, eine Geschichte, die das Journal bis in feinste Verästelungen prägt, aber in ihm selbst nicht vorkommt – und wenn, dann nur als Auslassung, als Lücke, als das »verborgende Zentrum«, von dem Ludwig Hohl sprach. Es ist die Geschichte von André Gide und seiner Frau Madeleine. Als Geheimnis, um das herum das Tagebuch geschrieben ist, in Anspielungen und Andeutungen allenfalls ist diese Geschichte präsent, von der Gide selbst nach dem Tod seiner Frau gesagt hat, es handele sich um eine »dauernde, latente, heimliche, wesentliche Tragödie, die sich nur an ganz wenigen Ereignissen ablesen ließ; sich nie offen enthüllte«.
Der privateste Bereich Gides ist ein blinder Fleck im Tagebuch, musste es wohl sein, solange die Ehefrau lebte, und das Tagebuch für die Öffentlichkeit bestimmt war. Um Madeleine Gide zu schützen, sparte der Mann, der Lüge und Feigheit hasste, sein Sexualleben im Tagebuch weitgehend aus. Gleichzeitig aber bereitete er Schriften vor, in denen von Homosexualität allgemein und der eigenen Erfahrung in für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, geradezu provozierend offener Weise die Rede ist.
Eine dieser Schriften ist der autobiographische Text Stirb und Werde, der 1920 /21 zunächst als Privatdruck, fünf Jahre später – Gide ist Mitte fünfzig – auch in einer regulären Ausgabe erschien. Geschildert wird Kindheit und Jugend, die Bekanntschaft mit der fast drei Jahre älteren Cousine Madeleine und seine erste Reise nach Nordafrika 1893. Geschildert werden auch die hetero- und homosexuellen Erlebnisse auf dieser Reise. Gide ließ keinen Zweifel daran, welcher Spielart er, der bis dahin »jungfräulich« gelebt habe, den Vorzug gab. Er bekannte sich als praktizierender Homosexueller. Gleichwohl hat er seine Autobiografie vor der Jahrhundertwende, 1895, mit dem Tod der Mutter und der anschließenden Verlobung mit Madeleine enden lassen.
Ob und wann seine Frau Klarheit über seine sexuellen Vorlieben gewonnen hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Von Interesse ist die Geschichte dieser Ehe auch deswegen, weil sich beispielhaft zeigt, zu welchen Schwierigkeiten und Ausweichmanövern es führen kann, wenn ein Tagebuchschreiber ein wesentliches Moment seines Lebens ausblendet. So hervorragende Miniaturen und Kurzporträts, regelrechte kleine Charakterstudien es in seinem Tagebuch gibt – das Bild von Madeleine oder »Ern.«, wie sie dort genannt wird, bleibt unscharf. Selbst dann, wenn es um weniger problematische Seiten des gemeinsamen Lebens geht. Es muss in den entscheidenden Fragen eine schweigsame Ehe gewesen sein, und so mochte sich Gide über die Gefühle seiner Frau Illusionen machen. Ganz gelang ihm das wohl nicht, schon gar nicht mehr nach ihrem Tod im Jahr 1938.
Knapp ein Jahr danach schrieb er einen kurzen autobiographischen Rückblick auf die Ehe, und dort heißt es: »Heute glaube ich, dass der Blindere von uns beiden, der einzig Blinde, wohl ich selbst war. Aber abgesehen davon, dass ich in dieser Blindheit einen Vorteil spürte, der es mir erlaubte, meinem Vergnügen ohne allzu viele Gewissensbisse nachzugehen, zumal Herz und Geist unbeteiligt blieben, kam es mir auch gar nicht so vor, als wäre ich ihr untreu, wenn ich fern von ihr eine sinnliche Befriedigung suchte, die ich von ihr nicht zu erbitten verstand.«
Die er nicht zu erbitten verstand – oder gar nicht zu erbitten gedachte? Warum der junge Gide seine Cousine unbedingt heiraten wollte, nachdem sie ihm einen früheren Antrag schon abgelehnt und er selbst seine afrikanischen Erfahrungen gemacht hatte, vermochte er niemals schlüssig zu erklären. In Stirb und Werde heißt es, dass er nach dem Tod der Mutter einen Halt nur noch in der Liebe zu Madeleine zu finden glaubte und damals meinte, sich ihr »ungeteilt« und »ohne jeden Vorbehalt« geben zu können. Madeleine selbst sah das skeptischer, wie man aus ihrem Jugendtagebuch weiß, das freilich nur anderthalb Jahre umfasst. Vier Jahre vor der Eheschließung mit Gide beantwortete sie sich selbst die Frage, ob sie ihn liebe: »Nein – bei aller Aufrichtigkeit mir selbst gegenüber – Liebe schließt, scheint mir, Begierde ein – irgend etwas Glühendes, Leidenschaftliches, das zwischen uns nicht vorhanden ist (weder bei ihm noch bei mir).« So schrieb eine junge Frau mit Anfang zwanzig. Arglos war sie also nicht. Madeleine hatte ein traumatisches Erlebnis hinter sich: Ihre Mutter war einst aus dem Haus ausgezogen, nachdem sie zuvor den Ehemann, anscheinend wenig dezent, betrogen hatte. Der Vater war kurze Zeit danach gestorben, und die Tochter vergötterte ihn immer noch. Wer sich »die höchste Reinheit« erträume, so hat sie wenige Tage vor dem Hinweis auf die mangelnde Begierde notiert, der dürfe sein Herz mit keiner »irdischen Liebe« füllen.
Im Tagebuch jedenfalls glänzt die Ehefrau durch Abwesenheit. Selbst auf der Hochzeitsreise nach Tunesien und Algerien ist sie nur Statistin – und wenn die Anzeichen nicht trügen, dann nicht allein im Tagebuch. Erst mitten im Ersten Weltkrieg, im Sommer 1916, ließ Gide auf den Tagebuchseiten durchblicken, dass bei ihm daheim alles andere als Friede herrsche. Zunächst ist nur von zerrissenen Blättern des Journals die Rede, dann folgt eine mehrmonatige Pause, und erst im September werden die Aufzeichnungen fortgesetzt, in bis dahin ungewohnter Offenheit, was das Verhältnis zur Ehefrau angeht: »Ich nehme in einem neuen Heft das Tagebuch wieder auf, das ich im vorigen Juni abgebrochen habe. Die letzten Seiten hatte ich zerrissen. Sie spiegelten eine furchtbare Krise wider, in die Ern. verwickelt war: oder genauer, deren Ursache Ern. war. Ich hatte diese Seiten in einer Art Verzweiflung geschrieben, und da sie eigentlich an sie gerichtet waren, habe ich sie auf ihre Bitte hin zerrissen, nachdem sie sie gelesen hatte. Sie hatte mich zwar aus Zartgefühl nicht direkt darum gebeten, aber ich merkte ihr so deutlich an, wie erleichternd es für sie wäre, dass ich es ihr sogleich vorschlug. Und bestimmt ist sie mir dafür auch dankbar gewesen.«
Trotzdem würden ihm diese Seiten jetzt fehlen: »Weniger deshalb, weil ich meine, noch nie etwas Vergleichbares geschrieben zu haben, noch weil sie mir aus einem krankhaften Zustand hätten heraushelfen können, dessen aufrichtiger Spiegel sie waren und in den ich nur allzu leicht wieder zurückfallen könnte, sondern weil dieser Vernichtungsakt mein Tagebuch abrupt abgebrochen hat, so dass ich, dieser Stütze beraubt, mich seither in einem furchtbaren geistigen Durcheinander befinde.«
Die Biographen Gides gehen davon aus, dass diese Krise damit zu tun hat, dass ein enger Freund und langjähriger Reisegefährte Gides, Henri Gheon mit Namen, zum Katholizismus übertrat und seinem bisherigen Lebenswandel abschwor. Ein Brief Gheons muss Madeleine in die Hände gefallen sein, so dass sie sich spätestens vom Sommer 1916 an keine Illusionen mehr machen konnte. Sie zog sich ganz nach Cuverville, ganz in sich selbst zurück. Ein späterer Rückblick Gheons auf die gemeinsamen wilden Jahre mit Gide ließ das Ausmaß der Beziehung ahnen: »Wir gingen in kleine zweideutige Cafés, in denen Zuhälter und Dirnen verkehrten. Wir hatten Knaben bei uns, die jung und schön waren; sie verkauften Rauschgift oder waren vorbestraft … Die Gefahr erregte uns und keiner ließ den anderen allein. Ich glaube, Gide suchte in mir, was ihm am meisten fehlte: einen, der mitmachte; triebhaft, gesund, freimütig, und, wie ich gestehe, kühn genug, um die Begierden zu verwirklichen. Es war eine liederliche und beschämend verrückte Zeit.« Im selben Jahr 1916 wandte Gide sich immer stärker einem damals sechzehnjährigen Jungen zu, dem Sohn eines befreundeten Ehepaars. Als »M.« und »Michel« taucht er von 1917 an im Tagebuch auf. Als sei damit schon zu viel verraten, vollbringt Gide in den darauf folgenden Eintragungen ein interessantes Täuschungsmanöver. Er führt eine männliche Figur Fabrice ein, die einem jungen Mann, Michel, verfallen ist.
Aus dem Tagebuch wird so eine Erzählung. Der Ich-Erzähler: Gide. Doch ist unschwer zu mutmaßen, um wen es sich bei Fabrice handelt: eben auch um Gide. Häufig tauchte fortan im Tagebuch das Wort Glück auf, vom »grenzenlosen Taumel des Glücks« ist die Rede. Die von Gide lange kultivierte und mit ideologischem Eifer vertretene Trennung von Liebe und Begierde ließ sich offenbar nicht aufrechterhalten: Er konnte seine Liebe nicht mehr »ungeteilt« und »ohne jeden Vorbehalt« für Madeleine reservieren, und die Lust auf den jungen Mann war mehr als eine rein körperliche.
Die einzige Arche zerstört
Im Alter von 48 steuerte Gide auf die nächste Katastrophe zu, dieses Mal eine, die ihn zutiefst verwunden und bis zum Ende seines Lebens verfolgen wird: Ausgerechnet Madeleine fügte ihm eine narzisstische Kränkung zu, einen Verlust, der Gide lähmt und niederwirft. Im Sommer 1918 hatte er zusammen mit seinem Geliebten eine Reise nach England unternommen und zuvor im Tagebuch vermerkt, er verlasse Frankreich in einem Zustand »unaussprechlicher Angst«. Eine Vorahnung, dass er mit dieser Reise den Bogen überziehen wird? Nach der Rückkehr im Oktober quälte Gide plötzlich »Furcht vor dem Tod«. Kurz nach diesem Eintrag brach das Tagebuch ab, so scheint es, wenn man nur das öffentliche Journal zu Rate zieht. Zehn Jahre nach der Buchausgabe aber lieferte Gide einige damals unterdrückte Blätter nach und schrieb dazu: »In der von mir veranstalteten Ausgabe hört mein Journal Ende Oktober 1918 auf, um erst im Mai 1919 wieder anzufangen; hört fast sogleich wieder auf, um in ein neues Schweigen von fast einjähriger Dauer zu verfallen. Hier sollten, als Erklärung dieses langen Schweigens, die folgenden Seiten eingefügt werden.«
Die nachgereichten Tagebucheintragungen beginnen am Vorabend von Gides 49. Geburtstag und enthüllen, wie die Ehefrau auf die Reise nach England reagiert hatte: »Madeleine hat alle meine Briefe zerstört. Eben hat sie mir dieses Geständnis gemacht, das mich niederschlägt. Sie hat es, wie sie mir sagt, gleich nach meiner Abreise nach England getan. Oh, ich weiß wohl, dass sie unter meiner Abreise mit Marc furchtbar gelitten hat; musste sie sich aber an der Vergangenheit rächen? … Damit verschwindet mein Bestes, das nun mein Schlimmstes nicht mehr aufwiegen wird. Während mehr als dreißig Jahren hatte ich ihr (und ich tat es noch) mein Bestes übergeben, Tag für Tag, auch bei kürzester Abwesenheit. Ich fühle mich mit einem Schlag zugrunde gerichtet. Ich habe zu nichts mehr Mut. Ohne Anstrengung hätte ich mich umgebracht. Wäre dieser Verlust wenigstens noch irgendeinem Unglück, der Invasion, einem Brand zuzuschreiben … Aber dass sie das getan hat!« Ob sie denn nicht wusste, »dass sie so die einzige Arche zerstörte, wo später einmal, wie ich hoffte, mein Gedächtnis Zuflucht finden konnte? All mein Bestes hatte ich diesen Briefen anvertraut, mein Herz, meine Freuden, den Wechsel meiner Stimmungen, den Inhalt meiner Tage … Ich leide, als hätte sie unser Kind getötet. Oh, ich dulde nicht, dass man sie anklagt! Das ist nur die äußerste Spitze der Nadel. Die ganze Nacht habe ich gefühlt, wie sie sich in mein Herz bohrte.«
Dass Gide seine Briefe als das gemeinsame Kind dieser Ehe ansah, sollte fünf Jahre später noch einen neuen Unterton erhalten. Ein Urteil darüber, was schwerer wiegt, der Verlust der Briefe aus mehreren Jahrzehnten oder die darauf folgende Verstörung, die Gide zwanzig Jahre lang, bis zum Tod Madeleines im Jahre 1938, an den Tag legte, fällt schwer. Auch lässt sich der Wert der Briefe ebenso wenig einschätzen wie der des verlorenen Tagebuchs von Max Frisch, das die Liebe zu Ingeborg Bachmann zum Thema hatte und von der Dichterin gelesen und verbrannt worden ist. Ein Stück seiner Vergangenheit konnte Gide nun nicht mehr betreten – aber er konnte auch der Frage nicht länger ausweichen, ob die Grundlagen seines Lebens stimmten.
Dass er die Tragödie seiner Ehe dem Publikum zunächst vorenthielt, war eine Sache, doch wie sollte er verfahren, als die Buchausgabe anstand? Würde das Verschweigen und Auslassen nicht die Aufrichtigkeit des Journals insgesamt beeinträchtigen? Im April 1938, also nahezu zwanzig Jahre nach der ehelichen Katastrophe, erörterte Gide das Problem mit einer guten und langjährigen Freundin, Maria van Rysselberghe, der »petite dame«, wie er sie ihrer Körpergröße wegen nannte. Was er nicht wusste: Auch Maria von Rysselberghe schrieb regelmäßig ein Tagebuch, in dem sie alle Gespräche mit dem von ihr bewunderten Dichter getreulich notierte – und zwar seit November 1918, also zufällig genau zur Zeit des Dramas. Die Vernichtung der Briefe, aus der Gide anscheinend im Freundeskreis keinen Hehl gemacht hatte, bildet gewissermaßen den Ausgangspunkt dieses bis zum Tod von Gide geführten Paralleljournals, das oft gerade dann Auskunft gibt, wenn das Tagebuch des Dichters schwieg: Das Tagebuch der kleinen Dame wurde in den siebziger Jahren in Frankreich erstmals publiziert. Darin wird von jener Begegnung berichtet, in der Gide sich Rat erbat, wie er es mit den Madeleine betreffenden Stellen halten sollte. Auf seine Ehefrau musste er keine Rücksicht mehr nehmen, sie war kurz zuvor mit Anfang siebzig gestorben. Dennoch griff Gide äußerst bereitwillig den Vorschlag seiner alten Freundin auf, bestimmte Passagen über Madeleine auch weiterhin zurückzuhalten und sie mit Anmerkungen versehen als Privatdruck erscheinen zu lassen. Neu war die Idee nicht, Gide selbst hatte sie Jahre zuvor schon einmal geäußert, schon damals, Mitte der dreißiger Jahre, war es immer wieder um die Veröffentlichung seiner Tagebücher gegangen, die der Schriftsteller der »kleinen Dame« zu lesen gab, was diese wiederum in ihrem Journal festhielt.
Immer nur halb aufrichtig
Eines ist gewiss: Das Bild, das Gide von seiner Frau zeichnete, bleibt merkwürdig blass. Das Büchlein Et nunc manet in te kam schon bald nach Gides Tod an die Öffentlichkeit und wurde als Rechtfertigungsschrift verstanden, in der es mehr um ihn als um seine Frau geht.
Nachzutragen ist die andere private Geschichte, deren Ausblendung im Tagebuch der Jahre bis 1939 fast perfekt ist. Sie betrifft das Kind, das Gide zusammen mit Elisabeth van Rysselberghe hatte, der Tochter der »kleinen Dame«. Die junge Frau, die den Schriftsteller von Kindesbeinen an kannte, hatte sich ein Kind von ihm gewünscht, ohne sich an ihn binden zu wollen; für Gide war es die Chance, sich zu vergewissern, dass er zur Fortpflanzung in der Lage war. Jedenfalls ist das einer Äußerung zu entnehmen, die, geschrieben nach dem Tod seiner Frau, direkt auf die Vaterschaft Bezug nimmt: »Denn ich vermochte wohl andererseits zu beweisen, dass ich die Fähigkeit (ich spreche hier von der Zeugungsfähigkeit) besaß, aber eben unter der Bedingung, dass ich nichts Intellektuelles oder Gefühlsmäßiges einmischte.«
So heißt es in der Einleitung zu Et nunc manet in te. Der Ehefrau gegenüber war die Geburt der Tochter Catherine ein absolutes Tabu. Das Neugeborene wurde sogar als Adoptivkind ausgegeben, um die Spuren zu verwischen. Dennoch wussten einige Freunde Bescheid, und die Frage bleibt, ob dieses Geheimnis Gides Frau tatsächlich fünfzehn Jahre lang verborgen bleiben konnte, eine Frage, die sich Gide auch in seinem Rückblick nicht stellte, obgleich doch die Vermutung naheliegt, dass von allen Aspekten des der eigenen Frau gegenüber verborgenen Lebens dieser der gravierendste und kränkendste gewesen sein mochte – falls Madeleine je davon erfahren hat. Gides Tochter wurde im April 1923 geboren, der Vater weilte währenddessen mit einem Freund in Marokko. Als er nach seiner Rückkehr erfuhr, dass er eine Tochter gezeugt hatte, war er enttäuscht. Alles dies, auch die erste Begegnung zwischen Vater und Tochter, kennt man nur aus dem Tagebuch der kleinen Dame, in dem der neugierige Leser sogar erfährt, unter welchen Umständen das Kind gezeugt wurde. In den Tagebüchern Gides von alldem kein Wort. Die kleine Catherine taucht ganz nebenbei, gewissermaßen als Kind der Tochter von Freunden, erst 1926 im Journal auf – und ihr sind bis zum Tod von Madeleine Gide noch vier Erwähnungen gegönnt. Dass es gemeinsame Ausflüge an die See und Kinobesuche gab, unterschlägt das Journal ebenso wie den Tag, an dem sich Gide der Tochter, kurz nach ihrem dreizehnten Geburtstag, als Vater offenbarte. Später übrigens, als Madeleine nicht mehr am Leben war, adoptierte Gide Catherine und erklärte sie so offiziell zu seinem Kind. Im Tagebuch 1939–1949 ist dann häufiger und unbefangener von der jungen Frau die Rede.
Zu seiner verstorbenen Frau kehrte Gide immer wieder in Gedanken zurück, so am 9. September 1940, als er sich Klarheit darüber zu verschaffen suchte, ob die Bindung an Madeleine, ob die Ehe mit ihr ihn in seiner literarischen Laufbahn eher behindert oder befördert habe – eine unentschiedene Bilanz: »Ich bin in meinen Büchern mutiger gewesen als in meinem Leben, wo ich so manche Dinge respektierte, die vermutlich gar nicht so respektabel waren; und wo ich vom Urteil anderer zu viel Aufhebens machte. Was für ein guter Mentor wäre ich heute für den, der ich in meiner Jugend war! Wie gut verstünde ich es, das Äußerste aus mir herauszuholen! Wenn ich auf mich gehört hätte (das Ich von vorgestern auf das Ich von heute), hätte ich vier Reisen um die Welt gemacht und hätte nicht geheiratet.« Er zittere wie bei einer Gotteslästerung bei diesem Gedanken: »Weil ich nämlich trotz allem immer noch sehr verliebt in das geblieben bin, was mir den größten Zwang auferlegt hat, und nicht beschwören kann, ob nicht gerade dieser Zwang das Beste aus mir herausholte.«
Ein Schlüsselsatz, der für jedes Tagebuch gilt, steht in seiner Autobiographie Stirb und Werde: »Sosehr man sich auch um Wahrheit bemüht, die Beschreibung des eigenen Lebens bleibt immer nur halb aufrichtig: In Wirklichkeit ist alles viel verwickelter, als es dargestellt wird. Vielleicht kommt man im Roman der Wahrheit sogar näher.« Er sei nur in der Einsamkeit etwas wert, hat Gide schon früh zu erkennen geglaubt. Er könne nur zu gewissen Zeiten »höflich« gegenüber anderen sein, »Kopfsprünge in die Einsamkeit« seien ihm jeden Tag ebenso unentbehrlich wie der Schlaf bei Nacht. Dass Gide sich selbst in Gesellschaften zur Qual wurde, hat ihn bisweilen zu wortreichen Selbstkasteiungen getrieben. Er verstehe nicht recht, warum man ihn überhaupt einlade: Er sei – so notiert er 1915 – nicht berühmt genug, als dass es schmeichelhaft wäre, ihn bei sich zu sehen; seine Unterhaltung sei zum Verzweifeln trocken; man habe sich von ihm keinerlei Vorteil zu erwarten. Gleichzeitig sensibilisierte ihn dieses Unbehagen an seiner Rolle zu ungeheuer exakter Beobachtung und Selbstbeobachtung.
Trotz aller Selbstbezichtigung muss Gide jedoch ein Genie der Freundschaft gewesen sein, Legende ist die Zahl der Kollegen, mit denen er korrespondierte, dinierte und debattierte. Nicht nur Schriftsteller zählten zu seinem großen Bekannten- und Vertrautenkreis. Über die Begegnungen mit ihnen aber schrieb er besonders gern, etwa über Paul Valéry und Marcel Proust. Valéry, heißt es, werde niemals die ganze Zuneigung ahnen, »deren ich bedarf, um seiner Unterhaltung ohne Ausbruch zuzuhören«. Er sei danach ganz erschlagen. »Gestern habe ich fast drei Stunden mit ihm verbracht. Nichts stand in meinem Geist nachher noch aufrecht.« Eine Notiz aus dem Mai 1921: »Gestern Abend wollte ich eben schlafen gehen, als es läutete. Es ist Prousts Chauffeur, der mich mitnehmen will, denn Proust fühlt sich ein wenig besser und lässt mir sagen, er könne mich empfangen, wenn es mich nicht stören würde zu kommen. Lange hatte ich Proust im Verdacht, er übertreibe seine Krankheit ein wenig, um seine Arbeit zu schützen (was mir völlig gerechtfertigt schien); aber gestern und schon neulich musste ich mich überzeugen, dass er wirklich sehr leidend ist. Er sagt, er liege stundenlang da, ohne auch nur den Kopf bewegen zu können; er bleibt den ganzen Tag und viele Tage hintereinander im Bett.« Proust bereue die »Unentschlossenheit«, die ihn bewogen habe, alle Grazie, alle Zärtlichkeit, allen Charme seiner homosexuellen Erfahrungen in den Schatten junger Mädchenblüte zu transponieren, um dem heterosexuellen Teil seines Buches Nahrung zu geben, so dass ihm für Sodome nur noch Groteskes und Gemeines geblieben sei. »Als ich ihn frage, ob er uns diesen Eros denn nie in jungen, schönen Gestalten darstellen werde, erwidert er zunächst, das, was ihn anziehe, sei fast nie die Schönheit, die seiner Meinung nach überhaupt wenig mit der Begierde zu tun habe – und die Jugend sei im übrigen das, was er noch am leichtesten transponieren könne.«
Zur Zeit des Ersten Weltkriegs, im Februar 1918, notierte sich Gide: »Offen gestanden interessieren mich politische Fragen nicht besonders.« Es sollte nicht sein letztes Wort bleiben. Schon die Beurteilung der Kriegsereignisse im Tagebuch zeigt einen wachen und originellen Blick – ohne nationale Scheuklappen. Doch es ist noch weit zu der Bemerkung vom Mai 1940: »Die soziale Frage! … Wäre ich zu Beginn meiner Laufbahn über diese Falle gestolpert, ich hätte nie etwas Wertvolles geschrieben.« Gides Flirt mit dem Kommunismus war heftig, aber kurz. Anfang der dreißiger Jahre verspürte er noch den Wunsch, seine Sympathien für Russland hinauszuschreien und lange genug zu leben, um Zeuge des Erfolgs »dieser gewaltigen Anstrengung zu werden«. Freilich blieb bei Gide stets ein Rest von Reserviertheit, und er verleugnete nicht ein Gefühl eigener Inkompetenz, was wirtschaftliche und politische Fragen betraf. Im Sommer 1936 reiste er in die Sowjetunion, hielt auf dem Roten Platz in Moskau – neben Stalin stehend – eine Rede auf den verstorbenen Gorki. Und kehrte ernüchtert nach Frankreich zurück. Nicht zuletzt der menschenverachtende Umgang mit Homosexuellen hatte ihm die Augen geöffnet. Für seine zwei Reiseberichte aus der Sowjetunion wurde er von denselben linken Kreisen befehdet, die zuvor für jede seiner Unterschriften dankbar gewesen waren. Später, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, erinnerte sich Gide überaus milde seiner Reisen, offenbar beeindruckt vom Kampf der Roten Armee gegen Hitler.
Für Gide war das Journal als Textform im gesamten Werk bestimmend, vom Erstling, den Heften des André Walter, bis hin zum fiktiven Tagebuch im Roman Die Falschmünzer. Darin ließ er sein Alter Ego, den Schriftsteller Edouard, Aufzeichnen über die Entstehung eines Romans mit ebendiesem Titel machen: ein vertracktes Spiel mit einem doppelten Boden. Außerdem publizierte Gide einen Teil seines realen Tagebuchs, der eigenen Notizen zur Entstehung der Falschmünzer, separat als Tagebuch der Falschmünzer – eine Idee, die Thomas Mann Jahre später für seinen Roman Doktor Faustus mit dem nachgelieferten Buch Die Entstehung des Doktor Faustus aufgreifen sollte. Dessen Sohn Klaus war der Erste, der sich fragte, ob das gewohnte Verhältnis von Tagebuch und literarischem Werk bei Gide nicht verkehrt werde: »Das Werk André Gides wäre fragmentarisch ohne die Tagebücher; ja, es ließe sich beinah sagen, dass die dramatischen Versuche, Erzählungen und Essays nur die Ergänzung, die plastische Illustration zum Journal bedeuten.«
Im April 1943 notierte André Gide in Tunis unter dem Eindruck nächtlicher Bombenangriffe: »Die Kunst ist aufgerufen, von der Erdoberfläche zu verschwinden; allmählich; vollständig. Sie war Sache einer Elite … Ich sehe eine Zeit kommen, in der aristokratische Kunst einem allgemeinen Wohlbefinden weicht; in der das Individuelle keine Existenzberechtigung mehr findet und sich seiner selbst schämt.«
Und dann nahm er die Noten von Bachs »Wohltemperiertem Klavier« zur Hand und las sie entzückt – ein Klavier stand ihm ja nicht zur Verfügung. Und er stellte fest: »Die Literatur vermochte nichts ähnlich Vollkommenes hervorzubringen.«
DER ANARCHIST UND DIE FRAUEN
ERICH MÜHSAM
Prügel stehen am Anfang dieses Lebens. Prügel stehen am Ende. Die einen beschreibt er selbst in seinem Tagebuch: die sadistischen Prügelstrafen des biederen und herrschsüchtigen Vaters. Über die anderen kann er nicht mehr berichten: Es sind Schläge im KZ Oranienburg im Juli 1934, gezielt und mit tödlicher Wut verabreicht von SS-Schergen.
Dazwischen ein wildes, hedonistisches, oft genug bitteres Leben: Als überzeugter Anarchist und kurzzeitiger Kommunist, als einer der Köpfe der Münchner Räterepublik und eines der ersten prominenten Nazi-Mordopfer ist Erich Mühsam in die Geschichte eingegangen.
Der 1878 geborene jüdische Apothekersohn war zugleich Revolutionär und Lyriker, ein Bohemien und Verächter aller Doppelmoral, er war politischer Häftling und belächelter Sonderling, ein mitreißender Redner und Frauenverehrer, leidenschaftlicher Liebhaber und früher Feminist, ein Mann mit ausgeprägtem Helfersyndrom – fast ständig in Geldnot und von bemerkenswerter Großzügigkeit gegenüber Freunden und jungen Damen.
Und er war ein so begnadeter wie besessener Chronist seiner selbst und seiner Zeit: fünfzehn Jahre lang, von August 1910 bis Dezember 1924, hielt er in 42 Schreibheften fest, was er erlebt und provoziert, was er gesehen und gehört hat – bis ins intime Detail, rücksichtslos gegen sich selbst und andere, anschaulich und druckreif verfasst in einer fließend-flüchtigen Handschrift. Mitreißende Tagebücher, die sich mit den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts messen können und bisher weitgehend unbekannt waren.
»Ob sich in 80 oder 100 Jahren mal jemand findet, der meine Tagebücher der öffentlichen Mitteilung für wert halten und herausgeben wird, kann ich nicht wissen«, schrieb Mühsam im Oktober 1910. »Niemand, der aus dem Tagesgeschehen und -Erleben heraus Notizen schreibt, kann deren Kulturdauer ermessen.« Gut 100 Jahre später wurde von einem mutigen kleinen Verlag eine Gesamtausgabe der Tagebücher gestartet. Bislang war nur eine kleine Auswahl im Taschenbuchformat auf dem Markt.
Als Mühsam am 22. August 1910, mit Anfang dreißig, während eines von der Familie finanzierten Kuraufenthalts in der Schweiz die ersten Sätze in einem frisch erworbenen Schreibheft notierte, hatte er schon manchen Konflikt mit der Staatsmacht hinter sich. So wurde er 1903 in Berlin als Agitator unter Polizeiaufsicht gestellt und drei Jahre später wegen eines Flugblatts verurteilt, zu einer – wiederum vom Vater bezahlten – empfindlichen Geldstrafe. Anfang des Jahres 1910 war er mehrere Wochen lang in Untersuchungshaft, wurde aber schließlich freigesprochen.
Nun saß er also im Sanatorium in Château d’Oex und haderte mit sich. Was kann er? Wo will er hin? Er hat Gedichte veröffentlicht, aber bislang nicht viel Anerkennung gefunden. Sein Theaterstück will keine Bühne aufführen. »Kurz, ich kann anfassen, was ich will – nichts will mir glücken! Es ist, als ob an meiner Hand von Natur aus Pech klebte. Ich muss gradezu mit dem linken Fuß zuerst aus dem Mutterleibe gestiegen sein. Denn am Ende habe ich doch alles: Talent, Fleiß, Intelligenz und bin ein leidlich netter Mensch.« Er musste es sich selber sagen, denn von daheim hatte er wenig Zuwendung erhalten.
Der Vater hielt den Sprössling für gründlich missraten. Als der Abgeordnete der Lübecker Bürgerschaft seinen 72. Geburtstag feierte, weilte Sohn Erich noch in der Schweiz und dachte an die Prügel, »mit denen alles, was an natürlicher Regung in mir war, herausgeprügelt werden sollte«. Er erinnerte sich daran, wie er Bücher lesen wollte, aber nicht durfte, wie er ein wenig Geld erschwindelte, um sie sich heimlich zu kaufen – und ihm wegen der »Unterschlagung« eine dreifache Tracht Prügel verabreicht wurde. An drei Tagen hintereinander hatte er sich »zum Empfang der Strafe zu melden«. Etwas »Haarsträubenderes an viehischer Grausamkeit« sei wohl gegenüber einem 12- bis 13-Jährigen nie »ausgesonnen worden«, notierte er. Auch eine Ohrfeige, die ihm Jahre später sein Vater verabreichte, als er mit achtzehn in den Ferien einmal von einem Konzert verspätet heimkam, »brennt mir heute noch im Gesicht«. Bitteres Fazit der über Seiten gehenden Abrechnung mit dem Tyrannen: »Die einzige Möglichkeit, dass ich leben könnte, wäre, wenn mein Vater stürbe.«
Der Konflikt mit dem Vater hat den jungen Mühsam gelehrt, sich von Autoritäten nicht einschüchtern zu lassen. Zuspruch suchte er auf politischen Versammlungen. Die schmerzlich entbehrte Liebe – seine Mutter starb früh – fand er bei Freunden und in den Armen der Mädchen. Er konnte nicht genug davon haben. Schier unüberschaubar sind die Namen, die Liebeleien und Affären. Er aber glaubte dennoch, »maßlos wenig Glück bei den Frauen« zu haben, denn: »Jede hat mich gern, aber keine liebt mich!«
Doch wenn sich dann eine in ihn verliebte, wie das Zimmermädchen in seiner Pension, begegnete er der jungen Frau mit wenig Herz und schrieb über sie mit kühlem Blick. Als merkwürdig verbuchte er die Tatsache, »dass das zwanzigjährige Mädchen noch unberührt war« und »das gute Kind rasend in mich verliebt ist«. Froh ist er, »dass ich endlich einmal – und doch hoffentlich für längere Wochen – sexuell versorgt bin«. Dann ist von dieser Frieda erst ein Jahr später im Tagebuch wieder die Rede, und das auch nur, weil sie angerufen und ihm gestanden hat, ihn immer noch zu lieben. Er registriert es mit Stolz und vermerkt, er habe sie besucht und sei mit ihr ins Bett gegangen. Zwei Wochen später, im September 1911, notiert er aber auch: »Die Emanzipation des Weibes wird das Bedürfnis nach einer Kultur wecken, die das Wesen der Frau mitberücksichtigt. Dadurch werden die Frauen selbst produktiv werden und alle Kultur wird um eine Hälfte bereichert werden, von der wir heute noch gar nichts kennen. Eine Weltgeschichte, von einer Frau geschrieben – was für Perspektiven!«
Mühsam hatte sich vorgenommen, in seinem Tagebuch ehrlich zu sein, »soweit ich es von mir selbst nur kann«, er wolle auch »vor einer Entblößung meiner Geschlechtlichkeit« nicht haltmachen. Daran hielt er sich. Anfangs traute er sich selbst nicht zu, regelmäßig Tagebuch zu führen. Aber er unterschätzte sich: Beharrlich und in epischer Breite machte er seine Einträge, über längere Zeiträume hinweg sogar tagtäglich. Literarische Absichten verband er – anders als André Gide – zunächst nicht damit. Er kannte das grundsätzliche Problem von Tagebüchern: Die Zusammenhanglosigkeit der Bemerkungen hindere »die Entstehung eines literarischen Meisterwerks«. Über den Wert von Tagebüchern entscheide »der Rhythmus der allgemeinen und persönlichen Ereignisse, die registriert werden«. Und doch las er bald schon Freunden aus dem Manuskript vor, als wäre es ein Stück Literatur. Das ist oft genug bei Diaristen nichts als hoffnungslose Selbstüberschätzung. Mühsams Tagebuchwerk zählt zu den großen Ausnahmen. Es bietet das richtige Mischungsverhältnis von privaten und öffentlichen Mitteilungen, ist Chronik des kulturellen und politischen Geschehens und ein Stück Sittengeschichte. Und der Klatsch aus der Münchner Kulturszene kommt auch nicht zu kurz. In der noch friedlichen und doch schon angespannten Phase vor dem Ersten Weltkrieg fühlte er sich in der Welt der literarischen Kaffeehaus-Boheme, des Kabaretts und des Theaters ganz zu Hause. Zahlreiche ehrgeizige, oft schon prominente Künstler tauchten auf und eigensinnige junge Frauen, die es zu eigenem künstlerischen Tun drängte.
Das Schicksal der mehrfach von der Vernichtung bedrohten Mühsam-Manuskripte ist eine atemberaubende Geschichte, in der sich Hoffnungen und Tragödien der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gespenstisch spiegeln. Als im Mai 1919 Reichswehr und Freikorps der nur wenige Wochen alten Münchner Räterepublik – zu deren treibenden Kräften Mühsam gehörte – brutal und blutig den Garaus machten, waren die Tagebücher in Sicherheit gebracht worden. Paradoxerweise durch die Polizei. Die hatte Mühsams Manuskripte beschlagnahmt und so vor der Wut der Konterrevolutionäre geschützt. Der Autor selbst saß derweil sicher im Gefängnis, mal wieder, und wurde zu fünfzehn Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er fünf absitzen musste.
In der Haft setzte Mühsam sein Tagebuch trotz gelegentlicher Zensurkontrollen fort. Und bei der Amnestie zu Weihnachten 1924 wurden ihm sämtliche Hefte tatsächlich unversehrt ausgehändigt. Fortan schien ihm das Notieren von Gedanken und Ereignissen, die Nennung von Namen und Orten doch zu gefährlich zu sein. Er setzte das Tagebuch nach der Freilassung nicht mehr fort. In Sicherheit waren die Hefte damit nicht. Als die Nazis Mühsam acht Jahre später, im Februar 1933, aus seiner Wohnung holten, waren die Manuskripte zwar bei Freunden versteckt – doch was sollte weiter mit ihnen geschehen? Mühsams Witwe ließ sich trotz Bedenken und Warnungen auf eine Einladung nach Moskau ein, übergab alles Material dem Maxim-Gorki-Institut zur Archivierung und Publikation – und wurde danach unverzüglich verhaftet und bis Mitte der fünfziger Jahre in verschiedene Lager verbannt.