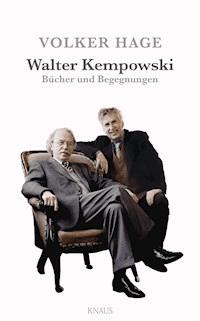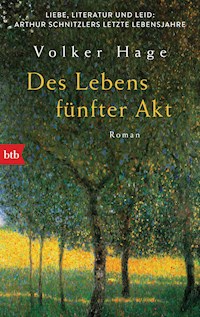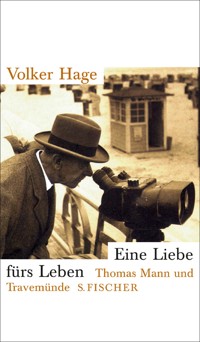9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Max Frisch gehört zu den Klassikern der modernen Literatur. Seine Romane, Tagebücher und Theaterstücke sind von hoher Aktualität. Sie zeigen den Menschen auf der Suche nach dem eigenen Ich – im Spannungsfeld von Pflicht und Neigung, von den Ansprüchen der Gesellschaft und der Angst vor Festlegung. Frisch war ein politisch aufmerksamer Autor jenseits der gängigen Ideologien und Moden: ein später Aufklärer und Moralist. Volker Hage porträtiert den Schweizer Autor auch als Privatperson und stellt seine wichtigsten Werke vor, einschließlich derjenigen aus dem Nachlass, wie das erst kürzlich publizierte Fragment eines dritten Tagebuchs. Eine kurze Biographie, die sachkundig in Leben und Werk von Max Frisch einführt. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Volker Hage
Max Frisch
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Rowohlt E-Book Monographie
Max Frisch gehört zu den Klassikern der modernen Literatur. Seine Romane, Tagebücher und Theaterstücke sind von hoher Aktualität. Sie zeigen den Menschen auf der Suche nach dem eigenen Ich – im Spannungsfeld von Pflicht und Neigung, von den Ansprüchen der Gesellschaft und der Angst vor Festlegung. Frisch war ein politisch aufmerksamer Autor jenseits der gängigen Ideologien und Moden: ein später Aufklärer und Moralist. Volker Hage porträtiert den Schweizer Autor auch als Privatperson und stellt seine wichtigsten Werke vor, einschließlich derjenigen aus dem Nachlass, wie das erst kürzlich publizierte Fragment eines dritten Tagebuchs.
Eine kurze Biographie, die sachkundig in Leben und Werk von Max Frisch einführt.
Über Volker Hage
Inhaltsübersicht
Begegnung
Ein großer Teil dessen, was wir erleben, spielt sich in unsrer Fiktion ab, das heißt, daß das wenige, was faktisch wird, nennen wir’s die Biographie, die immer etwas Zufälliges bleibt, zwar nicht irrelevant ist, aber höchst fragmentarisch, verständlich nur als Ausläufer einer fiktiven Existenz.
Max Frisch[1]
30. August 1981, Sonntagvormittag, im Haus des Verlegers in Frankfurt am Main: der Gast der Familie Unseld sitzt beim Frühstück in einem sonnigen Erker. Er erhebt sich unverzüglich zur Begrüßung, sehr höflich, ernst. Später, auf dem Sessel des Wohnzimmers, hat er sogleich die Pfeife im Mund: Max Frisch, wie man ihn von Fotos kennt. Er versinkt nicht im Sessel, sondern sitzt vorgebeugt, gespannt, aufmerksam.
Sie werden sehen, sagt er, meine Biographie ist nicht sehr ergiebig.[2] Es existieren einige autobiographische Texte, er hat gelegentlich in Interviews aus seinem Leben erzählt. Doch es gebe große Lücken, sagt er. Es hat sich jetzt bei der Archiv-Sache gezeigt: Ich habe nie etwas gesammelt. Es ist wenig da, auch an Bildern. Ich bin oft umgezogen. In Zürich, erklärt er dazu, werde gerade ein Max Frisch-Archiv aufgebaut. In der literaturwissenschaftlichen Abteilung der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule, an der er vor mehr als vierzig Jahren Architektur studiert hat, sammelt man die erreichbaren Dokumente zu Leben und Werk. Irgendwann einmal soll dieses Archiv für Studienzwecke zugänglich gemacht werden.
Frisch, siebzig Jahre alt, erlebt die Stabilität seines Ruhms. Zu Popularität brachte er es schon bald drei Jahrzehnte zuvor, nicht sogleich mit den ersten Veröffentlichungen, doch früh genug, um den Erfolg als Rückenstärkung zu erleben. Nun erweist sich, dass das kein Saisonerfolg gewesen ist. Max Frisch ist längst ein moderner Klassiker, attraktiv geblieben auch für ein junges Publikum, das ihn nicht nur für die Schule liest. Es wundert ihn, dass seine Ansichten über Liebe und Ehe auch für junge Leute interessant sind, nicht nur für Germanisten. Und er sagt: Das ist natürlich etwas Schönes, diese Leserpräsenz. Er spricht nüchtern über seine Popularität, nicht eigentlich bescheiden, durchaus selbstbewusst: Es sind eben Fakten. Wozu Versteck spielen? Und doch zeigt sich mit jedem Wort, dass Frisch nicht zu den Selbstgefälligen gehört. Was er geleistet hat, ist schwer errungen. Darauf ist er vielleicht ein wenig stolz: es ausgehalten zu haben. Erfolg? Der nimmt den Zweifel nicht weg.
Seine Theaterstücke Biedermann und die Brandstifter und Andorra zählen zu den meistgespielten deutschsprachigen Dramen des 20. Jahrhunderts. Sein Prosawerk – Romane, Tagebücher und Erzählungen – wird seit Jahrzehnten gelesen und diskutiert. Stiller, Homo faber und Mein Name sei Gantenbein haben nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Forschung nachhaltig Resonanz gefunden. Interpretationen und Dissertationen sind schon zu Lebzeiten des Autors kaum noch zu überblicken. Er hat wenig Verächter, aber viele Bewunderer, ja Freunde gefunden. Was fühlt er, einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, wenn er heute zurückschaut? Welches Verhältnis hat er zu seinen Werken?
Zum Teil bin ich mit ihnen gewiß nicht glücklich. Aber sie sind wenigstens da. Man hat eine Spur, gar nicht einmal für die Nachwelt. Man hat sich daran gewöhnt. Wenn ich mir vorstelle, es wäre nichts davon vorhanden: Da wäre schon ein großes Loch. Und er setzt hinzu: Bisweilen leistet man sich das Gefühl, das alles sei belästigend … Er behält die Pfeife beim Reden zumeist im Mund, nur manchmal hält er sie für ein paar Augenblicke in der Hand, als gestisches Mittel. Auch dann ist er schwer zu verstehen. Er öffnet die Lippen kaum, spricht leise. Nicht zögernd: Er weiß, worauf es ankommt. Vieles hat er schon so oder ähnlich in anderen Interviews gesagt. Im Gespräch gibt er durchaus ein Bild von sich.
Lässt sich ein Mensch beschreiben? Max Frisch hat sich mit dieser Frage zeitlebens befasst. Seine literarischen Figuren geben davon Zeugnis. Anfang der sechziger Jahre, in der Zeit, als der Gantenbein-Roman entstand, hat er sich mehrfach auch theoretisch dazu geäußert. Die Person sei eine Summe von Möglichkeiten, resümierte er damals seine Überlegungen, eine nicht unbeschränkte Summe, aber eine Summe, die über die Biographie hinausgeht[3]. Das tatsächlich gelebte Leben, so ist das wohl zu verstehen, macht immer nur einen Teil des Menschen aus. Das, was sonst aus ihm hätte werden können, gehört auch zu ihm. Mehr noch: Das, was jemand für seine Vita hält, ist lediglich eine nachträgliche Interpretation, aus Bruchstücken der Erinnerung zusammengesetzt. Auch mit Fakten lässt sich spielen. Sie lassen sich je nach Laune montieren, können heute dies, morgen jenes beweisen. Wie lässt sich ein Leben darstellen? Eine Biographie, die zu wissen vorgibt, wie es gewesen ist, muss für einen Autor wie Frisch ein Gräuel sein. Er schrieb 1960: Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann, oft unter gewaltigen Opfern, für sein Leben hält, oder eine Reihe von Geschichten, die sich mit Ortsnamen und Daten durchaus belegen lassen, so daß an ihrer Wirklichkeit nicht zu zweifeln ist.[4]
Zwanzig Jahre danach trotzdem die Frage, ob es nicht auch für ihn ein gutes, vielleicht sogar behagliches Gefühl bei der Rückschau gebe. Behaglich? Gar nicht. Aber das Gefühl, daß ich sehr viele Schutzengel hatte. Es war ein äußerlich banales Leben. Sehr viel Verzweigungen, Spannungen. Oft das Gefühl des Aufgebens: das Leben aufgeben oder die Arbeit, das Gefühl: was ich mache, hat keinen Sinn. Also das Gegenteil von einem Behagen. Vieles kam zur richtigen Zeit: ein Stipendium nach Amerika, die Begegnung mit Peter Suhrkamp. Aber wenn man zurückschaut, so denke ich: Was da alles hätte schieflaufen können … Seine Rede ist jetzt zutraulich, zwischendrin lacht er auch einmal kurz auf. Seine Augen werden durch die Brillengläser vergrößert. Immer noch spricht er mit großer Ruhe, hört bei Fragen geduldig zu, signalisiert zugleich mit einem begleitenden Ja … ja … ja … die Bereitschaft zur Antwort. Er ist kein Rhetoriker seiner selbst: Er hat Überredung nicht nötig. Väterlich wirkt er eigentlich nicht. Auch aus der Nähe sind seinem Gesicht kaum Spuren des Alters abzulesen.
Neulich traf ich mit einem alten Mann zusammen, erzählt er, stockt kurz, der war sogar noch älter als ich, ein Musiker, der nach Erfahrungen befragt wurde in einer kleinen Runde. Plötzlich sagt er: «Ich habe drei Bücher geschrieben, lesen Sie die!» Und ich versteh ihn – das habe ich nun schon alles einmal gesagt, soll ich das nochmals sagen? Das Veröffentlichte kann belastend sein. Bei jedem Gespräch, bei jedem Vortrag rechnet man im Grunde doch damit, daß man nicht ganz von vorn anfangen muß. Daraus klingt nicht nur die Befürchtung, sich zu wiederholen, sondern auch ein Stück Genugtuung darüber, dass einige grundsätzliche Gedanken formuliert sind.
Das heißt nicht, dass er nun zur Ruhe gekommen ist. Ich muß arbeiten, sagt Max Frisch an diesem Tag im August. Nicht damit ein neues Buch da ist, sondern damit ich durchhalte. Wenn ich nicht arbeiten kann, ist es schwierig. Das nimmt zu. Das hat natürlich damit zu tun, daß verschiedene Vergnügungen nicht mehr so verlockend sind: Reisen etwa. Schreibt er an einer Autobiographie vielleicht? Nein, das würde mich nicht interessieren. Weil mein Leben nicht interessant ist. Und im Gegensatz zu Elias Canetti – beim Lesen von dessen Memoiren stiegen in ihm auch eigene Erinnerungen wieder auf – meint er, wenig über seine Kindheit zu wissen. Zu Beginn des Gesprächs hat er gesagt: Wenn Sie mich chronologisch fragen, kommt wenig dabei heraus. Was soll ich jetzt – in gelassener Morgenstimmung – übers Gymnasium erzählen? Da kommt fast nichts zum Vorschein: wenn ich keinen assoziativen Einstieg habe. Er erzählt dann aber doch: über die Eltern, über den Bruder, über Kindheit und Jugend – wie es sich gerade ergibt.
Kindheit und Jugend
Geboren wurde er am 15. Mai 1911. Die Eltern wohnten in der Heliosstraße, Zürich-Hottingen. Der Vater, Franz Bruno Frisch, war Architekt. Die Mutter hieß mit Vornamen Karolina Bettina (geborene Wildermuth) und hatte in jungen Jahren Russland gesehen: als Kinderfräulein. Es gab zwei Geschwister: eine Halbschwester, die der Vater mit in die Ehe gebracht hatte und deren Mutter bei der Geburt gestorben war, und einen Bruder. Eine schwierige Kindheit hat Max Frisch nicht gehabt. Allerdings wuchs er unter ärmlichen Bedingungen auf. Im Ersten Weltkrieg konnte der Vater nicht mehr in seinem Beruf arbeiten und versuchte sich als Grundstücksmakler. Die Mutter ging mit dem kleinen Max im Herbst durch Wälder und Gärten, um Fallobst zu suchen. Kaffee wurde aus gesammelten Bucheckern bereitet. Die Familie hatte Schulden, der Vater konnte mit Geld nicht umgehen: Wenn ihm ein Geschäft geglückt war, wollte er es auch genießen – und sei es, dass er seiner Frau eine Brosche schenkte. Oft fehlten die Münzen für das Nötigste: Der grüne Gas-Automat in der Diele, die Mutter muß immer einen Zwanziger einwerfen, damit am Herd die Flamme kommt, und dann ist das Gas plötzlich wieder weg, und es braucht viele Zwanziger, wenn etwas lang kochen muß; da hilft es nichts, daß der Vater, wenn er spät in der Nacht heimkommt, vielleicht noch einen Zwanziger in der Tasche haben wird.[5]
«Irgendwann im neunzehnten Jahrhundert, so zur Zeit des reifen Gottfried Keller, trat über die schweizerisch-österreichische Grenze ein junger Geselle, Sattler von Beruf, um hier zu arbeiten. Er heiratete eine Tochter aus dem Kleinbürgertum, Nägeli mit Namen, in Zürich, und machte Kinder, Söhne, die sich einbürgerten, einer davon wurde Architekt. Ungefähr zur selben Zeit, die eine große Zeit für die Schweiz war, kam ein anderer aus Württemberg, Sohn eines Bäckermeisters, auch einer, der dann nicht mehr ging, der sich einbürgerte und eine Baslerin heiratete, Schulthess mit Namen, er wurde Maler und Kunstlehrer in Zürich und machte ebenfalls Kinder, aber Töchter. Später dann, kurz nach der Jahrhundertwende, heirateten eine dieser Basel-Töchter und einer dieser Zürich-Söhne, und das gab wieder Kinder, Söhne – einer davon bin ich.»
«Überfremdung 2» (1966). V 398f.
So hat es Max Frisch später in einer der wenigen präzisen Erinnerungen an die Kindheit notiert. Skizzenhaft hielt er an anderer Stelle Verdrängtes fest, als er, sechzig Jahre alt, in New York für kurze Zeit die Wohnung einer Psychiaterin gemietet und sich spaßeshalber auf den Patientensessel gesetzt hatte. Generalstreik 1918: Studenten mit Couleur-Mütze als Straßenbahnführer, dahinter Soldaten mit Helm und aufgepflanztem Bajonett, die den Streikbrecher beschützten.[6] Ihm fielen die Kriegskinder aus Wien wieder ein: Ich spielte lieber mit ihnen, sie wußten andere Spiele, aber es ging nur heimlich, und als ich ertappt wurde, war es eine Schmach; ich war ein Abtrünniger.[7] Und Lenin: Das schmale Männchen, das im Nachbarhaus ein und aus ging: mein Vater sagte, der wolle alles in dieser Welt kaputtmachen.[8]
Zum Vater hatte Frisch kein besonders inniges Verhältnis. Die Mutter, die lange lebte, stand ihm näher. Auch der Bruder, acht Jahre älter, war alles in allem eine positive Figur für ihn. Gab es keine Konflikte? Es muß sie gegeben haben. Ich erinnere mich nur schwach. Der Bruder war schon pubertär, als ich noch ein Kind war, dann, als ich aufs Gymnasium ging, war er schon Student. Er wußte immer mehr, war immer diesen Sprung voraus, der stimulierend ist. Große Spannungen, glaube ich, gab es nicht. Das lag an ihm, weil er ein milder, toleranter Mensch war. Er hat ein bißchen den Vater ersetzt. Zum Vater eine schwache, eigentlich eine Nicht-Beziehung. Ich rede auch nie von meinem Vater. Dabei ist nicht etwa irgendetwas Fürchterliches zu überdecken. Es ist von meiner Seite eine Gefühlslücke, ohne daß ich, soweit ich sehe, eine enorme Mutterbindung gehabt hätte. Etwas über meinen Vater zu schreiben, wäre eine für mich notwendige Arbeit. Es kann ja nicht einfach ein Vakuum sein. Warum mache ich ein Vakuum daraus? Das interessiert mich eigentlich.[9]
Franz Bruno Frisch, der Architekt, war Autodidakt. Einige seiner Jugendstil-Bauten stehen heute noch. Nach dem Weltkrieg nahm er seinen Beruf nicht wieder auf: Er blieb Liegenschaftsmakler. Nach Auskunft von Max Frisch war der Vater ein bequemer Mensch. Er starb 1932, knapp über sechzig. Die Mutter ist 91 Jahre alt geworden und starb 1966. Karolina Frisch hat ihren jüngsten Sohn mehr geformt als der Vater: Die Abenteuer- und Reiselust der Mutter muss den Jungen fasziniert haben. Sie konnte Geschichten aus fernen Gegenden anschaulich erzählen.
Die Mutter war zentral. Aber ich glaube nicht, daß es eine Ödipus-Situation war. Ich habe nach dem Tod des Vaters auch eine Zeitlang mit ihr gelebt, weil kein Geld da war. Über Jahre hin, als ich verheiratet war, habe ich sie sehr selten gesehen. Sie kommt aus einem sehr gemischten Milieu. Der Vater, Wildermuth, kam aus dem Württembergischen. Er war Maler, seine Aquarelle waren hübsch, nicht bedeutend. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Leiter der Kunstgewerbeschule in Zürich. Er hatte viele Töchter und kümmerte sich nicht weiter um sie. Meine Mutter ging dann nach Wien, Berlin und Rußland als Gouvernante. Das war damals ein großer Schritt. Rußland war für mich immer das Märchenland: Wie sie von den Wölfen erzählt hat! Wenn man krank war, durfte man das russische Album anschauen. So war Rußland: Mütterchen Rußland. Das Bild, das ich von meiner Mutter habe, ist eine Art Ikone, vielleicht wird es irgendwann eine Revision erfahren.[10]
Von 1924 bis 1930 besuchte der junge Frisch die Oberschule, das Kantonale Realgymnasium in Zürich; er war nach eigener Auskunft kein besonders guter Schüler, doch durchlief er die Klassen ohne Probleme. Wichtig wurde in dieser Zeit ein Freund, Werner Coninx, der später noch eine entscheidende Rolle spielen sollte. Max Frisch hat Jahrzehnte danach ein Porträt von ihm entworfen. Darin ist auch etwas über den Beginn der ungleichen Freundschaft zu lesen: Nach der Schule begleitete ich ihn nach Hause, was für mich ein großer Umweg war, aber ein Gewinn; durch ihn hörte ich zum ersten Mal von Nietzsche, von Oswald Spengler, von Schopenhauer. Seine Eltern waren sehr reich. […] Er war ein philosophisches Temperament; ich staunte, was sein Hirn alles denken kann. Auch war er sehr musikalisch, was ich nicht bin; Abende lang spielte er mir Platten von Bach, von Mozart, von Anton Bruckner und von andern, die ich noch nicht einmal dem Namen nach kannte; kein Mensch sei völlig unmusikalisch, sagte er.[11] Frisch war in seiner Jugend keineswegs ein Stubenhocker, der sich hinter Büchern vergrub. Wie er in einer autobiographischen Skizze aus dem Jahr 1948 offenbarte, war er überhaupt kein großer Leser:
Ich weiß nicht, warum ich von allen Kameraden der einzige war, der nie einen Karl May las, eigentlich auch keine anderen Bücher; außer Don Quixote und Onkel Toms Hütte, die mir unsäglich gefielen, aber genügten. Was mich unersättlicher begeisterte, war Fußball und später Theater. Eine Aufführung der Räuber, eine vermutlich sehr schwache Aufführung, wirkte so, daß ich nicht begriff, wieso Menschen, Erwachsene, die genug Taschengeld haben und keine Schulaufgaben, nicht jeden Abend im Theater verbringen. Das war es doch, das Leben. Eine ziemliche Verwirrung verursachte das erste Stück, wo ich Leute in unseren alltäglichen Kleidern auf der Bühne sah; das hieß ja nicht mehr und nicht weniger, als daß man auch heutzutage Stücke schreiben könnte.[12]
Das ist nun gewiss aus der Erinnerung ein wenig poliert und pointiert dargestellt – als Frisch dies notierte, waren seine eigenen Stücke schon erfolgreich über manche Bühne gegangen. Was er hier beschreibt, ist wohl auch ein Teil aus jener Geschichte, die sich der Mensch erfindet, um sie dann für sein Leben zu halten. Doch soll damit an dem Sachverhalt nicht gezweifelt werden. Die Folgen der Verwirrung des jungen Mannes sind aktenkundig. Im Alter von sechzehn schickte der Schüler ein selbstverfasstes Stück nach Berlin: an den berühmten Theatergewaltigen Max Reinhardt.
Der junge Dichter
Im Frühjahr 1931 wurde Max Frisch gefragt, ob er Offizier werden wolle. Er hatte zwei Monate lang die Rekrutenschule besucht. Er lehnte ab, ohne den ausschlaggebenden Grund preiszugeben: Er wollte lieber Dichter werden. Und ein Dichter hat kein Interesse am Aufstieg beim Militär, einem Aufstieg, der eine gute Basis für die bürgerliche Karriere gewesen wäre (Frisch strebte auch später, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, nie einen gehobenen Dienstrang an). Ohnedies hatte er nach der bestandenen Matura schon dem Drängen der Eltern nachgegeben: Sie wünschten, dass beide Söhne studierten. Der Bruder war mit dem Chemiestudium inzwischen fertig und Leutnant geworden. Für den, der schreiben wollte, schien Germanistik verlockend.
Die Universität enttäuschte Max Frisch: Er lernte dort nicht, wie man Schriftsteller wird. Er versuchte es – wie er bald einsah: erfolglos – mit Gedichten, nachdem er seine Karriere als Theaterautor für beendet hielt. Max Reinhardt hatte das Stück mit dem Titel Stahl nach sieben Wochen wieder zurückgeschickt. Ein ausführlicher Brief war dabei gewesen, den der verzweifelte Autor nicht verstand. Er schrieb trotzdem noch drei oder vier Stücke (sie alle sind wie das erste verschollen), darunter eine Ehekomödie und eine Mondlandungs-Farce. Dann meinte er erkannt zu haben: Die Bühne war nicht sein Feld.
Mit dem Theater hatte die erste Veröffentlichung aber doch zu tun. Im Mai 1931, ein paar Tage nach seinem zwanzigsten Geburtstag, druckte die «Neue Zürcher Zeitung» einen kleinen Beitrag, einen Bericht über eine Theaterkunst-Ausstellung: Mimische Partitur?[13] Max Frisch hatte ihn einfach der Zeitung zugeschickt, und nun war sein Text erschienen. Das war tatsächlich enorm. Daß das wirklich Wort für Wort da war. Dann noch der Name gedruckt![14] Immerhin war dieses kleine Debüt ein origineller Beitrag: Der junge Mann zeigte Mut zur Meinung. Er wollte nicht bloß referieren, er wollte beweisen, dass er etwas zu sagen hatte. Wie sollte man sonst auffallen?
Im Jahr darauf, im Frühjahr 1932, starb der Vater.[15] Frisch begann nun, regelmäßig für Zeitungen zu schreiben. Obgleich ihm ein Professor ein Stipendium verschaffte (800 Franken im Jahr), brach er das Studium aus Geldmangel und Abenteuerlust[16] vorerst ab. Vor allem wollte er beweisen, dass er auf eigenen Füßen stehen kann. Der Universität trauerte er nicht nach, besuchte aber weiter Vorlesungen. Heute mag man ihn um seine Lehrer beneiden: Bei C.G. Jung hörte er etwas über Psychologie, bei Heinrich Wölfflin über Kunstgeschichte und bei Emil Ermattinger über Literatur. Zugleich stellte er sich in den Zeitungsredaktionen vor. Bald konnte er sein Sprüchlein auswendig hersagen: Vergangene Woche ist mir der Vater gestorben. Ich habe Literatur und Journalistik studiert. Mein Studium muß ich unverzüglich abbrechen, um mich aus eigener Kraft durchzuschlagen, so gut das eben geht. Ich bin einundzwanzig. Illusionen mache ich mir ja keine; aber ich vertraue auf meine journalistische Befähigung und habe auch Anerkennungen und Empfehlungen –. Das klang sehr selbstgewiss, war jedoch gespielt. Damals notierte Frisch: Man schreibt und telefoniert und stellt sich vor. Und während man sich selbst empfiehlt, stößt und sticht einen immer und immer wieder die Frage: was bist du eigentlich?[17]
Bemerkenswert ist freilich, dass der journalistische Anfänger solcherart Selbsteinschätzung nicht für sich behielt, sondern als Feuilleton in die Zeitung brachte. Überhaupt war er nicht bange, von sich zu sprechen. Ob es eine Reportage über die Arbeit als Postgehilfe oder über den Straßenbau in den Bergen war (wobei er jeweils tüchtig mit anfasste), immer wieder nutzte er die Gelegenheit, sich zu offenbaren. Und er überhöhte seine Subjektivität noch mit allgemeinen Gedanken dieser Art: Aber weil wir letzten Endes, sofern wir ehrlich sind, ausschließlich von uns selber aussagen können, darf ich vielleicht nur sagen, daß dies für mich Richtigkeit hat. Und weil wir schon bei der Ich-Ehrlichkeit sind: Ich bin nicht hergekommen, um der armen Bergbevölkerung zu helfen, sondern um mir zu helfen.[18] So schrieb er mit Anfang zwanzig: Wenn ihm Drama und Gedicht nicht gelangen, dann wollte er wenigstens auf der Zeitungsseite Literatur machen. Seine Artikel trugen Titel wie Wolken am Abend, Ein Mensch geht weg, Stadtherbst oder Freunde und Fremde.[19] Er schrieb auch Buchrezensionen.
Bald reichte ihm das nicht mehr. Es galt die Welt kennenzulernen. Als im Frühjahr 1933 in Prag die Eishockey-Weltmeisterschaft anstand, erzählte er gleich in zwei Redaktionen, er würde ohnehin fahren: Ob er für sie berichten dürfe? Er durfte: Ich war stolz darauf, wie ich das gemanagt hatte.[20] Spesen erhielt er nicht. Es wurde eine lange Reise. Ich dachte, ich gehe für vierzehn Tage fort, und bin dann ein halbes Jahr geblieben.[21] Er blieb von April bis Oktober im Ausland und reiste von Prag weiter nach Belgrad, Sarajevo, Dubrovnik, Zagreb, Istanbul, Athen, Korinth und Delphi. Zurück führte der Weg noch einmal über Dubrovnik und dann nach Bari und Rom. Er war in dieser Zeit auf das Zeitungshonorar angewiesen. Oft saß er in einem Hotel und wusste nicht, womit er es bezahlen sollte. Das Frühstück blieb nicht selten die einzige Mahlzeit. In Prag hatte er dem Beamten eines Ministeriums weisgemacht, er sei studienhalber für eine Zeitung unterwegs. Mit Knickerbocker und Akkreditierungsausweis war er aufmarschiert.
Er glaubte mir nicht so recht, daß ich Journalist sei. Die Reise bis zur Grenze war im voraus bezahlt. Er fragte mich, wo ich ausreisen wolle. Zum Glück hing eine Karte an der Wand. Die längste Strecke führte über Budapest. In Belgrad machte ich dann das gleiche noch einmal, in einer Mischung aus Unbedarftheit und Unverfrorenheit. Diesmal erhielt ich sogar ein Rundreiseticket erster Klasse. Und wieder hing eine Karte an der Wand. Ich wählte schnell den größten denkbaren Weg bis zur bulgarischen Grenze. Wie es von da weitergeht, werden wir sehen, dachte ich. Zweimal dieses Glück: Wie kannst du die größte Gratisfahrt herausholen? Das war nicht einmal clever, sondern eine glückliche, hermesgelenkte Keckheit.[22]
Max Frisch schrieb viel in diesen Monaten (er malte übrigens auch), und eine Menge wurde in der Zeitung daheim gedruckt. Erstmals blitzte in diesen Berichten etwas von der Problematik der Geschlechterbeziehungen auf. Aus Sarajevo ließ er über die verschleierten Frauen verlauten: Die Vermummung erhöhe den Reiz, indem sie in uns den Ergänzer und Erdichter weckt. Zu Hause dagegen werde der Mann, der immer ein Träumer ist, durch Einblicke bestohlen um alles Erahnen.[23] Frisch war, wie er später schrieb, damals ledig jeder Pflicht, frei, bereit für jede Gegenwart […]. Das war, obschon verdüstert durch den jähen Tod einer jungen Frau, eine volle und glückliche Zeit.[24] Diese junge Frau – war sie die erste Liebe? Das war eine reine Verehrungsgeschichte. Sie leitete in Dubrovnik mit ihrer Mutter eine Pension. Sie war dreiunddreißig Jahre alt, eine dicke Blonde, Ostdeutsche. Als ich weg war, auf meiner Reise nach Istanbul, ist sie gestorben. Ich kam zurück, und sie war schon begraben. Ich habe ihrer Mutter noch drei Wochen geholfen, bei der Buchhaltung.[25]
Vieles davon findet sich im ersten Roman wieder. Jürg Reinhart, Untertitel: Eine sommerliche Schicksalsfahrt, erschien 1934 in der Deutschen Verlags-Anstalt. Frisch hatte von Herbst 1933 bis Frühjahr 1934 daran gearbeitet und eine Menge seiner Reisenotizen verwendet. Eigentlich wollte er nur kurz nach Hause kommen, zum Geburtstag seiner Mutter. Er blieb dann im Land, weil er sich in eine Studentin aus Berlin verliebte. Und er schrieb. Frisch im Gespräch (fast ein halbes Jahrhundert danach): Es waren so viele Texte da, und dann habe ich das halt gemacht; so Feuilletons, die ich einfach zusammengekittet habe.[26] Das Buch, das längst vergriffen ist[27], kann in der Tat seinen Charakter als Anfängerarbeit nicht verleugnen, doch als literarisches Debüt eines Dreiundzwanzigjährigen muss es sich nicht verstecken.
Der junge Jürg Reinhart verbringt eine unbeschwerte Sommerzeit in Ragusa, in einem kleinen Hotel am Meer. Er verdient sich das wenige, das er braucht, mit Zeitungsartikeln, die daheim veröffentlicht werden. Seine Gedanken kreisen um drei Frauen: eine holländische Gräfin, die Gast ist wie er, das Dienstmädchen Hilde und Inge, die kranke Tochter der Hotelbesitzerin. Vor der ersten flieht er, ihren Verführungsabsichten während einer nächtlichen Bootsfahrt entzieht er sich durch einen Sprung ins Wasser; bei der zweiten missglücken seine Annäherungen auf komische Art, wiederum auf dem Meer: Fischer schleppen das zu weit hinausgetriebene Segelschiff ab; mit der dritten Frau redet er nur. Worüber? Über Sexualität und die Angst vor dem ersten Mal. Jeder Lump wagt es! Bloß ich nicht![28], sagt er seiner kranken und geduldigen Freundin. Für Reinhart bedeutet das alles einen niederschmetternden Schwächebeweis, eine Lebensniederlage[29]