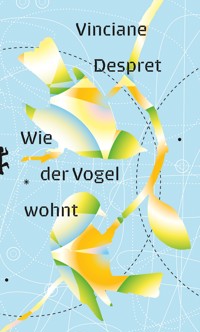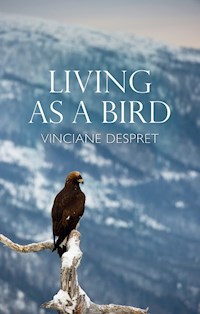17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer sagt, dass Tiere einfach gestrickt sind und keine Kultur haben? Die belgische Philosophin Vinciane Despret knöpft sich Annahmen vor, die in der Regel nicht infrage gestellt werden. Mal philosophisch, mal kurzweilig, aber stets mit einem Augenzwinkern widmet sich Despret in 26 Essays provokanten Fragen: Mit wem würden Außerirdische verhandeln wollen? Was interessiert Ratten bei einem Experiment? Können Vögel Kunstwerke erschaffen? Desprets Antworten eröffnen immer wieder neue Perspektiven, durch die der vermeintlich Beobachtende zum Beobachteten wird. Sie sind gespickt mit Berichten von Forscher*innen aus der freien Wildbahn und mit amüsanten Beispielen und Anekdoten aus dem Tierreich. Despret will nicht belehren, sondern fragt neugierig und ergebnisoffen nach den Fähigkeiten und dem Wesen der Tiere, danach, wie sie die Welt begreifen und – sie ist schließlich Philosophin – ob wir das überhaupt wissen können. Die in der Wissenschaft scheinbar klar gezogenen ontologischen Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen dabei zusehends. »... mal hochtheoretisch, mal amüsant, mal philosophisch … absolut empfehlenswert … « – Ulrike Schwerdtner, Tierbefreiung »In Vinciane Desprets Werk sind Ideen im Überfluss vorhanden, sie schwärmen aus und vermehren sich; die Tiere hingegen reagieren – und zwar nicht immer nach den Regeln des philosophischen Anstands. Ausgesprochen beunruhigend, da sie als mit künstlerischen Fähigkeiten, erprobten Praktiken, einem Gefühl der Gleichheit und Gerechtigkeit ausgestattet erkannt werden. Diese kleinen philosophischen Erkenntnisse, die zugleich zugänglich, lebendig und originell sind, bestätigen, dass Ethologie unter dem geschärften Verstand der Autorin eine äußerst spannende Wissenschaft ist.« – Le Monde
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Vinciane Despret ist eine belgische Philosophin. Sie forscht und lehrt an der Universität Lüttich und hat mehrere Bücher über das Verhältnis von Tieren und Menschen veröffentlicht, aber auch Werke zu feministischen Themen.
Vinciane Despret
Was würden Tiere sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen?
Aus dem Französischen übersetzt von Lena Völkening
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Vinciane Despret
Was würden Tiere sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen?
1. Auflage, März 2019
eBook UNRAST Verlag, September 2020
ISBN 978-3-95405-043-7
Copyright der Originalausgabe
Que diraient les animaux, si … on leur posait les bonnes questions?
© Editions LA DÉCOUVERTE, Paris, France, 2012, 2014
Vorwort von Bruno Latour übersetzt aus der englischen Ausgabe
What would animals say if we asked the right questions?
© University of Minnesota Press, 2016
© UNRAST-Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de – [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Felix Hetscher, Münster
Übersetzung: Lena Völkening, Berlin
Satz: Andreas Hollender, Köln
Druck: Multiprint, Kostinbrod
Inhalt
I. Vorwort der Übersetzerin
II. Vorwort von Bruno LatourÜber wissenschaftliche Fabeln in der Empirie
Danksagung
Wie dieses Buch gelesen werden soll
A wie AnmutDumm wie ein Maler?
B wie BedürfnisseIst es unangebracht, vor Tieren zu pinkeln?
C wie cleverÄffen Affen wirklich nach?
D wie DiebeKönnen Tiere aufbegehren?
E wie ExperimentSehen sie sich so, wie wir sie sehen?
F wie ForschungIst Tieren wichtig, wie sie aussehen?
G wie GenieMit wem werden Außerirdische verhandeln wollen?
H wie HierarchienKönnte es vielleicht ein Mythos sein, dass das männliche Geschlecht das dominante ist?
I wie inkonsequentSind Tiere geeignete Vorbilder für moralisches Verhalten?
J wie JustizSchließen Tiere Kompromisse?
K wie KilogrammGibt es eine Spezies, die wir töten dürfen?
L wie LaborWofür interessieren sich Ratten bei einem Experiment?
M wie mogelnSollte Betrug ein Beweis für richtiges Verhalten sein?
N wie NotwendigkeitKann man eine Ratte dazu bringen, ihre Kinder zu töten?
O wie originellIst das, was Vögel machen, Kunst?
P wie PunkteWie bringen wir Elefanten dazu, Spiegel zu mögen?
Q wie queerHaben Pinguine ein Coming-out?
R wie ReaktionSind Ziegen mit den Statistiken einverstanden?
S wie separierenKann man ein Tier kaputt machen?
T wie TeamWarum sagt man, dass Kühe nicht arbeiten?
U wie UmweltWissen Tiere, wie andere die Welt wahrnehmen?
V wie VariantenSind Schimpansen auf die gleiche Weise tot wie wir?
W wie WattanaWer hat die Sprache und die Mathematik erfunden?
X wie XenotransplantationKann man mit einem Schweineherz leben?
Y wie YoutubeSind Tiere die neuen Superstars?
Z wie ZoophilieSollten Pferde ihr Einverständnis geben?
Anmerkungen
I.
Vorwort der Übersetzerin
Lena Völkening
Übersetzen ist ein Tauschgeschäft. Es wird absolut berechtigterweise oft mit einer wackligen Bootsfahrt über einen Fluss verglichen, über-setzen. Am Ende sind alle ordentlich durchgerüttelt, ein paar Insassen sind über Bord gegangen und ein paar neue hat man sich dafür dazugeholt. Es ist das Schöne an Sprachen, dass zwei Sprachsysteme einander nie genau gleichen. Und so kann ein Wort, das so unschuldig daherkommt wie zum Beispiel Sache, in einer anderen Sprache zwar durch ein anderes Wort ersetzt werden, aber dieses andere Wort bedeutet eigentlich trotzdem etwas völlig anderes. Die französische Philosophin Barbara Cassin, auf die sich auch die Autorin dieses Buches bezieht (als sie davon spricht, wie wir die Konzepte, in denen Tiere denken, übersetzen) hat dem Problem ein ganzes Buch gewidmet: das Wörterbuch der Unübersetzbaren, das Dictionnaire des intraduisibles. Es ist sehr dick und enthält Übersetzungsvorschläge für philosophische Begriffe – vor allem aber lange Texte, in denen versucht wird zu erklären, was mit den Wörtern gemeint ist oder auch nur gemeint sein könnte. Denn was Bedeutung eigentlich ist, ist so komplex, dass die Linguistik die Frage bis heute nicht endgültig beantwortet hat.
Weil sich die Wörter mit ihren Anfangsbuchstaben gesperrt haben, haben wir gegenüber dem Original das Kapitel B gegen das Kapitel C vertauscht und einige Kapitelüberschriften leicht verändert. Diese Übersetzung ist ein Annäherungsversuch an ein philosophisches Werk, in dem die Autorin ihr ganz eigenes Vokabular findet, um über Tiere zu sprechen. Es ist die deutschsprachige Variante davon, um es mit Desprets Worten zu sagen. Ein Werk, in dem die Autorin selbst versucht zu übersetzen – aus den Begriffen der Tiere in die Begriffe der (französischsprachigen) Menschen.
Ich danke der Autorin, Vinciane Despret, dass sie geduldig auf meine Nachfragen geantwortet hat. Dem Übersetzer der englischsprachigen Ausgabe, Brett Buchanan, ebenso, und Andreas Pfeuffer für seine Hilfe mit der Sache. Meiner Lektorin Marie Bickmann für ihre Anmerkungen, die mich mehr als einmal zur Verzweiflung getrieben, aber den Text so viel besser gemacht haben. Lauriane Guichard danke ich dafür, dass sie sogar ihren französischen Vater für meine Fragen angerufen hat, und meinen Eltern danke ich für alles.
II.
Vorwort
Über wissenschaftliche Fabeln in der Empirie
Bruno Latour
Bereitet euch darauf vor, Geschichten zu lesen wie »Das Schwein, das zu lügen versuchte«, »Die viel zu schlaue Elster«, »Der Elefant und der Spiegel«, »Der Papagei, der nicht nachplappern möchte«, »Die Kuh, die gerne meditieren würde«, und »Die Ziegen, die nicht gezählt werden können«, Geschichten wie »Die Zecke, die glaubt, sie ist Charles Sanders Peirce«, oder wie »Der Pinguin, der zu viele queere Geschichten gelesen hat«, und nicht zu vergessen: »Der Lemur und der Ethologe, die des Kindsmordes bezichtigt werden«, und viele, viele weitere. Bereitet euch darauf vor, viel Wissenschaftliches zu lesen und gleichzeitig viel darüber zu lernen, wie gute, schlechte oder fürchterlich schlechte Wissenschaft funktioniert. Gleich lernt ihr ein neues Genre kennen, die wissenschaftlichen Fabeln, womit ich nicht Science-Fiction oder ausgedachte Geschichten über die Wissenschaft meine, sondern im Gegenteil Wege, wirklich zu verstehen, wie schwierig es ist herauszufinden, wozu Tiere imstande sind. Dies ist eines der wertvollen Bücher, die in den Bereich der neu aufkommenden Scientific Humanities gehören, was bedeutet, dass, um zu verstehen, was Tiere zu sagen haben, sowohl die Natur- als auch die Geisteswissenschaften zu Rate gezogen werden müssen.
Das Problem bei Tieren ist, dass jeder schon Erfahrungen mit ihnen gemacht und zahlreiche Ideen hat, inwiefern sie Menschen ähneln oder nicht. Wenn man also damit anfängt, einen strukturierten Bericht über ihre Gewohnheiten zu liefern, sieht man sich sofort mit einem Schwall von Aussagen wie »aber meine Katze tut dies«, »ich habe auf Youtube einen Löwen gesehen, der das gemacht hat«, »Wissenschaftler haben bewiesen, dass Delfine das können«, »auf dem Bauernhof meines Großvaters haben die Schweine immer das gemacht« und so weiter und so fort konfrontiert. Das Gute daran ist, dass, wann immer man etwas über Tiere sagt, es wirklich jeden interessiert, was man zu sagen hat. Das Schlechte daran ist, dass der eigene Bericht in diesem Schwall von alternativen Berichten ertränkt wird, die aus völlig unterschiedlichen Überlegungen und Erfahrungen im Umgang mit Tieren entsprungen sind.
Die meisten Wissenschaftler versuchen, wenn so viele Alternativen zu ihren Berichten auf sie einprasseln, sich von all diesen Sichtweisen zu distanzieren, um dann bei null anzufangen und so exakt wie möglich nachzuahmen, was ihre Wissenschaftlerkollegen in angrenzenden Forschungsbereichen mit physischen Objekten und chemischen Reaktionen gemacht haben. Was auch immer die Durchschnittsbürger, Tierbesitzer, Viehzüchter, Naturschützer und Dokumentarfilmer so gesagt haben, wird als bloße »Anekdote« beiseitegeschoben. Und dasselbe passiert mit dem, was Wissenschaftler in früheren Jahrhunderten oder Kollegen, die einer anderen Schule angehören, unter ungewöhnlichen Umständen beobachtet zu haben behaupten, zum Beispiel in der Feldforschung. »Das waren jetzt genug Anekdoten, lass uns jetzt unter kontrollierten Bedingungen im Labor echte Daten sammeln, um das Verhalten der Tiere so objektiv, neutral und distanziert wie möglich zu untersuchen.«
Wenn die Laien nicht mit am Tisch sitzen dürfen, dann liegt das diesen Wissenschaftlern zufolge daran, dass sie Geschichten erzählen, von denen man, wenn man sie hört, niemals wissen wird, ob daraus ihre Gefühle, Sichtweisen und Gewohnheiten sprechen oder die der Tiere selbst. Nur die streng kontrollierten Bedingungen im Labor bewahren die Wissensproduktion davor, in die »Anthropomorphismus«-Falle zu tappen. Dem so zu begegnen, erzeugt ein interessantes Paradoxon: Nur, indem man die extremst künstlichen Bedingungen in Laborexperimenten herstellt, kann man herausfinden, wozu Tiere wirklich fähig sind, wenn sie von allen von den Menschen künstlich auf sie übertragenen Werten und Annahmen befreit wurden. Ab dem Zeitpunkt zählt nur noch eine bestimmte Anzahl geordneter Berichte darüber, was Tiere unter diesen Bedingungen tun, als echte Wissenschaft. Alle anderen werden als »Geschichten« bezeichnet und die Geschichtenerzähler als bloße Laien abgetan.
In den vergangenen 20 Jahren hat Vinciane Despret, die sowohl ausgebildete experimentelle und klinische Psychologin als auch Philosophin ist, nie damit aufgehört, sich mit diesem Paradoxon auseinanderzusetzen. Warum sollten wissenschaftliche Erkenntnisse über Tiere unter derart künstlichen Bedingungen erlangt werden, um all die ebenso künstlichen Fälle von Begegnungen von Menschen mit Tieren loszuwerden? Ist der Kampf gegen den Anthropomorphismus so wichtig, dass er dem weichen sollte, was sie als allgemeinen »Akademikozentrismus« bezeichnet? Gemeint ist damit, dass nur ganz bestimmte Sichtweisen den Tieren und aber auch denjenigen, die wissenschaftliche Berichte lesen, aufgedrängt werden. Ist es nicht etwas seltsam, dass Beschreibungen der Natur mit Tricks ermöglicht werden sollen, während das, was ganz natürlicherweise passiert, als Quelle ausgedachter Geschichten gilt? Denn Wissen wird letztendlich immer aus künstlich entwickelten Gründen und unter künstlich hergestellten Bedingungen produziert, warum also nicht auf die Tausende von Fällen zurückgreifen, in denen Menschen auf natürliche Weise mit Tieren interagieren – den täglichen Umgang mit Labortieren und das Planen neuer Versuche ebenso wie die Arbeit von Trainern und Viehzüchtern inbegriffen – um Wissen anzuhäufen, statt welches wegzunehmen?
Vinciane Despret gehört einer ganz besonderen Sorte empirischer Philosophen an. Gelegentlich wird übersehen, dass es zwei verschiedene Arten von Empirikern gibt: die Wegnehmer und die Hinzufüger. Ersteren geht es darum, ihre Thesen zu untermauern, allerdings nur unter der Bedingung, dass eine These die Zahl der Alternativen verringert und die der Stimmen, die auch etwas beitragen wollen, begrenzt. Es geht ihnen darum, zu vereinfachen, zu beschleunigen und manchmal sogar eine Sichtweise komplett auszuschließen und, wenn möglich, die Geschichtenerzähler ebenfalls zum Schweigen zu bringen. Die Hinzufüger unter den Empirikern interessieren sich genauso für objektive Fakten und Thesen mit Hand und Fuß, aber sie fügen gerne Dinge hinzu, verkomplizieren, spezifizieren und verlangsamen sie, wann immer es möglich ist, und vor allem halten sie inne, damit auch andere Stimmen gehört werden können. Sie sind Empiriker, aber Empiriker im Stil eines William James. Wenn sie nichts wollen als das, was durch Erfahrung gewonnen wird, wollen sie ganz sicherlich nicht weniger als die Erfahrung. Wie Isabelle Stengers, eine von Desprets wichtigsten Inspirationsquellen für ihre besondere Methode, zu sagen pflegt: Die Wissenschaft würdigt sich selbst herab, wenn sie von ihren Erfolgen ausgehend argumentiert, um andere Sichtweisen ganz auszuschließen. Stengers und Despret propagieren nicht ein Entweder-oder, sie sind Verfechterinnen des Sowohl-als-auch.
Wie schafft es ein Empiriker, konsequent hinzuzufügen? Indem er zuerst einmal das, was die Wegnehmer geschrieben haben, sehr ernst nimmt und sehr sorgfältig liest. Desprets Genialität besteht darin, dass sie die wissenschaftliche Literatur liest, aber nicht, um sie zu bewerten (also die wenigen stichhaltigen Fakten auszumachen und die übrigen als irrelevant abzutun), sondern um herauszufinden, was darin über die zahlreichen Schwierigkeiten zu finden ist, Orte zu erschaffen, die wirklich einige der Bedingungen replizieren, unter denen Menschen und Tiere miteinander interagieren, oder, wichtiger noch, unter denen Tiere mit anderen Tieren interagieren. Und dann nutzt sie in einem zweiten Schritt diese Schwierigkeiten dazu, zu beleuchten, wie auch die vielen anderen Arten von Wissensproduzenten mit Tieren umgehen, dies aber tun, indem sie sich auf völlig andere Weise mit ihnen auseinandersetzen. Auf Laborarbeit begründete Sichtweisen müssen natürlich eingeschlossen sein, liefern sie doch derart großartige Erkenntnisse, ohne dass ihnen aber dabei die Macht zugesprochen wird, alternative Sichtweisen auszuschließen.
Ein so gnädiger Umgang mit der wissenschaftlichen Literatur hat einen ganz besonderen Effekt, den ich den Despret-Effekt nenne: Ein karger Wissenschaftskorpus, der Hunderte von oft merkwürdigen Versuchszusammenhängen enthält, wird zu einer faszinierenden Lektüre. Er wird mit Humor behandelt, aber ohne jegliche Ironie und, was das Seltsamste daran ist, ohne den kritischen Ton anzuschlagen, mit dem Tierliebhaber so oft gegen wissenschaftliche Thesen angehen. Wenn ihr Empiriker seid, die hinzufügen, müsst ihr euch dem Wegnehmen in jeglicher Form widersetzen. Dem Eliminativismus derer, die die Laien gerne vor die Tür setzen würden, aber auch dem Eliminativismus derer, die davon träumen, die Wissenschaft allgemein zu umgehen – zwei Arten von Obskurismus, die miteinander konkurrieren und einander ergänzen.
Dank des Despret-Effekts ist die Empörung, mit der ihr auf eine alternative Version dessen, was ein Tier tun soll, reagiert, jedes Mal auch eine neue Gelegenheit, infrage zu stellen, wie ihr Menschen wie Tieren Agency zuschreibt. Von der Frage nach dem Anthropomorphismus kommt ihr zu der sehr viel interessanteren nach der Metamorphose, womit ich nicht nur meine, die Grenze zwischen dem, was Mensch und was Tier ist, zu überprüfen (eine eingeschränkte Problematik, wenn sie überhaupt je existierte), sondern die vielseitige Natur dessen, was es bedeutet, belebt zu sein, zu erforschen. Wissenschaftler, Viehzüchter, Tierliebhaber, Haustierbesitzer, Zoowärter, Fleischesser – wir alle versuchen ständig, dem zu entgehen, diesen Lebewesen, mit denen wir ständig die Gestalt ändern (Gestaltänderung ist die Entsprechung für das lateinische metamorphosis), das Belebtsein abzusprechen oder es ihnen übermäßig zuzugestehen.
Nach zahlreichen Langzeitbefragungen hat sich Vinciane Despret entschieden, mit Was würden Tiere sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen? einen großen Teil ihrer bisherigen Arbeit in einer Reihe kurzer Kapitel darzulegen, die sich ganz wie La Fontaines Fabeln lesen, nur dass ihre Fabeln nicht aus einer tausend Jahre alten Tradition hervorgehen. Stattdessen fußt jede von diesen Fabeln auf einem bestimmten Korpus wissenschaftlicher und ethnografischer Literatur über eine oder mehrere Begegnungen mit Tieren.
Der Bezug dieses Buchs zu den Fabeln ist natürlich, dass Tiere sprechen oder, genauer gesagt: »sprechen würden«, wenn wir nur die »richtigen Fragen« stellen könnten. Während es in der Fabel als traditioneller Textgattung unproblematisch zu sein scheint, das Tier etwas Witziges, Kritisches, Scharfsinniges, Ironisches oder Dummes sagen zu lassen, wird hier jegliche Äußerung darauf bezogen, wie die Fragen gestellt werden. Und sind die Fragen oft witzig, kritisch, scharfsinnig, ironisch oder schlicht dumm – und manchmal stehen sie in Bezug zu einem Verbrechen (vgl. die Fabel, die den Titel »Der Sadist Harlow und seine Affen« tragen könnte). So bringt uns jede Fabel näher an das heran, was die kollektiven Ausdrucksschwierigkeiten derer genannt werden könnten, die andere zum Reden bringen könnten, würden sie nur selbst nicht so schlecht hören.
Bei Despret ist die Fähigkeit, Tiere dazu zu bringen, etwas Relevantes zu sagen, oft ansteckend: Dumme Fragen bringen dumme Tiere hervor, die von Menschen analysiert werden, die sogar noch dümmer werden. Kluge Fragen befördern kluge Tiere zutage, die Lesern, indem ihre Taten niedergeschrieben werden, ein besseres Verständnis von der Welt beibringen können. Liest man Despret, steht außer Frage, dass die Welt an Komplexität gewinnt und dass das, was es bedeutet, belebt zu sein, eine tiefgreifende Metamorphose durchläuft.
Der Grund aber, weshalb dieses Buch der neuen Textgattung der wissenschaftlichen Fabeln zuzurechnen ist, ist der, dass jedes Kapitel mit einer Moral endet. Nicht mit den etwas faden moralischen Lektionen, die La Fontaine ans Ende seiner Geschichten zu setzen pflegte, sondern ganz im Gegenteil, mit einer Reihe äußerst kühner philosophischer Lektionen. In gewisser Weise ist Desprets Fabliau nichts geringeres als ein Buch über wissenschaftliche Methoden, das nicht nur von jungen Wissenschaftlern gelesen werden könnte, die eine Karriere im Bereich der Ethologie beginnen, sondern auch von all jenen, die sich nie sicher sind, wie sie mit wissenschaftlichen Neuigkeiten über »ihre« Tiere umgehen sollen.
In gewisser Weise kann das Buch als eine Aneinanderreihung moralischer Erzählungen gelesen werden, die nicht nur davon handeln, wie Wissenschaft betrieben werden soll, sondern auch – was die Leserschaft allgemein anbetrifft – davon, wie wir an uns selbst unsere eigenen ethischen Reaktionen überprüfen können. Das trifft ganz besonders auf die Frage zu, wie Nutztiere behandelt werden – ein sehr schwieriges Thema. Wie kann selbst bei einem derart sensiblen Thema die Frage nach der Agency über eine hinzufügende und nicht wegnehmende Form der Empirie weiterhin gestellt werden? In einer Fabel, die den Titel »Der Landwirt und die arbeitende Kuh« tragen könnte, erwähnt Despret eine Studie ihrer Freundin Jocelyne Porcher, die insbesondere dafür steht, »Menschen und Tiere, Landwirte und ihre Tiere, immer zusammenzudenken. Tiere nicht länger als Opfer zu betrachten, bedeutet zu denken, dass eine Beziehung etwas anderes sein kann als Ausbeutung. Gleichzeitig bedeutet es, eine Beziehung zu denken, in der Tiere, weil sie in Bezug auf ihre Natur oder ihre Kultur keine Trottel sind, sich selbst aktiv einbringen, in der sie geben, sich austauschen, empfangen und in der Landwirte, weil es sich um keine Ausbeutung handelt, geben, empfangen, sich austauschen und gemeinsam mit ihren Tieren wachsen.«[1]
Warum ist es so schwer, Agency nicht zu leugnen, wenn es dabei um Tiere geht? Es liegt an dieser seltsamen Absicht, Entitäten, aus Angst, ihnen das Belebtsein übermäßig zuzugestehen (das heißt: ihnen eine Art Seele zu geben), Selbiges ganz abzusprechen. Desprets Ansatz macht so außergewöhnlich, dass sie genau die Literatur, die den Tieren das Belebtsein abzusprechen sucht, mit dem ausdrücklichen Ziel verwendet, zu zeigen, wie belebt diese ist. Doch belebt ist ebenso weit von eine Seele haben entfernt wie davon, als Computer zu agieren. Das zu zeigen gelingt ihr nicht nur anhand von Beispielen aus dem Behaviorist Turn (der mittlerweile zur Fundgrube für lustige Anekdoten geworden ist), sondern auch anhand von Fällen aus dem Sociobiological Turn, im Zuge dessen Gene mit so viel kausaler Agency ausgestattet waren, dass für die von ihren selbstsüchtigen Genen geleiteten Tiere nichts mehr übrig blieb, was sie »von alleine« tun konnten. Reduktionismus ist in vielerlei Hinsicht ein unerreichbares Ideal, sobald man anfängt, den Versuchsaufbau hervorzuheben, mit dem die »Reduktion« erreicht wird. Von Mal zu Mal ergeben sich immer mehr interessante Fragen.
Dieser inhärente Widerspruch tritt bei niemandem so deutlich hervor wie bei Lorenz. In einer Fabel, die den Titel »Der Pfau und die Wissenschaftler« tragen könnte, schreibt Despret: »Die Ethologen, die [Lorenz] dann folgen, haben gelernt, Tiere als nur ›reagierende‹ statt als ›fühlende und denkende‹ Lebewesen anzusehen und jegliche Möglichkeit, individuelle und subjektive Erfahrungen einzubeziehen, auszuschließen. Die Tiere werden verlieren, was eine entscheidende Bedingung für die Beziehung gewesen war, nämlich die Möglichkeit, den, der sie analysiert, zu überraschen. Alles wird vorhersehbar. Beweggründe werden durch Handlungsursachen ersetzt, seien sie nun vernünftig oder unrealistisch, und das Wort ›Initiative‹ weicht dem Begriff ›Reaktion‹«.[2] Nur dass uns Lorenz außerdem als derjenige in Erinnerung geblieben ist, der viele der früheren Herangehensweisen voll Respekt und Aufmerksamkeit gegenüber dem überraschenden Verhalten der Tiere restauriert hat. Ist Lorenz also letzten Endes ein Empiriker, der hinzufügt, oder einer, der wegnimmt? Ach, würde doch nur Tschok die Dohle die Geschichte aus seiner Perspektive erzählen können!
Für mich ist der Hauptgrund, warum die Fabel für Fabel aufgerollten moralischen Erzählungen für die Scientific Humanities und allgemeiner für die Philosophie so wichtig sind, dass das, was Despret in Bezug auf Tiere, vor allem des 20. Jahrhunderts, in ihrer Beziehung zu Menschen zeigt, das ist, was in früheren Jahrhunderten mit physikalischen, chemischen und biochemischen Entitäten passiert ist. Die endlose Zahl von Beziehungen, die Menschen mit Materiellem hatten, war auf eine viel kleinere Menge von Verbindungen mit dem, was später »Materie« genannt wird, reduziert worden. Materialität und Materie sind ebenso verschiedene Phänomengruppen wie es der Affe, den Shirley Strum vor Ort beobachtet (vgl. die Fabel »Der Pavian und die Frau aus Berkeley«), und der Affe, der in den 1970er-Jahren im Labor eines Behavioristen sitzt, sind. Heute wird es so sehr als selbstverständlich angesehen, andere Stimmen, Sichtweisen, Fähigkeiten und Gewohnheiten auszuschließen, dass wir nicht mitbekommen und uns auch nicht vorstellen können, dass erst umfassende Prozesse dazu geführt haben, Agencys zu regulieren und, auch hier, Materialität mit einigem Nachdruck das Belebtsein abzusprechen, um am Ende so etwas wie »eine materielle Welt« zu erhalten. Und in ebendiese stark vereinfachte »materielle Welt« müssen die armen Tiere – die Menschen inbegriffen – gesteckt werden und darin sollen sie mit Müh und Not überleben.
Wurdet ihr aber erst einmal von Desprets großmütiger Lehre angesteckt, könnt ihr gar nicht mehr damit aufhören, das Gelernte auch auf andere Dinge zu übertragen, zum Beispiel in der Physik und der Chemie. Schließlich war es Alfred North Whitehead, welcher ebenfalls großen Einfluss auf ihre Methode hatte, der forderte, dass wir auch in der Physik lernen sollten, als Empiriker wieder hinzuzufügen und nicht wegzunehmen: »Für die Naturphilosophie ist alles Wahrgenommene in der Natur. Wir sollen nicht etwas herausgreifen und auswählen. Für uns sollte das rote Sonnenuntergangslicht ebenso ein Teil der Natur sein wie die Moleküle und elektrischen Wellen es sind, anhand derer Wissenschaftler das Phänomen erklären würden. Die Naturphilosophie muss analysieren, wie diese verschiedenen natürlichen Elemente miteinander verbunden sind.«[3] Die Schönheit von Desprets Arbeit liegt darin, dass sie in der Tat eine »Naturphilosophin« ist, die nicht nur die Themen, mit denen sich die Philosophie normalerweise beschäftigt, vollständig rehabilitiert, sondern auch die potenziellen Agencys, mit denen die »Natur« ausgestattet ist. Und darüber hinaus tut sie dies mit einer stilistischen Neuschöpfung, den wissenschaftlichen Fabeln, die in ihrem Rhythmus, ihrem Humor, ihrem umfassenden Wissen über so viele Experimente und ihre Umstände exakt das nachahmen, zu dem wir gemeinsam mit intelligenten Tieren wieder eine Verbindung herstellen müssen, welche von den schlauen Gerätschaften von Wissenschaftlern, die diese intelligent entworfen haben, dazu gebracht werden, intelligente Sachen zu sagen – wobei diese all jene sind, die sich darin zusammengefunden haben. Wagt folgendes Gedankenexperiment: Vergleicht das, wozu Wölfe, Affen, Raben, Kühe, Schafe, Delfine und Pferde vor dreißig Jahren fähig gewesen sein sollen, mit den Fähigkeiten, mit denen sie heute ausgestattet sind. Ein völlig neues Universum von Fähigkeiten hat sich aufgetan.
Das Problem und zudem das, was Desprets Arbeit sogar noch interessanter macht, besteht darin, dass eine derartige Expansion der Fähigkeiten wie bei den Tieren nicht parallel auch bezüglich dessen stattfindet, wozu »menschliche« agents angeblich fähig sind. An dieser Stelle wird ihre Arbeit für die politische Philosophie bedeutsam. Das ist es, was Donna Haraway, die ebenfalls Desprets Sicht entscheidend beeinflusst hat, unternahm, als sie die gegenseitige Beziehung, die sie mit ihrem Hund Cayenne aufgebaut hatte, als Beispiel nannte für die Art von Aufmerksamkeiten, die wir aufbringen müssten, um wieder politische agents zu werden. Da sie der Aufmerksamkeit, die ihnen andere, tierische Gefährten schenkten, beraubt wurden, haben die Menschen die Fähigkeit verloren, sich wie Menschen zu verhalten. Das gibt dem Kampf gegen den Anthropomorphismus seine Ironie: Die meisten Menschen werden von den Soziologen oder Ökonomen heutzutage nicht ebenso großzügig behandelt, wie Wölfe, Raben, Papageien und Affen von ihren Wissenschaftlern behandelt werden. Mit anderen Worten: Ein Buch mit dem Titel Was würden Menschen sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen? muss erst noch geschrieben werden. Sicher aber ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und wenn wir die Sache in Vinciane Desprets zuverlässige Hände legen, dass Tiere zahlreiche moralische Geschichten erzählen können, die immensen Nutzen haben könnten, wenn ihre Wissenschaftler den Menschen denn erlauben würden, sie sich anzuhören.
A
wie
Danksagung
Ich danke Éric Baratay, Éric Burnand, Annie Cornet, Nicole Delouvroy, Michèle Galant, Serge Gutwirth, Donna Haraway,
Jean-Marie Lemaire, Jules-Vincent Lemaire, Ginette Marchant,
Marcos Mattéos-Diaz, Philippe Pignarre, Jocelyne Porcher,
Olivier Servais, Lucienne Strivay, François Thoreau
und ganz besonders danke ich Laurence Bouquiaux, Isabelle Stengers und Evelyne Van Poppel.
A
wie
Wie dieses Buch gelesen werden soll
Dies hier ist kein Wörterbuch. Aber es kann wie ein Nachschlagewerk genutzt werden. Wenn ihr Ordnung mögt, könnt ihr es in alphabetischer Reihenfolge lesen. Es ist aber auch möglich, mit irgendeinem Kapitel anzufangen, das euch gerade interessiert oder neugierig macht. Ich hoffe, dass euch dieses Buch überrascht. Dass ihr nicht das findet, was ihr gesucht und erwartet habt. Ihr könnt das Buch in der Mitte öffnen und schauen, welche Seite ihr zufällig in die Finger kriegt oder worauf ihr gerade Lust habt. Oder aber ihr folgt den Querverweisen im Text, die euch jeweils zu den passenden Kapiteln führen. Wie ihr an das Buch herangeht und es lest, will ich euch nicht vorschreiben.
A
wie
Anmut
Dumm wie ein Maler?
»Dumm wie ein Maler.« Dieses französische Sprichwort geht mindestens auf die Zeit von Murgers Bohème zurück, um 1880, und wird immer noch scherzhaft in Gesprächen vorgebracht. Warum sollte ein Künstler als weniger intelligent gelten als irgendwer sonst?
Marcel Duchamp,
»Soll der Künstler an die Universität gehen?«[1]
Ist es möglich, mit einem Pinsel an der Schwanzspitze zu malen? Eine mögliche Antwort liefert das berühmte Gemälde Sonnenuntergang über der Adria, das im Jahr 1910 in der alljährlich stattfindenden Pariser Kunstausstellung im Salon des Indépendants gezeigt wurde. Es ist das Werk von Joachim-Raphaël Boronali und sollte sein einziges Gemälde bleiben. Boronali hieß in Wahrheit Lolo. Und er war ein Esel.
In den vergangenen Jahren haben einige Tiere eine altbekannte Diskussion wieder losgetreten, unter anderem dadurch, dass ihre Werke über das Internet verbreitet wurden (• Youtube). Können wir ihnen zugestehen, dass sie Künstler sind? Die Vorstellung, dass Tiere ein Kunstwerk erschaffen oder an seiner Entstehung mitwirken können, ist nicht neu – lassen wir Boronali einmal außen vor, dabei handelt es sich ja eher um eine Anekdote und die Frage stellt sich hier nicht wirklich. Allerdings haben Tiere schon oft und seit Langem (im Guten wie im Schlechten) bei den unterschiedlichsten Showeinlagen mitgewirkt, was einige Dresseure dazu bewegt hat, sie als echte Künstler zu sehen (• Experiment). Wenden wir uns der Malerei zu, finden wir heute viele, wenn auch sehr kontrovers diskutierte, Kandidaten.
In den Sechzigern löste Congo, der Schimpanse des berühmten Zoologen Desmond Morris, mit seinen abstrakten impressionistischen Malereien eine Debatte aus. Congo, der im Jahr 1964 verstarb, hat seine Nachahmer gefunden, und so können wir heute im Zoologischen Garten von Niterói – einer Stadt zwischen Rio de Janeiro und der Guanabara-Bucht – tagtäglich Jimmy zuschauen, einem Schimpansen, der sich so sehr gelangweilt hat, dass sein Pfleger auf die Idee kam, ihm Malsachen zu geben. Noch berühmter als Jimmy, und vor allem auf dem Kunstmarkt erfolgreicher, ist das Pferd Cholla, das mit seinem Mund abstrakte Werke malt. Tillamook Cheddar ihrerseits war eine Jack-Russel-Terrier-Dame aus Connecticut, die der Öffentlichkeit ihr Können zeigte, und zwar mithilfe einer Vorrichtung, die sich ihre Eigenschaften als Jagdhündin (und vor allem als sehr ungeduldiges Tier) zunutze machte. Ihr Herrchen bedeckte eine weiße Leinwand mit innen farbigem Kohlepapier, das die Hündin mit Maul und Pfoten beherzt attackierte. Während sie an ihrem Werk arbeitete, wurde sie von einem Jazzorchester begleitet. Nach gut zehn Minuten, in denen die Hündin leidenschaftlich in ihre Arbeit versunken war, nahm ihr Herrchen die Leinwand und entfernte das Kohlepapier. Zu sehen war eine Zeichnung mit ein oder zwei Knäueln aus unruhigen Linien. Die Videos von diesen Aufführungen zirkulieren überall im Internet. Zugegebenermaßen ist fraglich, ob hier wirklich die Intention vorliegt, ein Kunstwerk zu erschaffen – unabhängig davon, was am Ende dabei herauskommt. Aber ist das wirklich die Frage, die wir uns stellen sollten?
Ein besseres Beispiel ist (auf den ersten Blick zumindest), was man bei Elefanten im Norden Thailands beobachten kann. Seitdem in Thailand der Einsatz von Elefanten für den Holztransport gesetzlich verboten wurde, haben sie keine Arbeit mehr. Weil sie nicht mehr in der freien Natur leben können, kamen sie auf Gnadenhöfe. Die bekanntesten Videos, die im Netz verbreitet werden, sind im Maetang Elephant Park gedreht worden, der rund fünfzig Kilometer von Chiang Mai entfernt ist.[2] Darin ist ein Elefant zu sehen, der etwas malt, das die Macher der Videos ein Selbstporträt genannt haben. Hierbei handelt es sich um einen stark stilisierten Elefant, der eine Blume im Rüssel trägt. Bleibt noch zu klären, was die Kommentatoren dazu verleitet hat, dieses Bild ein »Selbstporträt« zu nennen. Wenn ein Außerirdischer einen Menschen beobachten würde, der aus dem Gedächtnis das Porträt eines Menschen malt, würde er das dann womöglich auch als Selbstporträt bezeichnen? Haben die Kommentatoren unserer Videos Schwierigkeiten, Individualität zu erkennen, oder ist das ein alter Reflex? Ich tendiere zu Letzterem: ein Reflex. Dass, wenn ein Elefant einen Elefanten malt, dies automatisch als Selbstporträt wahrgenommen wird, kommt bestimmt von dieser seltsamen Überzeugung, dass alle Elefanten untereinander austauschbar wären. Die Identität von Tieren reduziert sich oft auf ihre Zugehörigkeit zu einer Art.
Wenn man sich die Bilder dieses Elefanten bei der Arbeit anschaut, wundert man sich zwangsläufig: Die Präzision und Genauigkeit, die Art, wie das Tier in das vertieft ist, was es tut, all das scheint dem zu entsprechen, woran wir eine künstlerische Intention erkennen. Aber wenn wir uns das Ganze einmal genauer anschauen, wenn wir uns fragen, wie das Ganze genau abläuft, können wir nachlesen, dass diese Arbeit das Resultat jahrelanger Übung ist. Dass die Elefanten zuerst lernen mussten, auf von Menschen angefertigten Skizzen zu zeichnen, und dass es genau diese Skizzen sind, die sie jetzt unermüdlich reproduzieren. Wenn wir genauer darüber nachdenken, wäre alles andere auch verwunderlich gewesen.
Desmond Morris interessiert sich ebenfalls für diese malenden Elefanten.[3] Er will eine Reise in den Süden Thailands nutzen, um sich das einmal genauer anzusehen. Sein Aufenthalt ist zu kurz, um auch in den Norden zu dem Gnadenhof bei Chiang Mai zu reisen, der die Elefanten und ihre Kunst berühmt gemacht hat, aber es gibt Ähnliches im Nong Nooch Tropical Garden zu sehen. Nach einer Vorführung schreibt er: »Die meisten unter den Zuschauern meinten, einem Wunder beizuwohnen. Elefanten müssen, was ihre Intelligenz angeht, fast schon menschlich sein, wenn sie so wie hier Bilder von Blumen und Bäumen malen können. Worauf das Publikum aber nicht geachtet hat, sind die Handbewegungen der Elefantenführer, während ihre Tiere gearbeitet haben.« Schauen wir nämlich genau hin, so fährt er fort, dann sehen wir, dass der Elefantenführer bei jedem Pinselstrich, den der Elefant malt, das Ohr des Elefanten streift. Von oben nach unten für die vertikalen Linien, seitwärts für die horizontalen. So, folgert Morris, »ist das Bild, das der Elefant malt, leider nicht sein eigenes Werk, sondern das des Menschen. Auf Seiten des Elefanten steckt keine Intention dahinter, keine Kreativität, nur braves Nachahmen.«
Das nennt man dann einen Spielverderber. Es überrascht mich immer wieder, mit welchem Eifer manche Wissenschaftler diese Rolle übernehmen und mit welch bewundernswertem Heroismus sie die traurige Aufgabe angehen, schlechte Neuigkeiten zu überbringen – wenn es sich nicht gerade um den männlichen Stolz derer handelt, die sich nicht wie alle anderen täuschen lassen. Sie sind übrigens nicht nur Spielverderber, sie befinden sich mit ihrem »Es ist nichts weiter als …« auf einem regelrechten Feldzug der Entzauberung, wie das eben so ist, wenn Wissenschaftler sich zugunsten der Wahrheit aufopfern, die uns die Augen öffnen soll. Aber diese Entzauberung findet nur auf Kosten eines schweren (und vielleicht auch nicht sehr ehrlichen) Missverständnisses darüber statt, was hier eigentlich bezaubert und Freude bereitet. Dieses Missverständnis fußt auf der Annahme, dass die Menschen voller Naivität an Wunder glauben. Anders gesagt kann etwas nur so leicht entzaubert werden, wie sich darin geirrt wird, was den Zauber ausgemacht hat.
Dem, was dem Publikum dargeboten wird, wohnt nämlich sehr wohl ein gewisser Zauber inne. Aber dieser Zauber liegt nicht dort, wo Desmond Morris ihn vermutet. Da ist vielmehr etwas, das etwas mit einer gewissen Anmut zu tun hat. Eine Anmut, die man in den Videos sehen und sogar noch besser wahrnehmen kann, wenn man das Glück hat, vor Ort dabei zu sein – ich hatte dieses Glück, kurz nachdem ich die erste Version dieses Buchs geschrieben hatte.
Dieser Zauber liegt in der großen Aufmerksamkeit, die das Tier jeder einzelnen Linie widmet, die es mit dem Rüssel zeichnet. Schlichte, präzise und zielgerichtete Linien. Wie es dennoch manchmal inne hält, für einen kurzen Moment, einige Sekunden lang zögert, und uns eine feine Mischung aus Entschiedenheit und Zurückhaltung zeigt. Das Tier, würde man sagen, ist ganz in seinem Element. Aber der Zauber offenbart sich vor allem in der Anmut, mit der beide Lebewesen miteinander im Einklang sind. Er liegt in dem Gelingen, dass Menschen und Tiere zusammen bewerkstelligen, und darin, dass sie dabei glücklich – ich würde sogar sagen: stolz – wirken. Und genau diese Anmut erkennt das Publikum an und sie ist der Grund, warum es begeistert applaudiert. Ob die Tiere auf irgendeine Weise dressiert wurden oder nicht, ob dem Elefanten etwa die Richtung für die Linien, die er zeichnen soll, heimlich gezeigt wird, ist hier nicht das, worauf es für diejenigen ankommt, die sich die Aufführung anschauen. Was diese Menschen interessiert, ist, dass das, was hier passiert, bewusst uneindeutig gelassen wird, dass noch Raum bleibt für Zweifel – ob Zweifel nun angebracht sind oder einfach erlaubt. Es gibt keine endgültige Antwort auf die Frage, was hier gerade passiert. Und genau dieser Zweifel, ähnlich dem, den wir zulassen können, wenn wir einem Zaubertrick beiwohnen, trägt dazu bei, dass wir für die Anmut und den Zauber empfänglich werden.
Ich werde also in dieser Diskussion beim Thema bleiben und nicht argumentieren, dass die Elefantenführer bei der Aufführung in Maetang, anders als bei der in Nong Nooch, nicht die Ohren ihrer Elefanten berühren. (Was ich im Übrigen gar nicht sagen könnte, hätte ich mir nicht die Fotos noch einmal angesehen, die ich dort gemacht habe.) Noch unwichtiger wird dieses Argument, da ja wieder irgendein Spielverderber erwidern könnte, es müsse irgendetwas anderes geben, jeder Gnadenhof müsse seinen eigenen Trick haben, der mir nicht aufgefallen ist. Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, dass die Elefanten im Süden, anders als die im Norden, am Ohr gestreichelt werden müssen, um zu malen? Oder darauf, dass manche Elefanten mit ihren Ohren malen; es wird ja auch von den Elefanten im Süden, im Norden und selbst von denen in Afrika gesagt, dass sie mit den Fußsohlen hören.
Das Bedauern, das mitschwingt, wenn Desmond Morris sagt, dass das vom Elefanten gemalte Bild »leider nicht sein eigenes Werk« sei, lehne ich also ab, da ich das damit verbundene großzügige Angebot der Entzauberung ablehne. Natürlich ist das Bild nicht das Werk des Elefanten. Wer würde das infrage stellen?
Ob es sich nun um einen Trick handelt oder ob der Elefant gelernt hat, brav nachzuahmen, was man ihm beigebracht hat, wir kehren immer wieder zur selben Frage zurück. Nämlich, ob er »von sich aus gehandelt hat«. Ich habe gelernt, die Art, wie an diese Frage herangegangen wird, mit Vorsicht zu betrachten. Ich habe während meiner Recherchen festgestellt, dass Tieren viel schneller als Menschen unterstellt wird, nicht autonom zu handeln. Das ist umso mehr der Fall, wenn es um Verhaltensweisen geht, die lange Zeit als sicheres Unterscheidungsmerkmal von Menschen und Tieren galten. Zum Beispiel kulturelle Praktiken, wie jene kürzlich zu aller Verwunderung auf einem Gnadenhof in Kamerun beobachtete, als eine Gruppe Schimpansen über den Tod eines ihrer besonders geliebten Artgenossen trauerte. Weil dieses Verhalten erst auf Initiative der Pfleger hin ermöglicht worden war, die den Körper des Verstorbenen seinen Liebsten zeigten, ließen die Kritiker nicht lange auf sich warten: Das sei keine Trauer, die Schimpansen hätten sie spontan zeigen müssen, irgendwie »von sich aus« (• Varianten). Als ob wir unsere eigene Trauer angesichts des Todes selbst erschaffen hätten und als ob wir nicht Maler oder Künstler werden würden, indem wir die Handgriffe von denen, die uns vorausgingen, lernen, indem wir Motive, die jemand vor uns erdacht hat, wieder und wieder aufnehmen und fortführen, wie es jeder einzelne Künstler tut.
Sicher, die Sache ist sehr viel komplizierter. Aber wenn wir sie auf ein Entweder-oder reduzieren, vertun wir die Chance, dass die Angelegenheit kompliziert oder gar interessant wird.
In den Szenen, die wir uns hier ansehen, entsteht das Kunstwerk anscheinend nicht durch das Handeln eines einzelnen Lebewesens, sei es nun ein Mensch ( »Alles ist auf die Intention des Menschen zurückzuführen«, wie manche sagen) oder ein Tier (es ist ja schließlich der Urheber des Werkes). Worum es hier geht, ist ein komplexes Zusammenspiel: Jedes einzelne Mal handelt es sich um eine Konstellation, in der ein intentionales Zusammenspiel entsteht, das sich in heterogene organische Netzwerke einfügt, und darin spielen – wenn wir bei den Elefanten bleiben – die Gnadenhöfe eine Rolle, die Pfleger, die verblüfften Touristen, die dann Fotos machen, die sie im Internet verbreiten, und die die Kunstwerke mit in ihre Länder nehmen, die NGOs, die diese Kunstwerke verkaufen und den Erlös den Elefanten zukommen lassen, die Elefanten, die keine Arbeit mehr haben, weil gesetzlich verboten wurde, dass sie Holz transportieren …
Ich kann die Frage, ob Tiere Künstler sind, also letztlich nicht beantworten, sei es in dem Sinne, in dem wir es sind, oder in einem ganz anderen (• originell). Allerdings kann ich davon sprechen, dass etwas gelingt. Diese Terminologie hat sich aus dem, was ich auf diesen Seiten schreibe, ergeben und aufgedrängt: Tiere und Menschen erschaffen zusammen etwas. Und sie tun das mit einer Freude und Lust an dem, was sie erschaffen. Wenn ich bei diesen Begrifflichkeiten bleibe, dann, weil ich das Gefühl habe, dass sie uns für diese Anmut und für alle Erfahrungen, die sich daraus wiederum ergeben, sensibilisieren. Kommt es nicht letztendlich genau darauf an? Solche Weisen zuzulassen, über etwas zu sprechen, es zu beschreiben und davon zu erzählen, dass wir auf diese Erfahrungen mit Sensibilität reagieren.
B
wie
Bedürfnisse
Ist es unangebracht, vor Tieren zu pinkeln?
Niemand weiß, wozu der Körper fähig ist, schrieb einst der Philosoph Spinoza. Ich weiß nicht, ob Spinoza damit einverstanden wäre, wie ich seine Gedanken fortführe, aber ich finde, dass er eine sehr schöne experimentelle Möglichkeit gefunden hat, wie dieses Rätsel, das die Praktiken mancher Ethologen aufgeben, ergründet werden kann: »Wir wussten nicht, wozu unsere Körper fähig sind, bis wir es gemeinsam mit unseren Tieren gelernt haben.« So haben mehrere Primatologinnen angemerkt, dass die Arbeit in der Natur ihren Menstruationszyklus teilweise deutlich beeinflusste. Um nur eine zu zitieren: Janice Carter berichtet, dass ihr Menstruationszyklus vollkommen durcheinandergeriet, als sie mit weiblichen Schimpansen zusammenlebte, die ausgewildert werden sollten. Ihr Zyklus reagierte auf die schlagartig veränderten Lebensbedingungen mit einer Amenorrhoe von sechs Monaten. Als ihre Regelblutung zurückkehrte, pendelte sie sich in einem unerwarteten Rhythmus ein: Während der folgenden Jahre der Forschung vor Ort glich sie sich an den der Schimpansenweibchen an, sodass ihr Zyklus fünfunddreißig Tage dauerte.
Dass Ethologen über ihren Körper berichten, kommt allerdings nicht besonders häufig vor. Wenn überhaupt, dann erwähnen sie ihn nur kurz nebenbei und meistens geht es dabei dann um ein praktisches Problem, das gelöst werden muss. Allerdings finden wir bei manchen von ihnen explizit oder implizit Geschichten, in denen ihr Körper auf eine ganz bestimmte Weise aktiv einbezogen wird: als Mittel der Mediation.
Eines der Beispiele, in denen dies auf explizitere Weise geschieht, analysierte die Philosophin Donna Haraway, als sie über die Feldforschung der Primatologin und Pavian-Expertin Barbara Smuts sprach. Als Barbara Smuts ihre Feldforschung im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania begann, wolle sie so vorgehen, wie man es ihr beigebracht hatte. Um die Tiere an einen zu gewöhnen, müsse man lernen, sich ihnen erst nach und nach zu nähern. Um sie nicht zu beeinflussen, müsse man sich so verhalten, als wäre man unsichtbar, so, als wäre man gar nicht da (• Reaktion). Es ginge darum, »wie ein Stein zu sein«, sagt sie, »nicht ansprechbar zu sein, sodass die Paviane am Ende ihren Beschäftigungen nachgingen, als wäre der Mensch, der neben ihnen seine Fakten sammelt, gar nicht da«.[1] Ein guter Forscher ist also einer, der die Natur aus nächster Nähe beobachten kann, so, als würde er »durch ein Loch in der Wand« gucken, weil er lernt, unsichtbar zu sein. Habituierung zu erzielen, indem man sich unsichtbar macht, ist allerdings ein sehr langsamer, anstrengender Prozess, der oft scheitert. Das können sämtliche Primatologen bestätigen. Und wenn der Prozess scheitert, dann aus einem einfachen Grund: Weil diese Methode auf der Annahme aufbaut, dass Pavianen Gleichgültigkeit gleichgültig wäre. Smuts war bei ihren Bemühungen nicht entgangen, dass die Paviane sie oft ansahen, und je mehr sie ihren Blick nicht erwiderte, desto weniger schienen sie damit zufrieden zu sein. Die einzige Kreatur, für die diese angeblich neutrale Wissenschaftlerin unsichtbar war, war sie selbst. Soziale Interaktion zu ignorieren, ist alles andere als neutral. Die Paviane müssen jemanden wahrgenommen haben, den sie nicht einordnen konnten, jemanden, der so tat, als wäre er nicht da, und sie müssen sich gefragt haben, ob sie diesem jemand beibringen könnten, wie sich ein höflicher Gast bei den Pavianen verhält. Tatsächlich lässt sich alles darauf zurückführen, wie die Tiere von den Forschern wahrgenommen werden. Die Fragen stellt der Forscher. Und der ist oft weit davon entfernt, sich vorstellen zu können, dass sich die Tiere genauso viele und manchmal sogar dieselben Fragen über ihn stellen! Es wird gefragt, ob Paviane soziale Wesen sind oder nicht, ohne dabei auf den Gedanken zu kommen, dass sich die Paviane genau dieselbe Frage in Bezug auf diese seltsamen Kreaturen, die sich so komisch verhalten, stellen müssen: »Sind Menschen soziale Wesen?« Offensichtlich sind sie es nicht. Und dementsprechend verhalten sich die Paviane, und flüchten zum Beispiel vor ihrem Beobachter oder verhalten sich anders als sonst oder seltsam, weil die Situation sie verwirrt. Wie Smuts das Problem gelöst hat, ist schnell erzählt. Die Umsetzung aber war alles andere als leicht. Sie fing an, sich ähnlich zu verhalten wie die Paviane. Sie übernahm ihre Körpersprache und lernte, wie man sich bei ihnen richtig verhält. Sie schreibt: »In diesem Prozess, in dem ich ihr Vertrauen zu gewinnen versuchte, habe ich fast alles an mir verändert, auch meine Art zu laufen und zu sitzen, meine Körperhaltung und wie ich meine Augen und meine Stimme gebrauchte. Ich lernte, auf eine völlig neue Weise – die der Paviane – auf der Welt zu sein.«[2] Sie übernahm die Art der Paviane, miteinander umzugehen. Das bedeutete paradoxerweise, dass sie in dem Moment, als die Paviane begannen, ihr böse Blicke zuzuwerfen, damit sie sich entfernte, große Fortschritte machte. Denn sie wurde nicht mehr wie ein Objekt behandelt, das es zu meiden galt, sondern als ein vertrauenswürdiges Subjekt, mit dem sie kommunizieren konnten. Ein Subjekt, das sich entfernt, wenn man es dazu auffordert, und mit dem klare Verhältnisse geschaffen werden können.
Haraway verbindet diese Geschichte mit einem neueren Artikel von Smuts, in dem diese über die Rituale schreibt, die ihr Hund Basmati und sie gemeinsam erschaffen und die ihr zufolge einer verinnerlichten Kommunikation entspringen. Eine Choreografie, kommentiert Haraway, ein Zeichen gegenseitigen Respekts im etymologischen Sinn des Wortes: in dem Sinne, dass der Blick erwidert wird, dass beide lernen, zu antworten, aufeinander zu antworten und Verantwortung zu übernehmen.
Aber wir können Smuts’ Text auch so interpretieren, dass er den sehr empirischen und zugleich hypothetischen Rahmen zu dem bildet, das der Soziologe Gabriel Tarde als eine Interphysiologie bezeichnet, eine Wissenschaft des Zusammenkommens der Körper.[3] Wenn wir diese Perspektive einnehmen, knüpft der Körper wieder an das an, was Spinoza einst gesagt hat: Er wird zu dem Ort für das, was affizieren und affiziert sein kann, der Ort für Veränderungen. Betonen wir zuerst einmal, dass das, was Smuts beschreibt, die Möglichkeit ist, zwar nicht durch eine Metamorphose der andere zu werden, aber mit dem anderen zu werden. Nicht, um nachzuempfinden, was der andere denkt oder fühlt, wie es das sperrige Konzept der Empathie nahelegen würde, sondern um in gewisser Weise die Möglichkeit zu erhalten und zu erschaffen, eine Beziehung einzugehen, in der ein Austausch stattfindet und Nähe herrscht, in der es aber nicht darum geht, sich mit dem anderen zu identifizieren. In gewisser Weise ist es tatsächlich so, dass getan wird, als ob, was dazu führt, dass man eine Veränderung durchläuft, wobei das Ergebnis bewusst ein Artefakt ist, das weder Authentizität vortäuschen kann und will, noch zu einer Art romantischer Vereinigung führen soll, von der oft gesprochen wird, wenn es um Beziehungen zwischen Menschen und Tieren geht.
Von dieser romantischen Vorstellung eines friedlichen Aufeinandertreffens sind wir übrigens weit entfernt, wenn Smuts betont, dass ihr dieser Prozess dann deutlich wurde, als die Paviane ihr irgendwann zu verstehen geben konnten, dass es möglicherweise zu einem Konflikt kommen könnte, indem sie ihr böse Blicke zuwarfen. Dass es zu einem Konflikt kommen könnte und dass man darüber verhandeln kann – genau das ist die Voraussetzung für eine Beziehung.
Bleiben wir bei den Pavianen. In den Texten einer anderen Primatologin finden wir eine andere Diskussion des Körpereinsatzes. Shirley Strum berichtet in ihrem Buch Almost Human, dass eine der Schwierigkeiten, mit denen sie seit Beginn ihrer Forschung vor Ort konfrontiert war, darin bestand herauszufinden, was sie in Anwesenheit der Paviane mit ihrem Körper tun durfte und was nicht.[4] Diese Frage stellte sich zum Beispiel, wenn sie dringend pinkeln musste. Sie hätte weggehen können, um sich hinter ihrem Wagen zu verstecken, der recht weit entfernt geparkt war. Aber sie stand vor einem großen Dilemma: Mit großer Wahrscheinlichkeit passiert genau in dem Moment, in dem der Forscher nicht da ist (und diese Sorge habe ich viele Feldforscher äußern hören), etwas Interessantes, das nur sehr selten passiert. So beschloss Strum letztendlich, nicht ohne Sorge, nicht länger hinter ihren Wagen zu gehen. Sie entkleidete sich sehr, sehr vorsichtig und schaute sich dabei immer wieder um. Die Paviane waren überrascht über das Geräusch, sagt sie. Tatsächlich hatten sie noch nie gesehen, wie sie etwas aß, trank oder schlief. Natürlich wissen Paviane, was Menschen sind, aber sie kommen ihnen nie besonders nahe und mussten Strum zufolge geglaubt haben, dass sie keine körperlichen Bedürfnisse haben. So fanden sie es aber heraus und zogen gewisse Schlüsse daraus. Beim nächsten Mal zeigten sie keinerlei Reaktion mehr. Wir können auf Grundlage dessen, was Strum beschreibt, nur mutmaßen. Sicherlich verdankt sie ihren Ruhm vielen Aspekten ihrer Feldforschung, ihrer Arbeit, ihrer Beobachtungsgabe, ihrer Vorstellungskraft, ihrem Interpretationsgespür und ihrer Fähigkeit, Verbindungen zwischen Ereignissen zu sehen, die nicht zusammenzugehören scheinen. Sie verdankt ihren Erfolg ebenfalls ihrem Taktgefühl, das sie stets an den Tag legte, wenn sie ihren Tieren begegnete, wovon die von ihr gestellte Frage zeugt: Ist es unangebracht, vor Pavianen zu pinkeln? Ich komme aber nicht umhin anzunehmen, dass ihr Erfolg (diese erstaunliche Beziehung, die sie mit den Pavianen gemeinsam herstellen konnte) vielleicht auch von dem herrührt, was diese an jenem Tag entdeckten: dass die Forscherin, genauso wie sie, einen Körper hat. Wenn man liest, was Shirley Strum und Bruno Latour über die gesellschaftliche Ordnung bei Pavianen und über die Komplexität ihrer Beziehungen geschrieben haben, dann dürfte diese Entdeckung für sie nicht unbedeutend gewesen sein.[5] Weil Paviane nicht in einer materialistischen Gesellschaft leben, weil sie ihre sozialen Beziehungen nicht festigen können und weil jegliche noch so kleine Störung in einer Beziehung auch die anderen auf unvorhersehbare Weise beeinflusst, muss jeder Pavian konstant verhandeln und immer wieder neu verhandeln, um das Netz aus Allianzen stets erneut zu erarbeiten. Bei dieser gesellschaftlichen Verpflichtung geht es um Kreativität, es geht darum, tagtäglich eine fragile soziale Ordnung herzustellen, sie immer wieder neu zu erfinden und wiederherzustellen. Um das zu tun, hat der Pavian nur ein Hilfsmittel: seinen Körper. Was als eine Anekdote erscheinen könnte, war für die Paviane womöglich ein wichtiges Ereignis. Dieses seltsame Wesen, das einer anderen Spezies angehört, hat in mancherlei Hinsicht einen dem ihren ähnlichen Körper.
Ist diese Interpretation überzeugend? Hat Strum sich, in Smuts Sinne, sozialisiert, ist sie also in den Augen der Paviane ein soziales Wesen geworden, indem sie einen Körper gezeigt hat, der dem ihren in gewisser Hinsicht ähnlich ist? Darüber können wir natürlich nur mutmaßen.
Diese beiden Geschichten erinnern zwangsläufig an eine dritte. Die Texte, in denen der Biologe Farley Mowat von dieser berichtet, sind allerdings eigentlich keine wissenschaftlichen Texte und sie wurden heftig diskutiert. An dieser Geschichte ist außerdem einiges vollkommen anders. Zum einen werden dabei eher Verhaltensregeln missachtet, als dass jemand wirklich ein guter Gast hätte sein wollen. Zum anderen verkehrt sie in Anbetracht dessen, was Smuts berichtete, die Forderung: Nicht die Gastgeber sollen freundlicherweise als soziale Wesen wahrgenommen werden, sondern der Beobachter.
Mowats Geschichte beginnt Ende der Vierzigerjahre, als der Biologe gebeten wird, eine Expedition durchzuführen, deren Ziel es ist herauszufinden, was Angriffe durch Wölfe bei Karibus bewirken.[6] Es sollte eine harte Prüfung werden. Mowat brachte eine ziemlich lange Zeit alleine in einem Zelt mitten im Territorium eines Wolfsrudels damit zu, die Wölfe zu beobachten. Wie die Regeln, die Smuts schildert, es vorschreiben, achtete er darauf, so diskret wie möglich zu sein. Mit der Zeit kam der Biologe aber immer weniger damit zurecht, dass er von den Wölfen vollkommen ignoriert wurde. Er existierte nicht. Die Wölfe kamen tagtäglich an seinem Zelt vorbei und zeigten nicht das geringste Interesse. Mowat fing also an zu überlegen, wie er die Wölfe zwingen könnte, seine Existenz anzuerkennen. Wie er sagt, bot sich die Methode der Wölfe an. Er musste Besitzansprüche stellen. Das tat er also in einer Nacht, als die Wölfe auf Jagd gegangen waren. Es dauerte die ganze Nacht, bis er fertig war … und er trank dabei mehrere Liter Tee. Aber als die Sonne aufging, war jeder Baum, jeder Strauch und jedes Grasbüschel, das zuvor von den Wölfen markiert worden war, jetzt von ihm markiert. Er wartete, etwas unruhig, bis das Rudel zurückkam. Wie gewohnt kamen die Wölfe an seinem Zelt vorbei, als wäre es gar nicht da, doch plötzlich hielt einer von ihnen völlig verdutzt inne. Der Wolf zögerte einige Minuten lang, dann kam er zurück, setzte sich und fixierte den Beobachter mit einem Blick von beunruhigender Intensität. Mowat, der kurz vorm Nervenzusammenbruch stand, entschied sich, ihm den Rücken zuzukehren, um ihm zu bedeuten, dass diese Penetranz ja wohl eindeutig gegen die Höflichkeitsregeln verstieß. Da setzte der Wolf sich in Bewegung, ging systematisch das Territorium ab und markierte mit allergrößter Sorgfalt jeden Fleck, den zuvor der Mensch markiert hatte. Von diesem Augenblick an, sagt Mowat, »hatten die Wölfe meine Enklave akzeptiert«, und jeder von ihnen, Wolf wie Mensch, frischte regelmäßig seine Duftmarken auf seiner Seite der Grenze auf.
Trotz aller Unterschiede sind diese drei Geschichten doch sehr ähnlich: Sie alle beschreiben Situationen, in denen Lebewesen entweder lernen einzufordern, dass das Wesentliche Beachtung findet, oder aber selbst eine Antwort auf eine derartige Forderung zu finden. Und sie lernen es zusammen mit einer anderen Spezies. Und dadurch bekommen jene Forschungsprojekte diese besondere, auffällige Note, bei denen die Beobachteten kennenzulernen dem untergeordnet wird, zuerst einmal zu lernen sich wiederzuerkennen.
C
wie
clever
Äffen Affen wirklich nach?
[1]
Es war sehr lange Zeit schwer für Tiere, nicht dumm zu sein (wie sollte ein Schaf nicht dumm wie ein Schaf sein). Natürlich gab es immer Menschen mit einem offenen Geist, engagierte Laien. Menschen, denen unheilbarer Anthropomorphismus unterstellt wurde. Heute arbeitet die wissenschaftliche Literatur an ihrer Rehabilitierung. Sie holt diese Menschen aus der Versenkung und geht außerdem mit all jenen ins Gericht, die aus dem Tier eine seelenlose Maschine gemacht haben. Und das ist gut so. Aber, auch wenn es sinnvoll sein mag, grob auseinanderzunehmen, wie Tiere zu den Dummen gemacht werden, so wäre es doch auch hilfreich, sich die kleinsten Details dieser Abwertungsmechanismen ganz genau anzuschauen, die weniger offensichtlichen Weisen, die sich hinter oftmals noblen Motiven verstecken. Hinter Skeptizismus, hinter den Zwängen der rigiden Regeln der Wissenschaft, der Absicht, mit geringen finanziellen Mitteln auszukommen, der Objektivität usw. So fordert bekanntermaßen eine Regel aus Morgans Kanon, dass, wenn eine Erklärung, die von niedrigeren Fähigkeiten ausgeht, mit einer Erklärung konkurriert, die von höheren oder komplexeren Fähigkeiten ausgeht, die einfache Erklärung gewählt werden muss. Das ist nur eine Strategie der tierischen Verblödung neben anderen, deutlich weniger offensichtlichen Methoden, deren Entlarvung manchmal sorgfältigste Aufmerksamkeit erfordert, oder sogar Argwohn, der an Paranoia grenzt.
Wir sollten mit unserer Suche nach diesen Methoden bei den wissenschaftlichen Kontroversen darüber, welche Fähigkeiten Tieren zugesprochen werden sollten und welche nicht, beginnen. Die Kontroverse über Nachahmung bei Tieren ist exemplarisch, was das angeht.
Wir können aus ihr umso mehr lernen, da diese lange und ziemlich vehement geführte Diskussion zu dieser reichlich seltsamen Frage führen wird: Äffen Affen nach? – Do apes ape?
Die Geschichte lehrt uns, dass diese Art von Streit darüber, welche höheren Fähigkeiten Tieren zuzuschreiben sind, sich häufig als Frage nach dem Anrecht auf Eigenschaften entpuppt (wenn ihr mir erlaubt, es so herunterzubrechen). Was uns eigen ist, unsere ontologischen Eigenschaften – das Lachen, die Tatsache, dass wir uns unserer selbst und unserer Sterblichkeit bewusst sind, dass wir uns Inzest verbieten usw. – sollen das Unsrige bleiben. Dann müssen wir aber die Eigenschaften, die den Tieren schon zugeschrieben worden sind, wieder konfiszieren! Es scheint, dass Wissenschaftler besonders empfindlich reagieren, wenn sie die ihnen eigenen Fähigkeiten angegriffen sehen – den Philosophen wurde das schon vorgeworfen. Es heißt, Letztere würden vollkommen irrational werden, wenn es darum geht, herauszufinden, ob Tiere der Sprache mächtig sind. Könnte, wenn es um die Fähigkeiten von Tieren geht, das Nachahmen für die Wissenschaftler sein, was die Sprache für die Philosophen ist?
Eine andere Hypothese, die empirisch besser gestützt ist, könnte jene etwas unglückliche Vorliebe von Wissenschaftlern für das, was Kaspar-Hauser-Versuche genannt wird, berücksichtigen. In Kaspar-Hauser-Versuchen wird die Frage »Wie machen Tiere diese und jene Sache?« in die Frage »Was muss ihnen weggenommen werden, damit sie das nicht mehr machen?« überführt. Konrad Lorenz zufolge werden die Tiere bei dieser Art von Versuch regelrecht kaputt gemacht. Was passiert, wenn einer Ratte oder einem Affen die Augen, die Ohren oder diese oder jene Gehirnregion weggenommen oder aber wenn ihnen jeglicher Kontakt zu Artgenossen verwehrt wird? (• separieren