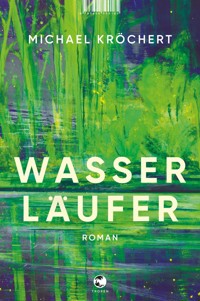
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommer zwischen Freundschaft und Verrat, Liebe und Hass, Leben und Tod Michael Kröcherts Romandebüt ist eine Reise ins flüssige Herz Brandenburgs. Ein zarter, geradezu schwereloser Sommerroman auf dem Wasser. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der sich an einer großen Weggabelung seiner Biografie wiederfindet und endlich für das Leben entscheidet. Ein Abenteuer der Weltflucht, Selbstfindung und Freiheit – in politisch explosiven Zeiten. Rio braucht dringend Abstand zu seinem Leben. Kurzentschlossen baut er sich ein Floß, auf dem er die nächsten Wochen verbringen wird. Doch das Idyll gerät schnell ins Wanken. Während Rio inmitten von Seerosen und Wasserläufern seine innere Freiheit zu finden versucht, zerreißt eine Explosion die Stille auf seinem Floß. Ein Anschlag auf einen Geschäftsmann vom Nachbarsee, wie er später erfährt. Doch das ist nicht das Einzige, das den Frieden stört. Auch die Einsamkeit macht Rio mehr zu schaffen als erwartet. Und so freundet er sich mit Birk und Johanna an, die am Ufer des Sees ein unkonventionelles Leben führen. Als dann ein Berliner Künstlerpaar auf seiner 20-Meter-Luxus-Jacht vor Anker geht, nimmt Rios Sommer eine unvorhergesehene Richtung. Er entdeckt noch weitere Sprengsätze und wird vor die größte Entscheidung seines Lebens gestellt: Was für ein Leben will er führen? Was für ein Mensch will er sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Kröchert
WASSERLÄUFER
Roman
Tropen
Impressum
Das Motto stammt aus Grace Paley, Manchmal kommen und manchmal gehen. Gedichte. Ausgewählt, übersetzt aus dem Englischen sowie mit Glossar und Nachwort versehen von Mirko Bonné © der deutschen Ausgabe: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main 2018, S. 45.
Das Zitat auf S. 155 f. stammt aus »Die Läusesucherinnen«, aus: Arthur Rimbaud, Gedichte. © Insel Verlag 1907. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Insel Verlag Berlin.
Das Zitat auf S. 285 stammt aus Michail Bachtin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. Übersetzt von Alexander Kaempfe. © 1969 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero-Media.net, München unter Verwendung eines Kunstwerks von © VG Bild-Kunst, Bonn 2023/Bernd Zimmer, Weiher. Weide, 2011
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50016-5
E-Book ISBN 978-3-608-12188-9
Eines Tages beschloss ich nicht mehr älter zu werdenviel Glück sagte ich mir
Grace Paley
Ich nahm Anlauf und sprang
1
Ich nahm Anlauf und sprang. Fühlte das Schwanken der Plattform unter meinen Füßen und wie ich durch die Luft zischte, wie die Wasseroberfläche zerplatzte, wie zuerst meine Arme, dann mein Kopf, die Schultern ins Wasser stürzten, als hätte es nur darauf gewartet.
Ich ließ mich gleiten, tauchte auf, holte tief Luft und machte die ersten Schwimmbewegungen. Arme zum Körper ziehen, Beine anwinkeln, abstoßen. Ich nahm mir vor, langsam zu schwimmen, um meine Kräfte einzuteilen, wollte es bis zur Insel schaffen, aber schon nach zwanzig oder dreißig Zügen merkte ich, dass ich zu lange in der Sonne gelegen, vielleicht zu viel Kaffee getrunken hatte. Vielleicht war mir das Wasser auch einfach zu kalt. Nur am Ufer gab es diese dicke Speckschicht aus warmem Wasser, das von der Sonne in den letzten Wochen aufgeheizt worden war.
Ich entschied, die Insel ein anderes Mal zu besuchen, und schwamm zurück. Im Uferbereich – dort, wo mein Floß lag – war das Wasser nicht tief und ich tat das, was ich nach dem Schwimmen so gerne tat. Ich begutachtete die Planken, testete, ob die Gurte an den Tonnen noch straff waren, ob alle Schrauben festsaßen. Aber eigentlich umrundete ich das Floß nur, weil ich mich nicht daran sattsehen konnte, weil ich es mit eigenen Händen gebaut hatte.
Danach watete ich weiter zum Ufer, um das Schilf aus nächster Nähe zu betrachten. Interessanterweise wuchs es zusammen mit anderen Pflanzen wie auf kleinen Miniaturinseln. Da war Wasserminze, da waren Schwertlilien und Schwanenblumen, und als ich eine Weile reglos stehenblieb, kamen Wasserläufer und kleine Fische aus ihren Verstecken. Zugleich hörte ich dieses wilde Geraschel, so als würde es im Dickicht um Leben und Tod gehen. Im Grunde genommen ging es dort ständig um Leben und Tod.
Als ich mich abgetrocknet und mir meine Hose angezogen hatte, holte ich die Matratze aus ihrer Aufhängung unter dem Dach und warf sie auf die Planken. Ich hatte erst am Tag zuvor festgestellt, dass es das Beste war, wenn ich sie tagsüber nicht flach hinlegte, sondern das Kopfteil gegen den Mast lehnte. »Ja«, sagte ich leise und stopfte mir den Schlafsack hinter den Kopf. Halb auf der Matratze liegend, halb sitzend schloss ich die Augen und fühlte den Wind auf meiner Haut. Er kam an diesem Nachmittag aus Richtung der Sonne, aus Südwest, wie aus einer anderen Welt. Er ließ mich die Hitze vergessen, strich leichthin über den See, zu mir. Und so wie dieser kühle Wind, so war auch das kontinuierliche Schwanken des Floßes und das Glitzern des Lichts auf den Wellen erregend und einschläfernd zugleich.
Der Soliner See, auf dem ich ankerte, war groß. Fast zwei Kilometer lang und ungefähr einen halben Kilometer breit. Am westlichen und östlichen Ende lagen Dörfer, die man vom Wasser aus jedoch nicht sehen konnte. Sie hießen Ranitz und Bridow. Am nordöstlichen Ende gab es eine große Bucht. Es gab eine kleine, bewaldete Insel ungefähr in der Mitte und ausgedehnte Schilfgürtel vor allem am nördlichen Ufer. Der restliche See grenzte an Wald. Es war eines dieser Gewässer, die am Ende der letzten Eiszeit entstanden waren und von denen es rund um Berlin Hunderte gab. Ich kannte den See gut, war schon als Kind zum Baden hier gewesen, dann später als Teenager mit dem Kajak, natürlich auch mit Alissa.
Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf und blickte auf die Wellen, die auf dem Wasser spielten. Wenn ich es mir nach dem Schwimmen bequem machte und über meinen Bauch, meine Beine und Füße hinweg über den See schaute, wurde ich müde und so angenehm schwer. Ich ließ Erinnerungen und Gedanken schweifen, blinzelte eine Weile mit halb geschlossenen Augen in die Ferne, und als ich zu müde wurde, stand ich auf und kochte mir einen Espresso. Vom ersten Tag an war das eins der zentralen Rituale dieses Sommers. Lange bevor ich Magda und Jost kennenlernte. Ich hatte mir am Tag meiner Abreise einen neuen Campingkocher besorgt. Er nannte sich pocket rocket de luxe. Diesen Aufsatz auf die Kartusche zu setzen, das fauchende Gas mit dem Feuerzeug zu entzünden, die silberne Kanne aufzuschrauben, mit Espressopulver und Wasser zu befüllen und zuzusehen, wie sich der schwarze Sud durch das Röhrchen ergoss – all diese Handgriffe waren wie eine Meditation, und jeden Schluck behielt ich lange auf der Zunge. Auch weil ich seit meiner Corona-Erkrankung kaum noch etwas schmecken und bis auf Zigarettenrauch überhaupt nichts mehr riechen konnte.
Nach dem Espresso fühlte ich eine Unruhe in mir. Ich konnte nicht mehr einfach nur dasitzen, Bücher lesen, Musik hören, träumen. Das Nichtstun hatte seine Süße verloren. Ich beschloss, das Floß umzusetzen, und stieg zurück ins Wasser, lichtete den Anker, band die Leine los und schob es zum Uferwald. Nein, ich vermisste niemanden. Ich suchte die Stille und das Alleinsein in der Natur. Deshalb war ich auf dem See. Deshalb hatte ich Berlin und meinem Alltag für eine Weile den Rücken gekehrt. Doch als ich eine Libelle beobachtete, die direkt vor mir schwebte, spürte ich, dass sich etwas in mir aufgestaut hatte. Ich musste mal wieder ein paar Worte mit jemandem wechseln. Mir reichten die Selbstgespräche und das Tagebuchschreiben nicht mehr aus.
Als ich das Floß an seinem neuen Platz festgemacht hatte, drehte ich mir die Abendzigarette, füllte das große Glas voll Tempranillo und paddelte mit dem Kajak in die Mitte des Sees. Diese Momente, wenn die Sonne sank und der Himmel seinen Farben freien Lauf ließ – vor allem dann musste ich an Alissa denken. Am nächsten Tag war es so weit. Wir waren für den 1. Juli zum Telefonieren verabredet. Bevor ich auf das Floß ging, hatte ich entschieden, dass ich die ersten zehn Tage ohne Handy sein wollte. Alissa hatte keine Lust gehabt, sich darauf einzulassen. Aber was das betraf, war ich nicht kompromissbereit. Ich nahm einen Schluck Wein und fragte mich, was ich ihr erzählen wollte. Wovon würde ich ihr berichten bei diesem ersten Telefonat nach zehn Tagen? Nicht von den stillen, himmlisch sonnigen und meditativen Momenten. Nicht von der Magie des Windes, der Sterne, der Insel oder der Wellen. Nicht von den Farben der Lilien und Seerosen, nicht von den Rufen der Kormorane, nicht von meiner Lektüre oder meiner allabendlichen Unruhe. Auch nicht, wie es sich anfühlte, keinen Kühlschrank zu haben, keine Milch, keine Schokolade. Nein, erzählen wollte ich ihr von meinem allerersten Erlebnis auf dem Floß.
2
Das Fahren gehörte zu den weniger angenehmen Aspekten, denn der Außenbordmotor, den ich am Heck des Floßes befestigt hatte, war alt und schwach. Er hatte nur zwei PS, erlaubte keine Ad-hoc-Manöver und machte einen höllischen Lärm. Zwar hatte ich ihn auf einer Probefahrt getestet, aber als ich mich dann endgültig auf den Weg machen wollte, war ich angespannt. Zum ersten Mal würde ich eine weite Strecke mit meinem Floß zurücklegen.
Das Grundstück, auf dem ich es gebaut und zu Wasser gelassen hatte, gehörte meiner Tante und hatte einen Zugang zum Dämeritzsee. Der Soliner See, auf dem ich den Sommer verbringen wollte, war von dort aus fünfzehn Kilometer entfernt. Beide Seen waren über einen Fluss miteinander verbunden – die Lahne. Das war nicht weit, doch für mein Floß war diese Strecke ein Marathon. Die vier Tonnen, auf denen ich die Plattform befestigt hatte, lagen tief im Wasser und mit meinem Motor brauchte ich für fünfzehn Kilometer, noch dazu stromaufwärts, mindestens fünf Stunden, weshalb ich die Fahrt in zwei Etappen absolvieren wollte. Von früheren Ausflügen mit dem Kajak kannte ich einen Ankerplatz auf halbem Weg.
Ich legte um acht Uhr abends ab, weil ich möglichst wenig Booten begegnen wollte. Ich hatte alles startklar gemacht und schaute mit meiner Tante gemeinsam von ihrem Steg aus über den See. Niemand war mehr unterwegs, alle hatten ihre Ankerplätze bezogen. Hin und wieder flog ein Graureiher mit eingezogenem Kopf über das Wasser in Richtung Nacht. Auch die Wellen schienen den Betrieb jeden Moment einstellen zu wollen. Nur ein leiser Westwind wehte, der mich sanft vor sich herschieben würde.
Nach einer nüchternen Verabschiedung bestieg ich mein Floß und tuckerte los. Der Außenborder zerriss die Stille, und nach anderthalb Stunden Fahrt im Schritttempo erreichte ich das östliche Ende des Sees und die Mündung der Lahne.
Der Fluss barg am linken Ufer kleine, geschützte Buchten, die sehr idyllisch waren. Doch als ich zu der Bucht kam, in der ich ankern und die Nacht verbringen wollte, sah ich, dass genau dort ein Hausboot lag. Ich fühlte, wie sich mein Bauch verhärtete, der Magen krampfte. Mir wurde heiß. Eins dieser Gefühle, das ich nicht mehr haben wollte, das ich in Berlin hatte lassen wollen, in den überfüllten Straßen von Kreuzberg und Neukölln, in der Redaktion bei Solveigh, meiner Chefin. Aber die Wut verpuffte genauso schnell, wie sie gekommen war, denn im nächsten Moment ging mein Motor ohne jede Vorwarnung aus.
Was war los? Ich drehte mich um und zog am Starter, wieder und wieder. Dann begriff ich endlich. Der Tank war leer. Eine Füllung reichte für etwa zwei Stunden Fahrt. Ich hatte zu knapp aufgefüllt! Doch auch dieser Gedanke verschwand sofort wieder, denn plötzlich sah ich, dass mein Floß mit unverminderter Geschwindigkeit direkt auf das Hausboot zutrieb. Ausgerechnet jetzt hatte der Wind aufgefrischt und drückte mich, obwohl ich alle Seitenplanen sorgfältig unter das Dach gebunden hatte, vor sich her. Dazu kam die Strömung der Lahne, die zwar träge, aber doch unaufhaltsam ihr Wasser gen Berlin und mich zur Seite schob. Panik ergriff mich. Niemals würde ich es schnell genug schaffen, Benzin nachzufüllen, den Motor anzuwerfen und beizudrehen. Ich musste das Floß sofort stoppen. Ohne lange nachzudenken, sprang ich aus meinen Sachen und stürzte mich ins Wasser, versuchte, das Floß mit der linken Hand festzuhalten und mit der rechten gegen die Strömung und den Wind anzuschwimmen. Aber das war unmöglich. Ich griff nach der langen Bootsleine, schlang sie mir um den Oberkörper und schwamm, so kräftig ich konnte, schaffte es aber nicht mal, das Floß zu verlangsamen. Der Wind war erbarmungslos, er schob das Floß einfach weiter, immer weiter. Keine zehn Meter war ich mehr von dem verdammten Hausboot entfernt.
Okay, eine Kollision wäre keine Katastrophe. Es würde krachen und ein paar Beulen oder Kratzer geben, anschließend Diskussionen mit den Hausbootbesitzern. Aber genau das war es. Ich wollte mich an diesem ersten Abend auf keinen Fall mit irgendjemandem auseinandersetzen. Hatte noch weniger Lust, angeglotzt zu werden oder Gelächter zu ernten: Denn was war das für ein nackter Floß-Mensch, der da im Abendwind die Kontrolle über sein selbstgebautes Vehikel verlor!
Wie verrückt zerrte ich an der Ankerkette. Warum war ich nicht früher auf diese Idee gekommen. Aber das Teil klemmte in einer Spalte zwischen den Planken. Ich riss mit aller Kraft daran und endlich, endlich bekam ich es frei. Der Anker fiel ins Wasser und fuhr zum Grund, die Kette rasselte hinterher. »Mann!«, stieß ich hervor und fühlte, wie sich die Kette spannte.
Abrupt blieb das Floß stehen, erleichtert schloss ich die Augen und atmete durch. Doch dann hörte ich Stimmen. Instinktiv duckte ich mich hinter dem Floß weg und spähte über die Planken. Auf dem Hausboot war niemand zu sehen. Das Innere war hell erleuchtet. Auf einmal glaubte ich, Solveighs Stimme zu hören, ihre dunkle, volle, eigentlich schöne Stimme. Und dann tauchten Bilder vor meinem inneren Auge auf, ich sah die Redaktion, die engen weißen Räume, die Tische und Bildschirme, das Erdgeschoss, den tristen Blick in den Hof. Das alles untrennbar verbunden mit den kurzen, hitzigen Diskussionen und schnellen Entscheidungen.
Solveigh und ich hatten uns darauf geeinigt, dass ich mich am 8. Juli meldete und dann drei Tage für sie arbeitete – wenn Naomi und Peter Urlaub machten und sie ganz alleine in der Redaktion war. Nur unter dieser Bedingung hatte sie mir fünf Wochen freigegeben. Doch in diesem Moment, als ich dort im Wasser hing, begriff ich, wie unrealistisch diese Abmachung eigentlich war, und dass ich mich genauso gut auch nie wieder bei ihr melden konnte. Dieser Gedanke erfüllte mich mit einer bösen Freude, plötzlich musste ich lachen.
Tropfnass und splitternackt kletterte ich zurück aufs Floß. Mittlerweile war es dunkel geworden. Ich zog mir eilig etwas über, befüllte den Tank, holte den Anker ein und fuhr laut tuckernd zur nächsten Bucht. In diesem Moment kamen sie aus ihrem Hausboot, die anderen Menschen, doch ich drehte mich nicht mehr um.
Während dieser ganzen Aktion geschah etwas Überraschendes mit mir. Ich bemerkte es, als ich abgetrocknet und angekleidet vorne auf den Planken saß und eine Zigarette auf den Schreck rauchte und Wein trank. Ja, ich war zwar in Panik verfallen und fühlte noch das kalte Wasser in meiner Nase, in den Ohren und in den Haaren, aber ich war nicht erschöpft oder wütend, im Gegenteil, ich wurde euphorisch.
Meine Haut war warm und glatt, meine Muskeln darunter stark und entspannt. Voller Elastizität und Kraft. Ich stand auf, streifte mein T-Shirt ab, breitete die Arme aus und fühlte den nächtlichen Wind auf meiner Haut. Schloss die Augen, öffnete sie wieder. Vorne in der Dunkelheit sah ich das schwarze, silbrige Schimmern der Wasseroberfläche und weiter oben die scharf gezackte, feine Linie zwischen Wald und Himmel. An diesem allerersten Abend meiner Reise in den Floß-Sommer spürte ich die unermessliche Tiefe dieses Raums. Aber noch deutlicher als das fühlte ich mich.
3
Die Brücke am östlichen Ende des Sees war kein guter Ort, um mit Alissa zu telefonieren, auch wenn es weit und breit der einzige war, wo ich vernünftigen Empfang hatte. Immer wieder kamen Fußgänger oder Radfahrer und ziemlich oft verlangsamten sie ihren Schritt oder ihre Fahrt und schauten mich an. Unten am Flussufer war ein schmaler Streifen Wiese. Genau in dem Moment, als ich auf die Brücke gekommen war, kreuzte dort ein Angler auf und begann, seine Ausrüstung auszupacken und seine Mehlwürmer zu sortieren. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Ort tausend Augen und Ohren hatte.
Ich drückte mich gegen das Geländer. Alissa war für ein Semester in Frankfurt am Main und arbeitete dort an ihrer Dissertation. Ihre Tage waren vollständig strukturiert, und ich fragte mich, in welcher Stimmung sie sein würde, wenn wir uns zum ersten Mal nach so langer Zeit sprechen würden. Dass ich ihr von meinem Abenteuer mit dem Hausboot erzählen wollte, war in den Hintergrund getreten, denn in der Nacht zuvor hatte es dieses fürchterliche Gewitter gegeben, das mir noch in den Knochen steckte. Im Fluss, der genau hier in den Soliner See mündete, trieben zahllose Blätter, Zweige, sogar große Äste. Das Wasser war trüb. Alles Mögliche hatte der Sturm ins Gewässer geweht.
Als ich mich anlehnte, die raue, verwitterte Oberfläche des Geländers an den Handflächen fühlte, spürte ich ein stetiges Schwanken in mir. Seit zehn Tagen war ich so gut wie ununterbrochen auf dem Wasser. Es war angenehm, sich an etwas Unbewegtem festzuhalten.
Ich schaute über den See. Mein Floß sah ich von diesem Punkt aus nicht, obwohl die Brücke hoch war. Es lag hinter der kleinen Landzunge, dicht am nördlichen Ufer, dort, wo das hohe Schilf stand und der Wald begann.
Überall an den Ufern hob sich die Vegetation ansatzlos aus dem Wasser. Eine ebenso klar definierte Linie schied diese auch vom Himmel. Das Wasser unten, der Himmel oben, dazwischen die Vegetation – klar voneinander getrennte Räume. Dieser Anblick hatte mich schon immer fasziniert. Das hatte etwas Ozeanisches. Ich meine: etwas Weites und Fremdes, etwas Grenzenloses, Tiefes, Rätselhaftes. Diese Landschaft hatte sich seit meiner Kindheit tief in mich eingeschrieben. Hierher hatte ich zurückgewollt. Mein Großvater hatte die Gegend Märkisch Polynesien genannt. Diesen Wechsel von Flüssen und Seen, bewaldeten Ufern, Schilf und kleinen Inseln. Aber der See wirkte an diesem Abend, während ich das Handy in der Hand hielt, klein und banal. Endlich sprangen die Ziffern auf 21:00. Ich tippte auf Alissas Namen, hörte kurz darauf ein verzerrtes Freizeichen, doch sie nahm nicht ab.
Ich war etwas erleichtert, denn der Angler wurde immer unverschämter. Er stand jetzt direkt unter mir am Fluss und tat nicht mal so, als würde er mir nicht zuhören wollen. Er schaute mich nicht unfreundlich, doch auf geradezu monströse Art neugierig an. Er hatte große Augen und schmale Schultern, silbrige Locken quollen unter seinem Basecap hervor. Hin und wieder spitzte er die Lippen. Ich fand, er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Molière.
Ich drehte ihm den Rücken zu, lehnte mich gegen das Geländer und überprüfte das Datum. Ja, es war der 1. Juli. Auch die Uhrzeit war korrekt, und ich versuchte es noch mal. Hörte das Freizeichen. Schon in diesem Moment beschlich mich eine Ahnung. Alissa und ich hatten vereinbart, dass wir besprechen würden, wie wir ihren Besuch organisieren wollten. Für ein verlängertes Wochenende wollte sie kommen. Stille. Ich schaute erneut auf das Display. Nichts. Verbindung unterbrochen. Und dreißig Sekunden später kam ihre SMS. Endlosgespräch mit Steph. Entschuldige! Hab dich nicht vergessen! Können wir auf morgen Abend verschieben? Bitte sei nicht sauer. Küsse, A.
4
Bevor Alissa nach Frankfurt ging, hatten wir uns einen Tag freigenommen, einen Sprinter gemietet und waren kreuz und quer durch Neukölln gefahren. Wir steuerten Baustellen an, redeten mit Bauarbeitern, parkten neben Containern und klaubten einen großen Haufen Bretter, alte Dielen, Holzbohlen, auch ein paar Metallwinkel und alle möglichen anderen Dinge zusammen und warfen sie auf die Ladefläche.
Ich hatte mir Arbeitssachen angezogen. Alissa trug einen roten Overall. Wir setzten uns Sonnenbrillen auf, hörten Sonic Youth und Tocotronic, Eurythmics und Lady Gaga. Wir heizten durch die Gegend, inspizierten und durchwühlten jeden Container, und ich erinnere mich, wie ich sie bat, es nicht Upcycling zu nennen. Sie verstand nicht, was ich so ätzend an dem Begriff fand. »Das ganze aufgeblähte Blabla«, sagte ich und plusterte mich auf. Doch sie erwiderte nur: »Ist mir nicht wichtig, dass wir bei dem Thema einer Meinung sind«, und lächelte.
Es war ein großartiger, ein erfolgreicher Tag. Das Wenige, was ich für den Bau des Floßes noch kaufen musste, waren Spanngurte, lange Gewindestangen, regendichte Planen und vier leere, gebrauchte 220-Liter-Wassertonnen. Und als Alissa und ich den Transporter weggebracht hatten und nach diesem langen Tag nach Hause kamen, schauten wir uns wortlos an, liefen direkt weiter zu unserem Späti und tranken eiskalten Sekt.
Als ich dann Mitte Mai anfing, das Floß zu bauen, merkte ich, dass das alles komplizierter war als gedacht. Denn das Gefährt, selbst wenn ich nur ein paar Wochen damit unterwegs sein würde, musste stabil sein. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, in zwei oder drei Tagen etwas zusammenzuzimmern. Aber ich begriff schnell, dass man nicht mal eben so ein Floß bauen konnte, wenn es auch halten sollte. Es dauerte mehr als zehn Tage, bis es fertig war. Alle Wochenenden und Feiertage gab ich dafür hin.
Zuerst baute ich einen Rahmen, drei Meter breit und vier Meter lang, an dem ich die Tonnen mit Gurten befestigen konnte. Sie würden dem Vehikel den nötigen Auftrieb geben. Als dieser Rahmen fertig war, befestigte ich die Planken. Somit hatte ich die Plattform. Zuletzt baute ich noch ein stabiles Dach aus Holz, um vor Sonne und Regen geschützt zu sein. Dann befestigte ich Planen an den Seiten, für die Privatsphäre.
Meine Tante hatte mir die Wiese hinter ihrem Haus überlassen. Dort baute ich alles zusammen. Sie gehörte zu den Menschen, die mich nicht fragten, warum ich das machte oder was das eigentlich sollte. Hin und wieder brachte sie mir einen Espresso, und ich hatte das Gefühl, dass sie sich freute, dass ich in ihrer Nähe war. Ich musste ihr nur ausreden, ständig Fotos zu machen und sie über iMessages an ihre Freundinnen zu verschicken. Ich selbst machte extrem viele Fotos von jeder Phase des Baus, verschickte oder postete aber nichts. Ich wollte das für mich behalten, ich wollte es mit niemandem teilen. Ganz sicher war das nicht perfekt, was ich da zusammenzimmerte – es war nicht mal fertig, als ich losfuhr –, doch das Entscheidende war, dass es mir Spaß machte. Die Arbeit war rein und klar und einfach. Ich baute das Floß, weil ich ein Floß bauen wollte. Ein Floß für die Seen südöstlich von Berlin. Für Märkisch Polynesien.
Messen, sägen, schneiden, bohren, hämmern, zusammenfügen, Kaffee trinken, das Werk betrachten. Unter den ungewohnt wohlwollenden Blicken der Dorfbewohner, die oft neugierig vorbeischauten. Jürgen, der Nachbar rechts, sagte, dass er nicht gewusst hätte, dass ich handwerklich versiert sei. Ein Kompliment, das mich amüsierte, denn ich war das Gegenteil von versiert. Bodo, der Nachbar links, sagte: »Du bist ja ein richtiger Macher.« Ich wusste, dass er das ironisch und abwertend meinte, aber es war mir egal.
Schließlich hatte ich das Gefühl, gar nicht fertig werden zu wollen. Als könnte ich die Erfüllung meines Traums noch ein wenig hinauszögern.
Als ich zur ersten Probefahrt aufbrach, hörte ich plötzlich ein TA-TATÁ-TATÁ-TATAAAA. Es war Jürgen, er stand auf einem Stuhl und hielt eine Trompete in der Hand. Die Melodie flog über den Dämeritzsee. Laut und überaus klar. Sie traf auf keinen Widerstand. TA-TATÁ-TATÁ-TATAAAA. Das war das Halali. Das Fanal. Ich fand das sehr passend, auch wenn nun die ganze Seewelt Bescheid wusste über mich und mein Floß und dass mein Sommer begann.
5
Über dem Horizont im Westen war der Himmel noch hell. Zugleich wurden im Osten die ersten Sterne sichtbar. Der See kam zur Ruhe. Die Wellen, die der Wind und die Boote den Tag über aufgeworfen hatten, legten sich. Die kleinen Wellen, die ich mit meinem Kajak auf den See schickte, verloren sich. Ich paddelte in die beginnende Nacht.
Langsam und gleichmäßig stach ich das Paddel ins Wasser und glitt fast lautlos dahin. Nur zwei Boote waren an diesem Abend noch zu sehen. Eins ankerte in der großen Bucht am nordöstlichen Ende. Das andere, ein rosarotes Hausboot, lag vor dem Badestrand beim Campingplatz. Ich war mehr oder weniger allein. Allein mit dieser Stille und meiner Enttäuschung. Dem Gefühl, dass sich zu viel in mir aufgestaut hatte.
Einmal kam ein Reiher, dann drei Gänse, auch ein paar Möwen und Kormorane. Bis auf den Reiher flogen alle in Richtung Insel. Die Gänse mit kräftigen, kompakten Bewegungen. Die Kormorane lautlos und hektisch. Die Möwen leicht und lässig, sie waren die elegantesten Flieger.
Ungefähr in der Mitte des Sees legte ich das Paddel vor mich auf das Kajak und drehte mir eine Zigarette. Nachdem ich den ersten Zug tief inhaliert hatte, nahm ich die Weinflasche und kippte ein wenig in den See. Der erste Schluck war für Neptun. Dann füllte ich mir das Ikea-Glas randvoll und trank einen Schluck, blickte in den Abendhimmel. Doch der Wein war schlecht, er moussierte, vielleicht war er zu warm geworden. Ich spuckte ihn aus und schüttete die ganze Flasche in den See.
Drei Wolken standen über dem westlichen Horizont und verfärbten sich orange. Es dauerte eine Zigarettenlänge, dann hatten sie sich aufgelöst. Hin und wieder sah man die Positionslichter der Flugzeuge, die in Schönefeld landeten. Direkt dahinter war Berlin, dort war unsere Wohnung, mein Schreibtisch, der Laptop, unser Bett, der lange Flur, die Küche. Jetzt wohnte Xavi dort, ein alter Bekannter von mir aus Sevilla. Wir hatten ihm die Wohnung für den Sommer untervermietet. Eduard, seinen neuen Freund, kannte ich nicht.
Alissa und ich hatten deswegen heftig gestritten. Sie hatte gehofft, dass ich, solange sie in Frankfurt war, in der Wohnung blieb. Dass alles so bleiben konnte, wie es war. Aber ich wollte und musste raus. Raus aus der Stadt. Raus aus allem. Ich wollte endlich für einige Zeit in der Natur sein, vor allem aber alleine. Nach den Monaten – Jahren! – in unserer Wohnung, nach Lockdown und Quarantäne, Homeoffice und Lagerkoller. Nach Schimmelbildung, Balkon-Zigaretten, FFP2-Masken, ungelesenen Romanen, Netflix-Orgien, Chipsfrisch Oriental, nach der Invasion, dem Kriegs-Newsticker auf Spiegel Online, dem Atombunker in Mariupol, hochmobilen Raketenwerfern, russischen Folterkellern … Auch nach unseren Gesprächen über ein gemeinsames Kind. Nach all dem brauchte ich Weite, Stille und Abstand. Vor allem Weite, im Fühlen und im Denken. Und wenn es das alles zusammen gab – keine Stunde mit der S-Bahn, keine sechzig Kilometer Luftlinie von Neukölln entfernt –, dann war das ideal.
Alissa war es nicht recht, dass wir unsere persönlichen Dinge in den Keller brachten. Außerdem sei sie traurig, dass sie an keinem Wochenende zurück in die Wohnung konnte. Doch für mich gab es keine Alternative, ich musste raus. Und das Geld von Xavi konnten wir gut gebrauchen.
Während ich rauchte, während ich in das glutrote Schimmern im Himmel über Berlin starrte, war es, als verfestigte sich der See, als hätte sich die Temperatur und damit der Aggregatzustand verändert. Das Wasser lag da wie eine Art Gel. Tagsüber war die Oberfläche immer zerfurcht und zerwühlt. In manchen Phasen kamen alle paar Minuten Boote oder Schiffe. Tagsüber war immerzu Werden und Veränderung. Doch jetzt war das Ist zurück. Wenn die Sonne unterging, blieb die Zeit auf dem See für ein paar Stunden stehen.
Als ich die Kippe im See löschte und sie in das kleine, verschließbare Glas fallen ließ, das dafür vorgesehen war, hörte ich Stimmen. Vielleicht war es Molière. Vielleicht auch die Teenager, die in der Bushaltestelle gesessen hatten. Ich wusste es nicht. Ich drehte mich um und wunderte mich, in welch tiefe Dunkelheit die Brücke bereits versunken war. Dann las ich noch mal Alissas SMS. Endlosgespräch mit Steph … Hab dich nicht vergessen … Steph war ihre Professorin, die sie regelmäßig in Diskussionen über Diskurse verwickelte, aus denen es kein Entkommen gab. Und wie aus dem Nichts, wie ein Schrei, kam das Begreifen: Ich vermisste Alissa. Auch wenn ich die Nähe in Berlin einfach nicht mehr ausgehalten hatte. Ich wollte sie sehen, wollte, dass sie herkam und all das mit eigenen Augen sah. Und plötzlich war da noch ein anderer Gedanke: Was, wenn ich ihr nie wieder begegnen würde? Wenn ich sie schon verloren hatte?
Ich stieß das Paddel ins Wasser. Mitten rein in diese spiegelglatte Fläche. Wellen gingen in alle Richtungen. Wellen, die ich verursacht hatte. Ich fuhr für fünfzig oder sechzig Meter so schnell ich konnte. Rechts, links, rechts, links, immer schneller, und als ich schon neben meinem Floß war, fuhr ich einfach weiter, so als hätte ich nichts damit zu tun.
Als ich kurze Zeit später das Paddel sinken ließ und mich ausruhte, drückte ich meinen Kopf ganz weit in den Nacken und betrachtete die aufkommenden Sterne. Dann fuhr ich weiter zum Schilf. Doch das subtile, elektrisch anmutende Knistern, das aufkam, wenn die harten Blätter im Wind aneinander rieben, kam mir an diesem Abend sinnlos und traurig vor. Hier in diesem Bereich des Sees, in der Nähe des langen, verfallenen Stegs, hatten Alissa und ich im Jahr zuvor unsere Kajaks festgemacht. Wir waren geschwommen, hatten den ganzen Tag Prosecco getrunken und geschmolzenes Schokoladeneis gegessen. Ich starrte auf die lange Reihe der morschen und zerbrochenen Bretter, dann senkte ich den Blick. Hatte Lust, irgendetwas zu rufen oder zu brüllen, so immens war die Stille.
6
Keine hundert Meter von der Stelle entfernt, an der sich die Lahne aus dem Soliner See, durch den sie frei hindurchfloss, zurück in ihr Flussbett wie in ihr Schicksal fügte, stand ein Segelboot. Es war direkt am Flussufer aufgebockt. Als ich mich mit dem Kajak näherte, sah ich einen Schatten. Und als eine Zigarette aufglimmte, sagte ich mir, dass es nicht viele Gelegenheiten geben würde. Ich hatte noch nie jemanden bei diesem Boot gesehen.
»Hallo?«
»Hallo«, kam es aus der Dunkelheit zurück.
Ich sah, wie sich der Schatten bewegte. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigekommen war, hatte mich dieses Boot neugierig gemacht, das ganze Grundstück mit seinen alten Gebäuden und Gewächshäusern war mir aufgefallen. Besser gesagt: Zu dieser Form des Chaos fühlte ich mich hingezogen.
»Ist schon spät, entschuldige«, sagte ich, »aber kann ich vielleicht eins von den Brettern haben?«
»Nur eins?«
»Ja.«
»Wie lang soll es sein?«
»Ungefähr eins fünfzig lang und ungefähr so breit.« Ich legte das Paddel vor mich und zeigte es.
»Nimm dir eins weg. Ist okay.«
Ich ging davon aus, dass das jemand war, der gleich wieder verschwinden würde, sich mit seinem Joint auf sein Segelboot zurückzog, aber er kam ans Ufer, reichte mir die Hand und half mir, aus dem Kajak zu steigen. Ich spürte seinen sehr festen, trockenen Händedruck.
Wir liefen zu den Brettern, die sich neben seinem Segelboot befanden. An der einen Seite war das Holz sorgfältig aufgeschichtet und abgedeckt, aber auf der anderen war der Stapel umgefallen. Dort wuchsen hohes Gras und Brennnesseln. Als ich ein Brett in die Hand nahm, spürte ich, dass es schwer war.
»Das ist Mahagoni«, sagte er. »Ist ziemlich wertvoll. Aber wir bauen damit nichts mehr. Nimm dir einfach, was du brauchst.«
»Ist das hier eine Werft?« Ich deutete auf die Halle, die direkt neben einem Wohnhaus stand.
»Nein. War es mal. Wir lagern nur noch Boote ein, hin und wieder machen wir kleinere Reparaturen. Wir sind ein Ökolandbau-Betrieb.«
Ich nahm ein anderes Brett.
»Die sind alle zu lang. Hast du auch kürzere?«
In diesem Moment lief eine junge Frau mit einem Mann, der einen auffällig langen, grauen Zopf trug, über das Grundstück auf die ehemalige Werfthalle zu, deren Tor offen stand. Kurz darauf sprang eine Reihe Neonlichter an, die das halbe Grundstück mitbeleuchteten. »Bin gleich wieder da, ich hole mal einen Zollstock«, sagte er und lief ihnen hinterher. Ich blinzelte in das Licht, konnte aber niemanden mehr sehen.
Es war ein stiller Abend. Absolut ruhig lag die Lahne da. Auch hier trieben Blätter und Zweige auf dem Wasser, die Zeichen der vergangenen Nacht, die Zeichen des Gewitters. Wie absichtlich hingeworfen und ganz gleichmäßig verteilt schwammen sie an der Oberfläche. »Komm mal!«, hörte ich ihn rufen.
Die Halle war riesig. Ich ging um einen alten Lastwagen herum, bei dem die Vorderräder fehlten. Dann sah ich vier Segelboote in Holzgestellen, wobei mir nicht klar war, ob sie repariert werden sollten oder nur eingelagert waren. Der Mann mit dem Zopf stand neben einem dieser Boote und wickelte eine Leine auf. Überall standen oder lagen Kisten, Seile, Stoffballen, Werkzeuge, Segel und Motoren. An der Stirnseite hingen drei Anker an der Wand, darunter Steuerräder und präparierte Fische, eine lange Reihe unterschiedlich geformter Ruder. Ein vergilbtes Poster von Hans Albers.
Im hinteren Teil der Halle entdeckte ich ihn an einer großen Maschine, wobei ich nicht erkennen konnte, was sie darstellte. Ich beobachtete nur, wie er – den Joint noch im Mundwinkel, das lange Brett in der Hand – eine Schutzbrille nahm, den Gehörschutz aufsetzte und einen altertümlichen Hebel umlegte.
Das Kreischen, das anhob, war furchterregend. Ich trat ein paar Schritte zurück. Es klang wie ein Todesschrei. Das ganze Dorf musste von diesem irren Lärm verrückt werden, dachte ich. Aber das schien ihm egal zu sein. Und ich fand, dass das zu diesem Abend passte.
Es war eine Säge. An der Seite stand MASCHINENWERKEERNSTJÄGER und darunter Nürnberg Leipzig 1918. Ein langer Riemen war zu sehen, und unter einer Art Turm befand sich ein auffallend schmales Sägeblatt.
Ich hielt mir die Ohren zu. Er schob das Brett vor und kürzte es, führte alle Handgriffe konzentriert aus. Mir fiel auf, wie ich diesen Anfang Zwanzigjährigen anders, mit mehr Distanz, zugleich mit mehr Zuneigung und Neugier beobachtete. So hatte ich in Berlin seit Ewigkeiten niemanden mehr angesehen.
»Ratte«, sagte er grinsend, als er die Maschine abgestellt hatte und mir das Brett gab. »Das ist der Spitzname der Säge hier im Dorf.«
Er schaute mich einen Moment lang an. »Und ich bin übrigens Birk. Hallo!«
Ich musste lachen. »Rio.«
Dann schüttelten wir uns die Hand. »Tach.«
Das mörderische Kreischen vibrierte noch in meinen Ohren. Und als wir draußen neben seinem Boot angekommen waren, sagte ich: »Danke. Was willst du dafür haben?«
»Nichts. Kannst noch mehr haben, wenn du was brauchst.«
Es war Zeit, sich zu verabschieden, aber wir waren beide unschlüssig. Einen Moment lang betrachtete ich sein Boot. Es war ein altes Segelboot, das eine elegante Kielform hatte und auffällig schlank und edel wirkte, aber heruntergekommen war.
»Du bist der Typ auf dem Floß, oder?«
Ich hatte mich weitgehend unbeobachtet gefühlt, verborgen vom Schilf, bei den Seerosen, am Ufer. Der Satz amüsierte mich. Ich nickte.
»Wohnst du dadrauf?«
»Ja.«
»Cool. Wie lange willst du bleiben?«
»Für ein paar Wochen.«
»Selbstgebaut, oder?«
»Ja.«
»Ist illegal, weißt du.«
Ich schaute Birk an und grinste, obwohl ich das nicht wollte. »Ich habe beim Schifffahrtsamt einen Antrag auf ein Kennzeichen gestellt, aber nie eine Antwort bekommen. Bis jetzt ist die Polizei einmal vorbeigefahren. Haben mich entweder nicht gesehen oder es war ihnen egal.«
»Legal, illegal, scheißegal. Für so eine schwimmende Anlage kriegst du niemals eine Erlaubnis. Hast du einen Angelschein?«
»Nein.«
»Angelst du?«
»Nein.«
»Dann ist alles gut. Beim Angeln verstehen die Locals hier keinen Spaß. Wenn du zehntausend Liter Nitrat oder Glyphosat in die Böden bringst, kommst du durch. Wenn du ohne Angelschein eine Sprotte rausziehst, hast du ein Problem.«
»Wir haben eine Abmachung!«, hörten wir plötzlich jemanden rufen und drehten uns in die Richtung, aus der das kam. Es war die junge Frau, die sich vor der Halle aufgebaut hatte. Der Mann mit dem grauen Zopf war nicht mehr zu sehen.
»Ich weiß«, rief Birk.
»Warum hältst du dich dann nicht daran?«, erwiderte sie.
Birk setzte sich auf einen Stuhl neben seinem Boot.
»War eine Ausnahme.«
Sie stand ganz ruhig da, wie in einem Western, beim Duell, kurz vor dem Schuss. Sie war älter als er, vielleicht Ende zwanzig.
»Dann erzähl mir aber auch nichts von Konsequenz. Es darf keine Ausnahmen geben«, und sie drehte sich weg und ging davon.
Birk musste laut lachen und rief ihr hinterher: »Gut Nacht. Träum was Süßes, Schwesterchen.« Doch einen Augenblick später tauchte sie wieder auf, breitbeinig stand sie da. »Und wer ist das?« Es klang nicht unfreundlich.
Birk schaute mich an. Ich war gespannt, was jetzt kam.
»Keine Ahnung. Die Ursache. Er brauchte Holz.«
Als sie endgültig verschwunden war, sagte er: »Johanna ist harmlos. Hat nur ein Problem damit, wenn ich die Ratte für einen einzigen Schnitt anwerfe. Und hat alle zwei Tage das Bedürfnis jemanden anzumachen.«
Dann drehte er sich zu mir. »Gestern war doch dieses krasse Gewitter. Warst du da auf dem Floß? Ist es kaputtgegangen? Ist das Brett dafür?«
»Ja, ich war draußen, aber kaputtgegangen ist nichts. Das Brett ist für was anderes. Ich kriege demnächst Besuch. Möchte noch ein paar Sachen optimieren, damit man auf dem Floß auch gut zu zweit sein kann.«
»War nicht so lustig auf dem See, oder? Hier im Dorf sind die Keller vollgelaufen. Bei uns hinter den Gewächshäusern ist eine Mauer eingestürzt.«
»Nein, absolut nicht. Ich hatte echt Angst.«
»Hmm.« Er schaute mich an. »Klar. Das war megaheftig.«
Er nahm den halb aufgerauchten Joint, der auf einem Pflasterstein neben der Leiter lag, zündete das lange, schlanke Ding an und sagte: »Erzähl mal.«
»Stell dir einfach vor, du wachst mitten in der Nacht auf und merkst, dass da ein Sturm zugange ist, der dich und dein Floß quer über den See schiebt. Mein Anker ist wirklich schwer, aber der hat gar nichts gebracht.«
»Wahnsinn«, sagte er und grinste, »ein richtiges Abenteuer.«
»Ich habe Seitenplanen, die binde ich jeden Abend nach unten, damit ich ganz gemütlich wie in einem Zelt schlafen kann. Bei diesem Sturm waren sie allerdings wie Segel, perfekte Angriffsflächen. Ich musste sofort alle Planen hochbinden, um diese Fahrt zu stoppen. Aber so hatte ich keinen Schutz mehr vor dem Regen. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich habe es grad noch geschafft, meine Matratze zu verstauen und den Schlafsack in eine Kiste zu stopfen.« Ich machte eine Pause. »Da habe ich gemerkt, dass mein Handy weg war, hat der Sturm einfach weggeweht! Das war nicht so gut. Irgendwann will man ja vielleicht mal wieder telefonieren.«
Birk lächelte. »Wohl wahr, telefonieren muss man hin und wieder.« Er zog an seinem Joint.
»Auf jeden Fall war die Fahrt erst mal gestoppt, ich habe sogar das Handy wiedergefunden. Aber genau in dem Moment habe ich gesehen, wie ein Blitz auf der Insel eingeschlagen ist. Ein Baum hat Feuer gefangen und ist umgekippt. Dieses unglaublich laute Krachen. Nur fünfzig Meter neben mir. Ab diesem Moment hatte ich einfach nur noch wahnsinnige Angst. Ich war mitten auf dem See, mein Mast ist vier Meter hoch. Drei Minuten vorher hatte ich noch seelenruhig geschlafen! Und dann zuckte direkt über mir der nächste Blitz.«
Während ich erzählte, hockte sich Birk neben eine Metallkiste und öffnete sie. Als er die Abdeckung anhob, ging ein Licht an. Er nahm zwei Flaschen Bier heraus.
»Oh Mann, cool, ich liebe Seefahrergeschichten«, sagte er, öffnete eine Flasche und gab sie mir. »Prost.«
Wir stießen die eiskalten Flaschen gegeneinander.
»Los, erzähl weiter!«
7
Bei kleineren Ortswechseln lohnte es sich nicht, den Motor anzuwerfen. Nach dem Tiefgang der Fässer zu urteilen, wog das Floß ungefähr dreihundert Kilo, doch es war ein Leichtes und es machte Spaß, es mithilfe der langen roten Bootsleine über das Wasser zu ziehen. Wie ein Treidler, nur dass ich nicht am Ufer entlangging, sondern im hüfthohen Wasser waten und es bequem ziehen konnte. Das war ein bisschen wie Spazierengehen mit Floß-Begleitung.
Ich ankerte immer am nördlichen Ufer. Mal mehr westlich, wo der breite Schilfgürtel war, mal mehr östlich, wo der Wald direkt ans Ufer grenzte und ich mich mit dem Floß im Schatten der ausladenden Äste verstecken konnte. Wenn ich Kopfsprünge machen wollte, musste ich mich etwas vom Ufer entfernen, denn dort war es zu flach.
Am nächsten Morgen wollte ich zu dem Feld Seerosen, wo es so malerisch war, dass man es kaum aushalten konnte. Ich watete also durch das hüfthohe Wasser und zog das Floß hinter mir her. Ich hatte vor, es unmittelbar neben die schwimmenden Blüten zu setzen, aber auch so zu platzieren, dass ich im Schatten liegen und zugleich weit über den See blicken konnte. Als ich neben den Seerosen angekommen war, warf ich den Anker und konnte mit der Leine die exakte Position bestimmen, in der das Floß liegen sollte. Als ich es an einer der Miniaturinseln, auf denen das Schilf stand, festgemacht hatte, hörte ich das Dröhnen. Ich kannte dieses tiefe, laute Motorengeräusch und schaute in Richtung Ranitz. Ich wusste, gleich würde das Boot dort aus dem Fluss herausschießen, kurz hinter der Insel verschwinden und dann mit voller Geschwindigkeit über den See rasen. Bis zur Brücke und zurück. Das Dröhnen wurde lauter. Und da war es, mit den beiden gezackten Streifen auf der Seite. Es protzte quer über den See und warf eine dicke Welle auf. Keine Minute, dann erreichte sie mich. Ursache und Wirkung konnten durch kein Bild besser erzählt werden.
Die Welle hob mein Floß hoch und brachte es zum Schwanken, eine Tasse fiel um, rollte über das Holz, schlug gegen eine Kiste. Und schon wurde die Welle vom Ufer zurückgeworfen und drückte das Floß erneut und noch stärker auf die Seite.
Plötzlich hörte ich ein Räuspern direkt hinter mir. Ich drehte mich um.
»Wollte dich nicht aus deinen Tagträumen reißen!«
Es war Birk. Er saß in einem langen gelben Kajak, das über und über mit Aufklebern bedeckt war. There is no party on a dead planet, stand da sicher hundertmal. Im nächsten Moment hievte er, ohne sich am Floß festzuhalten, zwei prall gefüllte Stoffbeutel auf die Planken.
»Ist das für mich?«
»Ja, klar.«
»Das ist ja großzügig.«
Gurken und überdimensionale Zucchini schauten aus den Beuteln, ich sah auch Tomaten, Bohnen und sogar Erdbeeren. Und eine Flasche Bier. Ein Traum, bedenkt man, dass ich seit meinem Aufbruch vor allem Reis und Pasta mit Sambal Oelek oder Pesto gegessen hatte.
»Darf ich?«
»Ja«, sagte ich, und als er sich aufrichtete, stieg er mühelos aus seinem Kajak auf das Floß, während ich noch im Wasser stand.
Er lächelte und schaute mich an.
»Du brauchst was Frisches, meintest du.«
»So viel?« Ich stieg aufs Floß, griff mein Handtuch und trocknete mich ab.
»Ich könnte dir noch viel mehr bringen. Wir haben einen Hofladen, den dürfen wir aber grad nicht betreiben.«
»Wieso nicht?«
Birk blickte auf die Kisten, in denen ich alles verstaute. Auf die Matratze, meine Bücher, die Kamera, den Gaskocher, die Espressokanne. Da lag auch das Brett, das er mir gegeben hatte.
»Was? Ja. Weil das mit der Konzession nicht geklappt hat. Lange Geschichte. Zu kompliziert zu erklären. Nenn meinen Vater einfach Murphy. Alles, was er anpackt, geht schief«, sagte er und berührte einen der Holzbalken, die das Dach trugen, wie um zu testen, ob er stabil war.
»Gut, dass er nicht mit Flugzeugen herumfliegt oder Atomkraftwerke betreibt.«
»Er wollte mal eine Windkraftanlage aufstellen.« Birk schaute mich nachdenklich an.
»Und dabei hat er den Wind kaputtgemacht?«
»So ungefähr.« Birk lachte und setzte sich auf die Bank, die ich am Mast befestigt hatte. Er trug ein Tuch um den Hals, hatte ein Batik-Shirt an und weite Stoffhosen. Das sah alles ziemlich schwarz und grau und dunkel aus. Ein komischer Kontrast zu diesem Tag, an dem alles hellblau und grün zu leuchten schien und die Sonnenstrahlen auf dem Wasser glitzerten.
Er streckte die Beine aus. »Schön hast du es hier! Und damit bist du quer über den See gepustet worden? Verrückt. Ist viel robuster und größer, als man denkt. Aus der Entfernung sieht es wirklich lustig aus, dein Floß. Dein Kajak übrigens auch.«
»Darf ich vorstellen, der Schlumpf.« Ich nickte in Richtung meines Kajaks.
»Ja! So sieht das auch aus!« Er lachte.
Ich deutete auf die Beutel. »Ich würde dir gerne was dafür geben.«
»Wofür? Für Obst und Gemüse?« Er schaute mich einen Moment lang an. »Wir beliefern Wochenmärkte. Da bleibt immer ’ne Menge übrig. Das kriegen manchmal die Ziegen. Heute kriegst du es.«
Er stand auf und machte zwei Schritte auf sein Kajak zu. Das Floß schwankte.
»Die Leute reden schon über dich. Das weißt du, oder?«
»Wirklich? Na dann!«
»Der Typ auf dem Floß«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Meine Cousine hat mir getextet, dass du gesehen wurdest, wie du an der Brücke in Bridow telefonieren wolltest und deinen Müll an der Bushalte weggeschmissen hast.«
»Echt? Einmal hab ich das gemacht.«
»Einmal! Das ist mehr als genug.« Er lachte. »Aber warum fällt so viel Müll an?«
Ich dachte an die leeren Konservendosen, Nudel- und Basmatireis-Verpackungen, Tetrapacks, Zigarettenkippen, Weinflaschen, Zwiebelschalen. Das alles hatte ich in den Mülleimer neben der Bushaltestelle gestopft. Ich fand nicht, dass ich besonders viel Müll produzierte.
»Willst du einen Kaffee? Ich kann uns einen Espresso machen.«
»Ich trinke keinen Kaffee.«
»Tee?«
»Nein, keine Zeit, danke. Und wie machst du es eigentlich mit dem Wasser?«
»Als es neulich aufgebraucht war, hab ich bei euch im Dorf an einer Pension nachgefragt.«
»Und? Hast du die geballte Ladung Brandenburger Charme abbekommen?«
»Die waren eigentlich voll okay.« Ich griff nach einem der Beutel. »Danke jedenfalls. Und sag, wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst.«
»Auge um Auge, Zahn um Zahn?« Birk warf mir diesen prüfenden Blick zu, der etwas Hintergründiges und Ernstes hatte, wie ich fand, so als hätte ich gegen seinen Moralkodex verstoßen.
»Wenn du willst, kannst du mir direkt jetzt bei was helfen.«
»Jetzt?«
8
Wir ließen Ranitz, das Dorf, an dessen Rand Birk wohnte, hinter uns und paddelten die Lahne hinunter flussabwärts. Er war so schnell, dass ich kaum hinterherkam. Ich sah immer nur seinen schmalen, aber muskulösen Rücken vor mir. Kräftig und dynamisch setzte er das Paddel ins Wasser.
Nach einer halben Stunde Fahrt, weit vom Dorf entfernt, als keine Häuser mehr am Ufer standen, nur noch Bäume und Büsche, und der Fluss nach links mäanderte, legte Birk das Paddel endlich vor sich aufs Kajak und ließ sich treiben. Er blickte sich zu mir um, aber drehte sich nur so weit, dass er mich aus dem Augenwinkel sehen konnte. Kurz dachte ich, er hätte gehofft, dass ich nicht mehr da wäre. Aber ich war noch da und schaute ihn an. Dann tauchte er das Paddel links von sich ins Wasser und drehte sich um neunzig Grad, hielt auf das westliche Flussufer zu, wo eins der riesenhaften Schilder mit der Kilometerangabe stand. Eine 12 markierte die Entfernung zur Schleuse in Zernzig.
Dort, wo Birk anlegte, gab es keine Uferbefestigung, keinen Steg, nur dichtes Gebüsch und Äste, die weit über das Wasser ragten. Er hielt sich an einem Ast fest und stieg aus dem Kajak. Dann zeigte er auf eine Stelle, wo ich festmachen sollte. Nachdem wir ein Stück auf einem Trampelpfad gelaufen waren, kamen wir an ein Tor in einem Zaun und liefen quer über eine Weide. Da standen ungefähr dreißig Ziegen, einige mit grauem zotteligen Fell, die anderen mit kurzem braunen. Die Zicklein waren tiefschwarz. Sie schauten alle auf, als wir die Weide betraten. Aber die vielen Augenpaare fixierten uns nur für einen Augenblick. Einige Tiere wichen zurück oder trabten davon. Die meisten fraßen einfach weiter. Nur eins mit langen gebogenen Hörnern starrte uns ununterbrochen an.
»Der da«, Birk zeigte auf die Ziege, die uns nicht aus den Augen ließ, »das ist Vau. Der mit den schönen Hörnern.«
»Vau?«
»Eigentlich VdHA. Frag nicht. Das ist die Abkürzung für Die Versuchung des Heiligen Antonius. Den haben wir so bekommen. Der Name stand in seinem Herkunftsnachweis. Manche Züchter sind völlig plemplem. Mein Vater findet es super. Ich nenne ihn einfach Vau.«
Ich musste lachen. »Haben die alle Namen?«
»Ja.«
»Aber die kennst du nicht alle.«
»Doch.«
Wir liefen auf einen niedrigen, offenen Stall zu, und als er seine Gürteltasche abgenommen und dort auf das Dach gelegt hatte, fragte er: »Bist du bereit?«
»Wozu?«
»Ihn einfangen und ’ne Spritze verpassen.«
»Was für eine Spritze?«
»Vau hat Tollwut«, Birk schaute mich an.
»Nein. War ein Witz. Sie werden nur geimpft, reine Routine.« Er holte eine Plastikbox aus seiner Gürteltasche, hockte sich hin und klappte sie auf.
»Wogegen?«
»Nichts Wildes. Gegen Pasteurellose.«
In der Box lagen mehrere Spritzen mit auffällig kurzen Kanülen.
»Los. Komm. Auf ihn mit Gebrüll.«
Birk ging los. Sehr langsam allerdings. Ich neben ihm. Auf Vau, den Ziegenbock zu, der längst witterte, was hier im Gange war. Kampfbereit richtete er sich auf, wölbte seine Brust, dann senkte er den Kopf und hob ein Vorderbein. Wir waren kaum auf zwanzig Schritte herangekommen, da galoppierte er mit weit nach vorne gestreckten Hörnern zwischen uns hindurch. Ich sprang zur Seite und starrte Birk an.
Wir folgten ihm zum anderen Ende der Weide, stellten ihn am Zaun, und als er den nächsten Ausbruch wagte, brüllte Birk plötzlich: »UUAAAH!«, was das Tier irritierte und einen Haken schlagen ließ. Jetzt warf Birk sich auf ihn, hielt ihn an den Hörnern fest und brachte ihn zu Fall. Ich tat genau das, was wir in der Zwischenzeit verabredet hatten. Ich warf mich ebenfalls auf den Bock, griff seine Hörner und versuchte, ihn am Boden zu fixieren. Während Birk sich aufraffte und die Abdeckung von der Spritze entfernte, die er zwischen den Zähnen gehalten hatte, warf der Bock wie wild den Kopf hin und her und drehte den Körper um die eigene Achse. Mit aller Kraft schloss ich meine Fäuste um seine Hörner, und weil es fast unmöglich war, ihn festzuhalten, ich ihn aber nicht loslassen wollte, versuchte ich, seinen Rumpf mit meinen Beinen zu umklammern. Der Bock war nicht groß, aber schwer und unglaublich wendig und muskulös, und er war kurz davor, mir zu entwischen. Birk schrie: »Mach ihn müde! Mach ihn müde!«, und legte die Spritze in die Wiese, um mir zu helfen.
Wir umklammerten den Ziegenbock nun gemeinsam, aber Vau wurde nicht müde und Birk schrie, während er losließ und sich ein paar Schritte entfernte: »Oh Gott. Ich halt es nicht aus. Ich glaub, ich muss kotzen. Wie der stinkt! Lass es sein. Lass ihn. Heute haben wir keine Chance.«





























