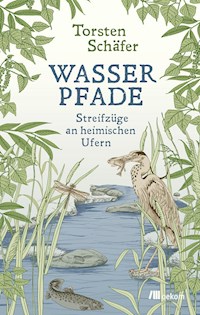Vorwort
von Andreas Weber
Mein Bewusstsein für das Wasser setzt mit einer Bachwanderung meiner Kindheit ein. Sie fand nicht weit entfernt von der Landschaft statt, deren flüssige Adern Torsten Schäfer in seinem Buch nachfährt. Schauplatz war ebenfalls das hessische Mittelgebirge, freilich nicht der Odenwald, sondern der Vogelsberg – nördlich statt südlich von Frankfurt gelegen.
Wie die Modau, der Fluss, um den Schäfers Buch kreist, mündet auch das Wasser der Eichel letztlich in den Rhein. Die Eichel durchfließt das Dorf, in dem mein Vater seine Kindheit verbrachte (und in dem sein Spielkamerad und Namensvetter Anfang der 1950er-Jahre ertrank). Der Bach schenkte den Kindern die Erfahrung, wie existenziell im Guten wie im Schlechten Wasser für uns Menschen ist – für uns Flüchtige, Abhängige und Begehrende des flüssigen Elementes.
Ich erinnere mich an den Weg durch das Bachbett, mit Sandalen gegen versteckte Scherben geschützt, beschattet von Erlen, die Waden gekitzelt vom Nass, das über die Kiesel sprang. An manchen Stellen bildete der Fluss eine Furt, durch die Kühe zum anderen Ufer trotteten und ein Bauer seinen Traktor hinüberlenkte, die kopftuchtragende Bäuerin auf dem Seitensitz festgeklammert.
Mir klopfte damals das Herz, die Wirklichkeit plötzlich aus der Perspektive des Baches zu sehen, mit dem Gesicht des Wassers selbst. Es schien, als hätte die bescheidene Eichel die Kraft, mich zu einem Selbst zu führen, das versteckt in mir schlummerte, verborgen wie der kleine Wasserlauf hinter Hecken und Dorfmauern, vorhanden und doch ungesehen. Eine gerade Linie in meinem Herzen, die erst sichtbar wurde, als ich meine kleinen Füße auf sie setzte.
Wenn ich zurückblicke, zeigte mir die Bachwanderung eine versteckte Tiefe der Welt, die nichts anderes war als die Tiefe in mir selbst. Sie bewirkte, dass ich diese Tiefe in mir spüren konnte, weil ich ihrer Gegenwart in der Welt Respekt zollte. Heute würde ich sagen: Wir wissen, dass uns das Wasser etwas über diese Tiefe zuflüstern kann, weil wir Wasser sind.
Die folgenden Seiten haben die Erfahrung meiner Kindheit, der Welt als Gleichgesinnter, als einer Spielgefährtin zu begegnen, wachgerufen. Ich dachte beim Lesen: Ich kannte auch so einen Fluss, im Hessischen, ich weiß, wovon der Autor spricht, er drückt es aus! Schäfer tut auf den Seiten dieses Buches in immer neuen Anläufen nichts anderes, als die Tiefe des Wassers in seinem spürenden und die eigene Tiefe ahnenden Körper auszuloten. Und am Ende muss er dieses Wasser, ohne es ganz ergründen zu können, weiterziehen lassen, zum Rheinstrom, zum Ozean, dahin, wo alles zusammenfließt.
Gaston Bachelard, der französische Philologe einer »Psychoanalyse« des Wassers, brachte auf den Punkt, was ich meine, als er von den Wasserpfaden Burgunds sprach, die über hellen Kalk ziehen, im Untergrund versinken und an anderer Stelle unverhofft in einem stillen Quellteich aufwellen – und die, wie auch die Bäche Hessens, letztlich im großen Atlantik münden: »In meinen Träumen am Fluss habe ich meine Phantasie dem Wasser geweiht … Das anonyme Wasser kennt alle meine Geheimnisse«, schrieb Bachelard. Das Wasser weiß, weil es auch mich enthält.
Aber um dem Wasser unsere Geheimnisse anvertrauen zu dürfen – um unsere eigene Tiefe zu erfahren, indem wir die Tiefe des anderen in uns einströmen lassen –, müssen wir den Weg des Flusses in geduldiger Arbeit entschlüsseln. Das ist nicht mit der magischen Geste des Flaneurs zu erledigen, der durch die Natur streift und das Schöne pflückt. Es lässt sich mit einer touristischen Haltung nicht bewerkstelligen, sondern erfordert Arbeit. Die Geheimnisse eines Flusses, eines Wassereinzugsgebietes mit seinen kleinen und kleineren flüssigen Pfaden zu kennen erfordert geduldiges Lernen. Seine Geheimnisse im Wasser gespiegelt zu finden ist kein Konsumakt, sondern Selbstveräußerung.
Um die Tiefe des Wasser zu erzählen, ist eine erzählerische Tiefe nötig, die sich nicht allein aus ästhetischer Imagination speist, sondern die sich mit der realen Gestalt des Flusses befasst, mit seiner ganz und gar empirischen Beschaffenheit, mit dem Kleinen und dem Großen, dem Glück an einer Biegung seines Laufes, die ein Stück verwunschene Wildnis offenbart, wie auch mit der Bestandsaufnahme seiner Verbauungen – und der Menschen, den großherzigen oder den spießigen, an seinen Ufern.
Genau das gelingt Schäfer. Er folgt dem Fließenden in sich selbst, das ihn zum Fluss in seiner Geburtslandschaft zieht, und er nähert sich diesem Selbst an, indem er geduldig den wirklichen Fluss besucht, seine Anwohner befragt, die mit seiner Erhaltung und seiner Zerstörung befasst sind. Schäfer überfliegt die Modau nicht, sondern erwandert (und erschwimmt) sie sich als Dokumentar, als Archivar, als Chronist, als Geograph. Schäfer studierte Journalistik in Dortmund, war einige Jahre lang Redakteur bei GEO International und trat 2013 eine Professur für Journalismus mit Schwerpunkt Textproduktion an der Hochschule Darmstadt an – wodurch er in einer Punktlandung wieder zum Fluss seiner Kindheit zurückkehrte.
Der Autor startet nicht mit dem Narrativ, mit der Imagination – also mit sich selbst – und findet dann die Bilder dazu in der Landschaft. Sondern er wendet sich nach außen, lässt sich von den realen Gegebenheiten des Wasserlaufs ziehen, verliert sich in der Landschaft, um daraus die Essenz des Flusses Tropfen für Tropfen zusammenzusetzen. Das ist bescheiden, und das auf bewunderungswürdige Weise, mit einem Blick für die Akteure der Provinz, die Wasserbauer und Flussfischer, die alten Frauen auf den Brücken, mit denen sich Gespräche entspinnen. Aus diesen Details entfaltet sich der Charakter des Flusses, der sich nach und nach ins Gemüt des Lesers eingräbt, mit Kolken und Flachstellen, mit Libellen und Forellen, mit der Lust seiner kurvenden Ufer und dem schwärenden Weh seines zerstörten Körpers, der Kanalisierungen und Barrikadierungen.
Mit all dem hat Schäfer ein hervorragendes Stück dessen geschaffen, was heute als Nature Writing in aller Munde ist. Es gibt sogar einen Literaturpreis dafür, und ich wünsche mir, dass er Schäfer mit einem seiner nächsten Werke zufällt. Derzeit werden gern Romane prämiert, die ihr Setting in der »Natur« haben, in denen »Natur« eine mystifizierende Rolle spielt, denen aber doch fehlt, was Schäfer hat: Sie kümmern sich oft wenig um die atmenden Details. Sie fabulieren, aber sehen nicht hin. Sie glauben nicht, dass die Begegnung mit »Natur«, also mit der nichtmenschlichen Welt, etwas über uns sagen kann.
Deutsches Nature Writing schafft oft Distanz zu der Natur, auf die es sich fixiert. Es findet in ihr wohlbekannte Diskurse wieder, gleitet aber an realen Körpern hilflos ab. Nature Writing leidet an der Körperangst der Intellektuellen. So konstatiert Marion Poschmann in Mondbetrachtung in mondloser Nacht: »Je genauer man hinsieht, desto unschärfer und vieldeutiger werden die Dinge.« Das ist nicht die Haltung, mit der Schäfer arbeitet: Für ihn ist das vertiefende Abmühen mit den Details seiner Heldin, der Modau, der Weg zu einer immer weiter fortschreitenden Bekanntschaft. Je tiefer er sich dem Fluss annähert, desto intensiver wird dieser ihm vertraut, und desto mehr vertraut er sich selbst.
Während sich das in Deutschland erfolgreiche Nature Writing mit der abgeschabten (und im Anthropozän überholten) kantianischen Position abgequält, dass der Mensch der »Natur« ein ewig Fremder sei, freundet sich Schäfer mit dieser an. Durch geduldige Arbeit und schweißtreibende Recherche (er sammelt Müll aus einer Quelle, er leitet seine Studierenden an, als angehende Umweltjournalistinnen jedes Detail aufzufischen) kommt Schäfer dem Fluss so nah, dass er dessen Zuneigung findet.
Damit steht Schäfer ziemlich genau in der Tradition von das Genre begründenden Autoren wie Henry David Thoreau und Gilbert White. Was er schreibt, atmet nicht die (derzeit wieder neu erstehende) Romantik der deutschen Erblinie, die sich mit Fichte und E. T. A. Hoffmann von der Welt der Körper abspaltet und stattdessen die eigene Befindlichkeit auf eine letztlich stumme »Natur« abbildet. Schäfers Arbeit zeigt eine zärtliche Geduld gegenüber der Welt, eine Geduld, die weiß, dass die Welt nur fruchtbar wird, wenn wir ihr mit Großzügigkeit den Raum lassen, sich selbst zu erschaffen.
Thoreau stellte sein Büchlein Walden aus einem Konvolut empirischer Beobachtungen zusammen, in denen er Realien archiviert hatte wie die Uhrzeit eines Regengusses, seine Richtung, die Größe seiner Tropfen. Thoreau wusste, dass es die Materie der Welt ist, aus deren Drang sich Form bildet. Er vertraute darauf, dass sich im Konkretesten das Ganze zeigt. Er suchte, was die kanadische Dichterin Jan Zwicky als »Dasheit« bezeichnet: Die »Erfahrung eines bestimmten Dinges auf eine solche Weise, dass die resonante Struktur der Welt durch es hindurch klingt«. Dafür müssen wir dieses Ding wirklich sehen.
»Ich habe die Ufer verfolgt, bin eingetaucht, es hat mich verwandelt, während sich die Flüsse und Teiche selbst verwandelten«, schreibt Schäfer. Das ist die Art von Erfahrung, die mit Bescheidenheit beginnt und dann staunend feststellt, dass diese Bescheidenheit der übrigen Welt erlaubt zu erscheinen. Es ist eine Bescheidenheit, die sich nicht darin versteigt zu glauben, unsere Imagination reiche aus, die Welt und das Poetische an ihr zu erschaffen. Vielmehr weiß sie, dass dieses Poetische Teil der Welt ist und dass man ernsthaft suchen – beobachten, warten, horchen – muss, um sich würdig zu erweisen, es zu finden.
Wir projizieren nicht narzisstisch unsere kulturellen Vorstellungen auf eine Leere, die wir dann »Natur« nennen. Wir werden von der Welt imaginiert, so herum ist es richtig. Dafür müssen wir der Welt gestatten zu sein. Dann können wir erleben, dass sie uns das Gleiche erlaubt. Das ist die Erfahrung, die Torsten Schäfer zuteilwird, weil er der Modau, dieser Spielart flüssiger Welt, ihren Raum schenkt. Dadurch schenkt sie ihm seinen zurück.
Dieses Geschenk zu erhalten war die Erfahrung in der Tiefe meiner Kindheit, zu der mich Schäfers Wasserpfade zurückführen. Das Geschenk bestand darin, ganz in der fließenden Welt inbegriffen zu sein. Es ist das Gegenbild zur Blickrichtung des Narzissten. »Was das Wasser nämlich bewirkt«, so sagt das der schon zitierte Gaston Bachelard, »ist eine Verwandlung unseres Spiegelbildes in Natur.«
1
Erste Wege
Himmelsfenster. Vielleicht liegt der Grund für die Sehens-Sucht und den Drang, in die Landschaft hineingehen und sie ergründen zu wollen, in dem Himmelsfenster, in dem ich aufgewachsen bin; ich habe diesen Zusammenhang gerade eben erst entdeckt, ein neuer Schatz, der erst noch gehoben werden muss. Der Lohberg, auf dem ich groß geworden bin, liegt weit über der Ebene und hat seinen Namen vom Loh, einem alten Wort für Holz, das zum Gerben verwendet wurde, wie auch von Waldgebieten, deren Holz nur bestimmte Marktgenossen schlagen durften. Es sind nur 280 Meter, die er sich hochstreckt, bis zum Gipfel an der »Finsteren Hölle«, einem bis heute schwer zugänglichen Waldstück, das wir bei allen Wanderungen und Entdeckungen meist mieden; mit dichten Vorhängen aus Wildem Wein am Rand, danach großen dunklen Fichten, schlechten Wegen und alten Bombenkratern.
Von unserem Berg ging morgens der Schulweg hinab ins Dorf, und wenigstens einmal blieben wir stehen, um in die Ferne zu sehen, durch das Himmelsfenster, das an manchen Tagen Wolkentiere schickte, die zur blauschwarzen, düsteren Herde wurden über der Rheinebene, die sich hinzieht bis ganz hinten, zum Horizont. An anderen Tagen tauchen in diesem Panorama Sonnenwesen auf, Strahlenstränge und alle Sommerfarben, die sich niemand hätte ausdenken können. In die man gleich hineintauchen will – wie auch in die Dämmerung oder gar in die Nacht, wenn das Lichtermeer unten in der Ebene liegt.
Manchmal, wenn der Horizont zu sehr lockte, standen wir auch am Rande des großen Feldes, hinter dem unser Revier begann, und liefen einfach los, über das Feld in den Himmel hinein, bis sich irgendwann der Boden senkte, der Schlamm vielleicht das Rennen bremste und uns wieder einmal klar wurde, dass wir so nicht weiterkamen.
Der Blick aber geht hier immer weiter, reist 60 Kilometer hinüber zum Donnersberg in der Pfalz, schweift über all die Windräder ganz außen am Gesichtsfeld, gleitet über die Pfälzer Wälder und verweilt dann vor dem Rhein, der silbernen Schlange, die im diesigen Licht schläft und glitzert. Der große Strom regiert hier still und erhaben, wohl wissend, dass er fast immer da war oder mindestens schon so lange, dass es sich darüber nachzudenken lohnt. Auch zu ihm wollten wir damals hinrennen, er nährte die Phantasien, gab der Ebene und ihren Städten Namen, damit sie sprechen und entdeckt werden konnten.
Von Hutzelweg und Habichtsflug. Im Internetlexikon wird die Neutscher Höhe als Gebirgspass beschrieben, was ich für etwas übertrieben halte bei einer Anhöhe von rund 360 Metern, die eher ein weit gezogenes Hochplateau darstellt. Aber es ist ein wunderbares Plateau, auch weil hier vor 2000 Jahren die Römer schon Waren herfuhren, von Dieburg und aus dem Odenwald. Die Hutzelstraße und die Gegend rund um die Neutscher Höhe sind eine feine Aussichtsfläche, die den Wind einfängt. Daher stand hier auch das erste Windrad Süddeutschlands. Von diesem Höhenzug wandert jetzt mein Blick in alle Richtungen, nirgends stellt sich ihm mehr etwas in den Weg: In der Ferne stehen die Wolkenkratzer Frankfurts mit dem EZB-Turm. Dann schaue ich zur Pfalz, zum Donnersberg und den Windrädern, die inzwischen zur Landschaft gehören, wie es die Strommasten tun. Die Senke des Rheins zeichnet sich ab, diesig am Horizont, immer wieder schemenhaft Wälder und viel offenes Land mit langen Häuserflecken, Türmen, grünen Inseln.
Es sind von hier aus nur wenige Kilometer in jedes Tal, ins Lautertal, Stettbachtal, Modautal, Mühltal – immer sind es die kleinen Bäche, die Namen geben und daran erinnern, dass mit dem Wasser die Namen kommen und das Leben beginnt. Mir wird klar, obwohl ich hier schon oft war, wie zentral dieses Plateau des Odenwalds und der Bergstraße ist, dass hier alle Wege zusammenführen und wieder auseinandergehen. Mir wird jedoch auch bewusst, wie verlassen die Gegend ist, da hier abgesehen von ein paar Höfen und einzelnen Gehöften nichts ist außer Wald, Feld, Windrädern und Wegkreuzen.
Mit mir unterwegs ist mein ältester Gefährte, Rouven Wembacher, mit dem ich seit dem vierten Lebensjahr befreundet bin; ein Landschaftswanderer, mit dem ich vieles geteilt habe über die Jahrzehnte – die Schule, viele Reisen, das Angeln, die Streifzüge in der Natur, die immer noch anstehen und nun von seiner Beobachtungsgabe und seinem Wissen profitieren. Denn Rouven, der Gefährte, ist Diplom-Ingenieur für Umweltschutz und arbeitet heute im Artenschutzreferat des hessischen Umweltministeriums.
Wir schauen jetzt nach oben, Rotmilane ziehen pausenlos über die Felder, teils so tief, dass ihr rostfarbenes Gefieder uns matt anglänzt, wir sehen den gekerbten Schwanz und ihren schwankenden und doch erhabenen Flug. Turmfalken rütteln über frischer Mahd, lassen sich fallen, um wieder aufzusteigen, kabbeln sich mit einer Krähe und verschwinden wieder in die Weite. Dazu die ewigen Boten, die Bussarde, mit denen wir vor dem Stimmbruch Unterhaltungen pflegten. Was sie sagten, wusste ich nie. Aber ich wusste, dass sie antworteten.
Wir ziehen weiter und hören ein Habichtpaar vor dem Waschenbächer Wald mit seinem grellen, zeternden Rufkonzert – um dann einen der beiden über dem Nieder-Ramstädter Boschel gleiten zu sehen, was selten ist. Denn Habichte sind Ansitzjäger und keine Gleiter; wie muss ihm oder ihr dieser Versuch vorgekommen sein, der etwas unbeholfen wirkte und nie ins eigentliche Gleiten hineinkam durch immer neue Anläufe, mit denen sich der große Vogel in die Höhe wirft, um dann bald wieder abzusinken. Hinter ihm öffnet sich vor unserem Blick die Rheinebene, Eberstadt, Pfungstadt, Ried, dann der Rest. Verbautes Land mit wenigen Geheimnissen, hatte ich oft gedacht. Jetzt überlege ich, wo es sich dort zu laufen lohnt.
Dreiflussland. Ich begreife die drei Flüsse als Grenzen unserer Region, wodurch eine Insel entsteht. Rhein, Main und Neckar müssen über Jahrtausende als natürliche Grenzen gewirkt und dabei tief eingeprägte kulturelle Muster hinterlassen haben. Ich weiß zu wenig über ihre Grenzwirkungen, aber die Vorstellung, aus einer Insel herauszukommen, die von Flüssen gerahmt ist, treibt mich an. Denn wer sich länger an den drei Ufern aufhält, so wie ich es von Kindheit an gemacht habe, und oft ins Wasser sieht, versteht, warum Flüsse so besondere Grenzen sind. Sie sind anziehende Grenzen; ich will nicht nur über sie hinweg, sondern auch auf sie, in sie hinein, bei ihnen bleiben. Die meisten Grenzen stoßen ab. Aber Flüsse, diese untypischen und doch ältesten Grenzen, ziehen an.
Kartenreisen. Wie steht es denn um die Quellen in diesem Land zwischen den drei Flüssen? Es sind viele und immer mehr, wenn man die Kartenmaßstäbe immer größer wählt, neue Karten auf den Tischen ausbreitet und sich dem Land so von oben in immer engeren Schritten nähert.
Ich gelange zu einer Karte meiner Gemeinde und entdecke auch kleinere Fließstrecken und Miniaturbäche, die ich nicht kannte, obwohl ich glaubte, dieses Land ganz genau zu kennen. Mit den Quellen geschieht es ähnlich; je näher ich mich auf die Karten und das Land einlasse, in dem ich wohne, je genauer ich es durchstreife, im Moment nur vom Schreibtisch aus in Gedanken und mit Phantasien, aber mit all der Begeisterung, die das Kartenreisen in Momenten der Muße entfachen kann. Je mehr ich dies tue, desto stärker wird mir klar, wie sehr das Wasser überall ist. Wie sehr wir mit ihm verwoben sind und es nur verbannt haben aus dem Denken und Tun.
Hier auf der Karte ist es nun überall vor mir, als Rinnsal und Quelle, als unbekanntes mäanderndes Wesen, das sich in einen kleinen Bach, den Beerbach, ergießt, der wiederum in den mittleren Fluss, die Modau, gelangt, die sich unten im Tal zum Rhein aufmacht. Aber von diesen kleinsten Bächen spricht heute kaum jemand mehr. Nur wenn im alten Ritual der »Grenzgänge« die Gemarkung abgewandert wird, eine knappe Hundertschaft der Bewohner ist meist dabei, mit dem Ortsvorsteher an der Spitze in schleppendem Tempo, scheint die alte Grenzmarkierung auf, die sich öfter an den Wasserläufen und Quellen orientiert.
Wie es um die Bäche und Quellen steht, möchte ich auf den Wanderungen herausfinden – und in Gesprächen mit den Wassermenschen, die sich eine besondere Beziehung zu ihnen erhalten oder auch ganz neu aufgebaut haben. Ich habe viele getroffen, manche geplant, andere unverhofft, typische und überraschende Ufergänger, auch solche in Amtsstuben, denn da wird letztlich über die Ufer, die Quellen, Bäche und das Leben darin entschieden. Nur in das Fließen zu schauen bringt nichts, denn es sind die Fachleute und Behördenmenschen, die ihren Teil zur Geschichte unserer kleinen Gewässer beitragen. Und die Wissenschaftler wohl auch.
Geolob. Mir sind viele Fächer der Wissenschaft auf der Wasserreise begegnet, natürlich die Hydrologie und Biologie mit der Ökologie und anderen Teildisziplinen, aber auch die Geologie, Geschichtswissenschaft, die Psychologie und Rechtskunde wie auch die Theologie mit ihren Wasser- und Taufdeklinationen. Wo aber ist die gute alte Erdkunde, mein erstes Lieblingsfach, geblieben, die Geographie als allgemeine Beobachtungslehre der Landschaft wie auch ihrer Menschen und deren Geschichte? Mein Eindruck ist, dass wir ihr weniger begegnen als früher. Es könnte am Trend zur Spezialisierung liegen, der alle Bereiche erfasst hat. Aber die Geographie ist anders, denn sie ist eine Klammer, ein Bindeglied, das nicht fehlen darf, weil sie den Kontext, den Zusammenhang über Fachgrenzen hinweg herstellt.
Deshalb hat ihr der Reiseschriftsteller Sylvain Tesson in seinem Kurzbericht von der Unermesslichkeit der Welt eine kleine Ode gewidmet. Für ihn wirft die Geographie das, was die anderen Fächer preisgeben, »in ihren Kessel, mischt die Zutaten und braut daraus ihre Lesart der Welt. Sie bittet die Historie um den Namen des Heeres, das in diesem Tal sein Blut vergossen hat. Sie fragt die Geologie, aus welchem Stein die Mauern des auf eine Bergkuppe erbauten Klosters sind, und die Geomorphologie, wo die Bergkuppe ihren Ursprung hat. Sie fragt die Paläoklimatologie, seit wann man Wein in Hanglagen anbaut, die Palynologie, was früher auf heutigem Brachland wuchs, bittet die Toponymie, das zu offenbaren, woran sich selbst die Ältesten nicht mehr entsinnen, und erfragt von der Topographie, weshalb sich die Ruinen eines Burgturmes genau an dieser Stelle befindet.« Und sobald die Daten gesammelt seien, schreibt der Franzose weiter, »offenbart sie ihre Vision, enthüllt, was die Naturgewalten dem Substrat zugemutet und was der Mensch ihm angetan hat. Sie überreicht die Schlüssel, die das Verständnis der Landschaft erschließen. Mit der Geographie wird endlich Licht.«
Hauptdarsteller. Wenn ich höre, dass in manchen Medizinstudiengängen Strickkurse angeboten werden, um die Fingerfertigkeit für die Operationen zu trainieren, würde ich gerne Wald- und Flussexkursionen mit Kletter- und Schwimmeinheiten verordnen. Damit die Finger und Hände in Bewegung geraten an den Orten, aus denen heraus die Menschen gekommen und seine Gesellschaften entstanden sind – Wälder und Flüsse, Bachtäler und Auen, Quellen. Hier liegen Antworten auf viele Fragen, auch auf meine danach, wie es diesen Landschaften wirklich geht, wohin sie mit uns gehen. Ich weiß es nicht, trotz vieler Lektüren und Recherchen, denn ich habe sie nicht mehr gefühlt, nicht so betreten wie zu der Zeit, als ich offener, intuitiver und meditativer war als heute, als Kind und Jugendlicher.
Daher mache ich mich auf diese lange Suche, die aber nach vorne weist. Denn wir müssen viel tun, weil es den Gewässern nicht gut geht, so viel ist klar. Und wir müssen es, weil die EU mit der Wasserrahmenrichtlinie allen ihren Ländern vorschreibt, die Gewässer in einen »guten Zustand« zu bringen. Das heißt, kurz gefasst, dass es keine Hindernisse für wandernde Arten wie Lachs und Bachforelle mehr geben darf, dass die Wasserqualität besser werden muss und die Flüsse renaturiert werden, damit sie wieder ursprünglichere Ufer bekommen. Diese Riesenaufgabe steht vor allen Staaten, Bundesländern, Regionen, Bezirken und Gemeinden, allen, die Verantwortung für die Flüsse tragen. Sie sind schon einmal gescheitert, denn die Richtlinie stammt aus dem Jahr 2000 und sollte von den EU-Staaten 2015 umgesetzt sein; nun ist 2027 die neue Frist.
Ich frage mich am Beginn meiner Wasserreise, was »ein guter Zustand« genau sein soll, wie es dorthin geht, was die Hindernisse sind – faktisch und emotional, explizit und implizit, gerade für die kleinen und mittleren Gewässer, von denen wir so viel weniger sprechen, denken, aufschreiben.
Ich werde diese Teiche und Seen, Bäche und Flüsse suchen zwischen allen Orten meines Lebens und ihnen die Rolle der Hauptdarsteller zuweisen, damit sie lebendig werden und Geschichten über Ortswesen und Wesensorte entstehen, damit die Landschaft spürbar wird und Worte erhält.
Flüsse gucken. Oft, wenn ich ans Wasser komme, zu Fuß oder in Gedanken, lande ich im Wald; beides ist für mich nicht voneinander zu trennen, deshalb sind mir die kleineren Flüsse, die sich direkt am Waldrand schlängeln, ihre Kurven zwischen die Bäume legen und sich wieder aufmachen nach einer Weile in das flache Land und die baumlose Weite, meine liebsten Flüsse. Sie nehmen Kontakt auf, lassen sich einhüllen von den Baumreichen und ziehen besondere Bäume wie die Schwarzerle an, die das Bachufer hält und Kinderstube für Fische und Insekten ist. Und dann wenden sie sich wieder ab mit ihrem eigenen Willen zur Ebene, zum Tempo, zum Fortstreben aus den dunkleren Gefilden mit Blättern und Stämmen. Aber dieser Kontakt, diese Flusskurve, die sich in den Wald neigt und wieder aus ihm herausstrebt, sie hat mich schon immer angezogen.
Ich erinnere mich an eine Klassenfahrt in den Norden Hessens, nach Schlitz an der Fulda, wo wir mit meiner sangeslustigen Französischlehrerin durch die Gegend wanderten, teils falsch, weil unser Physiklehrer ständig die Wanderkarte verkehrt herum hielt. Doch wir zogen immer wieder an der Fulda entlang mit ihren Prallhängen, steilen Brennnesselufern, schattigen Weidentunneln und ja, dann auch den Waldkurven, die sie nahm.
Auf der Anfahrt schon sah ich diese Kurven vom Bus aus. Ich reckte mich empor, musste auf die andere Busseite gelangen und hoffte, es noch zu schaffen, denn die Straße führte wieder den Berg hinauf und weg vom Fluss. Doch dann war irgendein Platz frei, ich presste meine Nase an die Scheibe und schaute hinunter in die Kurve der Fulda im Wald, so lange ich konnte.
So mache ich es heute noch, wenn ich Zug fahre und dann, der Geschwindigkeit wegen, noch kürzer, teils nur schemenhaft, kleine Flachlandflüsse auftauchen. Manchmal bekomme ich sie nicht, aber immer wieder entdecke ich sie noch, mit letzten Schritten im Zugabteil, schnell ans Fenster und noch irgendwie das Flussgucken versuchen. Die meisten bleiben mir unbekannt, weil alles so schnell geht. Aber ich nehme ihre Bilder mit und setze sie zur Fulda in Beziehung. Oder zur Werra, deren Kurven und Schlingen auf dem Weg nach Norden ebenso knistern und mich zu sich hinziehen.
Klein, mittel, unbekannt. Deutschlands Flüsse und Kanäle sind 530 000 Kilometer lang. Nur 6550 Kilometer davon sind schiffbar, die sogenannten Bundeswasserstraßen. Den Rest, rund 524 000 Kilometer, machen mittlere und kleine Flüsse aus. Um sie geht es mir, Flüsse, über die viel weniger gesprochen und geschrieben wird, weil sie sich dem bundesweiten Blick entziehen. Weil sie lokale Umwelten sind, die sich stark voneinander unterscheiden, gleichzeitig aber viele Erfahrungen und Probleme gemeinsam haben. Die meisten dieser Flüsse sind die kleinen Flüsse, für die die »Bund- und Länderarbeitsgemeinschaft Wasser« ein Einzugsgebiet von 100 bis 1000 Quadratkilometer vorsieht. Unter 100 Quadratkilometern sind es Bäche, über 1000 große Flüsse und ab 10 000 Ströme. Das Einzugsgebiet meiner Modau – und damit ungefähr auch dieses Buches mit seinen Wäldern, Gewässern und Orten – ist 205 Quadratkilometer groß. Dieser Fluss ist nur 44 Kilometer lang – ein Fluss, wie es Tausende davon gibt. Deshalb ist sie ein Prototyp, steht für ein gemeinsames Schicksal. Und für die Schönheiten, die jedem Fluss eigen sind. Und so ist es mit den Quellen, Brunnen, Teichen und Seen in meinem Land; denen, die ich meist kannte, aber jetzt wieder nähergekommen bin; ungezählt sind sie bundesweit, unterschiedlich und doch ähnlich: ganz klein als Gartenteich und größer als Parksee oder Tongrube, die aber nicht die Aufmerksamkeit eines Bodensees oder Chiemsees bekommen.
Sie. Meine Flüsse sind weiblich, auch der Heimatfluss, die Modau, um die es später gehen wird, ist eine Wasserfrau. Auch der Bach, die häufigste Gewässerform am Fuße des Mittelgebirges, ist in unserem südhessischen Dialekt weiblich; man geht in »die Bach« oder wohnt an ihr. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht in der Weise, wie ich auf Flüsse und Bäche blicke und darüber schreibe, ich glaube schon. Der Reisejournalist Dirk Rohrbach hat kürzlich im Radio seine Reise von der Quelle bis zur Mündung des Missouri vorgestellt, in mehreren Folgen und mit vielen Wasser- und Ufermenschen, die das Wesen des Flusses erklärt haben – er ist dort eine »Sie«, und für die Uferbewohner war es wichtig. Alles Große aus der Natur sei weiblich, sagte einer.
Anfang. Wir standen mit den gelben Gummistiefeln in der trüben Brühe, die sich Modau nennt, ein kleiner Fluss, der den Odenwald durchfließt und in eine alte Schleife des Rheins mündet. Wir standen da zu dritt, einer hielt einen blauen Müllsack auf, und die anderen stopften hinein, was sie im grauen Wasser finden konnten: rostige Cola-Dosen, braun-ölige Plastiktüten oder Reste davon, Schrauben, einen Schuh. Es war Abfall, den die Dorfbewohner über die Jahre in unseren Fluss geworfen hatten. Für sie war die Modau ein fließender Müllkorb. Aus unserer kindlichen Sicht aber begingen sie grausame Taten, wenn sie etwas hineinwarfen, die »Umwelt verschmutzten«, wie wir Fünftklässler ein Jahr zuvor in der Grundschule gehört hatten.
Wir drei waren wütend. Wir wollten helfen, verbessern, machen. Und das große Ziel verfolgen: Fische sollten in das öde Fließ zurückkehren, vor allem der Lachs, der unser König aus den Büchern war. Wir glaubten fest daran, dass wir ihn zurückbringen könnten, wenn nur die Modau wieder sauber würde. Wir wussten Bescheid, wir angelten seit dem sechsten Lebensjahr und kannten die Arten. Außerdem hatten alte Angler etwas vom Programm »Lachs 2000« für den Rhein erzählt, der Ende der 1980er-Jahre eine stinkende, blickdichte Brühe war.
Als wir da so in der Modau standen, hielt plötzlich ein Mann mit buntem 80er-Jahre-Pulli oben am Geländer der Promenade und rief etwas zu uns herunter. Es war der Jugendpfleger unseres Dorfes. Als wir ihm erklärten, was unsere Ziele waren, hatte auch er plötzlich eines: Die Jugendumweltgruppe Mühltal war gegründet. Und damit ein erster Ort für Umweltpädagogik in unserer Gemeinde. Was in den drei Jahren danach folgte, waren Neugiersalven, Spaßaktionen und echte Lehrstunden – Förderung im besten Sinne. Der Jugendpfleger trieb eine Umweltpädagogin auf. Mit ihr rammten wir kleine Schwarzerlen in Bachufer, um sie wieder fester und natürlicher zu machen. Gingen mit Detektoren nachts auf Fledermauswanderungen. Und siebten Insekten aus Bächen, um anhand der Funde die biologische Gewässergüte zu bestimmen. Wir machten das aber nicht zu Hause, in Mühltal, sondern fuhren dafür, ich weiß nicht, warum, nach Neckargerach in den badischen Odenwald, wo sich der klare Seebach durch den Wald schlängelt und in den Neckar mündet.
Es war jedes Mal ein spannendes Suche- und Ratespiel mit großen Lerneffekten: Steinfliegenlarven waren besonders hoch im Kurs, wenn wir sie denn fanden und in den Bestimmungsschlüssel eintragen konnten, denn sie stehen für sehr sauberes Wasser, ähnlich wie manche Larven der Eintagsfliegen; Gewässergüte 1, unbelastet bis sehr gering belastet, sagen die Fachleute auf einer Skala von 1 bis 4. Häufiger fanden wir im Seebach noch die Larven der Köcherfliegen mit ihren kreativ, aber sehr ordentlich gebauten Wohnröhren aus Pflanzenteilen, die bunt, eher braun, gelb sind oder auch ins Rote gehen können. Mit Spinnfäden klebt die Larve alles zusammen und tarnt sich so vor Fressfeinden wie der Bachforelle, der stillen Heldin dieses Buches. Ihre zweite Insektenleidenschaft ist der Bachflohkrebs, den ich mit meinen Kindern oft aus dem Kies der Modau siebe, auch mit der Hand, wenn die Strömung nicht so stark ist und der aufgewirbelte Grund nicht sofort forttreibt.
Irgendwann war das matschige Umweltgruppendasein vorbei. Mit 16 wurde ich politischer, wollte auch mal auf die Straße, etwas gegen Atomkraft rufen und als eine Art Dorf-Widerständler Dinge vor der Haustür verändern. Dafür gab es unverhofft Gleichgesinnte. Dass sie auch alle Tischtennis spielten, war wohl eher Zufall, auf jeden Fall schlug Tarek, ohne Rückhand, aber mit vielen Einfällen gesegnet, vor, dass wir doch junge Sozialisten werden könnten. Wir wurden dann Jusos. Worum es ging, war bald klar: ein Jugendbus für die Nacht, Fahrradwege entlang der Bundesstraße, Antiatomkraftdemos – und vor allem Solarenergie für die Kommune.
Wir recherchierten monatelang und verfassten einen Solarreader für die Kommune. Ich schrieb meine erste Pressemitteilung, die einen Schreiber anlockte, der über unseren Reader eine Meldung für sein Journalistenbüro daraus machte – die Profilwerkstatt, für die ich ein paar Monate später meine ersten Artikel schrieb, weil er mir die Telefonnummer gegeben hatte. Wir waren mächtig stolz auf unseren Solarreader. Und mächtig gespannt, denn zur großen Vorstellung des Werkes hatten wir rund 200 lokale »Genossen« aus unserem Dorf und den Nachbarsiedlungen angeschrieben. Es kamen – zwei, eine Riesenenttäuschung. Das war es dann erst mal für mich. Ich hatte keine Lust mehr auf irgendeine Art von Umweltengagement. Und es kamen andere Dinge – Abitur, Reisen, Journalistikstudium in Dortmund, Bielefeld, Tours und Brüssel, Europa-Master und Promotion in Aachen, was insgesamt eine angellose und wasserferne Zeit für mich war, fast 15 Jahre. Vielleicht muss ich wegen dieses Verlustes jetzt so tief eintauchen und hinterhergehen.
Schneckenzucht und Federsammlung. Jedenfalls bin ich 2013 Journalismusprofessor an der Hochschule Darmstadt am Campus der Kleinstadt Dieburg geworden – eine katholische Karnevalshochburg an der Deutschen Fachwerkstraße mit großen Waldflächen. Dort leite ich das Portal »Grüner Journalismus«. Ein Arbeitsschwerpunkt ist der Umweltjournalismus, da ich Naturredakteur bei der internationalen GEO-Ausgabe war und zu grünen Themen in der Online-Redaktion der Deutschen Welle gearbeitet habe. Nachhaltigkeit und Umwelt stehen bei mir journalistisch seit 2003 im Fokus, vor allem die Themenfelder Fischerei, Arten und Klimawandel.
Als 2002 die ersten großen Entlassungswellen kamen und jede Redaktion, bei der ich frei schrieb, geschlossen wurde von Verlegern, die Renditen unter 89 Prozent für unsittlich hielten, besann ich mich darauf, was ich ganz ursprünglich kannte, wovon ich etwas Ahnung auch ohne Studium hatte und was mich anzog – Landschaftsliebe, wenn ich es in ein Wort fassen soll. Und sie hat den Boden bereitet, nach der Rückkehr in die alten Gefilde auszuziehen und ganz neu in alte Bäche, Teiche, Seen und die Wälder zu blicken, die sie umranden.
Meine Jugend verlief oft draußen; mit Blick auf den friedlichen Lohwald auf der einen Seite des Elternhauses und die dunkle »Finstere Hölle«, die wir nur selten aufsuchten bei all den »Touren«. So nannten wir die langen biologischen und landschaftskundlichen Exkursionen, die zwischen 12 und 17 Jahren Alltag waren und heute wieder sind, auch rund um den heiligen Berg, die »Schmallert« mit dem Griesbach. Immer war Rouven, der Gefährte, mit dabei, ist es noch heute manchmal. Wir haben immer alle gefundenen Arten aufgeschrieben nach den drei, vier Stunden, die die Touren dauerten: »14 Rehe, ein Fuchs, drei Bussarde, zwei Fasane, drei Rebhühner, Krähen und Weinbergschnecken«, das waren immer die ersten Sätze, die wir den Eltern entgegenschleuderten, nass, verschlammt, mit Sonnenbrand, Kratzern und Schürfwunden. Wie es viele Kinder eben gemacht haben und es manche noch machen.
Wir haben es sehr ernst genommen. Selbst würde ich meinen Kindern heute vielleicht nicht erlauben, das Skelett eines alten Rehbocks ganz auszugraben, es zu wässern und zu putzen, weil es Grünspan in der alten Speißbütte angesetzt hatte, wo es wochenlang lagerte; es sollte in unserem Natur-Garagen-Museum ausgestellt werden, dessen Besucherzahl gering war. Eleganter war es, Schnecken zu züchten, bis zu 100 hatten wir manchmal. Am Wasserwerk fanden wir die meisten, die wir dann über Jahre züchteten, Baumschnecken und Schnirkelschnecken und Weinbergschnecken, die in großen Hasenkästen mit Maschendraht hausten und den Salat aßen, den wir ihnen gaben. Sie vermehrten sich wundersam. Waren keine mehr da, gingen wir zum Berg am Wasserwerk, damals noch voller Bäume und Hecken, genug, um eine kleine Verwunschenheit aufzubauen, in die Rouven seinen Schneckenzauber legen konnte.
Heute ist ein Zaun um das Wasserwerk, die Bäume sind weg, und es ist sauberer dort. Aber alles ist fort, von dem ich schreiben kann. Gearbeitet haben wir beim Bauern vor dem Dorf, im Hühnerstall; Eier sammeln, zwei Winter lang. Das erste Praktikum hatte ich bei dem Förster, der mir nun manchmal ein Reh schießt, 25 Jahre später, er hat mich noch erkannt. Und stolz bin ich immer noch auf die Federsammlung, die jetzt unsere drei Kinder verwalten. Manchmal kommt wieder etwas hinzu. Manche Orte sind bei alledem zu festen Wegmarken geworden: die Kühkopfaue, dazu eine kleine Angelwiese in Freudenberg am Main, der Campingplatz in Neckargerach, wo wir nach den gewässerbiologischen Ausflügen dann später im Sommer zum Angeln hinfuhren. Schön war auch das Schleienangeln im April, Teekräutersammeln im Mai oder die Parasolpilzsuche im September, die immer viel einbrachte. Das Gegenteil galt für meine ersten Survialtrainings in der Mühltaler Wildnis, die kläglich scheiterten.
In der Zeit bei GEO in Hamburg, wo wir fast fünf Jahre waren, habe ich dann mit meiner Frau eine Kräuterausbildung gemacht. Und wir beackerten zwei Jahre Gartenstücke vor der Stadt, danach auch in Darmstadt, am wunderbaren Biohofgut Oberfeld, bis wir nach Mühltal, in die alte Heimat, zogen. Die Kinder besuchen nun den Kindergarten, in dem ich auch war. Die Kräuter finde ich jetzt direkt vor der Haustür, hinter der der Wald beginnt – und aus dem die Wildschweine in den Garten spazieren, weshalb wir den Zaun ausgebessert haben. Im Wald bin ich immer öfter, mit und ohne Kinder, denn ich habe hier neue Orte gefunden, die ich mit dem Älterwerden brauche.
Versperrte Gewässer. Ich komme in Gesprächen immer wieder auf Gewässer, vor allem auf die, die verschwunden oder versperrt sind. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen im eigenen Umfeld sich an solche Verluste oder Sperren erinnern. Da ist die Freundin, die am Main aufgewachsen ist und von einem Baggersee aus ihrer Kindheit erzählt, der wegen einer Straße zugeschüttet wurde. Da ist der alte Freund, dessen Kinder jetzt zwar noch immer in dem trüben und tiefen alten Steinbruchsee schwimmen, der seiner Familie gehört. Doch früher sind hier alle im Dorf geschwommen, Dutzende Jahrgänge haben hier ihre ersten Schwimmzüge gemacht, weil es da noch keinen Zaun gab. Wenige Gewässer waren zusammengenommen kleiner, tiefer und trüber als dieser fast kreisrunde alte Steinbruchsee mit seinen riesigen algenbesetzten Karpfen und der über die Jahre immer mehr gegen Wind und Wetter kämpfenden Minigolfbahn, die ich als Kind noch selbst bespielt habe. Irgendwann floss zu viel Wasser die harten steilen Gabbro-Wände über der Bahn hinab, war es zu feucht dort oben im Eck, wo in der Nähe eine der besonderen Quellen entspringt, zu der inzwischen am Wochenende Menschen aller möglichen Nationalitäten von weit her kommen, um in großen Plastikkanistern das Wasser fortzutragen.
Im selben Dorf, meinem Waschenbach, das nach seinem Bach benannt ist, war früher auch der neuere Steinbruch zugänglich, der vor der Siedlung liegt, vielleicht zwei Kilometer entfernt vom alten und hoch oben auf dem Berg. Dort sind wir weniger geschwommen, haben aber mit meinem Großvater, einem vereinsaktiven Vogelschützer und pragmatischen Alltagsnaturalisten, nach Molchen Ausschau gehalten. Heute ist der kleine blaue Teich, den wir ansteuerten, von mehreren Zäunen und Sperren eingefasst und zudem in der Tiefe des Steinbruchs versunken, der noch in Betrieb ist und sich immer tiefer in den vorderen Odenwald fräst. Wieder ein Gewässer, das versperrt ist.
Weggesperrt von einem besonders schönen und verwunschenen See, dem einzigen weit und breit, der tiefer als 35 Meter ist und daher auch für amtliche Tauchscheine geeignet war, wurden ebendiese, die Taucher, dazu Angler, die aus diesem Steinbruchsee große wunderschöne Forellen gezogen hatten. Denn die Hartsteinindustrie hat hier ebenfalls einen Zaun um das Gelände herumgezogen und lässt niemanden herein. Den Uhu, der dort in den steilen Schluchten danach seinen Horst bezog und damit den Nieder-Ramstädter Steinbruch zu einem europäischen Naturschutzgebiet machte, würde gelegentlicher Betrieb nicht stören, da er keineswegs so lärmempfindlich ist wie bisweilen behauptet; inzwischen ist er ohnehin in den Waschenbächer Steinbruch mit all seinem Betriebslärm gezogen.
Dieses ökologische Kleinod bleibt jedenfalls in privater Hand und damit den Menschen des Ortes verschlossen; es ist eine Geschichte des Verlustes, die kaum jemand wahrnimmt oder kennt.
Ähnlich unbekannt ist, auf ganz Deutschland bezogen, das Gegenteil: Dem Verlust von zugänglichen Gewässern steht ein Anwachsen der Wasserflächen insgesamt gegenüber. Deutschland wird schrittweise zum Wasserland, mit jedem Braunkohletagebau mehr, der am Ende ist und geflutet wird. Denn vor allem diese neuen Seen im Osten treiben die Statistik nach oben; in Sachsen sind so ganz neue große und tiefe Seen entstanden, die meist öffentliche Güter sind und von vielen genutzt werden – ein Beispiel, das Schule machen könnten. Unklar ist, ob es so auch in einigen Jahrzehnten im Rheinland kommt, wo nach dem Braunkohletagebau noch tiefere Seen entstehen werden, die Nordrhein-Westfalen eine neue Gestalt als Wasserland geben könnte. Die größten dieser neuen Seen werden ähnlich viel Wasser in sich tragen wie etwa der Chiemsee, dort könnten neue Aquakulturen, Badeanstalten, Häfen, Tauchakademien, Umweltschulen am Wasser und an Stränden wachsen und blühen. Vielleicht sogar Schutzgebiete, sobald sich Leben hier eingestellt hat.
2
Waldbrunnenland
Zeugenbaum. Scharbockskraut breitet sich um ihn aus, ein labendes Mattgrün, das das Braun der Herbstblätter längst übermannt hat. Krautteppiche umhüllen einen kurvigen Ast, auf dem Käfer Loopings laufen könnten. Er steht dazwischen. Die Sonne hängt in feinem Orange in den Baumkronen über der Straße. Dazwischen die hellgrünen und weißen Punkte der sprießenden Buchenblätter, die das Gleißen des Morgens mir aus der Tiefe des Waldes entgegenschickt. Autos ziehen vorbei, andere Buchen stehen davor.
Er, mein Zeuge, steht in der Mitte von allem, direkt vor mir, wo ich geparkt habe, um ihn zu besuchen. Es ist eine dunkle alte Buche, vielleicht 150 Jahre alt, die an einem Waldparkplatz nahe der Bundesstraße steht. Ich habe bei ihr gehalten, um das Ritual zu vollziehen, das sich vor vier Jahren eingestellt hat; als ich nach 15 Jahren Abwesenheit in meine Heimatgemeinde zurückkehrte – und damit auch in die Wälder hier. Ich hatte einen großen Mietwagen voller Zeug, kam von Hamburg und wollte eigentlich nur noch an den gedeckten Tisch der kleinen Willkommensfeier, die arrangiert war. Endlich zu Hause, der Satz begleitete mich die ganze Fahrt über, sechs Stunden lang.
Und dann bog ich doch noch im letzten Moment ein und suchte nach einem Zeugen, der dabei sein würde, bevor ich die Tür in eine neue Phase öffnen würde. Der Zeuge sollte ein Baum sein. Ich stieg aus und sah die Buche, mit ihren senkrechten langen Wachstumsnarben, den faltigen Inseln, kleinen Löchern, den Pocken und Canyons, ihrer ganzen Rindenlandschaft, auf der selbst ein Wald wächst: ein dichter Teppich aus dunkelgrünem Moos, der sich über drei Meter den Stamm entlangzieht und nur selten das gräuliche Grün der Rinde freigibt. Ein Wald auf dem Baum, eine Decke, die ihn schützt, ein Teppich, auf den ich jetzt meine Hand legte und mir dabei vornahm, manches besser zu machen als früher.
Dann nahm ich meine Hand vom Stamm und ging wieder durch die Zeitpforte, deren Pfeiler mein Zeugenbaum war. Seitdem halte ich hier immer wieder kurz an, sammle mich und lege meine Hand auf das Moos an seinem Stamm.
Am Oberwaldhaus. Es ist der Wald hier gleich an der Straße, wenige Schritte von uns, nur nicht am großen Weg, sondern entlang eines versteckten Pfads, seine Ränder sind durchwühlt von Wildschweinen. Kaum eine Stelle ist unberührt. Daneben fast lückenlose Bodenteppiche von Scharbockskraut, das einst gegen Skorbut half seines Vitamingehalts wegen. Der Förster hat beschlossen, den Wald hier am Rande der Straße nach Dieburg sich selbst zu überlassen. Deshalb gleiten wir mit jedem Schritt weiter hinein in eine andere Sphäre. Hier ist kein aufgeräumter Forst oder schöner Mischwald. Hier ist Wildnis. Alte Stämme liegen tot in den Scharbockskrautteppichen, willkürlich verteilt und so in guter Ordnung. Sie leben, sind voller Moose, schimmern in Hellgrün und dunkleren Tönen durch den feuchten Wald. Dann das Fastsmaragd der jungen Buchen, die Farbe, die sie nur jetzt haben bis in den Mai hinein. Und die Stille. Der Wald dampft leicht, der Morgen ist fast vorbei, er ist ein lichternes Dunkel, ein Grünbad, das hinten als zarte Wand endet. Wir stehen und schauen.
Coaching-Lektion. Ich bin mit einem Naturcoach bei uns im Wald unterwegs, wir gehen barfuß, lange auch mit geschlossenen Augen, schweigen, er redet ein wenig, ich höre zu, spüre. Es geht um Beruf, die Rollen, die man hat, Zeiteinteilung, Prioritäten, meine ewigen Baustellen, die ich einmal angehen wollte, wo mir alles vertraut ist, im Wald.
Dann ist mehr daraus geworden, weil es nun um Wasser geht, denn er führt mich an eine Quelle, ganz in der Nähe, die ich bei meinen Quellgängen immer links liegen gelassen habe. Dabei ist der Eleonoren-Brunnen, benannt nach der 1937 verstorbenen Großherzogin »von Hessen und bei Rhein«, mit der nahen, dicht bewachsenen Brunnenfassung schön, wenn auch das Wasser besonders fade schmeckt. Meine Klage über den Fluss, der Darmstadt wie auch anderen Städten fehle, kontert der zugezogene Coach mit dem Hinweis, dass es hier so viele Quellen und Brunnen wie kaum anderswo gebe. Daher seien wir hier durchaus in einer Wassergegend, einer besonderen noch dazu.
Das war eine echte Lektion, eine neue Sichtweise. Zwar würde ich weiterhin gerne, wie einst in Tours an der Loire am wilden Ufer eines großen Stromes, meinen Gedanken nachhängen können. Aber ich bin jetzt all denen noch einmal dankbarer, die die unzähligen Quellen und Brunnen hier bauen ließen und so das Wasser des Waldes einfach nach oben holten im sicheren Vertrauen darauf, dass der Mensch Romantik braucht und starke Orte für Rückzug und Besinnung. Genau dafür sind diese zauberhaften Wasserstellen da; mehr sollte es von ihnen geben oder die vorhandenen besser erhalten sein. Immerhin gibt es eine kleine Gruppe, die genau dafür sorgt, die Brunnenschützer.
Brunnenputzer. Ich lese mich nach der Quellenlektion durch den Coach in die Geschichten der Quellen und Brunnen ein. Plane Wanderungen entlang einiger Waldbrunnen und suche nach Menschen, die explizite Brunnen- und Quellenfreunde sind. Fündig werde ich im benachbarten Eberstadt, zwar Stadtteil von Darmstadt, aber ein eigenständiges Dorf von jeher, wohlhabend, stolz, voller Tradition. Goethe begann hier seine Italienische Reise, und so wurde Eberstadt in der ersten Bergstraßenromantik im 19. Jahrhundert als »Tor zum Süden« gefeiert. Hier fiel 1997 zwei Eberstädtern auf, dass viele der zahlreichen Brunnen und Brunnentöpfe im Wald versiegt waren. Sie fanden Gleichgesinnte, gingen von Brunnen zu Brunnen »und merkten, dass man mit geringem Aufwand die meisten Brunnen wieder in Gang bringen kann«, wie mir Jürgen Breuler, ein früherer Zahnarzt und nun Vorsitzender der Arbeitsgruppe »Brunnen und Quellen«, erklärt.
Wir sitzen auf einer Bank vor dem Eberstädter Friedhof. Ein paar Meter weiter steht der neue Ilse-Fiedler-Gedächtnisbrunnen, den die Brunnenschützer zu Ehren einer Bürgerin, die ihnen einen großen Teil ihres Vermögens über eine Stiftung hinterlassen hat, selbst entworfen haben. So ist der Brunnenschutz gesichert, denn das Dutzend älterer Herren, die meisten Rentner, kümmert sich ehrenamtlich um 25 Brunnen in und um Eberstadt. »Wir kommen aber auch woanders hin, wenn wir gerufen werden«, sagt Breuler, der sich mit den anderen der »wohl einzigartigen Gruppe, wir kennen keine anderen«, jeden Monat zum Brunnenstammtisch trifft, in der historischen »Geibelschen Schmiede«, die der Bürgerverein auch als Heimatmuseum nutzt.
Es ist mühsame Arbeit, oft im Wald, manchmal im Dorf, die die alten »Brunnenputzer«, so ihr T-Shirt für öffentliche Aufritte, verrichten. Sie fischen Laub aus den Brunnentöpfen, jagen Wasser mit dem Kompressor durch verstopfte Röhren und klettern die Brunnenschächte hinab, um Schmodder herauszufischen und den Ablauf zu öffnen – gerade das Klettern fällt den älteren Herren immer schwerer, weshalb sie keine Möglichkeit auslassen, auf ihrer Website und in Zeitungsartikeln für Nachwuchs zu werben. Die Experten müssen oft mehrmals einen verstopften Brunnen »durchpusten«, weil oft nicht ganz klar wird, wo die Verstopfung sitzt und ob nun das Wasser wieder ganz läuft. Manche versanden, manche bekommen Algen, manche brauchen einen Brunnentopf, damit sie funktionieren – im einfachen Fall einen Eimer samt Schlauch, den die Brunnenschützer im Waldboden eingraben und der das langsam aus dem Boden sickernde Wasser einer »Sickerquelle« sammelt, von wo es in den eigentlichen Brunnen, oft in einer Mauer eingefasst, abfließt und diesen zum Sprudeln bringt. Andernfalls würde das Wasser der Quelle im Waldboden förmlich zerlaufen.