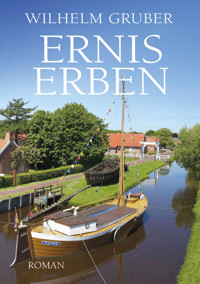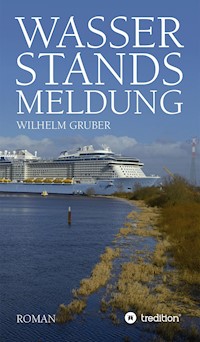
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ernst Patolak ist nach der Gesellenprüfung einer alten Tradition gefolgt und als Zimmermann mit Stenz und Bündel auf die Walz gegangen, Linda als Studentin der Tiermedizin auf die Barrikaden der achtundsechziger Zeit. Über fünfzig Jahre haben sie nichts voneinander gehört oder gesehen. Plötzlich steht er vor ihr, ein unverhofftes Wiedersehen. Wobei, eigentlich müsste auch Ernst ein bisschen älter geworden sein. 'Wasserstandsmeldung' erzählt von zwei ungleichen Lebenswegen, die im Alter wieder zueinander führen. Auch eine Geschichte vom verlorenen Sohn, aber mehr noch von verlorenen Vätern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Wasserstandsmeldung
Wilhelm Gruber
Verlag & Druck: tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck
Coesfeld
Titelfoto © Joachim Affeldt
Abbildung S. 223 basiert auf fox-37416.svg von Clker-Free-Vector-Images, via pixabay.com
Satz: Ansgar Gruber
© 2020 Wilhelm Gruber
ISBN Paperback: 978-3-347-06362-4
Hardcover: 978-3-347-06363-1
e-Book: 978-3-347-06364-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Gras wächst von alleine
durch Fugen und über Steine
Inhalt
… glaub’ ich jedenfalls …
… catfish blues …
… jury imaginaire …
… furzen, wenn’s donnert …
… Sekte auf Seelenpirsch …
… nichts Menschliches fremd …
… kalbender Eisberg …
… wer weiß, wofür das gut ist …
… a part of me still …
… mit Pfannkuchen zugenagelt …
… morgen ist heute schon gestern …
… O wie Opfer …
Sei doch schlau, Fuchs!
Der Spaten an der Wand
Der alte Schaluff
Die Igelfelle
Lindas Lächeln
Die Krähen
Die Wildschweine
Der Volltreffer
Der Fuchs und sein Jäger
Die rechte Zeit am rechten Platz . .
… einer inneren Pflicht folgend …
… bonjour, Pépé Pato …
Mensch, Fisch, versteh doch!
… yes, we are sisters …
… als wäre nichts gewesen …
… vorglühen …
Komm lieber Berg, wir tauschen!
… erklär das dem Herzen …
… nicht den langen Umweg …
… kombiniere …
… weißer Bruder …
… ohne Kappe kein Tom …
… no moss …
… der Senfglassammler …
… Pastorentöchter …
… singen nach Farben …
… vaterlose Gesellen …
… tut und macht …
Ende der Visite, die weiße Karawane löst sich auf. Schwester Gerda, die Letzte in der Reihe, nimmt Dr. Patolak, den Vorletzten, zur Seite:
„Auf Zimmer 14 möchte Frau Dr. Buchholz noch mit Ihnen sprechen.“
„Mit mir? Nicht mit der Oberärztin oder dem Chefarzt? Es waren doch beide da.“
„Nein, mit Ihnen. Als ich die Tür zumachte, hat sie gefragt, ob sie Ihren Namen richtig verstanden hat. Ich habe ihn wiederholt: Dr. David Patolak und dazu gesagt, dass Sie der Stationsarzt sind. Die alte Dame hat Sie während der ganzen Visite nicht aus den Augen gelassen.“
David Patolak blickt auf den Bettenplan. „Dr. Gerlind Buchholz?“ Er zuckt mit den Schultern. „Was kann ich ihr schon sagen? Seh’ sie heute zum ersten Mal, ich kenn’ die Akte nicht; bin gerade aus dem Urlaub zurück.“
„Frau Buchholz ist ’ne ganz Patente, es geht nicht um ihre Krankheit, glaube ich. Vielleicht stellen Sie sich mal eben als Stationsarzt vor. Zimmer 14!“
„Mach ich, am besten sofort.“
‚Nicht um ihre Krankheit?‘, denkt er. ‚Um was denn sonst? Hier muss man sich so viele Lebensgeschichten anhören, hoffentlich nicht schon wieder; das ist nichts für mich.‘ Er klopft an die Tür.
„Frau Dr. Buchholz, Sie hatten nach mir gefragt?“
„Freut mich, dass Sie sich noch eben Zeit für mich nehmen. Lassen Sie den Doktor gern weg. Ich sag’ dann auch gleich ‚Herr Patolak’ zu Ihnen.“
„Was für einen Doktor haben Sie, Frau Buchholz?“
„Dr. med. vet.“
„Ah, Tierärztin. Ich bin zum Glück noch nicht auf den Hund gekommen, sonst könnte ich Sie konsultieren. Um was geht es, Frau Buchholz?“
„Nichts Medizinisches. Ich falle einfach mit der Tür ins Haus: Kennen Sie einen Ernst Patolak?“
„Ernst Patolak? So heißt mein Großvater.“
„Beinahe hätte ich es raten können, Sie sind ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.“
„Da muss was dran sein. Hab’ ich schon mal gehört. Woher kennen Sie ihn?“
„Wir sind ein Jahrgang, zusammen zur Schule gegangen.“
„Und? Haben Sie ihn in guter Erinnerung?“
Frau Buchholz fährt das Kopfende des Bettes hoch. Über ihr Gesicht geht ein Lächeln. „Ernst und ich haben gemeinsam einen verletzten Fuchs gesundgepflegt. Niemand durfte es wissen. Das war vielleicht der Grund, warum ich Tierärztin werden wollte.“
Dr. Patolak bemüht sich, seine Überraschung zu verbergen. „Sie sind Linda?“, fragt er.
„Ja, Linda!“ Frau Buchholz jubiliert, als wolle sie aus dem Bett springen. „Linda, so hat man mich in der Schule genannt, weil es noch eine Gerlind in der Klasse gab. Woher wissen Sie das?“
„Man pflegt doch keinen Fuchs gesund und dazu heimlich, ohne seinem Enkel davon zu erzählen. Die Geschichte habe ich als Kind so geliebt, dass ich sie immer wieder hören wollte.“
„Lebt Ernst noch?“
Dr. Patolak nickt. „Soll ich ihm Grüße bestellen?“
Sie zögert. „Ich weiß nicht. Wir sind damals weggezogen. Ich war gern in Papenburg, fühlte mich wohl dort, ein schmerzlicher Abschied. Wir haben uns nie wiedergesehen und nichts mehr voneinander gehört. Eigentlich hatte er versprochen, mir zu schreiben.“
„Nachtragend, Frau Buchholz? Nach so langer Zeit? Einem Kerl wie Ernst kann man doch nicht böse sein.“ Dr. Patolak sieht auf die Uhr. „Ich hab’ im Moment viel zu tun, Sie verstehen? Bin gerade erst aus dem Urlaub zurück, da ist einiges liegengeblieben, aber ich komm’ wieder“, verspricht er, schon mit der Türklinke in der Hand.
‚Linda‘, denkt er auf dem Flur, ‚dass ich die hier kennenlerne. Naja, vielleicht wird sie ja bald entlassen.‘
Schwester Gerda kommt ihm entgegen. Sie würde gern wissen, was Frau Buchholz auf dem Herzen hatte, er sieht es ihr an, aber er zieht schnell sein Handy aus der Kitteltasche.
„Ja, ich komme!“ Er legt einen Schritt zu und drückt den Knopf zum Aufzug.
… glaub’ ich jedenfalls …
Erst am späten Nachmittag ist Dr. Patolak zurück auf der Station. Schwester Gerda hat alles im Blick. „Sie vergessen es nicht: Zimmer 14? Frau Buchholz wartet sehnsüchtig auf Sie. Ich weiß schon: die Jugendliebe Ihres Großvaters. Sie ist ganz aus dem Häuschen. Das bringt sie auf andere Gedanken.“
„Hab’ ich auf dem Schirm, aber heute?“ Er schüttelt den Kopf. „Das wird nichts mehr. Morgen ist auch noch ein Tag.“
„Frau Buchholz wartet schon. Nur kurz. Es muss ja nicht lange sein.“
Dr. Patolak sieht ihren bittenden Blick.
„Frau Buchholz ist neugierig. Kurz, das wird bei ihr nicht gehen.“
„Neugierde ist eine Form von Interesse. Was soll daran schlimm sein? Frau Dr. Buchholz hat Ihnen bestimmt einiges zu erzählen. Wenn jemand nach Ihnen fragt, dann weiß ich, wo Sie sind.“
„Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, ich tu ja immer was Sie sagen, Schwester Gerda.“
„So, Frau Buchholz, Puls und Blutdruck in Ordnung. Kommen wir zum Eigentlichen: Papenburg.“
Frau Buchholz strahlt. „Fahren Sie ab und zu noch mal hin?“
„Ja schon, im Moment sogar öfter; so weit ist es ja nicht. Ernst ist nicht da und der Nachbar auch nicht. Von Zeit zu Zeit mal nach dem Rechten sehen, Rasen mähen und seinen prächtigen Rhododendron gießen. Es hat ja so lange nicht geregnet.“
„Ist es noch dasselbe Haus?“
„Dasselbe kleine Haus am Ende der Vosswiek mit dem Moor dahinter, ein Kleinod im wahrsten Sinne des Wortes.“
„Und wo ist Ernst?“
„Ernst? Ernst, der ist gerade in Spanien.“
„Jetzt, im Sommer? Alle Rentner fliegen doch in der kalten Jahreszeit nach Spanien.“
„Ernst ist ja nicht zum Spaß da. Er bildet Jugendliche aus, ehrenamtlich in einem Camp der Senior Experten oder so.“
Frau Buchholz nickt anerkennend.
„Wie lange haben Sie in Papenburg gewohnt?“, fragt er.
„Genau weiß ich es nicht mehr. Bis zu dem Alter, in dem Mädchen anfangen, sich für Jungen zu interessieren, und sich gerne mal unsterblich verlieben. Wir waren mit der Volksschule fertig, das war damals nach der achten Klasse. Er fand eine Lehrstelle in der Zimmerei; ich bestand die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium, seinerzeit Aufbauschule, und drückte weiter die Schulbank. Dann irgendwann zogen wir um.“
„Hierher?“
„Ja, nach Oldenburg“, bestätigt sie. „Für meinen Vater gab es als Notar in einer größeren Stadt mehr zu verdienen; die Landvergabe an die vertriebenen Bauern aus dem Osten war abgeschlossen, seit Jahren. Und meine Mutter war für diese Gegend nicht geschaffen, das behauptete sie. Sie hat sich immer nur abfällig geäußert. Für das Ende der Welt fand sie sich zu schön. ‚Im Moor versauern‘, so drückte sie sich aus. Das wollte sie nicht.“
„Klingt nicht sehr respektvoll. Keine lobenden Worte für Papenburg? Papenburg muss man doch lieben!“
Frau Buchholz beugt sich vor und schüttelt den Kopf. „Sie haben meine Mutter nicht gekannt; eine Frisur wie Marilyn Monroe, Pelzmantel, eine Art Diva, die ihr Rampenlicht nicht fand, zumindest nicht in Papenburg. Sie konnte meckern wie eine Himmelsziege und schöntun wie ein Hofschranz. Wenn jemand sagt, sie hätte so ihre Allüren gehabt, würde ich nicht widersprechen. Aber eigentlich wollte ich lieber etwas über Ernst hören, natürlich nur, wenn es Ihre Zeit erlaubt.“
„Schwester Gerda weiß, wo ich bin. Sie wird mich bei Bedarf abkommandieren. Einen Feldwebel muss es ja auf jeder Station geben. Also: Erni ist ein feiner Kerl, immer gewesen; glaub’ ich jedenfalls. Übrigens Erni darf nur ich zu ihm sagen, für alle anderen besteht er auf Ernst.“
„Ich durfte auch Erni zu ihm sagen“, unterbricht Frau Buchholz und scheint sich darüber zu freuen. „Ich erinnere mich aber, dass er schon damals mit dieser Lizenzvergabe sehr sparsam umging.“
David Patolak bleibt beim Thema: „Eigentlich bin ich bei Ernst groß geworden. Ich war ein Partykind. Meine Eltern gingen auseinander noch bevor ich zur Schule kam, natürlich in Freundschaft, wie sie mir versicherten. Das Sorgerecht wollten sie sich teilen. Formal stimmte das auch, aber in der Praxis wurde daraus nichts. Immer, wenn ich zu meinem Vater sollte, wurde ich zum Großvater gebracht. Darüber beklage ich mich aber nicht. Ernst hat sich rührend gekümmert. Er war mein Ankerpunkt und er ist es lange geblieben. Als meine Mutter einen neuen Partner fand, der mit mir nichts anfangen konnte, wurde Ernst sogar zur einzigen Anlaufstelle für mich. Auf ihn war immer Verlass.“
Dr. Patolak hält kurz inne. ‚Wer erzählt denn jetzt seine Lebensgeschichte, dazu noch einer wildfremden Frau?‘, denkt er. ‚Obwohl, Linda Buchholz? Nein Linda ist nicht fremd‘, entscheidet er kurzerhand, bevor sie sich mit der nächsten Frage weiter vortastet.
„Und Ihre Großmutter? Lebt sie auch noch?“
„Leider nicht. Sie ist gestorben, als ich ins dritte Schuljahr kam. Das war erschütternd für uns, für mich, für meinen Vater und am schlimmsten für Ernst. Ich sehe noch die vielen Leute, wie sie mir nach der Beerdigung über den Kopf streichen wollten. Ich rannte von der Kaffeetafel weg.
Mein Vater fand mich draußen und setzte sich zu mir auf die Bordsteinkante. Er hatte einen Teller Bienenstich dabei. Auf die Kuchengabel gesteckt, hielt er mir ein Stück hin. Ich mochte nicht, aber er sagte: ‚Oma Mia freut sich, wenn es dir schmeckt.‘ Ich sah die Mandelkruste und konnte nicht widerstehen. Wir aßen abwechselnd Stück für Stück, eins für mich, eins für ihn. Dabei merkte ich, dass auch er weinte.
Sie ist mir unvergesslich geblieben, meine Oma Mia. Wenn sie mir für das Abendbrot Pfannkuchen versprach, machte ich alles für sie, sogar die Schularbeiten. Die frühesten Erinnerungen habe ich an das Hühnerfüttern mit ihr. Wenn mein Vater mal wieder auf sich warten ließ, mich viel später abholte als vereinbart oder gar nicht kam, gingen wir nach draußen. Ich half ihr und streute Körnerfutter aus. Die Hühner kamen schon fast angeflogen, wenn sie mich nur sahen.“
‚Vielleicht erzähle ich ihr zu viel’, überlegt er. ‚Ob sie das alles hören will?‘ Aber Frau Buchholz hat schon die nächste Frage auf den Lippen. ‚Kurzfassen!‘, nimmt er sich vor.
„An was ist denn Ihre Großmutter gestorben?“
„Krebs!“, antwortet er und würde dieses grausam klingende Wort am liebsten zurückrufen. „Aber machen Sie sich keine Sorgen, daran muss man heute nicht mehr sterben“, fügt er schnell hinzu. „Die Medizin war damals nicht so weit.“
Einen Moment lang redet niemand.
„Und Sie? Haben Sie Familie?“, nutzt er die Lücke. Sie schüttelt den Kopf. „Ich bin allein geblieben, Single sagt man heute. Zu wählerisch“, sie lacht. „Ich war nicht adrett genug, wie meine Mutter es mir vorhielt. Mit Gummistiefeln im Kuhstall; das hatte so gar nichts von einer Dame, zu der Männer sich vielleicht eher hingezogen fühlten. Aber so war’s. Ich hatte mir einen Männerberuf ausgesucht, der fast ausschließlich an die Landwirtschaft gekoppelt war, an Schweinemast, an Rinder- und Pferdehaltung. Kleintiere spielten noch keine große Rolle, es gab nur wenige Praxen; kaum jemand ging mit einer Katze, einem Hund oder gar Meerschweinchen in eine Veterinärpraxis. Heute hat sich das Bild gewandelt. Die Behandlung von Kleintieren ist eine wichtige Einnahmequelle geworden und, was ich niemals erwartet hätte: Wir Frauen haben in der Veterinärmedizin die absolute Mehrheit erobert. Es arbeiten nur noch wenige Männer in diesem Beruf. Das war für mich so unvorstellbar wie Frauenfußball. Auch daran habe ich nicht geglaubt, so gern ich gegen jeden Ball trat.“
Schwester Gerda klopft. Sie öffnet die Tür nur einen Spalt. „Die Oberärztin ist da.“
Dr. Patolak steht auf. „Ich komm’ morgen wieder, Frau Buchholz, aber dann reden wir nur über Blutdruck, Puls und Co. Für alles andere habe ich keine Zulassung.“
Als David Patolak später nach Hause fährt, sind seine Gedanken sofort wieder bei Frau Buchholz. Er stellt sich Linda als junges Mädchen vor, in das Ernst sich verliebte oder sie sich in ihn.
‚Ihr Lächeln hat was. Immer noch‘, denkt er, ‚dazu die strahlenden Augen.‘
… catfish blues …
Am nächsten Vormittag hat Dr. Patolak nur auf der Station zu tun, nicht im OP. Er muss auch nicht an einer der vielen Besprechungen teilnehmen. Für Zimmer vierzehn will er sich Zeit nehmen. Alle anstehenden Routinearbeiten sind erledigt, ehe er kurz vor seiner Mittagspause bei ihr anklopft. Er öffnet die Zimmertür. Frau Buchholz sitzt aufrecht im Bett.
„Puls und Blutdruck in Ordnung“, sagt sie, „die Stationsschwester war hier und hat alles gemessen. Sie heißt auch Gerlind, aber sie hat daraus Gerda gemacht. Namen kann man sich nicht aussuchen, höchstens etwas daran drehen. Wenn Sie nicht diesen ungewöhnlichen Namen hätten, hätte ich mich bei Ihnen nie nach Ernst erkundigt. Wissen Sie eigentlich, was Patolak bedeutet?“
David grinst. „Es gibt keine Frage, die ich öfter beantworte. Ein garantiertes Alleinstellungsmerkmal. Lange Zeit hab’ ich es trotzig abgelehnt, nach der Bedeutung meines Namens zu forschen, habe falsche Schreibweisen, Verdrehungen und Ärgereien mit Großmut ertragen. Von ‚Pattjack’ über ‚Pastinak’ bis ‚Pottlecker’, immer kam etwas Neues, über das man lachte. Mitlachen war am besten.
Aber dann kam Zlatko, ein Schulfreund aus dem ehemaligen Jugoslawien, er nannte mich immer ‚Zwerg’. Erst dachte ich, er fände das bei meiner Körpergröße nur lustig, bis er mir irgendwann beiläufig verriet, dass in seiner Sprache ‚Patolako’ soviel wie Zwerg heißt. ‚Keine Patoleika?‘, fragte er mich eines Tages, als bei einer Party alle in Begleitung einer Freundin erschienen, nur ich nicht.
‚Keine Patoleika’, antwortete ich.“
Frau Buchholz will mehr wissen. Dr. Patolak sieht es ihr an. „Seinen Namen sucht sich niemand selbst aus, da haben Sie recht“, sagt er, „ich heiße Ronald David. Hier in der Klinik bin ich Dr. David Patolak, aber als Kind war ich nur Ronni. Der Wechsel beim Vornamen war leicht. Ich musste, als ich hier anfing, nur einmal sagen, wie ich es auf den Namensschildern haben wollte. Aber am Familiennamen ist nicht so einfach etwas zu drehen, Pech gehabt. Ernis Vater brachte den Namen mit. ‚Wer Kurt Patolak heißt, braucht keinen Spitznamen.‘, soll er gesagt haben. Kurt fand sein Glück bei Elfriede. Sie wohnte mit ihrer Tochter in dem kleinen Haus an der Vosswiek. Ihr erster Mann war im Krieg gefallen.“
„Elfriede!“, fällt es Linda wieder ein. „Für meine Mutter hieß sie ‚Frau Patolak‘. Ich durfte sie beim Vornamen nennen. Sie hat bei uns den Haushalt gemacht. Wann immer sie gebraucht wurde, kam sie und blieb, bis sich kein Staubkörnchen mehr regte. Wenn mir der Geruch von grüner Seife in die Nase kommt, sehe ich sie noch heute vor mir, wie sie sich die Hände an der Kittelschürze abwischt. Ich hab’ sie gemocht. Sie hatte etwas Warmherziges, brachte Blumen aus ihrem Garten mit und stellte sie bei uns auf den Tisch. Ein paar Brocken Plattdeutsch habe ich von ihr gelernt. Wenn ich sie aber später bei der Arbeit im Stall zum Besten gab, erntete ich nur abfällige Blicke, als wollte man sagen: ‚Die denkt wohl, wir können kein Hochdeutsch.“
„Schade, dass ich sie nicht mehr kennengelernt habe, meine Urgroßmutter Elfriede“, bedauert David Patolak. „Sie ist alt geworden, nur wenige Jahre vor Oma Mia gestorben. Aber ich habe keine Erinnerungen mehr an sie.“
Frau Buchholz fragt weiter: „Darf ich mich denn auch nach Ihrem Vater erkundigen? Sie haben ihn ja schon erwähnt.“
David zögert.
„Entschuldigen Sie bitte, Herr Patolak, wenn ich mit meiner Neugierde zu weit gehe.“
„Kein Problem, Frau Buchholz. Ich erzähle Ihnen alles. Mein Vater spielte in einer Band. Benannt hat er mich übrigens nach Ron Wood, einem Gitarristen von den Rolling Stones. Denen eiferte er nach. Am liebsten stand er groß auf der Bühne als Sänger und Frontmann. Die Fans jubelten, kreischten und stampften, sie liebten ihn und er liebte sie. Leider blieb dabei für mich und für meine Mutter nicht viel übrig.“
„Wie heißt denn die Band? Muss man die kennen?“, fragt Frau Buchholz.
Davids Handy klingelt. Schon beim ersten Signal greift er danach, nimmt das Gespräch an, dreht Linda den Rücken zu und ist eine Weile beschäftigt.
„Wenigstens hat mein Vater die Leidenschaft für Musik in mir geweckt“, führt David das Gespräch mit Frau Buchholz fort. „Mit dem Catfish Blues von Muddy Waters brachte er mir die ersten Riffs auf der Gitarre bei.
“Well, my mother told my father
Just before hmm, I was born
I got a boy child’s coming
Gonna be, he’s gonna be a Rolling Stone”
Ich übte mit Feuereifer, rauf und runter. Ernst gefiel das. Es war nicht seine Art von Musik, aber das war für ihn nicht entscheidend; er sah meine Begeisterung und lobte die Fortschritte; denn mit Ausdauer und Konzentration hatte ich bis dahin eher weniger geglänzt. Oma Mias Gesicht dagegen verriet unverhohlen, dass sie unter Musik etwas anderes verstand. Sie hätte die alte Gitarre, die mein Vater mir überlassen hatte, am liebsten im Kanal versenkt.“
„Und das konnten Sie als Kind schon so auf Englisch singen?“
„Nein, Englisch habe ich erst in der Schule gelernt. Aber den Blues, den hatte ich als Kind schon. Und es war mir damals schon klar, dass es eine ganz besondere Musik ist. Oma Mia sagte immer: ‚Spiel doch lieber schöne Lieder.‘ Sie wollte so gern das Lied vom Mond und dem lieben Nachbarn hören.“
„Sie meinen vom kranken Nachbarn.“
„Stimmt, aber meine Oma Mia sang immer vom ‚lieben Nachbarn‘.“
„Zurück zu Ihrem Vater“, sagt Frau Buchholz, „was macht er denn jetzt?“
„Musik. Einmal Rockstar, immer Rockstar. Er lebt für die Musik und von der Musik, wahrscheinlich gar nicht mal so übel. Sie wollen mit ihrer Band bis in alle Ewigkeit spielen, vor ihren alten und jungen Fans aus mehreren Generationen. Mein Kontakt zu ihm war nie eng. Ich habe seine Handynummer, er meine. Das muss genügen. Von den Auftritten schickt er mir gelegentlich ein paar Selfies.“
Dr. Patolak fasst sich an die Tasche, holt das Handy hervor, liest eine Nachricht, tippt die Antwort hinein und behält es in der Hand.
„Das war er nicht. Die andere Station. Ich muss gleich nach der Pause dorthin“, sagt er und wendet sich wieder Frau Buchholz zu.
„Es bliebe meine Mutter. Das schaffen wir noch und dann sind wir durch, vorerst. Ich fasse mich kurz, aber von ihr erzähle ich Ihnen gern, ohne dass Sie ausdrücklich fragen: Meine Mutter steht für die bürgerliche Seite der Familie und arbeitet als Lehrerin an einer Grundschule. Sie hat eine Tochter, meine Halbschwester Birgit, die tut es ihr gleich, das heißt, sie steckt in der zweiten Phase der Lehrerausbildung. Sicher lädt sie bald zu ihrer Examensfête ein.
Im letzten Jahr habe ich meine Mutter auf ihrer Klassenfahrt hier in der Jugendherberge besucht. Ein unvergessliches Erlebnis: die vereinten Nationen in einer Klasse und mitten im Gewusel der lebhaften Kinder, souverän: meine Mutter. Ich war stolz auf sie. Sie machte mich mit ihren reizenden Eleven bekannt und schon stürzten sie sich förmlich auf mich. Ein kleiner Bulgare stellte mir die wichtigste aller nur denkbaren Fragen:
‚War deine Mutter mit dir auch so streng?‘
Für eine Antwort musste ich nicht lange überlegen: ‚Oh ja, das war sie! Aber sie ist immer lieb dabei geblieben.“
… jury imaginaire …
Niemand da?“ Dr. Patolak trifft Frau Buchholz am nächsten Tag nicht in ihrem Zimmer an. ‚Heute kein Interview, Papenburg hat Ruh‘, denkt er und amüsiert sich über den Zufallsreim. Er wäre mit den Fragen an der Reihe und hatte sich schon einige zurechtgelegt.
Einen Tag später ist er nur kurz auf der Station; OP-Tag. Am nächsten Tag sucht Frau Buchholz ihn im Arztzimmer auf. Er macht Mittagspause. Freudestrahlend verkündet sie, dass sie bald entlassen wird.
„Zweimal in der Woche soll ich zur Nachbehandlung kommen. Damit kann ich leben.“
„Da freue ich mich für Sie, Frau Buchholz. Aber heute sind Sie ja noch hier. Wären Sie fit für einen Gang zur Cafeteria?“
Linda nickt. Sie machen sich auf den Weg. „Ich würde gern etwas über Ihre Mutter hören. Es gibt doch sicher auch Gutes von ihr zu erzählen.“
„Aber ja! Ich hoffe, Sie haben keinen falschen Eindruck von ihr bekommen. Solange es nach ihrer Mütze ging, war meine Mutter eine herzensgute Frau; sie tat alles für mich. Ich trug als erstes Mädchen in der Klasse Lastexhosen, die kennt heute keiner mehr, hauteng, knallige Farben, der letzte Schrei. ‚Schinken in Lastex’, frotzelten die Jungen.
Meine Mutter machte alles mit: Zuerst waren es die Petticoats, auf die ich so stolz war. Dann bekam ich Nietenhosen, so hießen die ersten Jeans, und später konnten meine Miniröcke nicht kurz genug sein; wir gingen mit der Mode. Sie war schon damals eine Helikopter-Mutter. Ballett, Tennis, Klavier, es gab keinen Wunsch, den sie mir nicht ermöglicht hätte, abgesehen vom Reiten. ‚Nach Pferdestall stinken‘, sagte sie, rümpfte die Nase und schüttelte den Kopf. Dabei blieb es. Außer Katzen war nichts Vierbeiniges zugelassen. Sie liebte ihre ‚verschmusten Samtpfötchen‘, die ihr um die Beine strichen und die Krallen am Sofa wetzten. Ein Buch wollte sie über Katzen schreiben, nur ein passender Titel fiel ihr nicht ein. Mit dem Buch war es wie mit dem Messer ohne Klinge, bei dem auch noch der Griff fehlt. Ich habe nie eine Zeile davon gesehen. Ich interessierte mich auch nicht dafür; ihr Katzengespann war widerlich. Die Pickel in meinem Gesicht verschwanden erst, als ich auszog und das Studium in Hannover aufnahm. Seitdem mach’ ich einen Bogen um Katzen, daran hat sich bis heute nichts geändert.
Das Ärgerlichste für meine Mutter war der Studienwunsch Tiermedizin. Sie schlug mir alle möglichen anderen Fächer vor. Wenn wir diskutierten und nicht weiterkamen, hielt sie ihren Kopf schief und saß mit trübsinnigem Blick da, als hätte sie Essiggurken an Sauerkraut gegessen.
Meine Mutter wusste, was für mich gut war. Sie ließ keine Gelegenheit aus, mir das zu erklären. Manchmal fing sie schon zum Frühstück damit an, um beim Abendessen die Lektion zu wiederholen. Ich glaube, dass ich mein Studium nur zu Ende gebracht habe, um es ihr zu zeigen. Wenn ich ein halbes Jahr vor dem Examen alles hingeschmissen hätte, wäre sie mir jubelnd um den Hals gefallen. Als sie erkannte, dass das Schicksal Tiermedizin nicht mehr abzuwenden war, schaltete sie um und legte einen anderen Gang ein.
‚Hannover’, so tönte sie vor ihren Clubschwestern, ‚wir haben uns umgesehen; eben doch eine richtige Großstadt, erstklassige Angebote! Mit der Auswahl hier nicht zu vergleichen. Es steht in einer Reihe mit Alternativen wie München oder Berlin, nur dass es nach Hannover nicht so weit ist.‘
Wenn ich davon erzähle, klingt mir ihre Stimme noch jetzt im Ohr. Manchmal sehe ich sie vor meinen Augen wie im Film. Sie gefiel sich, bei den Damen ihres Bridge-Clubs die Vorzüge von Hannover zu preisen. Dabei war für mich diese Stadt alles andere als liebenswert.“
„Was haben Sie gegen Hannover?“, fragt David.
Linda winkt ab und redet weiter. „Zur Zimmersuche fuhr meine Mutter mit, obwohl ich sie nicht eingeladen hatte. Viel lieber wollte ich alles selbstständig in die Hand nehmen und ließ sie das auch merken, aber sie stellte sich taub. Andeutungen reichten nicht und einen handfesten Krach mochte ich nicht vom Zaun brechen. Ich brauchte nur einzusteigen. Sie fuhr mit mir von einem Maklerbüro zum nächsten. Etwas anderes kam für sie nicht in Frage. Von Anschlagtafeln an der Uni wollte sie nichts hören, von Annoncen in der Zeitung auch nicht; das kostete nur Zeit. Die Vorauswahl gab sie in professionelle Hände. Überall hatte sie vorher angerufen und wurde dementsprechend in Empfang genommen.
Sie ließ sich gern die Tür aufhalten, Frau Buchholz hier, Frau Buchholz da. So etwas genoss sie und entschied sich für ein teilmöbliertes Zweizimmer-Apartment. Das war für meinen Bedarf zu groß und zu teuer, aber sie genehmigte es mit geübtem Gönnerblick. Sie ließ sich den Mietvertrag vorlegen, obwohl es einen Haken gab: Er war auf ein halbes Jahr befristet; dann käme die Eigentümerin zurück und würde selbst wieder einziehen.
Nun ja, ein halbes Jahr sollte reichen, um etwas Anderes zu finden. Meine Mutter unterschrieb. Sie hatte die Zimmersuche an einem einzigen Tag erledigt. Jetzt lief sie zur Hochform auf, kaufte dies und kaufte das.
Während meines letzten Schuljahres befürchtete ich, dass meine Eltern mir die finanzielle Unterstützung wegen des ‚falschen’ Studienfachs verweigern könnten. Außerdem wollte ich mir gern zum Studienbeginn eine gebrauchte Ente kaufen. Ich jobbte deswegen an der Kasse einer Tankstelle und sparte eisern. Meiner Mutter gefiel das überhaupt nicht. Damals gab es noch Tankwarte. Ihre Tochter eine Tankwartin? Das war für sie unerträglich.
Mein Vater war glücklicherweise anderer Meinung. Die Erfahrung zu machen, dass man Geld verdienen muss, fand er unterstützenswert. Es kann ihm dabei nicht ums Geld gegangen sein; denn als es mit dem Studium losging, kamen ihm auf einmal ganz andere Bedenken: Ein Gebrauchtwagen zu einem Preis, den ich bezahlen konnte, sei für eine Fahranfängerin mit viel zu hohen Risiken verbunden. Ein neuer Mini stand vor der Tür, für mich. Es war halt nicht die Ente, die ich wollte, aber ein bisschen freute ich mich trotzdem. Das verdiente Geld blieb mir so für etwas anderes.
Der Mini war schnell mit den nötigen Utensilien bepackt, die ich für das Apartment brauchte. Meine Mutter fuhr mit und blieb erst mal ein paar Tage; es gab ja zwei Zimmer. Sie ging shoppen und genoss die ‚richtige Großstadt’. Wenn sie vor den verspiegelten Wänden ihrer Haute Couture-Häuser wie auf einem Laufsteg hin und her stöckelte, fühlte sie sich wie vor einer Jury, einer jury imaginaire. Die Model-Nummer zog sie gerne ab. Bald verlor ich die Lust, sie zu begleiten. Nur, weil sie Spaß daran hatte, mir die exquisiten Novitäten der Herbstkollektion vorzuführen, sollte ich mit. Ich weigerte mich.“
„Das Semester fing doch sicher auch bald an“, wirft Dr. Patolak ein.
Frau Buchholz schüttelt den Kopf. „Darum kümmerte sie sich nicht, zum Glück. Ich war ihr dankbar dafür. In meinen schlimmsten Fantasien hatte ich schon befürchtet, dass sie mich in die Einführungsveranstaltungen für Erstsemester begleitete und dort wichtige Fragen stellte.“
In der Cafeteria ist noch ein Tisch am Fenster frei. Dr. Patolak holt zwei Tassen Kaffee, aber Linda nippt nur daran. Sie redet weiter: „Der befristete Mietvertrag erwies sich als vorteilhaft. Bald würde ich mir selbst meine Bude suchen und dann war ich frei. Emanzipation hieß das große Schlagwort. Es galt, sich von den Zwängen der etablierten Gesellschaft zu befreien. Ich war mit dabei und übte, die Faust zu ballen. Zuallererst rührte ich die Klamotten nicht mehr an, die meine Mutter mir aus den ‚Einkaufsparadiesen’ anschleppte. ‚Exzellente Angebote’, sagte sie und packte ihre Tüten aus. ‚Wie soll man da widerstehen?‘
Mit keinem Blick würdigte ich die Ausbeute ihrer Shoppingtouren. Ich praktizierte die ‚Befreiung vom Konsumterror’. Um meine Mutter zu vergraulen, schaltete ich auf stur, trug den verfilzten Norwegerpullover, die speckigen Jeans und den Parka.
Sie war empört. Statt mir nichts mehr zu kaufen und wütend abzuziehen, was ich bezweckt hatte, belämmerte sie mich unablässig und fuhr kaum noch nach Hause.
Ich stockte im Gegenzug meine Zeiten an der Uni auf, ließ keine Vollversammlung, kein Teach-in und keine Kundgebung aus. Es war die achtundsechziger Zeit, die ihre Boten vorausschickte. Der Kampf um die Rücknahme der Fahrpreiserhöhung, die Proteste gegen den Krieg in Vietnam und die Wahlen zur Fachschaft beanspruchten mich vollends und so merkte ich kaum, dass meine Mutter irgendwann nicht mehr da war. Abgezogen. Beleidigt und eingeschnappt nahm ich an. Ein Telefon hatte ich nicht, so dass ich mir den Grund ihres Rückzugs nicht anhören musste.
… furzen, wenn’s donnert …
An den folgenden Wochenenden blieb ich in Hannover und genoss es, allein zu sein in meinem geräumigen Apartment ohne mütterliche Gesellschaft.“
„Was war mit Ihrem Vater?“, fragt Dr. Patolak.
„Er schaltete sich nach einiger Zeit als Vermittler ein, schriftlich mit dem Briefkopf seiner Kanzlei und wies mich freundlich darauf hin, dass allein die Miete bei weitem den Betrag überstieg, der mir für den Unterhalt während des Studiums zustand. Er bat mich, meiner Mutter doch nachzusehen, dass sie sich möglicherweise ein klein wenig überfürsorglich verhalte.
Ich bedankte mich schriftlich, versprach ihm Nachsicht mit meiner liebenswürdigen Mutter und informierte ihn darüber, dass ich nach Ablauf des Mietvertrages ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft beziehen würde. Die Miete dort sei nicht halb so hoch; sicher auch in seinem Sinne.
Das war zu viel für meine Mutter. ‚In einer Kommune würde sie mich nicht mehr besuchen‘, so antwortete sie, ebenfalls schriftlich. Endlich verhängte sie die Höchststrafe. Genau das war mein Ziel.
Dafür tat sich eine neue Verbindung zu meinem Vater auf. Es entstand ein Briefwechsel zwischen mir und ihm. Ich schrieb an seine Kanzlei und damit war meine Mutter vom Zugang ausgeschlossen. Bald bekamen wir auch einen telefonischen Brückenschlag zustande. Ich wusste, wann er im Büro am besten zu erreichen war und rief von der Telefonzelle an. Nie zuvor hatte ich von ihm zwei Sätze im Zusammenhang gehört, ohne dass meine Mutter dazwischen keilte. Am Telefon unterbrach uns niemand. Das schien auch mein Vater zu genießen; er litt unter seiner Frau, genau wie ich unter meiner Mutter. Wir sprachen nicht über sie. Aber ungesagt herrschte Übereinstimmung. Wir waren geheime Verbündete. Offensichtlich freute es ihn, dass seine Tochter nicht nach der Mutter geraten war. Wenn er mich früher Fußball spielen sah, ließ er gern den altväterlichen Spruch fallen: ‚An dir ist wohl ein Junge verloren gegangen.‘ Das fand ich peinlich. Aber eine Frau wie meine Mutter zu werden, wäre für mich und für ihn gleichermaßen ein Albtraum gewesen. Ohne sie war ich jetzt auch endlich frei für einen ganz anderen Kampf; die Änderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse duldeten keinen Aufschub mehr.
In der Wohngemeinschaft war einiges anders. Ich gewöhnte mich erst langsam daran. Die Zimmer hatten keine Schlüssel. Nicht mal das Badezimmer ließ sich abschließen. Die Handtücher wurden scheinbar von allen benutzt, ich nahm meine zur größeren Sicherheit mit aufs Zimmer. Die Matratzen lagen direkt auf dem Boden; von den einengenden Bettgestellen hatte man sie befreit.
In der Küche gehörte allen alles, aber etwas Essbares war nur selten zu finden. Vor dem Essen empfahl es sich, erst mal zu spülen. Fast immer war ich es, die sich erbarmte, den Müll auszutragen, weil der Eimer so voll war, dass sich nicht mal mehr die Aschenbecher darin entleeren ließen.“
Frau Buchholz nimmt einen Schluck Kaffee. Ganz so heiß dürfte er nicht mehr sein. Es scheint sie nicht zu kümmern.
„Die Genossinnen und Genossen der Wohngemeinschaft hatten schon auf mich gewartet. Das Bewusstsein für Veränderung stand mir auf die Stirn geschrieben. Sie nahmen mich sofort in die Pflicht. Die Fachschaft Tiermedizin sei nicht hinreichend mit fortschrittlichen Vertreterinnen und Vertretern besetzt. ‚Kampf den reaktionären Kräften in den Fachschaften’, hieß ihre Parole zur anstehenden Wahl.
Jetzt ging es los, so wie ich es mir gewünscht hatte. Von einem Tag zum anderen stand ich auf Platz eins der ‚Liste Fortschritt’. Ich war Studentin der Tiermedizin, erst im zweiten Semester, von nichts auch nur eine Prise Ahnung, aber das richtige Bewusstsein, immerhin. Eigentlich hätte ich über mich selbst lachen müssen, aber vor lauter Aktionismus kam ich nicht dazu. Die Arbeit in den Gremien hatte Vorrang und Lachen gehörte nicht zum Geist der Zeit; zur revolutionären Gesinnung trug man ein grimmiges Gesicht.
Dafür aber lachten andere über mich. Was sie bei den Vorstellungsrunden der Kandidatinnen und Kandidaten auch fragten, ich hatte immer nur dieselben Phrasen von historischen Notwendigkeiten parat. Dass es doch jetzt darum ginge, die etablierte Gesellschaft zu verändern und das System zu überwinden. Es hagelte Spott, Hohn und Gelächter. Die Studenten der Tiermedizin und auch die wenigen Studentinnen dort waren geerdet. Viele kamen vom Bauernhof, standen fest mit beiden Beinen auf der Scholle, wussten, wohin sie gehörten und was sie wollten. Noch genauer wussten sie, wen sie wählten und wen nicht. Die meisten kümmerten sich nicht um die Wahl, weil sie das ganze Affentheater nicht ernst nahmen; Affentheater und Tiermedizin gingen nicht zusammen. Die Wahlbeteiligung war dementsprechend niedrig. Mich jedenfalls wählten sie nicht.
Ich holte kaum eine Stimme, die sich nicht in unsere kleine Szene zurückverfolgen ließ, und bekam kein Mandat, auch nicht im Nachrückverfahren. Durchgefallen. Die gesamte ‚Liste Fortschritt’ ging leer aus. Ich zog mir den Zorn meiner Mitbewohner zu. Sie gehörten zu den Altvorderen der sogenannten Bewegung in Hannover.
‚Nicht engagiert genug gekämpft, zu wenig Leidenschaft’, legte mir Diethard, unser Alphamännchen, zur Last. Das Pöbelhafte in seiner Stimme sagte alles; auf die Inhalte brauchte ich gar nicht zu achten, es waren immer die gleichen gebetsmühlenhaften Parolen.
Mit dem Telefonhörer am Ohr analysierte und diskutierte er das Wahlergebnis, am anderen Ende der Leitung vermutlich ein Genosse höheren Ranges aus seinem Kader. ‚Wir brauchen Aktionen! Unsere jungen Kandidaten müssen kämpfen lernen!’, donnerte er ins Telefon.
‚Eine Finte‘, raunte mir meine Mitbewohnerin Almut zu, ‚warte ab, gleich macht er eine Flasche Amselfelder auf und will dich trösten.‘
‚Furzen, wenn’s donnert’, dachte ich und sah sie gleichgültig an. ‚Solange er am Telefon den Brüllaffen macht, hört er nicht, was du sagst. Gleich, wenn er auflegt, spielst du wieder das unterwürfige Weibchen und hältst schön still.‘
Es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, dass diese Wohngemeinschaft für mich nicht das Richtige war, und kündigte zum nächstmöglichen Termin. Niemand sollte bei mir den Tröster der Betrübten spielen, erst betrüben und dann trösten.
Noch am selben Abend ließ ich mir einen Schlüssel für meine Zimmertür anfertigen. Der Kerl vom Schlüsseldienst zockte mich gehörig ab, in bar, ohne dafür eine Rechnung auszustellen.
‚Egal‘, dachte ich, ‚dann gibt es bis zum Monatsersten nur noch Toast und Knäckebrot’. Ich schloss jetzt regelmäßig meine Zimmertür ab und war damit endgültig in Ungnade gefallen, ins Lager der Reaktionäre zurückversetzt; Klassenziel nicht erreicht. Man schnitt mich, wo immer nur möglich. Allein Almut tauschte ab und zu einen Blick und manchmal auch ein paar belanglose Worte mit mir; ich verbuchte es als Geschlechtersolidarität.
Zur Sicherung meiner Privatsphäre ging ich noch einen Schritt weiter, diesmal etwas preiswerter. In einem Laden für Werkzeuge und Baubeschläge besorgte ich mir einen Türkeil und einen kleinen Hammer. Vor meinem nächsten Wannenbad versperrte ich damit die Tür. Hammer und Keil waren ab jetzt feste Bestandteile in den Taschen des Bademantels.
Einige Zeit später meldete sich die designierte Nachmieterin. Sie hatte das Casting durchlaufen und war von den Genossinnen und Genossen der Wohngemeinschaft auserlesen, mein Zimmer zu übernehmen. Sie war mir nicht unsympathisch, auf ihrer Stirn stand nichts von Opposition oder Revolte. Ob sie hier am richtigen Platz war? Was scherte es mich? Eine Warnung steckte ich ihr lieber nicht, so etwas wie: ‚Mädchen, mach keinen Fehler’ oder Ähnliches. Sicher würde sie besser klarkommen. Sie hieß Susanne. Ich dachte sofort an ‚Susanna im Bade’ und bot ihr an, dass sie gern meinen Zimmerschlüssel übernehmen könnte, Hammer und Keil erwähnte ich nicht.
Sie schien schon davon gehört zu haben und schüttelte lächelnd den Kopf. ‚Aber wie wäre es, wenn du mir deine neue Adresse gibst?’, fragte sie.
Darauf schüttelte ich lächelnd den Kopf. Auch wenn Susanne mir sympathisch war, wollte ich mit dem Rest der Wohngemeinschaft abschließen; meine neue Adresse behielt ich für mich.
Bald konnte ich mein Zimmer im Studentenwohnheim beziehen und kam allmählich zur Ruhe. Nachdem ich genesen war von all den Verwundungen, die ich mir an der Front gegen die reaktionären Kräfte zugezogen hatte, ‚friendly fire‘ inbegriffen, stellte ich ernüchtert fest, dass ich nicht einmal die Hälfte der vorgesehenen Leistungsnachweise geschafft hatte. Damit war mein zweites Semester danebengegangen. Alles war aufzuholen, nichts zu spät, aber es hieß nun, hinter den versäumten Scheinen her zu hecheln und die Semesterferien zu opfern, um den Stoff nachzubüffeln.
… Sekte auf Seelenpirsch …
Am Anfang des nächsten Semesters sah ich Susanne wieder. Für mich schien es ein Zufall zu sein, aber sie sagte mir, dass sie beim Parkplatz vor dem Institut schon länger neben meinem Mini gewartet hatte. Ich verstand sofort: der Zimmerschlüssel und überhaupt. Ich vertröstete sie und bot an, dass wir uns in zwei Stunden, nach dem nächsten Seminar in der Cafeteria zusammensetzen könnten.
Es wurde eine lange Sitzung. Die Kasse schloss, die Tische wurden abgeputzt, die Stühle hochgestellt und wir waren noch immer nicht fertig.
‚Wir gehen zu mir’, sagte ich, ‚das Wohnheim ist nicht weit.‘
Dort saßen wir noch einmal so lange. Ich wurde müde und wollte ihr den Schlüssel, den Hammer und den Keil geben. Aber sie zögerte.
‚Das ist keine Lösung’, sagte sie. ‚Ich weiß mich meiner Haut jetzt zu wehren, ohne Hammer und Keil. Ich hab‘ dazugelernt. Das ist nicht mehr das Problem. Hast du denn nur halb zugehört? Kapierst du nicht? Ob mein Fahrrad draußen oder drinnen steht, ist nicht so wichtig. Aber, warum ist plötzlich der Keller zum ersten Mal abgeschlossen? Warum finde ich mein Fahrrad neben der Haustür wieder, ohne dass mir nur einer etwas davon gesagt hat, nicht mal abgeschlossen? Als ich nachfragte, bekam ich lapidar zur Antwort: ‚Dein Fahrrad? Es gibt Wichtigeres!‘
Mein Fahrrad ist bei ihren umstürzlerischen Plänen nicht relevant. Ich bin nicht blind und mein Gehör funktioniert. Irgendwas ist über Nacht in unserem Keller deponiert worden. Was ist, wenn die ganze revolutionäre Zelle von der Polizei ausgehoben wird? Dann stecke ich mit drin. Ich muss da raus, am besten noch heute.“
Linda holt tief Luft. Sie nippt wieder vorsichtig an ihrem Kaffee und redet weiter.
„Ich gab meinem Herz einen Ruck. ‚Wenn dir eine Luftmatratze für heute Nacht genügt, ziehen wir gleich los und holen schon mal raus, was wir schleppen können. Der Rest kommt morgen.‘
Susanne sah schon etwas besser aus. Ich kippte meine Reisetasche und den halb gefüllten Koffer aus und fuhr mit ihr los. Wir nahmen die Straßenbahn, der Mini war uns zu auffällig. Es war schon dunkel. Gegenseitig sprachen wir uns Mut zu. Bevor Susanne die Haustür öffnete, checkten wir nochmal das Areal. Wessen Autos standen geparkt an der Straße? Welche Fenster waren beleuchtet? Wir überprüften die nächste Telefonzelle, ob sie funktionierte. Die Nummer 110 schrieb ich mir mit einem Kuli in die Hand. Sie würde mir bei der zu erwartenden Aufregung bestimmt nicht mehr einfallen. Ich überprüfte, ob mein Kleingeld zum Telefonieren genügte. Wir waren zu allem entschlossen. Was Susanne mir erzählt hatte, reichte für eine Anzeige bei der Polizei.
Ich schlich mit dem Koffer in der Hand hinter ihr her die Treppe hinauf. Leise öffnete sie die Wohnungstür und hielt den Zeigefinger vor die Lippen. Bei Almut war Musik zu hören. Wir kamen unbehelligt in Susannes Zimmer. Ich schloss die Tür mit dem teuren Schlüssel hinter uns ab, Susanne holte ihre beiden Taschen aus dem Schrank. Wir packten. Drei Reisetaschen, einen Koffer! Ich stopfte alles hinein, was im Kleiderschrank hing, auf Bügelfalten nahm ich keine Rücksicht.
‚Warum so hektisch?‘, fragte ich mich. Eigentlich musste es überhaupt nicht schnell gehen und auch nicht leise, wir trieben ja nichts Unrechtes. Warum flüsterten wir? So ein Quatsch! Je länger ich überlegte, desto mehr kam ich zu dem Entschluss, hier nicht als heimliches Kommando aufzutreten, sondern als zwei selbstbewusste Frauen, die sich ihr Recht nahmen. Aber wenn ich mir Susanne ansah, war sie weit von ‚selbstbewusst’ entfernt und mir ging es nicht besser: Unablässig zitterten meine Hände, eher ein Zeichen für Krampf als für Kampf.
‚Egal, wie es läuft’, dachte ich, ‚wer immer hier gleich aufkreuzen mag und sich in den Weg stellt‚ wir ziehen das durch und machen uns mit Susannes Sachen aus dem Staub.‘
Die Musik in Almuts Zimmer blieb laut, es war die LP der Stones. “Get off of my cloud”, hörte ich Mick Jagger schreien. Bald müsste die erste Seite zu Ende sein. Dann wäre es einen Moment leise und Almut würde die Platte umdrehen. Außer der Musik war nichts zu hören. Susanne hatte alles zusammengerafft, was ihr gehörte. Wir packten die letzten Sachen ein und behielten sogar noch Platz im Koffer. Leise schlichen wir über den Flur ins Treppenhaus, in beiden Händen je ein Gepäckstück.
‚Halt!‘, fiel es mir ein. Ich wurde inzwischen etwas mutiger und konnte nicht widerstehen. Eine kleine Spur wollte ich hinterlassen. Die Kommune Fortschritt sollte sich gern mal an mich erinnern. Im Dunkeln tappte ich zurück durch den Flur. Der Zimmerschlüssel, er steckte noch von innen. Ich zog ihn ab, verschloss Susannes Zimmer von außen und nahm meinen Schlüssel mit. Jetzt hatte ich mit diesen Fortschrittsfanatikern endgültig abgeschlossen.“
Frau Buchholz lächelt. Dr. Patolak rückt seinen Stuhl so zurecht, dass er die Uhr an der Wand der Cafeteria im Blick hat. Zehn Minuten sind es noch. Er wundert sich über ihre Energie und will sie nicht weiter unterbrechen.
„An der Haltestelle atmeten wir auf und setzten uns Rücken an Rücken auf den Koffer. Er ließ sich seitdem nie wieder ordentlich schließen, ein Andenken an Susannes Exodus. Wir räumten mein enges Zimmer im Wohnheim um. ‚Besuch und Fisch – drei Tage frisch’, ging es mir beim Aufpusten der Luftmatratze durch den Kopf. Aber ich hatte ja genügend Erfahrung, einen lästigen Gast aus meiner Bude loszuwerden. Gar nicht nötig: Mit Susanne war es angenehm; sie nahm sich so bescheiden zurück, wie ich es noch nie erlebt hatte, nicht bei meiner Mutter und erst recht nicht in der ‚Kommune’. Die Erfahrung, dass es auch liebenswerte Menschen gab, tat mir gut. Bisher hatte ich noch nicht so viele davon kennengelernt. Einige Wochen später fand Susanne eine dauerhafte Bleibe. Jetzt hatte sie meine Adresse und ich ihre.
Schon ein paar Tage darauf wartete sie wieder neben meinem Auto auf dem Parkplatz. Sie hatte festgestellt, dass sie schwanger war. Zu einer Anzeige gegen Diethard ließ sie sich nicht bewegen. Ich drängte sie nicht weiter. Schon am nächsten Morgen fuhr ich mit ihr nach Holland. Die Abtreibung kostete. Die Klinik stellte zwar eine Rechnung aus, aber eine Rechnung für einen Eingriff, der in Deutschland unter Strafe verboten war, konnte man natürlich nicht bei der Krankenkasse einreichen. Ich lieh Susanne den größten Teil des Geldes, von dem ich zu Beginn des Studiums die Ente kaufen wollte. Sie zahlte es mir monatlich in Raten zurück, ohne dass ich sie jemals daran erinnern musste.
Noch heute sind Susanne und ich befreundet. Wir denken immer mal wieder an ihren Exodus und an unsere Emanzipation vom Affentheater.“
Lindas Erzähltempo wird langsamer. „Dass ich für die Liste Fortschritt kandidiert hatte, lief mir lange hinterher. Als gegen Ende des Studiums die Letzten, die meine Kandidatur erlebt hatten, ihre Examen machten und die Uni verließen, fühlte ich mich wie befreit. Endlich! Aber das Kapitel war noch nicht abgeschlossen. Die Freundschaft mit Susanne wäre eingeschlafen, wenn ich nicht viele Jahre später einen Anruf von ihr bekommen hätte, in den Achtzigern.
Vorangegangen war ein unangemeldeter Besuch. Eine Dame und ein Herr hatten an einem Samstagmorgen nach dem Frühstück geklingelt. Ich drückte auf den Summer, aber sie standen schon direkt bei mir im dritten Stock vor der Wohnungstür, korrekt gekleidet.
‚Sekte auf Seelenpirsch‘, dachte ich, ‚irgendwelche Heiligen der letzten Tage, die sich berufen fühlen, mich früh am Morgen auf den rechten Weg zu bringen. Vielleicht haben sie den Zeitpunkt des Weltuntergangs neu berechnet.‘ Ich wollte ihnen die Tür vor der Nase zuschlagen, ohne sie zu Wort kommen zu lassen. Aber die Dame hielt mir eine Marke hin und riskierte, dass ich ihre Hand einklemmte.
‚Polizei’ sagte sie.
Ich zog die Tür wieder auf. ‚In Zivil?‘ Ich verglich die Fotos auf ihren Dienstausweisen mit ihren Gesichtern und ließ sie herein.
‚Ich bin eine unbescholtene Bürgerin.’
‚Wir vermuten auch nichts anderes, Frau Dr. Buchholz. Wir ermitteln nicht gegen Sie. Es geht um eine Zeugenaussage.‘ Die Dame führte das Wort. Der Herr beobachtete mich von der Seite.
‚Es kann einen Moment dauern. Dürfen wir uns setzen?‘, fragte sie.
Ich schob die Frühstückssachen beiseite, legte die Zeitung weg und stellte zwei Stühle hin, nebeneinander. Ich setzte mich ihnen gegenüber. So hatte ich sie beide im Blick. Vielleicht waren die Ausweise doch nicht echt. Auf Trickbetrüger hereinfallen, das sollte mir nicht passieren.
‚Wir stellen uns gern noch einmal ausführlich vor’, sagte die Dame. Beide legten ihre Dienstausweise auf den Tisch.
‚Cornelia Weiß, Kriminalhauptkommissarin, Weiß mit dem vom Aussterben bedrohten Eszett am Ende.‘
‚Mein Name ist Thorsten Schmitt, Kriminalkommissar, Schmitt mit einem doppelten T am Ende.‘
‚Gerlind Buchholz mit Zett am Ende. Zwei Bäume spielen in meinem Namen verstecken.‘
Ein Lächeln auf unseren Gesichtern löste die angespannte Stimmung. Noch nie im Leben war ich um Worte verlegen; die Gene meiner Mutter. Sie konnte eine Wendeltreppe beschreiben, ohne die Hände dabei zu bewegen.“
Dr. Patolak nickt zustimmend und verkneift sich ein Grinsen.
„Ich übernahm die Gesprächsführung: ‚Kommissar Schmitt-Doppeltee, worum geht es?‘
Der junge Mann spielte mit. ‚Es geht um die Zeit nach achtundsechzig. Die Älteren von uns erinnern sich.‘ Er holte ein Foto aus der Innentasche seines Jacketts und legte es auf den Tisch.
‚Diethard Wagner. Der ist aber ganz schön fett geworden‘, sagte ich.
Herr Schmitt nickte. ‚Haben Sie Herrn Wagner jemals unbekleidet gesehen?‘
‚Nackt? Aber ja, er posierte gern, zeigte sich von vorn und von hinten. Auf dem Weg vom Zimmer ins Bad trat er als Nacktfrosch auf. Er war ständig in Sorge, übersehen zu werden.‘
‚Haben Sie ihn dabei auch von hinten gesehen?‘
‚Sie möchten wissen, ob ich seinen nackten A – Allerwertesten gesehen habe?‘
‚So könnte man das auch ausdrücken. Falls ja, können Sie uns bitte beschreiben, wie er ausgesehen hat?‘
‚Ich kann Ihnen versichern, dass ich von Herrn Wagner mehr gesehen habe, als ich jemals sehen wollte, sein Hintern war auch dabei. Da gibt es aber nichts zu beschreiben, der war ganz normal, wie so ein Hintern eben aussieht.‘
Schmitt-Doppeltee steckte das Foto wieder ein und stand auf. ‚Das war es schon’, sagte er. ‚Vielen Dank.‘
Frau Weiß nahm die Ausweise an sich, klappte ihre Protokollmappe zu und folgte ihm in Richtung Tür.
‚Halt, halt!‘, rief ich. ‚Was ist mit meinen Fragen?‘
Frau Weiß wiegelte ab: ‚Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben können, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.‘
Bevor die beiden gingen, drehte Frau Weiß sich noch einmal um. ‚Ich verstehe ja, dass Sie auch Fragen haben. In absehbarer Zeit wird es einen Prozess geben, der wird öffentlich verhandelt, die Medien werden sicherlich darüber berichten.‘
Als sie weg waren, öffnete ich erst mal das Fenster und holte tief Luft.
Das Telefon klingelte: Susanne.
‚So ein Zufall. Ich wollte gerade bei dir anrufen, ich hatte Besuch.‘
‚Etwa von der Polizei?‘
‚Woher weißt du das?‘
‚Weil sie auch bei mir waren. Aus ermittlungstechnischen Gründen arbeiten sie offenbar zeitgleich. Mir wär’ fast die Kotze gekommen, als ich das Bild sah. Dieser widerliche Dreckskerl! Endlich haben sie ihn geschnappt! Hoffentlich wird er anständig verdonnert. Glaubst du mir die Sache mit dem Keller jetzt? Das waren keine Kisten mit harmlosen Knallfröschen, für die mein Fahrrad vor die Tür musste. Das war todernst damals!‘
Für mich sprach Susanne in Rätseln. Ich unterbrach sie: ‚Kannst du mir bitte sagen, um was es geht?‘
‚Liest du denn keine Zeitung mehr? Diethard Wagner steht unter Verdacht, an einem bewaffneten Banküberfall beteiligt gewesen zu sein. Der Überfall diente zur Geldbeschaffung für terroristische Aktionen. Es gab dabei einen Schusswechsel. Einer der Bankräuber wurde verwundet, entkam und tauchte unter. Das war unser Alpha-Männchen Diethard. Jetzt, viele Jahre später, ist er festgenommen worden, Kommissar Zufall.‘
‚Und was hatte das mit dem Hintern auf sich?‘