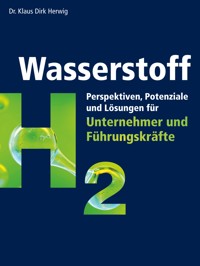
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch richtet sich an Alle, die sich zukünftig mit dem Thema Wasserstoff befassen wollen oder müssen. Es richtet sich an interessierte Unternehmer und Führungskräfte, ebenso an neugierige Neueinsteiger. Meine Empfehlung: Denken Sie nach, welche Rolle Wasserstoff für IHR Unternehmen spielt. Was wären dann neue Ziele, Märkte, Regionen und Zielgruppen, sowie neue Produktinnovationen für die Wasserstoff-Wirtschaft? Betrachten Sie dabei die gesamte Wertschöpfungskette für Ihr Unternehmen und Ihre Branche. Erkennen Sie die Anforderungen von Morgen aller Beteiligten der zukünftigen nachhaltigen Energiewirtschaft zu nachgefragten Produkten und Lieferanten. Entwickeln Sie innovativ einzigartige Angebote. Angebote für Ihre alten Zielbranchen oder für die neuen Boom-Branchen - Nachhaltigkeit, Klima, - Energie- und Umwelt-Technik und - Grünen Wasserstoff aus grünen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Ein erster Schritt auf Ihrem Weg zu einer zukünftigen Lösung für Sie und Ihr Unternehmen kann in der Ihnen vorliegenden Lektüre dieses Buches liegen. Unternehmer und Führungskräfte in Industrie, Handel, Handwerk, Verkehr, etc. stehen insbesondere vor zwei Fragen: - Vermag unser Unternehmen andere Unternehmen in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette mit angebotenen Produkten und Dienstleistungen zu unterstützten? Stellt somit die Wasserstoff-Wertschöpfungskette einen neuen Absatzmarkt da, mit dem zukünftig Geld zu verdienen ist? - Vermag unser Unternehmen der eigenen CO2-Neutralität näher zu kommen? Inwieweit kann Wasserstoff als Substitut fossiler Energieträger im eigenen Wertschöpfungsprozess eine Rolle spielen? Das vorliegende Buch versucht im Folgenden, Leser beim Finden von Antworten auf diese beiden Fragen zu unterstützen, Perspektiven und mögliche Marktpotenziale aufzuzeigen sowie einen Leitfaden zur Entwicklung von Lösungen darzustellen. Hierzu vermittelt das vorliegende Buch ein fundiertes Hintergrundwissen zu - den möglichen Quellen für Grünen Wasserstoff Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft in Kap.2, - der gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion durch elektrische Elektrolyse über den Transport bis zur Nutzung in Kap. 3 - den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten als Energiespeicher, als Rohstoff für die Rückgewinnung von elektrischem Grünen Strom und für die Bereitstellung von Prozesswärme in Industrie, Gewerbe und Gebäuden sowie für die klimaneutrale Herstellung von synthetischen Kraftstoffen oder Kunststoffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Eltern
Erika und Wilfried Herwig
Inhaltsverzeichnis
1. Zielsetzung und Gegenstand des Buches
2. Wasserstoff aus grüner Energie als Lösungsbeitrag zum Klimawandel
2.1 25 Jahre Klima-Konferenzen auf den Punkt gebracht
2.2 Wasserstoff als Elixier für das Leben in der Zukunft
2.3 Die Zutaten für Grünen Wasserstoff
2.3.1 Nutzung der Sonnenenergie
2.3.1.1 Photovoltaik
2.3.1.2 Solar-Thermo-Anlagen
2.3.2 Windenergie
2.3.3 Wasserkraft
2.3.4 Sonstige Alternativen
2.3.4.1 Wasserstoff von Biogas aus der Landwirtschaft
2.3.4.2 H
2
aus Blaualgen
2.3.4.3 Lieber auch etwas Atomkraft?
2.3.5 Fazit zu grünen Energien für Deutschland
3. Die Wertschöpfungskette von Grünem Wasserstoff
3.1 Die Produktion von Grünem Wasserstoff
3.2 Der Transport von Grünem Wasserstoff
3.3 Die Nutzung von Grünem Wasserstoff
3.4 Akzeptanz als Schlüssel für den Markthochlauf
4. Perspektiven
5. Marktpotenziale mit Umwelt-Technologien
6. Die Nutzung für Sie und Ihr Unternehmen
6.1 Anleitung zur Umsetzung im eigenen Unternehmen
6.1.1 Entwicklung und Konkretisierung Ihrer Ziele kurz- mittel & langfristig -
6.1.2 Ihre Zielgruppen, Zielbranchen und Zielregionen
6.1.3 Entwicklung Ihrer passenden Produktangebote auf Basis ermittelter Bedarfe der Zielgruppen
6.1.4 Erfolgsfaktoren identifizieren
6.1.5 Priorisierung Ihrer relevanten Erfolgsfaktoren
6.1.6 Die Benotung Ihres eigenen Unternehmens
6.1.7 Benchmarking zur Einschätzung der eigenen Marktposition im Wettbewerb
6.1.8 Passende Wege für Ihre Zielerreichung
6.1.9 Einsparung von unnötigen Ressourcen
6.1.10 Die Entwicklung Ihres H
2
-Business-Plans
6.2 Selbst nachhaltig(er) werden
6.2.1 Im Coop-Einzelhandel CO
2
-frei mit 1.000 H
2
-LKWs
6.2.2 Klimaneutraler Verkehr mit Bus und Bahn
6.2.3 Wasserstoff in KMU mit industrieller Produktion
6.2.4 Energieautarker Neubau von Einfamilienhaus
6.2.5 Der nächste Neuwagen mit Wasserstoff-Antrieb
6.2.6 Wasserstoff-GoKarts für die Kinder
6.3 Als Player im Wasserstoffmarkt aktiv mit verdienen
6.3.1 Vermarktung ähnlicher Produkte – NEA-Kompressoren
6.3.2 Vermarktung verwandter Produkte – Vorwärtsintegration von Voith Hydro Wasserkraft für Grünen Wasserstoff
6.3.3 nucera-Elektrolyseure als neue Innovationen im thyssenkrupp-Portfolio
6.3.4 Mit der passenden Gastechnik zur Marktführerschaft im Wasserstoffmarkt
6.4 Auf dem Weg zum Deutschen Weltmeistertitel im Spiel der internationalen Wasserstoffwirtschaft
7. Fazit und Ausblick
8. Glosar zu Abkürzungen und Fachbegriffen
Vorwort
Dieses Buch richtet sich an Alle, die sich zukünftig mit dem Thema Wasserstoff befassen wollen oder müssen.
Es richtet sich an interessierte Unternehmer und Führungskräfte, ebenso an neugierige Neueinsteiger. (Zur einfacheren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form der Substantive und Ansprachen benutzt, was jedoch auch vielen Kolleginnen das Lesen erleichtern wird)
Wie gut fühlen Sie sich aktuell im HIER und JETZT?
Mark Aurel (121 – 180 n.Chr.) brachte es auf den Punkt:
„Der Mensch wird zu dem, was er den ganzen Tag denkt.“
Dies muss damals wie heute einen wahren Kern haben. Denn Marc Aurel hat es zum Offizier gebracht, dann zum Oberbefehlshaber und schließlich zum Kaiser des römischen Weltreiches.
WIE wird in der Wirtschaft, in Ihrer Branche, in Ihrem Unternehmen oder in verschiedenen Lebenssituationen aktuell gedacht?
Viele denken an Krisen, Ängste und Probleme.
Das ist in der Tat ernst zu nehmen.
All dies sind Herausforderungen.
Die Herausforderungen vieler Unternehmen waren in vergangenen Jahren:
Corona
gesättigte Märkte
fallende Umsätze
sehr hohe Materialkosten
Billiganbieter im Ausland
schwieriger Vertrieb
Weitere Herausforderungen, welche seit 2022 neu dazugekommen sind:
Ukrainekrieg
Lieferengpässe
Fachkräftemangel
stagnierende Absatzmärkte
fehlende Marktinformationen
neue Kostensteigerung in allen Bereichen, wie z. B. bei Materialien und besonders Energie
Unsicherheit für wichtige Zukunftsentscheidungen
Was denken Sie hierzu?
In jeder Krise gibt es vielleicht 10 % oder mehr Unternehmen, denen es wirtschaftlich schlecht geht oder die eventuell untergehen.
ABER: in jeder Krise gibt es auch sicherlich andere 10 % und mehr Unternehmen (wie SIE), welche die Herausforderung als Chance sehen.
Unternehmen, die sich mit Leichtigkeit aufschwingen zu ungeahnten Erfolgen. Die Unternehmer dieser erfolgreichen Unternehmen denken anders, fühlen anders und handeln anders!
Eine buddhistische Weisheit lautet:
„Das Leben ist nicht gut oder schlecht, das Leben IST.“
Denken Sie nach, über
visionäre Ziele,
lukrative Zielgruppen und
innovative Produkte von Morgen
rund um die neuen Boom-Branchen nachhaltige Energien und Wasserstoff.
Viele fragen sich:
wie kann ich bzw. mein Unternehmen in den nächsten Jahren selbst nachhaltig werden?
ist Wasserstoff der richtige Weg für mein Unternehmen?
woher beziehe ich den Wasserstoff für mein Unternehmen?
kann ich in meinem Unternehmen Wasserstoff zukünftig profitabel nutzen?
Die zeitliche Reihenfolge auf diesem Weg verläuft folgendermaßen:
Die Wertschöpfungskette zu Grünem Wasserstoff wird aufgebaut:
Produktion,
Transport und Speicherung
Nutzung von Wasserstoff
mit allen notwendigen
Anlagen, wie zur Elektrolyse
Maschinen, wie Pumpen und Kompressoren
Systemen, wie Tanks mit kohlefaserverstärkten Kunststoffen
Komponenten, wie Armaturen,
Teilen wie Sensoren oder Messtechnik und
Rohstoffen, wie Kohlefasern.
Wenn Sie sich an der Wasserstoff-Wirtschaft von Morgen als Leistungsgeber und/oder Zulieferer beteiligen wollen, dann werden Sie und Ihr Unternehmen vergütet, machen neue Umsätze und erzielen Gewinne.
Der nötige Wasserstoff steht zur Verfügung.
Unternehmen, Fahrzeuge, Haushalte und sonstige Gebäude werden nachhaltig und CO2-frei.
Meine Empfehlung:
Denken Sie nach, welche Rolle Wasserstoff für IHR Unternehmen spielt.
Was wären dann neue Ziele, Märkte, Regionen und Zielgruppen, sowie neue Produktinnovationen für die Wasserstoff-Wirtschaft?
Betrachten Sie dabei die gesamte Wertschöpfungskette für Ihr Unternehmen und Ihre Branche.
Erkennen Sie die Anforderungen von Morgen aller Beteiligten der zukünftigen nachhaltigen Energiewirtschaft zu nachgefragten Produkten und Lieferanten.
Entwickeln Sie innovativ einzigartige Angebote.
Angebote für Ihre alten Zielbranchen oder für die neuen Boom-Branchen
Nachhaltigkeit, Klima,
Energie- und Umwelt-Technik und
Grünen Wasserstoff aus grünen Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft.
Ein erster Schritt auf Ihrem Weg zu einer zukünftigen Lösung für Sie und Ihr Unternehmen kann in der Ihnen vorliegenden Lektüre dieses Buches liegen.
Gewinnen Sie Inspirationen und Erkenntnisse für Ihr Unternehmen.
Nach dem Lesen dieses Buches sind Sie in der Lage, sich an Expertengesprächen zu beteiligen und jegliche Aussagen, Versprechen und Kalkulationen selbst verstehen und bewerten zu können.
Auf dieser Basis können Sie Lösungen für Ihr Unternehmen erfolgreich umsetzen.
Auf diesem Weg begleite ich Sie gerne.
Ihr Klaus Dirk Herwig
Prolog - Wie Coop CH das Henne-Ei-Problem gelöst hat
OHNE Grünen Wasserstoff
KEINE Nutzung in Industrie, Gewerbe, Verkehr und Gebäuden
OHNE Kunden in Industrie, Gewerbe, Verkehr und Gebäuden
KEINE Angebote für Grünen Wasserstoff
Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist mittlerweile in aller Munde. Doch viele Unternehmer, gerade Mittelständler, fragen sich, ob es sich lohnt, schon jetzt die eigene Produktion oder Logistik auf Wasserstoff umzustellen.
Denn ohne vorhandene Infrastruktur ist eine wirtschaftlich tragbare Umstellung des eigenen Unternehmens nicht möglich. Ohne Unternehmen, welche eine neue Infrastruktur nutzen, wird eben jene nicht geschaffen.
Es entsteht ein sogenanntes Henne-Ei-Problem (es ist unklar, was zuerst da war – bzw. bei Wasserstoff da sein muss).
Somit beschäftigt man sich in Deutschland seit vielen Jahren mit der Frage, ob man zuerst die Verbraucher in Verkehr, Gebäuden, Industrie und Gewerbe braucht oder zuerst die Lieferung von Grünem Wasserstoff auf Basis von Grünem Strom auf Basis von Solar-, Wind- und Wasserkraft.
Es gibt bereits Firmen, die mit großen Schritten vorangehen, wie das Beispiel von Coop in der Schweiz (CH) zeigt. Hierzu stellt Jörg Ackermann als Aufsichtsrat des Handelskonzerns Coop seine bewährte und schon umgesetzte Lösung dar:
Seit 2008 wurden in seinem Unternehmen Coop die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit ständig wichtiger. 2018 nahmen die Visionen und Ziele dann konkrete Formen an: in nur fünf Jahren bis 2023 in allen relevanten Bereichen des Unternehmens CO2-neutral zu sein und ein flächendeckendes Netz von Wasserstofftankstellen in der ganzen Schweiz zu schaffen.
Eine tolle Vision im Vergleich zu Alt-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der 2020 das Ziel formulierte, bis 2050 in Deutschland CO2- neutral zu sein.
Nach nur kurzer Entwicklungszeit nahm Coop bereits im Herbst 2020 einen der weltweit ersten serienmäßig produzierten Wasserstoff-Lastwagen in Betrieb. Insgesamt sieben Wasserstoff-Lastwagen waren dann schon bis Ende 2020 im Einsatz.
Coop nutzt diese Wasserstoff-Lastwagen zur Belieferung seiner 2.500 Verkaufsstellen, etabliert erste Wasserstoff-Tankstellen in der Schweiz und fördert so den Aufbau der landesweiten Wasserstoff-Mobilität.
Das anvisierte Ziel war, kurzfristig bis Ende 2023 schon 1.000 Wasserstoff-LKWs auf den Schweizer Straßen zu haben. (Details erfahren Sie S. → ff.)
Interview mit Jörg Ackermann in der Coop-Zentrale in Basel
Herwig: Wie kamen Sie auf die Idee, „H2 Mobilität Schweiz“ zu gründen, dessen Präsident Sie aktuell sind?
Ackermann: 2013 hat die Geschäftsleitung von Coop grünes Licht gegeben, ein Pilotprojekt aufzubauen, zuerst in kleinem Maßstab. Wir haben in Aarau ein Ökosystem aufgebaut mit der Produktion von Wasserstoff und einer ersten Tankstelle.
Wir haben ein eigenes Fahrzeug entwickelt, weil es damals keines auf dem Markt gab, d. h. wir haben einen eigenen LKW gebaut, mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Wir wollten das technologisch und betriebswirtschaftlich abbilden und dann nachweisen, dass dies funktioniert.
Und da es funktioniert hat, wollten wir dann als Coop weiter gehen. Dabei sollte es auf eine breitere Basis gestellt werden. Und so haben wir im Jahr 2018 den Förderverein gegründet mit sechs der größten Unternehmen in der Schweiz zu Tankstellen und Logistikunternehmen mit Fahrzeugen.
Das war der Start. Momentan sind wir bei 21 Unternehmen als Mitgliedern, 14 aus dem Transport und 7 mit Tankstellen, womit wir dann das „Henne-Ei-Problem“ gemeinsam lösen konnten.
Herwig: Wie kamen Sie auf die in den Medien präsentierte Zahl von 1.000 Wasserstoff-LKWs bis 2023 auf den Schweizer Straßen?
Ackermann: Die Anzahl von 1.000 Wasserstoff-LKWs war eine Prognose für die Mitglieder unseres Fördervereins, aber auch für andere Unternehmen in der Schweiz, die Interesse haben an diesen Fahrzeugen. Die Nachfrage kommt inzwischen nicht nur von Spediteuren und Fuhrparkbetreibern, sondern auch von Großunternehmen wie Nestlé (der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern und das größte Industrieunternehmen der Schweiz), welche letztlich Transportleistungen beziehen wollen, die CO2-frei sind.
Herwig: Ihre Fahrzeuge beliefern Ihr komplettes Land, die gesamte Schweiz?
Ackermann: Wir sind inzwischen vom Bodensee bis zum Genfersee mit Wasserstoff-Tankstellen versorgt. Da findet man immer irgendwo eine Tankstelle. Wir tanken sowohl bei öffentlichen Tankstellen wie auch bei Migros-Tankstellen, dafür tanken die Migros-LKWs bei Coop.
Herwig: Wie erfolgte bei Ihnen der Ausbau Ihres Tankstellen-Netzes?
Hier wird oft von dem sogenannten „Henne-Ei-Problem“ gesprochen:
Ohne Tankstellen fahren keine Fahrzeuge – und ohne Fahrzeuge machen die Wasserstoff-Tankstellen auch nur wenig Sinn.
Bei der Wasserstoff-Tankstelle in Koblenz habe ich selbst noch nie ein Wasserstoff-Fahrzeug beim Tanken gesehen.
Ackermann: Unsere Zielsetzung war immer: Wir wollen ein flächendeckendes Tankstellennetz in der Schweiz! Es war also die Frage, wie kriege ich das hoch, und dass sich das letztendlich betriebswirtschaftlich auch rechnen kann.
Wir haben immer gesagt, wir brauchen zuerst den Kunden und dann die Tankstellen. Lastwagen sind Großverbraucher. Die LKWs brauchen etwa 30- bis 50-mal mehr Wasserstoff als ein PKW. Also kriegt man in den Tankstellen in relativ kurzer Zeit mit dem LKW-Fuhrpark viel verkauft.
In der Schweiz haben wir den über 50-fachen Umsatz mit unseren Wasserstoff-Tankstellen, als in Deutschland.
Mit nur 15 Lastwagen, die etwa 100.000 Kilometer im Jahr fahren, können wir eine Tankstelle wirtschaftlich betreiben. Dies ist unsere Formel „15 zu 1“. Also sind in erster Linie Lastwagen von Beginn an nötig. Dies ist dann die Triebfeder, um mit dem Aufbau des Netzes zum einen schnell, zum anderen aber auch wirtschaftlich voranzukommen.
In Deutschland ging man leider umgekehrt vor.
Man hat erst begonnen, ein großes Tankstellennetz aufzubauen – und keiner geht, bzw. fährt hin. Die Tankstellen müssen aber auch Kunden haben, sonst macht das keinen Spaß.
Wenn Sie keine Kunden haben, haben Sie keinen Spaß, das ist ganz einfach. Es ist das Wesentliche, dass man am richtigen Ende anfängt. Das ist das Gleiche, wie für jedes andere erfolgreiche Produkt.
Unser Ansatz war ganz klar:
Zuerst die Kunden zu haben und erst dann die Produktionsstätten. Und deshalb haben wir in der Schweiz erst mit den Lastwagen angefangen, weil diese für den Wasserstoff und das Tankstellennetz umsatzbringende Großkunden sind.
Herwig: Besten Dank, Herr Ackermann.
Dies ist ein guter Ansatz für die Unternehmen der deutschen Wirtschaft.
Wie dabei insbesondere für Unternehmen mit 20 bis 1.000 Mitarbeitern, (dem typischen deutschen Mittelstand) eine wirkungsvolle Vorgehensweise aussehen könnte und wie mit Leichtigkeit erfolgreiche Ergebnisse erzielt werden, soll mein neues Buch beantworten.
1. Zielsetzung und Gegenstand des vorliegenden Buches
Was ist aus dem Beispiel Coop aus der Schweiz zu lernen?
Hier hat ein Handelsunternehmen unter Zuhilfenahme von Wasserstoff als Energieträger eine Herausforderung in seiner Logistik, insbesondere des LKW-Verkehrs, bewältigt. Auf diese Weise gelingt es dem Unternehmen, unter weitgehendem Verzicht auf den fossilen Kraftstoff Benzin einen Beitrag zur CO2-Neutralität nicht nur des Unternehmens, sondern damit auch des Standortes Schweiz zu leisten.
Unternehmer und Führungskräfte in Industrie, Handel, Handwerk, Verkehr, Landwirtschaft, öffentlichen Verwaltung und vielen Dienstleistungsbranchen stehen vor ähnlichen Herausforderungen., insbesondere vor zwei Fragen:
Vermag unser Unternehmen andere Unternehmen in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette mit angebotenen Produkten und Dienstleistungen zu unterstützten? Stellt somit die Wasserstoff-Wertschöpfungskette einen neuen Absatzmarkt da, mit dem zukünftig Geld zu verdienen ist?
Vermag unser Unternehmen der eigenen CO
2
-Neutralität näher zu kommen? Inwieweit kann Wasserstoff als Substitut fossiler Energieträger im eigenen Wertschöpfungsprozess eine Rolle spielen?
Das vorliegende Buch versucht im Folgenden, Leser beim Finden von Antworten auf insbesondere diese beiden Fragen zu unterstützen.
Hierzu vermittelt das vorliegende Buch ein fundiertes Hintergrundwissen zu
den möglichen Quellen für Grünen Wasserstoff Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft in
Kapitel 2
,
der gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion durch elektrische Elektrolyse über den Transport bis zur Nutzung in
Kapitel 3
den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten als Energiespeicher, als Rohstoff für die Rückgewinnung von elektrischem Grünen Strom und für die Bereitstellung von Prozesswärme in Industrie, Gewerbe und Gebäuden sowie schließlich für die klimaneutrale Herstellung von synthetischen Kraftstoffen oder Kunststoffen.
.
2. Wasserstoff aus grüner Energie als Lösungsbeitrag zum Klimawandel
2.1 25 Jahre Klima-Konferenzen auf den Punkt gebracht
Über Klima und Klimawandel wird schon seit über einem viertel Jahrhundert ausgiebig diskutiert. Im Jahr 1997 wurden in Kyoto von 160 Staaten die Begrenzungen und Sanktionen protokolliert. Viele sahen die UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen trotz vieler Visionen zum globalen Klimaschutz als gescheitert an, weil es keinen Konsens zu konkreten Maßnahmen gegeben hat. Anlässlich der 21. UN-Klimakonferenz im Jahr 2015 hat man sich über die Auswirkung der Erderwärmung und die möglichen Folgen einer globalen Erwärmung unterhalten.
Es gibt Prognosen, dass bei einer Erwärmung um 5° die weltweiten Gletscher sowie die Polkappen in der Arktis und Antarktis derart stark abschmelzen, dass der Meeresspiegel um einige Meter ansteigen würde. Somit würden viele Städte wie Venedig, viele flache Inseln wie die Malediven, ganze Landstriche wie die Niederlande und sogar die Innenstadtbereiche mancher Großstädte wie New York „absaufen“.
Aus diesem Grund hat man sich ein Ziel von einer Erderwärmung durch den CO2-bedingten Treibhauseffekt von deutlich unter 2°, möglichst 1,5° bis 2050 geeinigt, das sogenannte 1,5°-Ziel. Fast alle Staaten der Erde haben auf der 21. UN-Klimakonferenz 2015 mit dem Übereinkommen von Paris einen Vertrag mit Maßnahmen für einen aktiven Klimaschutz unterzeichnet, nach dem sie Anstrengungen zum Erreichen des 1,5°-Ziels unternehmen wollen. Leider hatte die Weltgemeinschaft bis dahin noch keinen breit akzeptierten Handlungspfad zur Umsetzung gefunden.
Der im Oktober 2018 veröffentlichte IPCC-Sonderbericht kommt allerdings zu dem Ergebnis, das 1,5°-Ziel sei noch erreichbar. Dazu müsste der CO2- Ausstoß der Menschheit noch vor 2030 deutlich zu sinken beginnen und ab etwa dem Jahr 2050 netto null Emissionen erreichen. Ab 2019 sorgte dann die Klimaschutzbewegung „Fridays-for-Future“ mit Greta Thunberg für eine sichtbare Neubelebung. Anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos hat man sich im Jahr 2020 mit den Vertretern der führenden Länder über das Thema Klima und gemeinsame Maßnahmen geeinigt. Klimawandelbedingte Unwetter, wie etwa jenes mit dem Starkregen im Ahrtal, sollen damit zukünftig vermieden werden.
2.2 Wasserstoff als Elixier für das Leben in der Zukunft
„Nichts auf der Welt ist so mächtig, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“Victor Hugo
Insofern war vielleicht bei meinen Studien im Jahr 1986 bei Professor Franz Pischinger auf seinen Versuchsständen in seinem Institut für Verbrennungskraftmaschinen in der Schinkelstraße an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule RWTH Aachen1, oder auch auf der EXPO-Weltausstellung im Jahre 2000 auf dem Gelände der Hannovermesse die richtige Zeit noch nicht gekommen.
Dort hatte BMW eine elegante 7er-Limousine mit einem Wasserstoff-Antrieb vorgestellt. Dieser sollte dann erst mal wieder für 20 Jahre in der Versenkung verschwinden, bis im Jahre 2020 von der deutschen Bundesregierung die Nationale Wasserstoff-Strategie verabschiedet wurde.
Am 10. Juni 2020 war es dann so weit. Unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft BMWi und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF wurde die Nationale Wasserstoff-Strategie NWS verabschiedet2:
Nationale Wasserstoff-Strategie:
Grüner Wasserstoff als Energieträger der Zukunft
Grüner Wasserstoff ist das Erdöl von morgen3. Der flexible Energieträger ist unverzichtbar für die Energiewende und eröffnet deutschen Unternehmen neue Märkte. Mit der Nationalen Wasserstoff-Strategie, ob in der Industrie, im Verkehr oder im Wärmesektor: Wir brauchen grüne Energie in allen Lebensbereichen, um unsere Klimaziele zu erreichen.
Dafür müssen wir die Erneuerbaren auch in die Anwendungsfelder bringen können, die sich schwer oder gar nicht elektrifizieren lassen. Hinzu kommt: Deutschland wird auch in Zukunft auf Energieimporte angewiesen sein.
Aber wir wollen die Abhängigkeit von Lieferanten fossiler Energieträger – Erdgas, Erdöl, Kohle – beenden. Wasserstoff ermöglicht es, grüne Energie aus sonnen- und windreichen Weltregionen zu importieren. Damit können wir gleichzeitig unsere Energieimporte diversifizieren.
Was ist Grüner Wasserstoff?
Grüner Wasserstoff ist der dringend benötigte Baustein für die sogenannte Sektorenkopplung und den Aufbau eines nachhaltigen, globalen Energiesystems auf Grundlage der erneuerbaren Energien.
Grüner Wasserstoff wird – etwa durch Elektrolyse – klimaneutral aus erneuerbarem Strom erzeugt. Die Energie von Sonne und Wind können wir so in einem vielseitig einsetzbaren Energieträger speichern, transportieren und je nach Bedarf einsetzen – etwa in Brennstoffzellen zur Erzeugung von Strom und Wärme oder in Industrieprozessen.
Gemäß dem Motto „Shipping the sunshine“ kann Grüner Wasserstoff in Regionen mit viel Wind, Sonne und Wasser produziert und von dort aus exportiert werden, um den Energiebedarf der Welt zu decken. Der globale Markt für Wasserstofftechnologien entwickelt sich bereits heute dynamisch. Deutsche Unternehmen haben gute Chancen, von diesem Wachstum zu profitieren.
Nationale Wasserstoff-Strategie: Klimaschutz „made in Germany“
Technologien rund um den Grünen Wasserstoff sind daher von höchster Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung im Juni 2020 die Nationale Wasserstoff-Strategie beschlossen. Diese wollen wir nach dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr neu auflegen: noch ambitionierter, noch verbindlicher.
Mit der Nationalen Wasserstoff-Strategie zeigt Deutschland, wie wir mithilfe von Grünem Wasserstoff in Industrie, Verkehr und Energiesystem unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten, die Klimaschutzziele erreichen und neue Märkte erschließen können. Dabei verfolgen wir einen systemischen Ansatz und denken Erzeugung, Transport, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff – einschließlich der internationalen Dimension – zusammen.
Die Nationale Wasserstoff-Strategie verzahnt Klima-, Energie-, Industrie- und Innovationspolitik. Ziel ist es, Deutschland zu einem globalen Vorreiter bei Grünem Wasserstoff zu machen und langfristig die Marktführerschaft bei Wasserstofftechnologien zu erlangen und zu sichern. Klimaschutztechnologien „made in Germany“ sollen zu einem neuen Markenzeichen werden:
Deutsche Forschung und Unternehmen gehören zur Weltspitze bei Wasserstofftechnologien und der Aufbau von komplexen Industrieanlagen ist eine Kernkompetenz unseres Anlagenbaus. Die einmalige Chance, mit unserem Know-How zum Ausstatter einer globalen Energiewende zu werden, gilt es zu nutzen.
Wasserstoffhandel: Partnerschaften in Europa und der Welt
Mithilfe der Forschung werden wir neue strategische Wasserstoff-Partnerschaften in Europa und der Welt aufbauen. Mit Australien und den Staaten des südlichen und westlichen Afrikas beispielsweise legen wir in Demonstrationsprojekten den Grundstein für einen internationalen Wasserstoffhandel. Damit werden neue Exportchancen und Absatzmärkte für innovative Technologieunternehmen aus Deutschland geschaffen.
Eine derartige Wasserstoff-Strategie haben in den vergangenen zwei Jahren auch 20 andere Industriestaaten verabschiedet (Abb. 2.1).
Abb. 2.1: Verabschiedung der nationalen Wasserstoff-Strategien der führenden Industriestaaten
Hiermit sollen die vier wesentlichen Energieverbraucher Verkehr, Industrie, Gewerbe und Gebäudetechnik bis 2050 CO2-neutral werden.
Der Wasserstoff sollte dabei möglichst „grün“ sein, d. h. aus der Kraft der Sonne, des Windes und des Wassers erzeugt werden.
Deutschland sollte mit den Umwelttechnologien bei den Anwendungen im eigenen Land, in Europa und in der gesamten Welt zu einem globalen Vorreiter werden.
Gerade jetzt bietet sich die Möglichkeit für Unternehmen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette den Wandel hin zu Wasserstoff und Nachhaltigkeit mitzugestalten und zu fördern.
Sich frühzeitig aktiv zu beteiligen, heißt auch, sich langfristig im Markt zu etablieren und einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu behalten, oder zu schaffen.
Wie schnell sich dieser Grüne Wasserstoff schon kurzfristig gegenüber klassischen Energieträgern aus fossilen Brennstoffen oder gegenüber der Batterietechnik durchsetzen kann, soll im Folgenden näher beleuchtet werden.
1 Anlässlich einer Praxisarbeit meines eigenen Hauptstudiums im Fach Maschinenbau an der RWTH Aachen
2www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/energiewende-und-nachhaltiges-wirtschaften/nationale-Wasserstoff-Strategie/nationale-Wasserstoff-Strategie_node.html
3 Jules Verne schreib 1874 schon ähnliches in seinem Buch „Die geheimnisvolle Insel“: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern.“
2.3 Die Zutaten für Grünen Wasserstoff
In dem Zusammenhang mit Klima und Umwelt werden zum Thema Energie unterschiedliche Terminologien mit oft gleicher oder ähnlicher Bedeutung verwendet:
umweltfreundliche Energien
nachhaltige Energien
erneuerbare Energien
CO
2
-freie Energien
So wird z. B. in Frankreich CO2-freie Energie mit „umweltfreundlich“ assoziiert. Nach dieser Auffassung ist die Atomenergie, welche in Frankreich zu über 80 % zur Stromerzeugung beiträgt, als umweltfreundlich zu betrachten.
Deutschland hingegen hat seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahre 2011 einen Ausstieg aus der Atomkraft entschieden.
Der Vollständigkeit halber soll auf das Thema CO2-freie Energie aus Atomkraft in Kapitel 2.3.4.3 kurz eingegangen werden.
Im Sinne dieses Buches soll ein Fokus auf diejenigen Energiequellen gelegt werden, welche in den kommenden 10 Jahren voraussichtlich für eine Wasserstoff-Erzeugung in einem professionellen und industriellen Maßstab eine maßgebliche Rolle spielen werden:
Dies sind die bereits ausgereiften Technologien der Energiegewinnung aus:
Sonnenenergie
Windenergie
Wasserkraft
Zu diesen verschiedenen Energiequellen existieren ganze Bücher.
An dieser Stelle soll der Umfang der nachfolgend beschriebenen Hintergrundinformationen als Basis für das Thema
Strom aus nachhaltigen Energien für Grünen Wasserstoff
erfolgen in dem Maßstab „so viel wie gerade nötig“.
2.3.1 Nutzung der Sonnenenergie
Um ein besseres Verständnis zum Thema Sonnenenergie zu entwickeln, soll im Folgenden eine grobe praktische Vorstellung vermittelt werden, was man sich denn darunter vorstellen kann:
Die Erde hat einen Radius von ca. 6.000 km, die Sonne über 600.000 km. In der Sonne fusionieren seit 5 Milliarden Jahren unter sehr hohem Druck und einer Temperatur von über einer Million Grad Celsius in jeder Sekunde 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu dem Edelgas Helium He. Dies entspricht der Leistung von 1 Billiarde – eine 1 mit fünfzehn Nullen – Atomkraftwerken, die seit 5 Mrd. Jahren eine CO2-freie Energie erzeugen.
Von dieser Leistung erreichen etwa 1,5 Trillionen kWh (1,5 x 1018) die Oberfläche der Erde. Die Menge der auf der Erde im Jahr 2020 verbrauchten Energie betrug 150 Milliarden kWh. Die auf die Erde fallende Energiemenge der Sonne entspricht somit mehr als dem 10.000-fachen des Weltenergiebedarfs.
Dies heißt somit im Umkehrschluss ganz einfach: Mit einer Fläche von einem Zehntausendstel der Welt könnte man durch Nutzung der Sonnenenergie den gesamten Energiebedarf decken. Es würde für die ganze Welt, die in der nachfolgenden Abbildung 2.2 mit dem rot markierten Quadrat unterhalb von Spanien markierte Fläche in Nordafrika ausreichen. Für Europa würde das darunter befindliche zweite Quadrat ausreichen. Für die Bundesrepublik Deutschland würden ca. 20 % der für Europa mit dem roten Quadrat EU25-2005 markierten Fläche ausreichen.
Eine Fläche von einem Zehntausendstel von Deutschland wird für die Deckung der deutschen Energie nicht ganz hinkommen, weil der Eintreffwinkel der Lichtstrahlen auf die Erdoberfläche in Nordeuropa deutlich flacher ist als in Afrika. Darüber hinaus gibt es in Deutschland oft viele Wolken. Ein Zehntausendstel der deutschen Fläche von 357,588 km2 wäre somit etwa 35 km2, wegen Eintreffwinken und Wolken kalkulieren wir der Einfachheit halber einmal mit 70 km2 notwendiger Solar-Fläche.
In Deutschland gibt es in Deutschland 700 Städte. Dies sind 80 Großstädte mit 100.000 und mehr Einwohnern und 620 Mittelstädte von 20.000 bis 99.999 Einwohner. Somit würde von der reinen Energie-Leistung her ganz einfach gerechnet 0,1 km2 pro Stadt ausreichen.
Abb. 2.2: Fläche, welche ausreicht, um den Energiebedarf der gesamten Welt4 bzw. von Europa5 mit ausschließlich Sonnenenergie bereitzustellen
Leider gibt es da ein böses Wort – das heißt „Wirkungsgrad-Verlust“. Dies beschreibt den Anteil der Energie, welcher bei dem „Einsammeln der Sonnenenergie mit Solar-Anlagen“, der Umwandlung in Elektrizität, der Speicherung, dem Transport und schließlich der Nutzung – sprich der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft – verloren geht.
Wenn 90 % verloren gehen, d. h. 10 % an reiner nutzbarer Energie am Ende noch übrigbleiben, so muss man am Anfang ganz einfach 10-mal mehr rein stecken, damit am Ende die nötigen 100 % heraus kommen – das wären dann 1 km2 pro Stadt – mit den Gebäudedächern und weiteren Solar-Feldern längs der Autobahnen an sich kein Hexenwerk.
Daher wird Sonnenenergie für die zukünftige Wasserstoff-Versorgung am vielversprechendsten angesehen. Für die Nutzung der Sonnenenergie existieren aktuell ca. 10 verschiedene Technologien. Hiervon werden 2 als „marktreif“ angesehen: Photovoltaik- und Solar-Thermo-Anlagen. Diese beiden werden im Folgenden beschrieben.
4 Das obere rote Quadrat „World 2005“ unterhalb von Spanien
5 Das zweite rote Quadrat „EU 25 2005“
2.3.1.1 Photovoltaik
Die Geschichte der Photovoltaik 6 (PV) beginnt im Jahr 1839, als der zugrundeliegende photoelektrische Effekt durch Alexandre Edmond Becquerel bei Experimenten entdeckt wurde.
Bei Experimenten mit elektrolytischen Zellen, bei denen er je eine Platin-Anode und -Kathode verwendete, maß er den zwischen diesen Elektroden fließenden Strom. Dabei stellte er fest, dass der Strom bei Licht geringfügig größer war als im Dunkeln. Damit entdeckte er die Grundlage der Photovoltaik.
Es dauerte jedoch noch über einhundert Jahre, bis es zu einer Nutzung in der Energieversorgung kam.
Als die USA 1958 erfolgreich den Satelliten Explorer 1 in eine Erdumlaufbahn gebracht hatten, war der zweite Satellit der USA namens Vanguard 1 zur Stromversorgung im All neben einer chemischen Batterie mit Solarzellen zum Betrieb eines Senders an Bord ausgerüstet. Nach langem Zögern seitens der US-Armee hatte sich Solar-Pionier Hans Ziegler aus München mit seiner Idee durchsetzen können, dass eine Energieversorgung mit Solarzellen den Betrieb des Senders länger gewährleisten würde als der Einsatz von Batterien.
Entgegen den Erwartungen der Militärs konnten die Signale des mit Solarzellen betriebenen Senders über sechs Jahre bis Mai 1964 empfangen werden, der batteriebetriebene Sender hatte lediglich drei Monate bis Juni 1958 funktioniert.
Der Erfolg dieses kleinen Satelliten und die daran beteiligten Wissenschaftler legten den Grundstein für die erste sinnvolle Verwendung der bis dahin noch nahezu unbekannten und vor allem sehr teuren Solarzellen.
Für viele Jahre wurden in der Folge Solarzellen vorwiegend für Raumfahrtzwecke weiterentwickelt, da sie sich als ideale Stromversorgung für Satelliten und Raumsonden bewiesen haben. Die dadurch gegenüber dem Batteriebetrieb ermöglichte lange Nutzungsdauer der Raumflugkörper überwog den immer noch hohen Preis der Solarzellen je Kilowattstunde bei Weitem. Darüber hinaus waren und sind Solarzellen gegenüber technischen Alternativen, die ähnlich lange Einsatzzeiten erlauben, billiger und risikoärmer. Die meisten Raumflugkörper wurden und werden daher mit Solarzellen zur Energieversorgung ausgestattet.
Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel, wenn das nächste Energieverbundnetz sehr weit entfernt war, kam es anfangs zu einer Installation von terrestrischen Photovoltaik-Inselanlagen auf dem Erdboden.
Mit der Ölkrise 1973 wurde das Interesse an anderen Energien deutlich stärker. Noch wurden große, zentrale Kernkraftwerke als die beste Lösung für eine flächendeckende Energieversorgung gesehen. Seit Mitte der 1970er-Jahre wurden dann erstmals mehr Solarzellen für terrestrische Zwecke als für den Einsatz in der Raumfahrt hergestellt.
Im Jahr 1983, wurde auf der nordfriesischen Insel Pellworm die erste Photovoltaik-Großanlage Deutschlands mit einer damaligen Gesamtleistung von 0,3 Megawatt errichtet.
1985 erreichte ein Solarpark im Gebiet des Carrizo Plain National Monument in Kalifornien 5,2 MW.
Ab 1991 wurden mit dem Stromeinspeisungsgesetz in Deutschland die Energieversorger dazu verpflichtet, den Strom der kleinen regenerativen Solar-Kraftwerke abzunehmen.
Mitte der 1990er-Jahre gab Greenpeace, nachdem trotz der Fördermaßnahmen entscheidende Teile der Photovoltaik-Produktion aus Deutschland abwanderten, mit einer neuen Studie über Deutschland als Photovoltaik-Standort in diesem Sektor neue Denkanstöße.
Neue Initiativen zur Gründung entsprechender Industriebetriebe gründeten sich, aus denen die Solon AG in Berlin und die Solarfabrik in Freiburg hervorgingen. Später wurde auch die Solarworld AG gegründet und weitere Firmen und Fabriken in diesem Marktsegment entstanden.
Deutschland hat dann im Jahr 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit kostendeckender Vergütung bundesweit eingeführt.
In Deutschland wurden zunächst viele Kleinanlagen unter 5 kW peak (Spitzenleistung) installiert. 2005 ging mit dem Solarpark Bavaria mit 6,3 MW der damals größte Solarpark der Welt in Betrieb. 2006 wurde der Titel der größten Anlage vom Solarfeld Erlasee mit 11,4 MW übernommen.
Im Jahr 2005 erreichte die gesamte Nennleistung der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen 1 Gigawatt, im Jahr 2010 wurde die Grenze von 10 Gigawatt überschritten und Anfang 2012 die 25 Gigawatt. Neben Dachanlagen wurden schließlich auch viele Solarparks mit jeweils einigen MW errichtet. Zum leistungsstärksten deutschen Park wurde 2010 der Solarpark Finsterwalde mit 41 MW. Mitte 2014 wurde die 37-Gigawatt-Grenze überschritten.
Weltweit wurde Mitte 2015 die 200-GW-Marke erreicht.
Im Jahr 2008 lieferten Solarzellen mit erhöhtem Wirkungsgrad mehrere Kilowatt Leistung für Nachrichtensatelliten zu je etwa 150 Watt Sendeleistung. Fast alle der weltweit rund 1.000 Satelliten, die im Einsatz sind, decken ihre Stromversorgung mithilfe von Photovoltaik.
Seit 2015 liegen die größten Solarparks der Welt in Asien: In China in der Nähe der Longyangxia-Talsperre mit 850 MW und eine in der Tengger-Wüste mit 1.547 MW.
Seit 2019 befinden sich die größten Anlagen in Indien: 2019 erreichte der Solarpark Pavagada 2.050 MW, im Jahr 2020 der Solarpark Bhadla 2.245 MW.
Im Jahr 2022 wurde ein Zubau in Deutschland von ca. 7 Gigawatt erreicht.
Bis 2040 könnten nach prognostizierten Szenarien von Energy Charts7 auf Dächern und Freiflächen ca. 300 Gigawatt PV-Leistung in Deutschland installiert werden.
Es gibt inzwischen PV-Module, die älter als 40 Jahre sind und immer noch Strom produzieren. PV-Module verlieren mit der Zeit zwar an Leistung. Das nennt man Degradation. Im Schnitt verliert ein PV-Modul nach ca. 20 Jahren ungefähr 10 % bis 20 % an Leistung. Dies wird zumeist als Leistungsgarantie von den Herstellern zur Obergrenze garantiert.
Folgende Hersteller produzieren in Deutschland 8 , welches einmal die globale Führungsposition innehatte:
ALGATEC SOLAR in Brandenburg
Antec Solar in Thüringen
AxSun Solar in Laupheim-Baustetten
Calyxo in Bitterfeld-Wolfen
Heckert Solar in Chemnitz
SI Module in Freiburg
SOLARA in Hamburg
SOLARWATT in Dresden
Sonnenstromfabrik in Wismar
Solar Fabrik in Laufach
Die aktuelle Auflistung der weltweit 10 größten Hersteller für PV-Module zeigt auf, dass China diese Führungsposition von der BRD übernommen hat:9
Hersteller
Leistung in Gigawatt 2022
• Jinko Solar
China
14,2
• Ja Solar
China
10,3
• Trina Solar
China
9,7
• Lerri Solar Technology
China
9,0
• Canadian Solar
Kanada
8,5
• GCL Technology
China
8,5
• Hanwha Q Cells
Südkorea
7,3
• Risen Energy
China
7,0
• First Solar
USA
5,5
• Shunfeng Photovoltaik
China
4,0
Generell lässt sich sagen, dass chinesische und deutsche Photovoltaik Module beide qualitativ hochwertig sind und es keine Qualitäts-Unterschiede gibt.
Praktische Tipps zum Aufbau der eigenen Solaranlage für Ihr Eigenheim, Ihre Gewerbe-Immobilie, Ihr Unternehmen
Damit Sie als Leser dabei Ihrem eigenen Engagement mit Solaranlagen für Ihr Eigenheim, Ihre Gewerbe-Immobilie mit Bürogebäuden, Produktions- und Lagerhallen oder auch für Ihr gesamtes Unternehmen nicht auf drei- bis vierfach überhöhte Nepp-Preise hereinfallen, erhalten Sie einige wertvolle Ratschläge in dem nachfolgenden
Experten-Interview10 mit Herr Volker Kremer
Herwig: Guten Tag, Herr Kremer. Wie lange kennen Sie sich denn schon mit dem Thema Solar-Energie aus?
Volker Kremer: Ich baue Photovoltaik-Anlagen seit 2007, also das jetzt 16 Jahre für Einfamilienhäuser, Gewerbe-Immobilien und Unternehmen.
Herwig: In den Medien steht, das Thema Photovoltaik würde boomen und manche sagen, man wäre dumm, wenn man aktuell auf sein Einfamilienhaus oder sogar auf die Dachflächen seines kleinen oder mittelständischen Unternehmens für die Energieversorgung keine Solarenergie nutzen würde.
Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell stark gestiegenen Energiepreise. Was meinen Sie hierzu?
Kremer: Ja, dies sehe ich genauso. Gerade als Firma, wo man über den Tag hinweg, wo die Sonne scheint, einen sehr hohen Strombedarf hat, und man ggf. die entsprechende Dachfläche zur Verfügung hat, sollte man eine Solaranlage bauen.
Wenn man den Strom tagsüber selbst verbraucht, und nicht für 8 Cent (ct) pro Kilowattstunde (KWh) einspeisen würde, sondern im Wert von 40 ct/KWh selbst nutzen kann, die man durch den Nichtkauf bei Energieversorger einsparen würde, rentiert sich die Anlage bereits nach Amortisationszeiten von unter 7 Jahren. Ab dann hätten man den Strom dann kostenlos. Daher wäre man im Augenblick recht dumm, eine derartige Möglichkeit nicht zu nutzen.
Herwig: Sie hatten einmal grob überschlagen, man würde monatlich für Abschreibung und Wartung mit Kosten von etwa 100 Euro bei einer Anlagegröße von 10 kWp für ein großes Einfamilienhaus hinkommen.
Dies wären dann deutlich weniger, als die meisten aktuell für ihre monatlichen Stromkosten bei ihrem Energieversorger bezahlen.
Kramer: Wenn man eine solche PV-Anlage für 24.000 Euro über 20 Jahre abschreiben würde, dann wären das 1.200 Euro pro Jahr, so kommt man mit Kosten von etwa 100 Euro pro Monat auf jeden Fall hin.
Herwig: Wäre da der Batteriespeicher schon mit enthalten?
Kremer: Ja, da wären die PV-Module mit einem aktuellen Preis von 400 € pro kWp, also für 10 kWp dann 4.000 €, das Haltesystem mit 2.000 €, die Dachmontage mit 2.500 €, der Wechselrichter mit 2.000 €, Kabel und Stecker mit 500 €, den elektrischen Anschluss mit 2.000 € und auch der Speicher mit 5.000 € alles enthalten. Die Gesamtkosten lägen dann für 10 KWp etwa bei 18.000 €.
Mit der Planung und einem Gewinnaufschlag käme man dann als PV-Anbieter auf den besprochenen Gesamtpreis von 24.000 Euro.
Herwig: Manche PV-Anbieter kalkulieren Service und Wartungskosten von bis zu mehreren hundert Euro je Monat?
Kremer: Solche PV-Anlagen sind nahezu wartungsfrei, die reinigen sich in der Regel durch den Regen von selbst so sauber, dass man diese nie reinigen muss. Gerade bei Einfamilienhäusern, wo die Module auf der schrägen Dachfläche ja in einem Winkel von 30 bis 40 Grad Schrägaufstellung an das Dach montiert werden. Eine Wartung ist in keiner Weise erforderlich.
Vielleicht muss man alle paar Jahre beim Wechselrichter den Filter vom Lüftergehäuse ausklopfen. Ansonsten sind die Anlagen total wartungsfrei und erzeugen somit auch keine Wartungskosten.
Herwig: Es gibt im Augenblick Anbieter im Markt, wie „Solar-P. ….“ D- … aus Hamburg oder Enp…. aus Berlin, welche die Anlagen nicht verkaufen, sondern inclusive Service und Wartung über 20 Jahre vermieten.
Da kommt man zum Teil auf Gesamtbeträge von 70.000 bis 100.000 €. Dort wird oft noch günstig gerechnet, wie „preiswert“ dieses Angebot im Vergleich zu den aktuellen und den zukünftig steigenden Energiekosten ist. Haben Sie auch schon von derartigen Nepp-Angeboten gehört?
Kremer: Ja, diese Nepp-Angebote gibt es überall auf dem Markt. Ich warne auch sehr stark davor. Da sollte man sich doch lieber an einen einzelnen PV-Anbieter wenden und die Anlage selber finanzieren. Das, was dort mit den „Mietangeboten“ angeboten wird, ist oft wirtschaftlich gesehen vollkommener Unsinn.
Es mag vielleicht sein, dass über die Laufzeit von 20 Jahren ein Wechselrichter kaputt geht. Dies ist in Einzelfällen schon vorgekommen. Ich würde eine Wahrscheinlichkeit von etwa 10% dabei sehen.
Und bei den Batteriespeichern hat man auch noch nicht die Erfahrung, wie lange die halten. Vielleicht müssten die dann auch nach 10 Jahren einmal ausgetauscht werden. Aber bis dahin werden die sich weiterentwickelt haben und sicherlich viel günstiger werden. Ansonsten sind notwendige Reparaturen sehr überschaubar. Und der Ausfall von Modulen ist die absolute Seltenheit.
Herwig: Ich hatte mir, um einen Eindruck von den aktuellen Angeboten zu bekommen, mehrere Vertriebsaußendienst-Mitarbeiter von derartigen Firmen zu mir bestellt.
Einer war sogar für eine Leistung von anstatt der von Ihnen kalkulierten 10 kWp für eine kleine Anlage von nur 5,5 kWp auf einen Gesamtpreis von 97.000 € gekommen. Und wenn man nicht sofort unterschreiben würde, würde es vielleicht in 4 Wochen noch teurer und die Einzelteile seien dann wegen den Lieferengpässen nicht mehr lieferbar.
Kremer: Derartige unseriösen Anbieter sollte man sofort bei dem Verbraucherschutzverein melden. Das geht teilweise schon in die Richtung Nötigung. Diese Firmen machen teilweise auch sehr aggressive Werbung in den Medien per E-Mail und SMS, was in dieser Form gar nicht erlaubt ist.
Herwig: Wie viele Anlagen haben Sie in den vergangenen Jahren aufgebaut und wie oft ist davon etwas kaputt gegangen?
Kremer: Das waren weit über 100 Anlagen und es ist in dem Zeitraum nur gerade einmal bei 8 Anlagen ein Schaden aufgetreten.
Herwig: Manche Verkäufer reden von teuren Schadenregulierungen wegen Hagel. Wie oft ist denn das Thema Hagelschaden bei den über 100 Anlagen vorgekommen?
Kremer: Ich habe erst bei einer einzigen Großanlage, die aus 163 Modulen Bestand, einen Hagelschaden gehabt. Damals war der Hagel so massiv, dass von allen Autos im Umfeld die Heckscheiben kaputt gegangen sind. (Die schrägen Windschutzscheiben sind in der Regel deutlich stabiler).
Von dieser Anlage waren jedoch von allen 163 Modulen lediglich 3 zerstört worden. Das war der einzige Hagelschaden, den ich in meiner gesamten Laufbahn als PV-Anlagenbauer mitbekommen habe.
Somit sind bei weniger als 1 % meiner Anlagen in über 16 Jahren 2 % zerstört worden, was somit eine Wahrscheinlichkeit von 0,01 % innerhalb von 10 Jahren ergeben würde. Diese geringen Schadenraten kennen auch die Versicherungen. Eine Hausversicherung kostet vielleicht im Jahr 20 € mehr, wenn man eine PV-Anlage auf das Dach montiert.
Herwig: Man hört in der Branche oft von aktuellen Lieferengpässen?
Kremer: Im Jahr 2022 war der Engpass ganz klar im Bereich Wechselrichter. Insbesondere wenn es in den Bereich Hybridwechselrichter geht. Dies sind Wechselrichter, die auch in der Lage sind, den Strom in einen Speicher umzuleiten, um den Strom dann später zu verwenden. Da waren über manche Zeiträume hinweg derartige Wechselrichter kaum lieferbar. Und noch schlimmer sah es bei den Speichern aus.
Doch diese Lieferfähigkeit von Wechselrichtern und Speichern hat sich Ende 2022 deutlich verbessert. Zurzeit ist der Engpass daher aktuell eher die Man-Power der Dachdecker, da zur Zeit sehr viele Hausbesitzer zu der Einsicht gekommen sind, dass sich eine Photovoltaik-Anlage sehr gut wirtschaftlich rechnet.
Darüber hinaus stellt diese PV-Anlage auch noch eine große Versorgungssicherheit dar, da man im Falle eines Stromausfalls auch noch den Strom zur Verfügung hat. In der aktuellen Situation von Energieverknappung und Hackerangriffen ist ein Blackout ein durchaus hohes Risiko.
Gerade auch aus diesem Grund sind viele Hausbesitzer zu der Erkenntnis gekommen, besser eine PV-Anlage auf Ihr Dach zu bauen. Nach der nun wieder größer gewordenen Lieferbereitschaft der Teile ist die Kapazität der Dachdecker, die die Montage durchführen können, nicht in dem Maße zugewachsen. Somit besteht im Moment bei der Aufbauleistung der größte Engpass.
Herwig: Sie sprachen als Argument für PV-Technik neben der Wirtschaftlichkeit auch das Thema Energie-Autarkie an. Es gibt aktuell immer mehr Hacker-Angriffe. Dies war gerade bei den 80 deutschen IHKs ein Thema, welche im vergangenen Jahr von Anfang August knapp 3 Monate bis Oktober lahmgelegt waren. Was schätzen Sie, wenn so etwas bei den Stromversorgern passieren würde?
Manche sagen, innerhalb von 14 Tagen würde dann das Chaos ausbrechen. Die Lebensmittel verderben im Kühlschrank, der Fernseher funktioniert nicht mehr, das Handy kann nicht mehr aufgeladen werden usw.?
Kremer: Bei einem absoluten Stromausfall glaube ich, dass das Chaos noch viel früher ausbrechen würde.
Viele Leute haben gar nicht im Hinterkopf, dass bei Stromausfall nicht nur das Licht nicht mehr angeht, es fällt auch die Heizung aus, man hat keine Kommunikation mehr, die Kassensysteme in den Läden gehen nicht, die Kraftstoffpumpen an den Tankstellen funktionieren nicht, die Frischwasserpumpen gehen auch nicht – somit wird sicher schon in weniger als einer Woche das Chaos ausbrechen.
Wenn wir mal einen ganz großen Blackout über mehrere Wochen haben sollten, dann kann es doch durchaus sein, dass eine sichere autarke Energieversorgung für das eigene Haus überlebenswichtig werden könnte.
Herwig: Sie selbst haben in Ihrem neuen Haus in Ihre Energie-Autarkie investiert. Für Sie selbst wäre es dann weniger problematisch?
Kremer: Ein Stromausfall wäre für mich gar kein Problem. Zur Not gibt es im Haus auch noch ein Notstrom-Aggregat.
Herwig: Wenn man dann auch noch ein Elektro-Auto hat, um ohne die Tankstellen mobil zu bleiben, um wie viel höher müsste nach Ihrer Erfahrung die Leistung der PV-Anlage sein, um den eigenen PKW in der Hausgarage laden zu können?
Kremer: In diesem Fall muss man sich überlegen, wann steht das Auto zum Laden in der Garage oder vor der Haustür? Wenn man morgens um 7:30 Uhr das Haus auf dem Weg zur Arbeit verlässt und erst um 18 oder 19 Uhr nach Hause kommt, hat man kaum die Möglichkeit, über direkten Solarstrom den Wagen zu laden. In diesem Fall müsste ein wesentlich größerer Speicher her.
Hingegen sieht die Sache anders aus, wenn man einen Zweitwagen zu Hause hat, wo die Frau dann mit zum Einkaufen fährt. Oder wenn man berufsbedingt im Home-Office auch zu Hause ist und den Wagen über Solarstrom laden kann. Dann würde es sicherlich ausreichen, die PV-Anlage um etwa 20% größer zu dimensionieren, um so den Wagen immer laden zu können. Anstatt 5,5 kWp dann eben 7 kWp. Dies ist natürlich dann auch von der jährlichen Fahrleistung abhängig.
Herwig: Denken Sie, dass Wasserstoff als Energiequelle für das Eigenheim in den nächsten 5 Jahren ein Thema werden wird? So etwas eine eigene Wasserstoff-Produktion mit der hauseigenen Elektrolyseanlage, gespeist mit insbesondere dem Überschuss-Strom, um damit dann das Wasserstoff-Auto zu betanken?
Kremer: Bei dem Thema Wasserstoff sind zwei Bereich zu unterscheiden. Zum einen die Energieversorgung des Eigenheims oder des Firmengebäudes, und zum anderen der Bereich Mobilität.
Im Bereich der Versorgung des Eigenheims sind Wasserstoff-Technologien noch sehr teuer und wirtschaftlich ineffizient. Im Bereich der Mobilität sehe ich Wasserstoff erst mal nur für den öffentlichen Nahverkehr als interessant, deutlich, bevor es ein Thema für die Wasserstoff-Betankung in der hauseigenen Garage ein Thema werden wird. Deshalb sehe ich das Thema Wasserstoff in Haushalten in den nächsten 10 Jahren erst mal skeptisch.
Herwig: Was wäre Ihr Abschluss-Statement zum Thema PV?
Kremer: Jeder sollte sich einmal Gedanken machen, ob und wie dieses Thema interessant wäre und es auf Basis der Stromkosten des vergangenen Jahres einmal durchrechnen.
Gerade bei den derzeitig hohen Energiepreisen und den stark gefallenen Kosten für Solar-Energie kann man von kurzfristigen Amortisationszeiten ausgehen.
Herwig: Herzlichen Dank.
Fazit zur Photovoltaik
Die beschriebene PV-Anlage kostet für ein großes Einfamilienhaus mit einer Anlagegröße von 10 kWp etwa 100 € pro Monat.
Für ein Gewerbe-Unternehmen mit dem hundert-fachen Energiebedarf, d.h. 1.000 kWp entspricht dies dann 10.000 € pro Monat.
Für ein industriell produzierendes Unternehmen im Mittelstand mit dem tausend-fachen Energiebedarf von 10.000 kWp fallen dann 100.000 € pro Monat an Kosten an.
Durch die sogenannten Economies of Scale, die Größenvorteile wird dies voraussichtlich noch deutlich niedriger sein.
Dies bedeutet, dass PV-Lösungen schon jetzt auch für jegliche Unternehmen deutlich günstiger sind, als herkömmliche Bezugsquellen.
Aus diesem Grund sollte man sich bereits in 2023 mit diesem Thema beschäftigen und keine unnötige Zeit verstreichen lassen.
6 Die Geschichte der Photovoltaik, Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Photovoltaik
7https://www.energy-charts.info/charts/installed_power/
8 Quelle: Solar.red
9 Quelle: Statista (Stand 2020)
10 In diesem Buch sind zur besseren Unterscheidung ALLE persönlichen Experten-Interviews von der Begrüßung bis zur Verabschiedung in der Schriftart Times New Roman dargestellt. Zur besseren Abgrenzung der oft unterschiedlichen Gedankengänge bei neuen Fragenstellungen sind die Fragen jeweils komplett fett dargestellt.





























