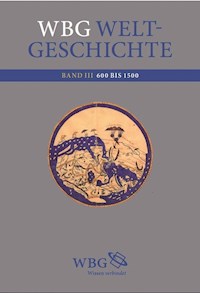
wbg Weltgeschichte Bd. III E-Book
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: wbg Academic
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die ›WBG Weltgeschichte‹ betrachtet – im Gegensatz zu bisherigen weltgeschichtlichen Darstellungen – die gesamte Menschheitsgeschichte erstmals unter dem Aspekt der globalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten und bietet so einen modernen und zeitgemäßen Gesamtüberblick. Wer etwas über die Geschichte der Menschen auf dem Planeten Erde unter Berücksichtigung aller Zeiten und Kulturen erfahren möchte, kommt an diesem Werk, an dem bedeutende deutsche Fachvertreter der Geschichtswissenschaften mitgewirkt haben, nicht vorbei: »Sowohl ein universitärer Leserkreis als auch ein breiteres Publikum finden hier wichtige lesenswerte Darstellungen zu großen welthistorischen Themen des 19. und 20. Jahrhunderts« Historische Zeitschrift
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 998
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
WBG WELTGESCHICHTE
EINE GLOBALE GESCHICHTEVON DEN ANFÄNGEN BIS INS 21. JAHRHUNDERT
Herausgegeben vonWalter Demel, Johannes Fried, Ernst-Dieter Hehl,Albrecht Jockenhövel, Gustav Adolf Lehmann,Helwig Schmidt-Glintzer und Hans-Ulrich Thamer
In Verbindung mit derAkademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
WBG WELTGESCHICHTE
EINE GLOBALE GESCHICHTEVON DEN ANFÄNGEN BIS INS 21. JAHRHUNDERT
Band IIIWeltdeutungen und Weltreligionen600 bis 1500
Herausgegeben vonJohannes FriedundErnst-Dieter Hehl
Impressum
Redaktion: Britta Henning
Abbildungsnachweis:S. 115, 251, 259 akg-images;S. 289, 293, 413 Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz;S. 145 Bridgeman Art Library;S. 61, 630., 690., 81 aus E. Edson/E. Savage-Smith/A.-D.von den Brincken: Der mittelalterliche Kosmos. Karten der christlichen undislamischen Welt, Darmstadt 2005;S. 11, 217 aus: Europa im Weltbild des Mittelalters.Kartographische Konzepte, hrsg. von I. Baumgärtner und H. Kugler, Berlin2008;S. 41 aus H.-J. Kotzur/B. Klein: Die Kreuzzüge: Kein Krieg ist heilig, Mainz2004;S. 15, 71, 79, 173, 343, 443 picture-alliance;S. 63u., 69u., 123 J. Schreiber;Karten: Peter Palm, Berlin.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung inund Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Sonderausgabe 2015© 2015, 2., durchgesehene Auflage1. Auflage 2009/2010Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitgliederder WBG ermöglicht.Satz: SatzWeise GmbH, TrierUmschlaggestaltung: Finken & Bumiller, StuttgartUmschlagmotiv: Weltkarte des al-Idrisi.Kopie von 1456. Bodleian Library, Oxford
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-26749-1
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-534-74038-3eBook (epub): 978-3-534-74039-0
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zu den Herausgebern
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Einleitung(Ernst-Dieter Hehl)
Die Vielfalt der Welt
Kommunikation – Handel, Kunst und Wissenstausch(Michael Borgolte)
Die Transversale der Oikumene – Indischer Ozean und Mittelmeer
Der Verkehr auf innerasiatischen und europäischen Straßen
Der geheimnisvolle dritte Kontinent
Waren und Wissen im Gepäck – Händler und Gesandte, Pilger und Gelehrte
Das „Gold“ von Byzanz in den Münzstätten der Araber und Lateiner
Weltbild, Kartographie und geographische Kenntnisse(Ingrid Baumgärtner, Stefan Schröder)
Antike Grundlagen und mittelalterliche Weltkunde
Die Multifunktionalität des Mediums
Neue Visualisierungen des Raumes – Regional- und Portulankarten
Erweiterung und Erneuerung des eurozentrischen Weltbildes
Die religiöse Vielfalt Asiens(Hubert Seiwert)
Die „Weltreligionen“ zwischen 600 und 1500
Die hinduistische Tradition Indiens
Der Buddhismus in Süd- und Südostasien
China und Japan
Afrika südlich der Sahara – Von den Sakralstaaten zu den Großreichen(Dierk Lange)
Staatengründungen südlich der Sahara
Bildung der subsaharanischen Reiche
Islamisierung und imperiale Machtentfaltung
Religion, Politik und die Geburt des Islam(Lutz Berger)
Lokalkulturen und Akkulturationstendenzen im spätantiken Arabien
Die politische Transformation der altarabischen Stammesgesellschaft
Die Geburt des Islam
Die Jüdische Diaspora(Eva Haverkamp)
Juden im Byzantinischen Reich
Juden unter islamischer Herrschaft
Juden im westlichen christlichen Europa
Die Ordnung der Welt
Islamische Reichsbildungen(Anna Akasoy)
Staatsbildung und Expansion
Reichsbildung
Die Abbasiden und das Auseinanderbrechen der islamischen Welt
Die Kreuzzüge(Nikolas Jaspert)
Zielgebiete und Verlauf
Voraussetzungen – Organisation – Reaktionen
Folgen
Nomaden zwischen Asien, Europa und dem Mittleren Osten(Felicitas Schmieder)
Früh- und hochmittelalterliche Steppenreiche
Die Reichsbildung der Mongolen (ca. 1200 bis Mitte 14. Jahrhundert)
Das Mongolenreich als kulturvernetzender Faktor der Weltgeschichte
Europa – Universalität und regionale Vielfalt(Klaus Herbers)
Herrschaftsordnungen im christlichen Bereich um 600
Universale und partikulare Konzeptionen im 8. und 9. Jahrhundert
Kaisertum und Papsttum im hohen Mittelalter
Die Königreiche im Hochmittelalter – Entwicklung, Verdichtung, Varianz
Höhepunkt und Krise des Kaiser- und Papsttums im 13. Jahrhundert
Veränderungen und Verdichtungsprozesse im späten Mittelalter
Muslimische Herrschaftsordnung und Herrschaftsverdichtung(Lutz Berger)
Herrschaft, Identität und Raum
Militärische Machtmittel und finanzielle Grundlagen
Herrschaft und Gemeinschaft
Das mittlere und östliche Asien(Achim Mittag)
Das aristokratische Kaiserreich der Sui- und Tang-Dynastien
Die Song-Dynastie und die Erobererdynastien Liao und Jin
Das mongolische Weltreich und die Ming-Dynastie
Der Indische Subkontinent(Annette Schmiedchen)
Das frühe Mittelalter in Indien (ca. 550–1206)
Das späte Mittelalter in Indien (1206–1526)
Konvergenz und Divergenz politischer und religiöser Herrschaft(Franz-Reiner Erkens)
Konvergenz
Umschwung
Divergenz
Außereuropäische Verhältnisse
Die Städte(Alfred Haverkamp)
„Die Stadt“ – „Die Städte“ – Konzeptionen
Kulturlandschaften
Vergleichende Perspektiven
Die Deutung der Welt
Wege zum Heil – China und Ostasien(Helwig Schmidt-Glintzer)
Vielfalt der Lehren, Mönche, Laien und die Rolle des Staates
Die Ausprägung des Buddhismus in Korea und Japan
Endzeitvorstellungen und das Mitleid des Bodhisattva
Heilsziele und Heilswege in Indien(Walter Slaje)
Religion in Indien
Grundkonzeptionen des Erlösungsgedankens
Theologie, Recht und Philosophie im Islam(Anna Akasoy)
Sunniten und Schiiten
Der Sufismus
Wege zum Heil in der christlichen Kultur des Mittelalters(Gert Melville)
Der uranfängliche Verlust des Heils
Göttliches Handeln zur Wiedererlangung des Heils
Individuelles Handeln zur Wiedererlangung des Heils
Kirche als Vermittlungsinstitution des Heils
Kognitive Ordnungen im lateinischen Mittelalter(Matthias Lutz-Bachmann, Alexander Fidora)
Die artes liberales – Das Erbe der Antike und Patristik
Wandel von den artes zur divisio philosophiae im 12. Jahrhundert
Wissenschaft und Weisheit – Wissenschaften vom 13. bis 14. Jahrhundert
Verwissenschaftlichung und Rationalität(Volkhard Huth)
Zur Genealogie des Wissens im Mittelalter – Entwürfe und Entwicklungen
Wissensgut und Wissensvermittlung
Vernunftvorrang und Naturerschließung
Emanzipation der Wissenschaft
Ausblick(Ernst-Dieter Hehl)
Literaturverzeichnis
Chronologie
Register
Einleitung
Ernst-Dieter Hehl
„Mittelalter“
Das westliche Geschichtsbild versteht den Zeitraum, dem sich dieser Band der Weltgeschichte widmet, meist als „Mittelalter“. Ein Begriff, der auf die Abgrenzung einer europäischen Neuzeit von den vorausgehenden Jahrhunderten, auf deren neuartige Rückbindung an die antike Welt des Mittelmeerraums zielt, kann jedoch nicht als Leitfaden für eine weltgeschichtliche Darstellung dienen. Weder das Bewusstsein der historischen Kontinuität, in der mit Bezug auf das Römische Reich sich das oströmisch-byzantinische Reich bis zu seinem Untergang 1453 sah, noch die Entstehung der islamischen Welt im 7. Jahrhundert lassen sich mit der Vorstellung von einer mittleren Zeit fassen, der eine neue und erfüllte folgt, sie taugt nur als chronologische Chiffre.
Dreiteilung der Welt
Drei Ereignisketten können den fast tausendjährigen Zeitraum strukturieren. An ihnen lässt sich ein grundlegender Wandel zu der vorausgehenden Epoche erkennen, deren kulturelle und geographische Pole der Mittelmeerraum zusammen mit dem Vorderen Orient sowie der Ferne Osten bildete. Diese gleichsam zweigeteilte Welt wird im 7. und 8. Jahrhundert zu einer dreigeteilten, denn mit dem Islam tritt eine weit ausstrahlende Kultur in Erscheinung, die sich zwar variabel, aber doch stabil politisch etabliert. Vom Westen der südlichen Mittelmeerküste bis in das nördliche Indien und in zentralasiatische Gebiete erstreckt sich der islamische Herrschafts- und Einflussbereich. Es ist ein größerer Kultur- und Herrschaftsraum, als Alexander der Große zu schaffen vermochte, und er erlangte Dauer. Europa, speziell das lateinischwestliche, befand sich in einer Randlage. Sein Ausgreifen in den Vorderen Orient im Zeichen der Kreuzzüge blieb Episode. Im 13. Jahrhundert schlugen die Mongolen unter Dschingis Khan und seinen Erben eine Brücke zwischen dem Fernen und dem Nahen Osten. Ihr Reich dürfte das größte sein, das sich bisher in der Welt überhaupt gebildet hat. Seine weitere Ausdehnung ist an den muslimischen Mamluken Ägyptens gescheitert. Zwischen 1200 und 1300 scheint die alte Welt stärker vernetzt gewesen zu sein als jemals zuvor. Erst mit ihren Entdeckungsfahrten gewannen die Europäer seit dem 15. Jahrhundert maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Welt. Das geschah jedoch nicht deshalb, weil sie das politische Übergewicht über die Muslime gewonnen hatten. Diese fanden vielmehr nach dem Zerfall des Mongolenreichs unter den Osmanen zu neuer, bis in das 18. Jahrhundert andauernder Stärke. Allein im westlichen Mittelmeerraum hatten die christlichen Mächte durch die Erfolge der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel, gipfelnd in der Eroberung Granadas (1492), die Oberhand gewonnen. Von dort aus versuchten sie den muslimischen Machtkomplex zu umgehen, indem sie den Weg nach Indien und in den Fernen Osten über das Meer suchten. Gefunden haben sie gleichzeitig einen neuen Kontinent: Amerika.
Großräumige Vernetzungen
Der Islam und die Mongolen sind im „Mittelalter“ die eigentlichen Träger einer politisch großräumigen Vernetzung. Diesen Zeitraum aus einer überwiegend europäischen Perspektive zu betrachten, führt in die Irre. Deshalb sollen im vorliegenden Band vielmehr die Eigenständigkeiten der muslimischen und asiatischen Reiche und Kulturen herausgestellt werden. Einleitend zu behandeln ist aber auch die Vielfalt des Christentums. Gerade auf Grund dieser Vielfalt, die oft nicht auf einer politischen Machtbasis aufbaute, stellten auch die Christen ein „globales“ Element des Mittelalters dar. Ohne politische Machtbasis waren auch die Juden in ihrer Diaspora; der Buddhismus entfaltete in China seine Wirksamkeit, ohne zur „Staatsreligion“ zu werden.
Die christlichen Welten
Das Christentum gilt heute als religiöses Kennzeichen der westlichen Welt; auch in seinen säkularisierten Erscheinungsformen übt es immer noch entscheidende Einflüsse auf diese aus. Der Blick richtet sich dabei sowohl auf die römisch-lateinische Form des Christentums, die sich unter der Leitung des Papsttums als römisch-katholische Kirche organisiert, als auch auf die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts aus dieser hervorgegangenen Kirchen und Glaubensströmungen. Der historischen Vielgestalt des Christentums trägt diese religiös grundierte Konstruktion einer westlichen Welt wenig Rechnung. Kaum berücksichtigt werden die griechisch-orthodoxen Kirchen und ihre Entsprechungen im östlichen Europa. Ignoriert wird die seit der Spätantike kontinuierliche Existenz christlicher Staaten und ihrer Kirche wie Georgien, Äthiopien und in gewissem Maße auch Armenien; übergangen werden die syrisch-orientalischen Kirchen mit ihrer langen Geschichte.
Warum sich aber eine solche Gleichsetzung des Westens mit der lateinischen Form des Christentums und seinen Ableitungen vornehmen lässt, ist in Entwicklungen begründet, die vom 7. bis 15. Jahrhundert stattfanden. Denn am Ende des 15. Jahrhunderts war allein die lateinische Kirche in den Staaten etabliert, von denen die Entdeckungsfahrten, die europäische Expansion und damit die Herausbildung der westlichen Welt ausgingen. Neben Portugal und Spanien, den anfänglichen Trägern dieses Ausgreifens, traten dann seit dem 16. und 17. Jahrhundert das reformierte Holland und vor allem England, dessen Hochkirche und reformierte Kirche sich aus der römisch-lateinischen Kirche gelöst hatten. Die griechisch-orthodoxe Kirche hatte mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 das östliche christliche Kaisertum als staatlichen Bezugspunkt verloren. Über den russischen Raum und seine Kirche erstreckte sich bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts die Vorherrschaft der Goldenen Horde. Dieses mongolische Reich bekannte sich im frühen 14. Jahrhundert zum Islam. Sowohl unter dem Nowgoroder Großfürsten Alexander Newskij (†1263) als auch unter dem sich aus der mongolischen Vorherrschaft lösenden Großfürstentum Moskau ist eine kirchliche Abgrenzung vom Westen zu beobachten. Die Politik der Großfürsten selbst zielt auf die „Sammlung der russischen Erde“, die Expansion in der Frühen Neuzeit ist nach Osten gerichtet und kontinental bestimmt. Deshalb hat die russische Kirche einen geringen Anteil an der Entwicklung des Christentums zu einer weltumspannenden Religion. Geographische Lage, politische Umstände und eigene Tradition haben die russische Kirche auf ihre kontinentalen Nachbarn ausgerichtet.
Die Ausbreitung des Christentums.
Bereits mit der frühen Expansion des Islam im 7. Jahrhundert hatten die Christen des Vorderen Orients, Ägyptens und Nordafrikas ihren Rückhalt bei einer christlichen Herrschaft eingebüßt. Bis zu den wachsenden Erfolgen der Reconquista seit dem 11. Jahrhundert galt das auch für den größten Teil der Christen auf der Iberischen Halbinsel. So sind es vor allem politische Faktoren, wegen derer die westlich-lateinische Kirche und Christenheit zum religiösen Kennzeichen von Verwestlichung und Globalisierung geworden sind. Dass sich die lateinische und die griechische Kirche zunehmend auseinanderlebten und sich schließlich endgültig voneinander trennten, verstärkte diese Entwicklung. Als die Lateiner 1204 auf dem Vierten Kreuzzug Konstantinopel eroberten, zerstörten sie nämlich gleichzeitig die Möglichkeit, die 1054 zerbrochene Einheit wiederherzustellen, was früher bei den lateinisch-griechischen Auseinandersetzungen immer wieder gelungen war. Im heutigen Geschichtsbewusstsein ist jedenfalls die Vorstellung von der Vielgestalt, die das Christentum in der Spätantike gewonnen hatte und mancherorts bis in die Gegenwart bewahren konnte, weitgehend verloren gegangen.
600 als Epoche
Um das Jahr 600, mit dem dieser Band der »Weltgeschichte« einsetzt, zeigt sich eine doppelte Entwicklung: Die westlich-lateinische Christenheit gewann neue Einheitlichkeit, während für den Osten christliche Vielfalt charakteristisch blieb. Politische und dogmatische Entwicklungen stehen dahinter. Die Restaurationspolitik des römischen Kaisers Justinian hatte mit dem nordafrikanischen Reich der Vandalen und dem Ostgotenreich in Italien zwei der germanischen Königreiche besiegt, die auf dem Boden des Imperiums entstanden waren und der arianischen Richtung des Christentums folgten. Nachdem das Konzil von Nicäa 325 diese Lehre verurteilt und sich in einem längeren Prozess die Lehre der Wesensgleichheit von Gottvater und Gottsohn im Imperium durchgesetzt hatte, markierte der Gegensatz Arianismus – Orthodoxie eine Grenze zwischen germanischer und romanischer Bevölkerung. An der Wende vom 5. zum 6. Jahrhunderts hatten sich die Franken unter Chlodwig direkt der katholischen Form des Christentums zugewandt, am Ende des 6. Jahrhunderts traten der westgotische König und sein Reich vom Arianismus zum Katholizismus über. Die Langobarden, die in das Machtvakuum Italiens eingedrungen waren, schwankten einige Zeit zwischen arianischem und katholischem Christentum, bis auch sie sich auf Dauer zum Katholizismus bekannten. In der Mitte des 7. Jahrhunderts waren die arianischen Formen des Christentums erloschen. Der lateinische Westen folgte mit dem Katholizismus der Form des Christentums, die auch die Reichskirche des Ostens prägte.
Probleme der Reichskirche
Hier gestalteten sich die Verhältnisse schwieriger. Christologische Auseinandersetzungen erschütterten Kirche und Reich im Osten. Wenn Christus Gott sei, in welchem Verhältnis standen dann seine menschliche und göttliche Natur zueinander? Das waren auch Diskussionen darüber, mit welchen Methoden die biblischen Texte zu interpretieren seien. Folgte man in Antiochia einer eher wörtlichen Interpretation und betonte die menschliche Natur Christi, so ließ die theologische Schule des ägyptischen Alexandria die menschliche Natur Christi gleichsam in der göttlichen aufgehen. Diese theologischen Auseinandersetzungen verknüpften sich mit einer Rivalität zwischen den Patriarchatssitzen von Antiochia und Alexandria. Der Patriarch von Konstantinopel wurde als geistlicher Führer der Reichshauptstadt in diese Konflikte einbezogen, der Kaiser wollte ihnen steuern, um die religiöse Einheit des Reiches zu bewahren. Dem Konzil von Chalkedon (451) gelang es nicht, den Konflikt zu beenden, als es die Gleichrangigkeit und Unvermischtheit der göttlichen und menschlichen Natur Christi feststellte. In Ägypten bildeten sich zwei rivalisierende Kirchen, von denen die eine der chalkedonensischen Lehre folgte und deshalb der Reichskirche zuzählen ist, während die andere an ihrer älteren Theologie festhielt, was nun als Monophysitismus (Einnaturenlehre) gebrandmarkt wurde. Die antiochenische Theologie fand eine neue Heimstatt bei den syrischen Christen außerhalb des Reiches, die sich zunehmend an den Lehren des Patriarchen Nestorius von Konstantinopel orientierten, den das Konzil von Ephesos 431 als führenden Kopf der antiochenischen Christologie verurteilt hatte. Für die Religionspolitik des Imperiums spielten diese „Nestorianer“ eine nur untergeordnete Rolle. In der syrischen Christenheit stand ihnen in der syrisch-orthodoxen Kirche eine monophysitisch orientierte Glaubensgemeinschaft (Jakobiten) gegenüber. Die „Monophysiten“ Ägyptens in die Reichskirche zu integrieren, gelang jedoch nicht. Glaubensformeln, mit denen der Kaiser und die östliche Reichskirche einen Ausgleich vermitteln wollten, scheiterten nicht nur, sondern führten auch zu heftigen Konflikten mit der westlich-lateinischen Kirche, die strikt an den Definitionen von Chalkedon festhielt.
Christentum und islamische Expansion
Die Entstehung des Islam und die blitzartige Ausbreitung islamischer Herrschaft unter den ersten Kalifen hatten für das Christentum unterschiedliche Konsequenzen. Nur auf der Arabischen Halbinsel führten sie zu einem Ende des christlichen Glaubens sowie des Judentums; hier duldete der Islam keine Religion neben sich. Außerhalb ihres Kernlandes verzichteten die arabischen Eroberer jedoch auf die gewaltsame Ausbreitung ihres Glaubens unter Juden und Christen, denen als „Schriftbesitzer“ zwar ein minderer Rechtsstatus zugewiesen, doch gleichzeitig Schutz gewährt wurde. Vor allem die monophysitischen Christen waren durch die islamische Herrschaftsbildung den Repressionen durch die Reichskirche entzogen und unterstanden nun einer gegenüber den innerchristlichen Streitpunkten neutralen Herrschaft. In ihrem Kernland Ägypten sicherten sie sich das Übergewicht gegenüber den Anhängern der chalkedonensischen Reichskirche (Melkiten). In Alexandria herrschte ein Schisma unter den ägyptischen Christen an, hier residierten zeitweise zwei Patriarchen, ein koptischer (monophysitischer), der 1077 seinen Sitz in die fatimidische Hauptstadt Kairo verlegte, und ein melkitischer. Der melkitische Patriarch stellte bis in das 14. Jahrhundert das diplomatische Bindeglied der in Ägypten jeweils herrschenden Muslime zum byzantinischen Kaiser dar; der koptische war politisch bedeutsam, weil die Christen Numidiens und Äthiopiens in ihm ihr geistliches Oberhaupt sahen. Für die Nestorianer wechselte nur die Religionszugehörigkeit der Herrschaftsträger. In Ägypten und dem Vorderen Orient einschließlich des Zweistromlandes bedeutete die Errichtung der islamischen Herrschaft kein Ende des Christentums. Doch waren die Christen der Versuchung ausgesetzt, sich durch den Übertritt zum Islam einen rechtlich besseren Status zu verschaffen, und unterlagen politisch und religiös bedingten Schwankungen in der Religionspolitik ihrer Herren, die sich auch in einem rabiaten Vorgehen gegen nichtmuslimische Untertanen äußern konnten.
In diese Zusammenhänge gehört die Zerstörung der Grabeskirche in Jerusalem, die der fatimidische Kalif al-Hākim 1009 verfügte. Sie ist wohl aus innerägyptischen Spannungen zwischen der ismaelitisch-schiitischen Führungsschicht und den Sunniten, die die Mehrheit der muslimischen Bevölkerung stellte, und damit überhaupt in die Spaltung des Kalifats der damaligen Zeit (sunnitsch-abbasidisch in Bagdad; schiitisch-fatimidisch in Kairo, 969–1171; sunnitsch-omaijadisch in Córdoba, 929–1031) einzuordnen sowie in den schlichten Finanzbedarf des Kalifen, dem auch jüdische Einrichtungen ihren Tribut zu zollen hatten. Mit einer grundsätzlichen Christenfeindschaft hat das wenig zu tun; al-Hākim selbst beendete 1019 diese Repressalien. Seine guten Beziehungen zum byzantinischen Kaiser, der sich weiterhin als Schutzherr der Christen in den an die Muslime verlorenen Gebieten des Imperiums fühlte, wurden durch die Verfolgungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt.
Islamische Welten um 1300.
Asien
Das nestorianische Christentum erlebte unter muslimischer Oberherrschaft für mehrere Jahrhunderte seine Blütezeit. Sein Oberhaupt Timotheus I. (780–823) hatte seine Residenz nach Bagdad, an den Sitz des Kalifen verlegt. Nestorianische Christen hatten durch Übersetzungen griechischer Philosophen, wie Aristoteles, und Wissenschaftler erheblichen Anteil an der Rezeption antiken Wissens durch die Muslime, die in diesem Bereich seit dem 12. Jahrhundert verstärkt auf die westlich-lateinische Christenheit einwirkten. Bagdad schließlich wurde zum Zentrum der Ausbreitung des nestorianischen Christentums bis nach China. Erst der Übertritt der mongolischen Ilkhane zum Islam beendete die Blüte des nestorianischen Christentums im nördlichen Syrien und im Zweistromland. Im heutigen Grenzgebiet von Syrien, Irak und Iran hat es als „Apostolische Kirche des Ostens“ bis heute überlebt. In Zentralasien ist es den Feldzügen Timurs (Tamerlan, gest. 1405) zum Opfer gefallen, seine indischen Niederlassungen an der Malabarküste (Thomaschristen) haben sich im 16. Jahrhundert den Portugiesen und damit der römischen Kirche angeschlossen. Spuren der missionarischen Bemühungen der Dominikaner aus dem 14. Jahrhundert fanden die Portugiesen nicht mehr vor, jedoch erschien ihnen die auf Syrisch verfasste religiöse Literatur der Thomaschristen so häretisch zu sein, dass sie diese zum größten Teil vernichten ließen. Den Missionserfolgen der römischen Kirche, die vor allem den neuen Orden der Dominikaner und Franziskaner zu verdanken waren, hatte in China die Beseitigung der mongolischen Herrschaft und die Etablierung der Ming-Dynastie (1368) ein Ende bereitet. Im westlichen und inneren Asien überlebten sie nicht die Eroberungszüge Timurs. Auf der Krim, im genuesischen Caffa, bestand bis zur Eroberung der Stadt durch die Osmanen (1475) ein katholisches Bistum, das zum Ausgangspunkt neuer missionarischer Bemühungen hätte werden können.
Afrika
Das am oberen Nil in Nubien und Äthiopien existierende Christentum ist in seinen Glaubensinhalten von den monophysitischen Christen Ägyptens beeinflusst worden und blieb organisatorisch deren Patriarchen verbunden Die Mamluken haben seit dem 13. Jahrhundert die nubischen Herrschaftsbildungen zunehmend bedrängt, die dann im 14. Jahrhundert zerfallen sind und islamisiert wurden. Äthiopien hingegen konnte sich als christlicher Staat behaupten und im 14. Jahrhundert sogar eine expansive Politik gegenüber seinen muslimischen Nachbarn betreiben. Im frühen 16. Jahrhundert fand es in den Portugiesen einen christlichen Bundesgenossen. In Nordafrika ist das Christentum in einem längeren Prozess untergegangen. Eine Zeitlang hatten hier melkitische Flüchtlinge vor den Arabern Zuflucht gefunden, unter ihnen Maximus der Bekenner (†662), einer der heftigsten Kritiker der auf Ausgleich zwischen den Anhängern und Gegnern Chalkedons zielenden Religionspolitik Kaiser Herakleios’ und seiner Nachfolger. Der Zusammenbruch dieser Kirche ist überraschend und kaum rekonstruierbar. Bis in das 12. Jahrhundert lassen sich Bischöfe in Nordafrika nachweisen, die letzten Spuren eines autochthonen Christentums verschwinden nach 1400.
Spanien
Auf der Iberischen Halbinsel, die 711 von der muslimischen Expansion erreicht wurde, ist das Christentum nach dem Untergang des Westgotenreichs unter der neuen muslimischen Herrschaft nie verschwunden. Unter muslimischem Schutz wurde hier vielmehr die christologische Debatte fortgeführt, die das Geschick der östlichen Christenheit nach Chalkedon bestimmt hatte. Von Toledo ausgehende Vorstellungen, Christus sei der Adoptivsohn Gottvaters, bedeuten einerseits eine Annäherung an den strengen Monotheismus des Islam, andererseits bezeugen sie das fortbestehende theologische Interesse und die intellektuellen Kapazitäten der spanischen Christenheit. Für Karl den Großen, den Frankenherrscher, boten diese Lehren hingegen den Anlass, sich als Hüter der katholischen Orthodoxie zu erweisen.
Rolle der Patriarchen
Der islamischen Expansion und Herrschaft kommt nicht allein Bedeutung für die Christen der jeweiligen Regionen zu. Es steigerte sich nämlich gleichzeitig die Bedeutung der beiden Patriarchensitze, die von dieser Expansion nicht erreicht wurden. Sowohl Rom als auch Konstantinopel wurden nun zu den unbestrittenen Führern der chalkedonensisch orientierten Christenheit, sie allein verfügten über autonome Handlungsmöglichkeiten, wobei der Patriarch von Konstantinopel weiterhin in die kaiserliche Politik eingebunden war. Die Patriarchen von Antiochia und Alexandria hatten ihre gesamtkirchliche Kompetenz eingebüßt, die gerade ihrem Amtsbruder in Konstantinopel in den religiösen Streitigkeiten seit dem 4. Jahrhundert so große Schwierigkeiten gemacht hatte. In der westlich-lateinischen Christenheit war mit Nordafrika ein wichtiges Zentrum theologischer Reflexion verloren gegangen und eine Kirche zur Wirkungslosigkeit verurteilt, die gegenüber dem Zentralismus der römischen Kirche wiederholt auf ihrer Eigenständigkeit und der Notwendigkeit des gleichberechtigten Zusammenwirkens bestanden hatte.
Griechen und Lateiner
Der Patriarch von Konstantinopel hatte in der Hauptstadt des Imperiums seinen Sitz, seine kirchliche Politik musste Rücksicht auf den Kaiser nehmen. Der Patriarch des Westens, der römische Bischof, residierte hingegen am Rande des politischen Zentrums der lateinischen Welt, wo Italien an Bedeutung verloren und sich mit dem Aufstieg der Franken und dem Kaisertum Karls des Großen (800) der Schwerpunkt nach Norden verlagert hatte. Als die ostfränkisch-deutschen Könige seit Otto dem Großen das westliche Kaisertum (962) auf Dauer in ihren Besitz brachten, hat sich an dieser Randlage nichts geändert. Die römischen Bischöfe und Päpste konnten somit unabhängiger agieren als ihr Gegenüber in Konstantinopel. Gingen diese von einer Gleichberechtigung der Patriarchensitze aus, wobei sie unter den östlichen nach der muslimischen Expansion auch faktisch einen Vorrang besaßen, so hielt der römische Bischof als Nachfolger auf dem Bischofsstuhl des heiligen Petrus an dem Primat seiner Kirche und ihrer Bischöfe, der Päpste, fest. Theologisch begründet wurde dieser Primatsanspruch zudem damit, dass die römische Kirche niemals geirrt habe oder vom wahren Glauben abgefallen sei. Unterschiedliche Lehrmeinungen sind auf diese Weise zu einem Mittel der Auseinandersetzung geworden. Geringfügige Unterschiede in der Formulierung des Glaubens und im liturgischen Vollzug ließen sich als Beleg für Häresie und Glaubensabfall werten. Politische Konflikte zwischen Rom und Konstantinopel ließen sich religiös überhöhen.
Konkrete Konflikte bestanden seit dem frühen 8. Jahrhundert, als der Kaiser das Illyricum dem Papst entzog und dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellte, ebenso mit Süditalien und Sizilien die Regionen Italiens, in denen Byzanz damals eine noch unangefochtene Herrschaft ausübte. Im 9. Jahrhundert verband sich der Streit um das Illyricum mit dem Problem, ob die Bulgaren von Rom oder von Konstantinopel aus zu missionieren und diesen Patriarchaten zuzuordnen seien. In diesen Streitigkeiten warfen sich die beiden Kirchen ihre unterschiedlichen Bräuche vor. Der Patriarch Photios prangerte zudem an, im Westen werde die Lehre geduldet, der Heilige Geist gehe von Gottvater und Gottsohn aus, während die spätantiken Glaubensdokumente ihn nur vom Vater ausgehen ließen. Mit diesem Streit um das filioque war ein in der Folgezeit immer wieder belebter Streitpunkt beider Kirchen benannt. Im 11. Jahrhundert kam die Auseinandersetzung dazu, ob bei dem Messopfer ungesäuertes Brot, wie es der jüdischen Paschasitte entsprach und in der lateinischen Kirche praktiziert wurde, oder gesäuertes Brot zu verwenden sei. Gleichzeitig führte die Errichtung der normannischen Herrschaft in Süditalien und die Verdrängung der Byzantiner zu dem Problem, ob hier eine lateinische und damit auf Rom bezogene Kirchenorganisation einzurichten sei und an die Stelle der byzantinischen treten solle. 1054 eskalierte der Konflikt: Der von Papst Leo IX. zu eher politischen Verhandlungen als Legat nach Konstantinopel entsandte Kardinalbischof Humbert von Silva Candida exkommunizierte den Patriarchen Michael Kerularios und wurde im Gegenzug selbst von diesem exkommuniziert.
Verfestigung der Kirchenspaltung
Eine dauernde Kirchenspaltung war mit diesen gegenseitigen Exkommunikationen nicht beabsichtigt, und doch hat sie sich daraus entwickelt. Papst Urban II. wollte 1095 mit dem Kreuzzug dem von den Seldschuken bedrängten Byzanz zu Hilfe kommen und hoffte auch auf kirchenpolitischen Ausgleich. In Wirklichkeit steigerten die Kreuzzüge jedoch die Entfremdung zwischen der lateinischen und griechischen Christenheit. Die Lateiner sahen in der mangelnden Unterstützung durch die Byzantiner Verrat und witterten Häresie. Die Griechen erblickten in der Errichtung einer lateinischen Kirchenorganisation im Heiligen Land, wo in Antiochia und Jerusalem lateinische Patriarchen eingesetzt wurden, einen unrechtmäßigen Übergriff der römischen Papstkirche. Die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204), die Errichtung des Lateinischen Kaiserreichs und die Einsetzung eines lateinischen Patriarchen führte zu dem endgültigen Bruch zwischen beiden Kirchen. Dass Papst Innozenz III. damals auch einen lateinischen Patriarchen für Alexandria ernannte und damit alle vier östlichen Patriarchen auf Rom ausgerichtet sein sollten, zeigt, dass auch die lateinische Kirche 1204 zu einem generellen „Neuanfang“ nutzen wollte. Das scheiterte an der Beharrungskraft der griechischen Kirche: Auf eine Union unter Führung des Papsttums ließ sich diese nicht ein. Selbst als der byzantinische Kaiser und der griechische Patriarch von Konstantinopel eine solche in Zeiten höchster Not vereinbarten, um die Lateiner zu Bundesgenossen im Kampf gegen die Osmanen zu gewinnen, konnten sie eine auf den Konzilien von Lyon 1274 und Florenz 1439 vereinbarte Union nicht durchsetzen.
Mission
Die christliche Kirche, die im Mittelalter den größten Raum erfasste, war die nestorianische. Als lateinische Missionare im 13. Jahrhundert an den Hof des mongolischen Großkhans im Fernen Osten kamen, fanden sie dort Nestorianer, auf ihrem Weg dorthin waren sie immer wieder auf nestorianische Gemeinden und Kirchen gestoßen. Das Zentrum der Nestorianer war Bagdad, der nestorianische Katholikos war Nachbar des muslimischen Kalifen. Und offensichtlich legte dieser der christlich-nestorianischen Mission in Gebieten, die herrschaftlich nicht muslimisch organisiert waren, keine Steine in den Weg, solange es nicht zu christlichen Herrschaftsbildungen kam. Die nestorianische Mission erfolgte ohne staatliche Rückendeckung. Sie war wie die frühchristliche auf die freiwillige Annahme des Glaubens angewiesen, wie es einer nie aufgegebenen christlichen Überzeugung entsprach. Dass solch freiwillige Annahme des neuen Glaubens in den sozialen Bindungen von Familie und größerer Verbandsbildungen erfolgte, politischer Absicherung diente oder neue Chancen schaffen sollte, lässt sich bei den Missionierungs- und Christianisierungsprozessen in Europa genauer verfolgen. Annahme des Christentums durch einen Herrscher vermochte dessen Selbständigkeit gegenüber einem bereits christlichen Nachbarn zu schützen. Speziell die lateinische Kirchenorganisation ermöglichte es, durch die Errichtung von Erzbistümern sowohl kirchliche als auch politische Unabhängigkeit gegenüber einem benachbarten christlichen Reich zu behaupten. Der Papst, ohne dessen Billigung kein Erzbistum gegründet werden konnte, wurde auf diese Weise zum Beschützer neuer Königreiche. Für Polen und Ungarn lassen sich derartige kirchliche Verselbständigungsprozesse im 10. Jahrhundert verfolgen; im 12. Jahrhundert verknüpften sie sich hinsichtlich Skandinaviens mit dem Konflikt zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und dem Papsttum. Auf diese Weise haben Missionierung und Christianisierung einerseits zur religiösen Einheitlichkeit, andererseits zur politischen Vielfalt des lateinischen Europa beigetragen. Ausbreitung des Christentums durch blanke Gewalt, Zwangsmission bei gleichzeitiger politischer Unterwerfung bildeten eher die Ausnahme. Ein frühes Beispiel dafür sind die Sachsenkriege Karls des Großen, die mit der Ausdehnung des Frankenreichs bis an die Elbe endeten. Doch schon bei den bald darauf folgenden Kämpfen gegen die Awaren forderte Karls wichtigster kirchlicher Berater Alkuin, von derartig gewalttätigen Missionsmethoden abzulassen. Im Inneren der christlichen Reiche sind Juden wiederholt zum Opfer von Zwangstaufen geworden. Dass dies der offiziellen Lehre der Kirche widersprach, hat ihnen wenig geholfen. Denn die einmal gespendete Taufe galt als gültig. Nur im Vorfeld versprach ein amtskirchliches Eingreifen Erfolg. So konnte Bernhard von Clairvaux der Judenhetze eines Kreuzzugspredigers entgegentreten, der die Juden vor die Alternative „Taufe oder Tod“ stellen wollte; doch hat er selbst gleichzeitig den Kreuzzug gegen die heidnischen Slawen östlich der Elbe unter solchen Vorzeichen begründet. In ihnen glaubte Bernhard Gegner des Christentums zu sehen, die „freiwillig“ ein Bündnis mit dem Teufel eingegangen waren, der auf diese Weise den Kreuzzug in den Orient und die Bekehrung der Heiden generell behindern wollte. Die Christianisierung Preußens, wo der Deutsche Orden schließlich seinen „Staat“ errichtete, erfolgte im Zeichen von Gewaltmission und Unterwerfung. Die kreuzzugsähnlichen „Preußenfahrten“ verbanden sich mit der Christianisierung Litauens, doch sicherte 1385 der Großfürst Władysław II. Jagiełło durch seine Taufe dessen Unabhängigkeit und erlangte gleichzeitig die polnische Königskrone.
Osma-Beatus-Karte (1086). Die von einem Heiligenschein umrahmten Häupter der zwölf Apostel sind systematisch über die bewohnte Erde verteilt. Siehe auch S. 66.
Liturgische Sprachen
Kirchenpolitische Konkurrenz zwischen der lateinischen und der griechischen Kirche und den hinter diesen stehenden Reichen wirkte auf die Missionierung und Christianisierung des europäischen Raumes ein und eröffnete den „Betroffenen“ Spielräume. Im 9. Jahrhundert schwankten die Bulgaren, ob sie sich der Mission durch die römische oder die griechische Kirche öffnen sollten, das Gleiche wiederholte sich im 10. Jahrhundert bei der Christianisierung Russlands. In beiden Fällen fiel die Entscheidung zu Gunsten des Patriarchen von Konstantinopel. Die fränkischbayerischen Bischöfe vermochten hingegen ihre Missionsbestrebungen in Böhmen und Mähren gegen die „Slawenapostel“ Kyrill und Method abzusichern. Vor allem deren Gebrauch des Slawischen als Sprache der Liturgie stieß auf heftigen Widerstand, obwohl sich Kyrill und Method dabei zeitweise auf die päpstliche Billigung stützen konnten. Es entstand eine kirchliche Teilung Europas in einen an Rom orientierten Bereich lateinischer Liturgiesprache und einen an Konstantinopel ausgerichteten Raum, der sich in der Liturgie entweder des Griechischen oder des Kirchenslawischen bediente. Die von Kyrill und Method favorisierte Verwendung der Volkssprache als liturgische Sprache in den zu missionierenden Gebieten eröffnet eine neue Entwicklung: Bis dahin bestimmte die liturgische Sprache der Kirchen, von denen die Mission ausging, die Sprache der neu errichteten Kirchen. Syrisch war zum Beispiel die Kirchensprache der Nestorianer auch im fernen Ostasien, das ägyptische Koptisch die der Äthiopier. Diese Kirchen blieben nicht allein organisatorisch, sondern auch sprachlich untereinander verbunden. In der von Konstantinopel ausgehenden Mission kam es hingegen zur Ausbildung von zwei Kirchensprachen, des althergebrachten Griechischen und des Kirchenslawischen. Die Verbindung zur Kirche von Konstantinopel wurde durch Entsendung von Griechen auf die wichtigsten Bischofssitze der missionierten Kirchen geschaffen. In der russischen Kirche war Kyrill von Kiew (1249–1281) der erste Metropolit slawischer Herkunft. Erst nach dem Sturz Erzbischof Isidors von Moskau, wohin der Metropolitansitz im 14. Jahrhundert verlegt worden war, setzte eine ununterbrochene Reihe von Metropoliten russischer Herkunft ein. Isidor hatte die in Florenz vereinbarte Union zwischen der lateinischen und griechischen Kirche befürwortet und selbst an dem Konzil (1438–1439) teilgenommen. Nicht allein die Union ist gescheitert, sondern der Plan hat auch zu einer weiteren Verselbständigung der russischen Kirche gegenüber dem Patriarchat von Konstantinopel beigetragen. Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 überdeckte diese Entwicklung. Ihren Abschluss fand sie in der Gründung des Moskauer Patriarchats 1589. Doch inzwischen sahen sich die Großfürsten von Moskau als die Erben des byzantinischen Kaisertums.
Christianisierung und Schriftlichkeit
Missionierung und Christianisierung waren mühsame, lang andauernde Prozesse der Akkulturation der „Bekehrten“. Das historische Wissen über deren Kultur ist in vielen Fällen nur aus den Berichten der Missionierenden und aus archäologischen Quellen geschöpft. Gerade die Räume außerhalb der alten Hochkulturen verdanken der Christianisierung und Missionierung oft die Entstehung einer eigenen Schriftlichkeit. Diese erlaubte es nun, die eigene Geschichte – einschließlich der Zeit vor der Annahme des neuen Glaubens und des Christianisierungsprozesses selbst – zu fixieren und zu interpretieren. Bewusstsein von Eigenständigkeit und Einfügung in ein christliches „Ganzes“ konnten sich hierbei miteinander verschränken. Die unterschiedliche Behandlung der Volkssprache in der von Rom oder von Konstantinopel ausgehenden Mission zeitigte jeweils lang nachwirkende Konsequenzen. In den Gebieten volkssprachlicher Liturgie waren die Bildungs- und Wissensunterschiede zwischen Klerikern und Volk geringer als in den Räumen, die an fremdsprachiger Liturgie festhielten. Der Zugang des Einzelnen zu Glaubensinhalten war unmittelbarer. Räume mit liturgisch begründeter Zweisprachigkeit erleichterten hingegen Kommunikation über weite Entfernungen – und auch lange Zeiten. Das Festhalten am Lateinischen als Liturgiesprache im „Westen“ lenkte nämlich gleichzeitig das Interesse auf die dadurch sprachlich zugängliche antike Literatur und ermöglichte Kontinuitäten und Neubelebungen des Wissens, die für das lateinische Europa konstituierend wurden, während sie im griechischsprachigen Byzanz nie abgerissen waren.
Christliche Ehenormen
Die schwerwiegendste Folge der Christianisierung Europas dürfte jedoch die Durchsetzung der Einehe und das Verbot der Verwandtenehe gewesen sein. Augustinus hatte in der Spätantike auf die gesellschaftlichen Folgen des biblischen Verbotes der Verwandtenehe hingewiesen. Es vergrößere den Kreis derjenigen, die durch Liebe, Verschwägerung und Freundschaft untereinander verbunden seien, und erhöhe so die Chance auf Frieden unter den Menschen. Das blieb Illusion. Nicht allein der als Verteidigung begriffene Kampf gegen Fremde und Andersgläubige, sondern auch die Auseinandersetzung unter Verwandten waren bestimmende Elemente des politischen Lebens.
Erst am Ende des Mittelalters lässt sich das Christentum als ein einheitliches begreifen. Aber das gilt nur in dem Sinn, dass nur noch das lateinische Christentum über eigenständige Handlungsmöglichkeiten verfügte; seine Vielgestalt hatte das Christentum jedoch bewahrt.
Vielfalt der Welt
Vielfalt der Welt ist deshalb auch die Leitlinie dieses Bandes. Die Welt, deren Geschichte nachgezeichnet wird, ist letztlich noch die Welt der antiken Oikumenen, die in Band II im Mittelpunkt stand. Sie erstreckt sich von Europa, das mehr und mehr erschlossen wird, bis hin nach Island und Grönland, über das vordere und mittlere Asien und Indien bis nach China, Japan und Korea. Das nördliche Afrika gehört zu dieser Oikumene, und hier bildet Ägypten wie in den Jahrtausenden zuvor einen Kernraum. Das nilaufwärts gelegene Nubien und Äthiopien bleiben dieser Welt verbunden, Äthiopien gewinnt sogar durch das gegenüberliegende Arabien neue Bedeutung. Arabische und indische Händler kennen die Ostküste Afrikas bis Madagaskar. Das westliche Afrika südlich der Sahara ist mehr als ein Raum, aus dem der Norden Gold und Sklaven importierte und der von islamischen Expansionen erreicht wurde. Neben indigenen Kräften sind ältere Zusammenhänge mit den antiken Oikumenen bei den Reichsbildungen in diesem Raum zu bedenken.
Ein Geflecht von Kommunikationen ermöglicht es, die Geschichte des soeben skizzierten Raumes als „Weltgeschichte“ zu beschreiben. Amerika, die Neue Welt, liegt noch außerhalb dieses Kommunikationssystems und findet in dem vorliegenden Band keine explizite Berücksichtigung. „Weltgeschichte“ beruht nicht auf geschichtsphilosophischer Konstruktion, sondern auf der schlichten Tatsache, dass man voneinander, oft rudimentär, Kenntnis hatte, dass Reisende als Händler, Pilger und Missionare unterwegs waren. Diese nahmen die Welt weniger als eine einheitliche, sondern als eine vielgestaltige wahr. Christentum und Islam als auf eine die ganze Menschheit und die ganze Welt ausgerichtete Religion vermochten keine einheitliche Welt zu schaffen, ebenso wenig die Mongolen, die mit ihrem Reich einer Herrschaft über die „bekannte Welt“ so nahe kamen wie niemand vor ihnen. Im christlichen Europa konkurrierten ein östliches und ein westliches Kaisertum mit jeweiligem universalen Selbstverständnis, dazu trat das universal ausgerichtete römische Papsttum. Seine politische Gestalt fand Europa jedoch in regional begrenzten und definierten Herrschaften, meist in Königreichen. Die Ordnung der Welt war eine regionale.
Religiöse Deutungen der Welt zielten in gleichem Maße auf die Bewältigung des Lebens in der Welt als auch auf das Abschütteln der Welt in asketischen Lebensweisen. Beides war nur zu leisten durch gedankliche Auseinandersetzung mit der Welt und den Lebensformen und -möglichkeiten des Menschen. Nicht zuletzt daraus ergaben sich Möglichkeiten von Rationalität, Verwissenschaftlichung und komplexer kognitiver Ordnungen.
In drei großen Abschnitten, Vielfalt der Welt – Ordnung der Welt – Deutung der Welt, sollen diese Linien einer Weltgeschichte von 600 bis 1500 nachgezeichnet werden. Diese Epoche aber ist in vielerlei Hinsicht mit den „Entdeckungen und neuen Ordnungen“ verzahnt, die in Band IV (1200–1800) mit Rückbezügen auf den vorliegenden Band dargestellt werden.
Die Vielfalt der Welt
Der Felsendom in Jerusalem. 7./8. Jahrhundert.
Kommunikation – Handel, Kunst und Wissenstausch
Michael Borgolte
Die Einheit der Welt war im „Mittelalter“ noch nicht realisiert. Zwar hatte sich das Menschengeschlecht schon seit der Vorgeschichte über den Globus verbreitet, doch war zwischen 600 und 1500 n. Chr. nicht jede menschliche Siedlung derart mit den anderen verbunden, dass alle die Knoten eines Netzes oder wenigstens die Glieder einer Kette bildeten. So blieb Australien mit seinen Ureinwohnern bis ins 17. Jahrhundert für sich, obwohl es nur wenige hundert Kilometer Seereise von Südostasien trennten, das selbst Teil eines weiträumigen Handelssystems vom Mittelmeer bis Japan war; ähnlich verhielt es sich mit dem noch weiter abgeschiedenen Neuseeland, während Neuguinea, das doch mit Streuinseln nach Borneo oder den Philippinen heranzureichen schien, erst 1526 als Baustein der Oikumene entdeckt worden war. Unerkannt entzogen sich der übrigen Menschheit auch das Innere Afrikas oder die Weiten Sibiriens, und Amerika hatten weder die Wikinger aus dem Osten noch die Polynesier aus dem Westen dauerhaft mit Europa oder Asien verknüpfen können.
Indianische Hochkulturen
Das „Mittelalter“ bestand also – universal betrachtet – aus mehreren voneinander getrennten Welten, die nur auf dem Weg des Vergleichs als globale Einheit konstruiert werden könnten. Für eine solche gedankliche Operation ist aber die Überlieferung allzu ungleichmäßig verteilt. Um den Zusammenhang Afrikas südlich des Äquators mit der Struktur anderer Weltgegenden konfrontieren zu können, reichen beim gänzlichen Mangel an Schriftzeugnissen die archäologischen Funde einfach nicht aus. Etwas besser ist die Lage bei den indianischen Hochkulturen, den mesoamerikanischen Maya (seit dem 3. Jh.) und Azteken (eingewandert seit ca. 1250) sowie dem Reich der Inka im Andenraum (seit ca. 1430). Die drei Herrschaftsbildungen hatten die beschränkte Mobilität für Handelswaren auf dem Landweg miteinander gemein. Dafür fehlten ihnen die Trag- und Zugtiere anderer Kulturen (Ochsen, Kamele, Pferde), so dass sie auch das Rad, das sie kannten, keinem Wagenkasten untersetzen konnten. Die Inka bauten zwar rund 24.000 Kilometer Straßen, darunter die Route über das Hochland der Anden zwischen Ecuador und dem heutigen Santiago de Chile, die aber nur Lastenträger, wenn nicht Krieger oder Boten, begehen konnten. Systematisch angelegte Speicher dienten zur Ablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die von Staats wegen redistribuiert wurden, während die Hauptstadt Cusco (Cuzco) nur Luxusgüter in kleineren Mengen erreicht haben dürften. Ein kommerzieller Handel konnte sich kaum entwickeln. Trotzdem gab es in den drei Zivilisationen Fernhändler, die, wo immer es ging, Wasserstraßen benutzten. Schiffe – oder Flöße – fuhren die peruanische Küste entlang und wagten sich von hier aus wenigstens gelegentlich auf die hohe See. Die Maya in Mexiko nutzten für den Warentransport ebenso Flussläufe. Fernhändler, die sich genossenschaftlich organisierten, konnten auch zu politischen und militärischen Zwecken eingesetzt werden; die aztekischen Herrscher schickten sie geradezu aus, um ihre Eroberungen in Nachbargebieten vorzubereiten. Im Ganzen lebten die indianischen Bevölkerungen aber in einem naturräumlich zerklüfteten Kontinent so isoliert voneinander, dass sich ihre Kulturen kaum berührten und gegenseitig befruchteten, ganz zu schweigen von überseeischen Kontakten.
Kenntnisse von der Welt
Weiträumige Kommunikation kann deshalb im mittelalterlichen Jahrtausend nur im Hinblick auf jene drei Kontinente betrachtet werden, die damals selbst als Oikumene galten: Asien, Europa und Afrika. Nach den Weltkarten der Lateiner waren sie durch Gewässer voneinander geschieden: Europa von Afrika durch das Mittelmeer und beide von Asien durch die Flüsse Don und Nil. Indessen bildeten diese technisch niemals unüberwindliche Hindernisse, während der Weltozean, der die drei Erdteile zu umschließen schien, in der Vorstellung der mittelalterlichen Menschen die Oikumene von den unbewohnten Teilen oder einem vierten Kontinent trennte, in dem womöglich die Monstren hausten. Tatsächlich war am Ende des Mittelalters von den drei Großmeeren der Weltkugel am besten das kleinste, der Indische Ozean, erschlossen; den Atlantik befuhr man regelmäßig allenfalls im Nordosten, während der Pazifik, größer als die beiden anderen zusammengenommen, nur an seinem chinesisch-japanischen Saum überbrückt wurde.
Die Transversale der Oikumene – Indischer Ozean und Mittelmeer
Über den Zusammenhang der drei Kontinente des Mittelalters entschieden die Ost-West-Verbindungen zwischen China und Lateineuropa; obschon, mindestens zeitweise, noch Fernwege auf dem Lande zur Verfügung standen, verknüpften diese Antipoden besonders die Schiffe auf dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer. Viele Küstenstädte unterwegs wurden angesegelt, die ihrerseits über große Flussläufe und Straßen weiter auf andere Zentren verwiesen; mit den Waren und Menschen konnten so auch an vielen Stationen Ideen, technische Errungenschaften und Werke mustergültiger Schönheit aus der Fremde an Bord kommen. Da weder die Gegensätze der Religionen noch die Unterschiede der Lebensweisen die Suche nach Wissen, die Neugier auf das Überraschende und das Streben nach Besitz, Genuss oder Gewinn nachhaltig zu hindern vermochten, störten die Kommunikation der Menschen empfindlich nur Herrschaft und Gewalt. Dort, wo die Erdteile aneinanderstießen, am Schwarzen Meer und in der Levante, lag das Scharnier für das Gefüge der mittelalterlichen Welt; eine Schlüsselrolle kam insbesondere dem zu, der die Wasserwege zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean beherrschte, im Osten das Zweistromland und den Persischen Golf, im Westen den Nil und das Rote Meer.
Seewege und Landstraßen
Das hatte schon für die großen Reichsbildungen des Altertums gegolten; nachdem der Achaimenide Dareios I. die Herrschaft der Perser über Ägypten und die Kyrenaika wiederhergestellt hatte (522–520 v. Chr.), ließ er vom Nil zum Roten Meer einen Kanal bauen und den Seeweg von hier nach Indien erkunden, eroberte aber selbst um 518 das Tal des Indus. Seither verkehrten seine Schiffe regelmäßig im Persischen Golf. Der große Makedone Alexander tat es ihm als Eroberer Ägyptens (Gründung Alexandrias 331) und des Pandschab (327) nach. Von der Periode des Hellenismus bis über die Zeitenwende befuhren Inder die Straße von Hormus oder das „blaue Wasser“ bis zum Horn von Afrika, während gleichzeitig die Araber, wie vielleicht schon seit Jahrhunderten, nach Indien segelten und die Verbindung zum Mittelmeer schlugen. Den Römern versperrte zwar das Reich der Parther (250 v. Chr.–226 n. Chr.) vom Euphrat bis zum Indus den Landweg in den Osten, doch ermöglichte ihnen der Gewinn Alexandrias unter Augustus (30 v. Chr.) einen eigenen Verkehr mit Indien zu Wasser. Plinius skizzierte die Route zu den dortigen Häfen, und nach Strabon seien jährlich 120 ihrer Schiffe vom Roten Meer nach der Küste von Malabar (Westindien) aufgebrochen. Die Römer importierten exotische Tiere, wertvolle Steine, Hölzer und Elfenbein, chinesische Seide, Gewürze und Zucker, Baumwolle sowie Früchte des Subkontinents; als Gegengaben hatten sie wertvolle Metalle zu bieten, wie etwa Hortfunde goldener Münzen in Indien belegen. Im 3. Jahrhundert verlor der römische Handel an Bedeutung; von jetzt an bis ins 6. Jahrhundert wurden stattdessen die Griechen beziehungsweise Byzantiner aktiv. Da diesen die Sasaniden die Landstraßen in den Orient verschlossen, bedienten sie sich der Partnerschaft mit dem (seit ca. 330) christlichen Reich von Aksum (Äthiopien). Griechische Händler unterhielten auf diese Weise Geschäftsbeziehungen mit dem Jemen, mit Persien, Indien und Sri Lanka. Lange vor der Zeit Mohammeds hatten die Araber ihre führende Rolle im Indienhandel an die Sasaniden abgegeben. Persische beziehungsweise nestorianisch-christliche Kolonien säumten unter anderem die Küsten von Malabar und Sri Lanka. Vom 5. Jahrhundert an beobachteten chinesische Autoren die Handelstätigkeit der Perser, die damals mindestens bis zur Malaiischen Halbinsel vorgestoßen sein müssen. Nach dem griechischen Händler Kosmas Indikopleustes (523) hätten sich persische Kaufleute mit Chinesen und Leuten „aus den entferntesten Ländern“ in Sri Lanka getroffen.
Muslime als Anrainer des Mittelmeers – Muslimische Eroberung Spaniens
Als 100 Jahre darauf die Araber ihr Reich unter den „vier rechtgeleiteten Kalifen“ (632–661) über fremde Völker ausdehnten, rückten die Muslime „in eine zentrale Position, von der aus sie die beiden großen wirtschaftlichen Einheiten des Mittelmeers und des Indischen Ozeans verbinden konnten“ (André Wink). Rasch hatten sie das Sasanidenreich zerstört und Byzanz neben Armenien im Osten und Tripolitanien im Westen vor allem die Provinzen Syrien, Palästina und Ägypten abgenommen. 712 konnten die Omaijaden aus Damaskus auch das südliche Industal erobern. Man hat gesagt, dass die Muslime jetzt bis zum 11. Jahrhundert alle wichtigen Wirtschaftsrouten zu Wasser und zu Lande kontrollierten, abgesehen nur von der transeurasischen Seidenstraße und vom Handelszentrum Konstantinopel selbst. Indessen konnten sie die See zwischen Spanien und Kleinasien, Europas Süd- und Afrikas Nordufer niemals wie die Römer als mare nostrum, in der „Mitte ihres Landes“ (mediterran), begreifen. Sie waren und blieben ein Anrainer des Mittelmeers. Es nutzte den Arabern nicht viel, dass sie in syrischen und ägyptischen Häfen (Akkon, Tyrus, Tarsus; Alexandria, Rosette, Damiette) Kriegsschiffe stationierten und noch im 7. Jahrhundert die Inseln Zypern, Sizilien, Rhodos und Kreta angriffen, weil sie bei der Einnahme Konstantinopels versagten. So mussten sie sich die Herrschaft Zyperns jahrhundertelang mit dem Kaiserreich teilen, und Kreta, einst Zentrum einer mittelmeerischen Thalassokratie, gewannen sie gar erst 826, bevor es ihnen, ebenso wie Zypern und das syrische Antiochia, schon Mitte des folgenden Jahrhunderts wieder genommen wurde. Auch die erfolgreiche Eroberung Nordafrikas schien noch lange vom Meer her bedroht. Die neue Metropole Kairouan wurde 670 aus Sorge vor der oströmischen Seemacht fern der Küste gegründet, ehe eine Generation später in Tunis ein arabischer Flottenstützpunkt entstand; für den Schiffsbau mussten hierher eigens tausend koptische Familien (aus Ägypten) umgesiedelt werden. Sizilien konnte eine muslimische Partikularmacht erst seit 827 in jahrzehntelangem Kampf erobern; allerdings griff diese auch erfolgreich nach Unteritalien hinüber; selbst die Stadt Rom war zeitweise bedroht. Die Byzantiner widerstanden mit Zähigkeit, und einer ihrer Generäle plante 1038 sogar die Rückeroberung der Insel. Er scheiterte, so dass bald darauf erst die Normannen die muslimische Herrschaft beseitigten und dann auch die langobardisch-sarazenisch-byzantinische Gemengelage in Süditalien durch ihre Reichsbildung aufhoben. Von herausragender Bedeutung erwies sich die muslimische Eroberung Spaniens im frühen 8. Jahrhundert, zumal sie, wie einst bei den Karthagern, auf lange Sicht politische Herrschaft, Migrationen und sonstigen Verkehr über die Meerenge nach Afrika begünstigte. Während sich die Korangläubigen dem Atlantik kaum zuwandten, mussten die Christen erst die Dominanz auf der großen Halbinsel zurückgewinnen, ehe sie und ihre Nachbarn aus Italien seit dem 13. Jahrhundert planmäßig zu Seefahrten jenseits von Cádiz aufbrachen.
Beutezüge von Piraten
Die politische Zersplitterung der muslimischen Welt in Kalifate, Emirate und Sultanate trug, ebenso wie die allmählich erfolgreiche Konversion unterworfener Christen, dazu bei, dass sich Gewalt immer wieder in den Beutezügen von Piraten entlud. Dies gilt etwa für die im Umfeld des Kalifats von Córdoba agierenden Freibeuter, die bis ins späte 10. Jahrhundert die Provence heimsuchten. Korsaren beunruhigten die Adria und Venedig, den engen Verbündeten von Byzanz. Die Küste Dalmatiens wurde aber auch von den Kriegsschiffen und Piraten der Slawen sowie der christlichen Normannen bedroht. Sicher, wie im alten Imperium Romanum, war das Mediterraneum nie, und bis weit ins hohe Mittelalter hinein konnten nur die Flotten der Byzantiner und Muslime die Gesandten, Kaufleute, Pilger und Gelehrten, die Lebenshungrigen und die Exilierten bei ihren Fahrten entlang den Küsten oder – seltener – über das Wasser bis an den Horizont beschützen. Die muslimische Präsenz im Westen wurde geschwächt, als sich das Herrscherhaus der Fatimiden aus Tunesien nach Kairo zurückzog (973), obwohl weder Afrika noch Spanien oder Unteritalien den Christen wieder zugefallen wäre. Kairo, beim alten arabischen Heerlager am römischen Nilkanal gelegen, sicherte bis zum Reich der Mamluken (1260–1517) den Muslimen die Kontrolle über den Wirtschaftsverkehr mit dem Orient; hierher – wenn nicht nach Alexandrien – kamen die Schiffe der Byzantiner und Westeuropäer, um die Schätze Asiens einzutauschen.
Mittelmeerhandel der christlichen „Abendländer“
Am Mittelmeerhandel hatten sich damals schon neben Muslimen und Oströmern sowie den Juden auch die christlichen „Abendländer“ beteiligt, deren Wirtschaft seit der Zeit Karls des Großen einen bemerkenswerten Aufschwung genommen hatte. Je mehr sich das kaiserliche Byzanz aus dem westlichen Mittelmeer zurückziehen musste, umso mehr konnten ehemalige Angehörige des Reiches, wie in Amalfi oder Venedig, die Lücken füllen, aber auch andere Seestädte, Pisa etwa oder vor allem Genua, entfalteten ihre eigene Wirtschaftsmacht. Venedig gelang es mit der Gunst beider Kaisertümer, die Route von der Adria nach Konstantinopel zu kontrollieren und in der ganzen Levante seine Handelshäuser und Kolonien zu errichten; Genua und die anderen italienischen Seestädte taten es ihm gleich, und zwar bis zu den Küsten des Schwarzen Meeres. Die Flotten der „Seerepubliken“ waren sogar in der Lage, die Kreuzritter des Westens zur Rettung des Heiligen Landes über das Meer zu fahren. Als Konstantinopel zum ersten Mal gefallen war (1204), profitierte Venedig am meisten; die Beziehungen zu den westlichen Ländern intensivierten sich aber allgemein durch die Gründung der lateinischen Staaten auf griechischem Boden. Noch im 13. Jahrhundert griff auch die Krone Aragón, nach Auseinandersetzungen mit den Anjou um Sizilien, ins östliche Mittelmeer aus; die Herzogtümer Athen und Neopatras konnte König Johann I. immerhin bis 1388/1390 halten. Weit übertroffen wurden die Spanier allerdings wiederum von der Beharrungskraft Venedigs und Genuas; denn lange nachdem das „Zweite Rom“ durch die Osmanen muslimisch geworden war (1453), behielten die Seestädte noch ihre Kolonien Modon und Koroni (Peloponnes, etwa bis 1500) sowie Chios (Ägäis, bis 1566). Die Vormacht zur See war damals allerdings bereits an die Türken übergegangen; Venedig, das seine Suprematie noch im 14. Jahrhundert in Seeschlachten und -kriegen gegen Genua und auch den König von Ungarn behauptet hatte, unterlag den türkischen Kanonen entscheidend in der Schlacht bei Zonchio 1499.
Handel mit Asien
Als Nachfolger der christlichen Kaiser hatte der Sultan von Istanbul am Ende des Mittelalters die Kontrolle über das Schwarze Meer gewonnen. Wichtiger für den Asienhandel war aber von jeher die muslimische Herrschaft über die Seewege im Süden durch das Kalifat und dann durch das Sultanat von Kairo. Die Verlagerung der muslimischen Hauptstadt von Damaskus nach Bagdad unter den Abbasiden hatte hier seit 762 der alten persischen Verbindung über den Golf die Dominanz gegenüber dem Roten Meer verschafft, das wegen seiner Untiefen gefürchtet war. Über die Hafenstädte Siraf an der persischen Küste und Basra gelangten jahrhundertelang die Handelswaren aus China, der Malaiischen Halbinsel, Indonesien und Indien nach Mesopotamien, wo Bagdad zum größten Hafen der Welt aufstieg. Die Kapitale am Tigris vermittelte die Güter weiter nach Syrien, Ägypten, Nordafrika und in den Westen Europas, in den Norden und Osten aber auch nach Aserbaidschan, Armenien, Isfahan und Chorasan. Ein Wendepunkt wurde bei der Eroberung Bagdads durch die seldschukischen Türken 1055 und dem Verfall der abbasidischen Macht erreicht. Von Kairo aus schalteten sich die Fatimiden Ende des 11. Jahrhunderts in den Indienhandel ein; seit Beginn der Kreuzzüge wurden die orientalischen Gewürze und andere Güter über das Rote Meer nach Kairo und Alexandria umgelenkt, wo christliche Handelsflotten die Waren aufnehmen konnten. Erst recht avancierte das Sultanat am Nil nach der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204) und der Zerstörung Bagdads durch die Mongolen (1258) zum neuen Zentrum nahezu aller Handelsaktivitäten von Indien über Aden nach Europa. Reich durch den Indienhandel wurde Ägypten unter den Mamluken.
Zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert dominierten neben Persern vor allem Araber im westlichen Teil des Indischen Ozeans, obwohl die Islamisierung Indiens um 750 stockte und erst mit Errichtung des Sultanats von Delhi (1206) wieder aufgenommen wurde. Von Siraf aus konnten große Überseeschiffe direkt bis nach China fahren; ein einziger arabischer Kapitän der Zeit soll die Reise siebenmal unternommen haben. In Kanton hatte es schon im 4. Jahrhundert eine Niederlassung arabischer Händler gegeben. Die Kaufleute wurden durch die teilweise glanzvolle Tang-Dynastie (618–906) begünstigt; diese chinesischen Herrscher duldeten viele Religionen, neigten aber selbst dem Buddhismus zu, dessen Klöster auf wirtschaftliche Hilfen der Laien angewiesen waren und den Handel förderten. Perser und Araber brachten neue Obstsorten, wie Granatäpfel, Walnuss, Feigen und Mandeln, nach China; aus Persien wurde auch das Polospiel eingeführt. Umgekehrt haben Ausgrabungen in Siraf Zeugnisse des arabisch-persischen Chinahandels preisgegeben; Keramik der Tang-Zeit gelangte bis zum Kalifenhof von Bagdad. Während eines der wiederholten Aufstände wurde allerdings 879 Kanton geplündert; dabei sollen nach dem zeitgenössischen Bericht des Abu Zaid aus Siraf 120.000 Menschen, die meisten von ihnen Muslime, umgekommen sein.
Einschneidender Wandel in der Ökonomie
Um die Jahrtausendwende vollzog sich im Indischen Ozean ein einschneidender Wandel in der Ökonomie; an die Stelle der direkten Belieferung der Abnehmer durch die Erzeuger trat der Emporienhandel, bei dem die Waren in oft mehreren Stapelhäfen zwischengelagert wurden. Die Emporien wurden am Ort älterer Handelsplätze oder ganz neu gegründet, boten eine große Vielfalt und Menge von Waren an, beherbergten Seefahrer vieler Völker und eine multinationale beziehungsweise plurireligiöse Einwohnerschaft. In diesem System nahm die Bedeutung der arabischen und persischen Händlergruppen seit dem 11. und besonders seit dem 14. Jahrhundert stark ab. So wagten sich die Fatimiden kaum noch über Südindien und Sri Lanka hinaus. An ihre Stelle traten vor allem die Inder, auch sie oft Muslime, aber auch Hindus, Juden und sogar Christen. Eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Relaisstationen scheint der Aufstieg des Chola-Reiches an der Koromandelküste gespielt zu haben. Die ungewöhnlich militanten Könige Rajaraja (985–1014) und Rajendra (1012–1044), dessen Sohn, errichteten eine Hegemonie über den gesamten indischen Subkontinent und unternahmen mehrere Eroberungszüge nach Sri Lanka und den Malediven. Offensichtlich ging es ihnen um die Kontrolle des Fernhandels, zumal China unter den Song (960–1126 bzw. 1127–1279) erneut aufblühte. 1014/1015 entsandten die Cholas erstmals eine Mission nach China, die keine einheimischen Produkte, sondern fast ausschließlich Zwischenhandelsgüter anbot. Das Herrschergeschlecht der Song erkannte das indische Reich daraufhin als „Großen Tributärstaat“ an. Mit den Cholas konkurrierte allerdings das Seereich von Srivijaya in Indonesien, das sich anschickte, die Meerengen in der südostasiatischen Inselwelt unter seine Kontrolle zu zwingen. Rajendra ließ deshalb 1025 Srivijaya durch eine Kriegsflotte angreifen und auf Sumatra, der Malaiischen Halbinsel und den Andamanen ein Dutzend Hafenstädte in Brand setzen. Um Emporien zwischen dem Indischen Ozean und dem Südchinesischen Meer dürften deshalb die Auseinandersetzungen gegangen sein. Unter der Herrschaft der Chola standen an der Malabar-, also der Westküste Indiens auch Niederlassungen jüdischer Kaufleute, die, nach der Überlieferung von Alt-Kairo, mit Glaubensbrüdern in Ägypten korrespondierten. Das expansive Delhi-Sultanat, das sich selbst als al-Hind oder Hindustan schlechthin verstand, eroberte noch im 13. Jahrhundert Gujarat im Nordwesten, wo traditionell die Schiffe aus dem Persischen Golf anzulegen pflegten. Die dortigen Händler traten vielfach ebenfalls zum Islam über, der jetzt von Indien aus nach Südostasien vordrang. Mit der Frequenz der Handelsfahrten und der Größe der Schiffe nahm auch die Zahl der Emporien zu.
Überseehandel der Song
Unter den Dynastien der Song traten die Chinesen zum ersten Mal als bedeutender Partner im Überseehandel in Erscheinung. Abgesehen von Japan und dem Königreich von Champa (Vietnam) waren Malaya und die Küstenstädte von Südindien ihre wichtigsten Anlaufstationen. Schon im 11. Jahrhundert waren sie auf den Gewürzinseln und auf Java präsent. Zentren ihres Handels mit den Arabern waren auf Sumatra Palembang, Aceh (Atjeh) am Eingang der Malakkastraße, die Häfen Borneos sowie Manila auf den Philippinen. Nach den »Aufzeichnungen über die Barbarenländer« aus dem 13. Jahrhundert kannten sie auch europäische Örtlichkeiten, vermittelt indes nur durch Erzählungen arabischer Seefahrer.
Drei große Segmente des Asienhandels
Mindestens seit dem 13. Jahrhundert war der Asienhandel über Arabisches Meer, Indischen Ozean und Südchinesisches Meer durch zwei Grenzzonen in drei große Segmente geteilt, die dem Radius der jeweils verkehrenden Schiffe entsprachen. Der westliche Kreis, überwiegend in der Hand von Muslimen, reichte von den Häfen der Arabischen Halbinsel beziehungsweise von Bagdad oder Kairo bis zur Nordwestküste Indiens (gewöhnlich Gujarat) hinüber, von wo die Händler die Küste nach Süden entlangfuhren; diejenigen, die vom Roten Meer gekommen waren, hatten hingegen Aden oder Had(h)ramaut passiert und segelten direkt nach Malabar. Der mittlere Kreis verband die südliche Küste Indiens mit der Region von Sumatra und Malaya an der Straße von Malakka bis nach Java; bei den Anwohnern handelte es sich, jedenfalls bis ins 14. Jahrhundert, überwiegend um Hindus, obgleich auch der Buddhismus von Bedeutung war. Der östliche Zirkel war der Raum zwischen Indochina und der Nordküste von Java einschließlich der großen Küstenstädte Chinas selbst; hier dominierte der Buddhismus, durchsetzt mit konfuzianischen Einflüssen. Allerdings waren die drei Zonen weniger durch ihre Religionen geprägt als durch die Natur bedingt. Mit ihren Emporien in den Umschlagskorridoren reagierte das Handelssystem auf den jahreszeitlichen Wechsel des Monsuns. Danach konnte man mit dem Südwestwind von Arabien oder Afrika nur zwischen März und Juli nach Indien segeln, musste mit dem Nordostmonsun von Gujarat oder Malabar aber erst nach Mitte Oktober und in jedem Fall vor dem 10. Februar zurückkehren. Entsprechend terminiert war die Segelsaison in beiden Richtungen in den anderen Abschnitten der maritimen Fernhandelsrouten. Wenngleich eine Direktverbindung zwischen Arabien oder Persien und China einschließlich der Rückkehr etwa anderthalb Jahre in Anspruch genommen hätte, konnte durch falsche Windberechnung sehr viel mehr Zeit verloren gehen. Händler, die nur in einer Zone verkehrten, wirtschafteten sehr effektiv, wenn sie je mit dem Wind fuhren und an den Stapelplätzen ihre Ladungen zügig austauschten.
Objekte des Handels
Was nun die Objekte des Handels selbst angeht, so spielten hochwertige Güter geringen Umfangs eine bedeutende, aber nicht die wichtigste Rolle. Unter den Luxusprodukten stand Pfeffer für die asiatischen Märkte (Ostasien und arabisch-persischer Raum) und für den Export nach Europa an erster Stelle; er wurde besonders im Westen Indiens und im Nordwesten Sumatras produziert. Teurer als Pfeffer war Ingwer, der allerdings in erheblich geringerem Umfang gehandelt wurde; er kam von der Malabarküste, von Bengalen und aus Ostafrika. Zimt stammte hauptsächlich aus Sri Lanka, Gewürznelken, Muskatblüten und Muskatnuss von den Gewürzinseln (Ambon, Molukken, Bandainseln). Kostspieliger waren Drogen und Duftstoffe wie Amber, Kampfer und Opium sowie das begehrte Sandelholz von der Insel Timor. Als Tauschmittel der europäischen beziehungsweise der vermittelnden islamischen, jüdischen oder auch armenischen Kaufleute dienten insbesondere Edelmetalle, Gold- und Silbermünzen, aber auch Brokat, Wolle, Korallen und Rosenwasser. China brachte Seide und Porzellan, Indien noch Textilien, Diamanten und Edelsteine, Sri Lanka Perlen in Umlauf: Gold kam aus Sumatra und Ostafrika, das auch Elfenbein und Sklaven lieferte. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert trat der Transport schwerer Massengüter in den Vordergrund. Stark nachgefragt wurde Kupfer, ein traditionelles Exportgut der Levante; begehrt war auch Zinn von der Malaiischen Halbinsel und Sumatra, das entweder nach Westen oder nach China ging. Eisen kam insbesondere vom Dekkan (Indien) und von Orissa, Schiffsbauholz wurde von der Westküste Südindiens in arabisch-persische Gebiete oder auch nach Gujarat verfrachtet. Teakholz aus Myanmar gelangte nach Malakka und an die Koromandelküste. Von Myanmar und Sri Lanka wurden Elefanten für den Kriegsdienst nach Indien verschifft, Pferde lieferten Arabien, Persien und Somalia. Zum Transport der raumgreifenden und schweren Güter kam die Beförderung von Sklaven und Passagieren, vor allem aber von Nahrungsmitteln in großen Mengen. Aden und Hormus mussten ebenso wie die islamischen Städte Ostafrikas und die Küstenorte von Sri Lanka Reis von der Koromandel- oder der Malabarküste beziehen, die Gewürzinseln versorgten Java mit Reis, und auch Malakka war von der Einfuhr von Lebensmitteln abhängig. Das fruchtbare Bengalen war mit seinen ausgedehnten Reis-, Zuckerrohr- und Baumwollpflanzungen sowie seinen großen Pferde-, Kuh- und Schafherden einer der wichtigsten Nahrungsmittelexporteure Asiens überhaupt. Neue Frucht- und Getreidesorten fanden aus Ostafrika oder Südostasien Verbreitung. Ein begehrtes Nahrungsmittel wie Dattelhonig wurde von Arabien bis China transportiert, in einigen Regionen musste aber gar mit Wasser gehandelt werden.
Handelsverkehr zwischen Japan und China
Der Zugang der ostasiatischen Länder und Völker zum interkontinentalen Handel und Kulturaustausch hing im Mittelalter fast ausschließlich am Interesse der Chinesen. China selbst, aber auch Korea konnten zwar die eurasischen Karawanenstraßen nutzen, über die unter anderem der Buddhismus und viel weniger der Islam vordrangen, aber Japan war auf den Schiffsverkehr angewiesen. Seit dem 5. und besonders der Mitte des 7. Jahrhunderts öffnete sich das Inselreich chinesischen Einflüssen, nicht zuletzt durch missionierende buddhistische Mönche. Die Blütezeit der chinesischen Song brachte auch eine Intensivierung des Handels in Ostasien mit sich, der noch weitgehend durch chinesische und koreanische Schiffe abgewickelt wurde. Alles änderte sich, als das Reitervolk der Mongolen aus Innerasien ganz China eroberte (1276–1279) und eine Fremdherrschaft errichtete. Zwar scheiterte die Yuan-Dynastie daran, mit chinesischen Schiffen ein mongolisches Seeimperium zu errichten – die Invasionen Japans, Annams, Champas, Borneos und Javas schlugen bis 1292 fehl –, aber nun wurde Japan zur Errichtung einer eigenen Handelsflotte animiert. In der Zeit des Ashikaga-Shōgunats (1338–1573) und besonders, nachdem in China die Ming zur Herrschaft gelangt waren (1368), setzte regelmäßiger Verkehr zwischen Japan und China ein. Zahlreiche Fahrten dienten vor allem der wirtschaftlichen Förderung von Zen-Tempeln; Verträge zwischen dem Kaiser, der dabei die Fiktion der Tributherrschaft aufrechterhielt, und dem Shōgunat sollten den Umfang des Austauschs genau regeln. Dabei war der maritime Fernhandel für China selbst zweifellos von großem Vorteil; schon Marco Polo, der 1292 für seine Rückreise nach Venedig aus Sicherheitsgründen die See wählte, hatte die Stadt Quanzhou (Zayton) als einen der beiden bedeutendsten Häfen der Welt gerühmt. Er beobachtete hier die Verladung von Pfeffer nach Alexandrien und zahllose Schiffe, die aus Indien Perlen und Edelsteine herbeibrachten. Nur eine Episode blieb viel später die Flotte des Ming-Kaisers Yongle (Chengzu), der seinen Admiral Zheng He, einen muslimischen Eunuchen, siebenmal weiträumige Expeditionen nach Java, Sumatra, sogar in den Persischen Golf und nach Dschidda am Toten Meer unternehmen ließ (1405–1433); Zhengs Kontingent bestand zwar aus 317 Schiffen und 20.000 bis 32.000 Mann Besatzung – die größte Armada in Ostasien bis zum Zweiten Weltkrieg –, doch scheinen die Unternehmungen weniger einen kommerziellen als einen diplomatischen und politischen Zweck gehabt zu haben. Offenbar ging es den Chinesen um die Anerkennung des kaiserlichen Vorrangs unter vermeintlich abhängigen Staaten. Die Ming-Regierung verzichtete danach auf jede weitere Förderung des Seehandels. 1530 beschloss der Kaiser sogar, keine japanischen Händler mehr zu empfangen, und provozierte damit weitere Überfälle japanischer und auch chinesischer Seeräuber auf die Küsten seines Reiches.
Der Verkehr auf innerasiatischen und europäischen Straßen
Innerasiatische West-Ost-Verbindung
Die für die Kohärenz der mittelalterlichen Welt entscheidende Verbindung zwischen Europa und Asien war auch dort, wo ihr das Land die Basis bot, in ihrer Tragfähigkeit weitgehend von den Seewegen abhängig. Denn die große innerasiatische West-Ost-Verbindung, die man wegen des Handels mit chinesischer Seide in neuerer Zeit die „Seidenstraße(n)“ nennt und die mit ihren Hauptrouten das zentralasiatische Tarimbecken um die Sandwüste Taklamakan im Norden und Süden umgreift, endete im Westen an den Häfen des Schwarzen beziehungsweise Asowschen Meeres und Syriens, wenngleich sie auch mit weiteren Landrouten nach dem Inneren Europas vernetzt war. Wer hier herrschte – in der Antike etwa die Parther, im Mittelalter teilweise die Byzantiner –, der hatte eine ähnliche Schlüsselstellung inne wie seit dem 7. Jahrhundert sonst in der Levante die Muslime. Allerdings konnte das Straßensystem in seiner riesigen Ausdehnung von vielen tausend Kilometern zwischen Mittel- und Gelbem Meer nur ausnahmsweise von einer einzigen Macht kontrolliert werden; die nahezu unvermeidliche herrschaftliche Zersplitterung trug dazu bei, dass die Kommunikation zwischen Ausgangs- und Endpunkt auch hier den weiten Raum nicht ohne Zwischenträger überbrücken konnte – mit allen Konsequenzen für Verluste, Mutationen und Anreicherungen.





























