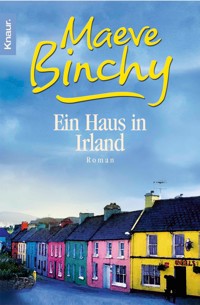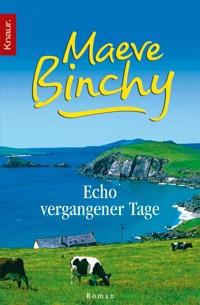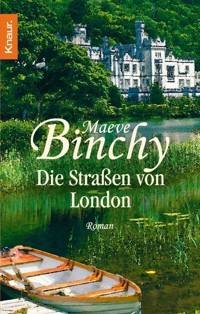6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gute Unterhaltung voller Wärme, Gefühl und Lebensweisheit! Clara Casey hat Sorgen mit ihren erwachsenen Töchtern: Adi kämpft ständig gegen oder für etwas – den Walfang, die Umwelt, fleischloses Essen –, während ihre Schwester Linda von einer Beziehung in die andere stolpert. Clara selbst muss außerdem mit den Anforderungen ihres neuen Jobs fertig werden, denn sie wurde eben zur Chefärztin in einer Dubliner Klinik ernannt. Leider ist der smarte Verwaltungschef Frank damit nicht sehr glücklich und legt Clara allerhand Steine in den Weg. Doch Clara lässt sich nicht unterkriegen … Wege des Herzens von Binchy: Familienschicksale im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Maeve Binchy
Wege des Herzens
Roman
Aus dem Englischen von Gabriela Schönberger
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Gute Unterhaltung voller Wärme, Gefühl und Lebensweisheit!
Clara Casey hat Sorgen mit ihren erwachsenen Töchtern: Adi kämpft ständig gegen oder für etwas – den Walfang, die Umwelt, fleischloses Essen –, während ihre Schwester Linda von einer Beziehung in die andere stolpert. Clara selbst muss außerdem mit den Anforderungen ihres neuen Jobs fertig werden, denn sie wurde eben zur Chefärztin in einer Dubliner Klinik ernannt. Leider ist der smarte Verwaltungschef Frank damit nicht sehr glücklich und legt Clara allerhand Steine in den Weg. Doch Clara lässt sich nicht unterkriegen …
Inhaltsübersicht
In Erinnerung an meine [...]
PROLOG
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
In Erinnerung an meine jüngere Schwester Renie.
Und mit großer Liebe und in Dankbarkeit für Gordon, der schlechte Zeiten erträglich macht und den guten einen magischen Zauber verleiht.
PROLOG
Manche Projekte brauchen eine Ewigkeit, bis sie endlich Realität werden.
Eines davon war der Umbau des stillgelegten Depots, das zum St. Brigid Hospital gehörte, eine hässliche Ansammlung unterschiedlich großer Lagerhallen. Früher war dort alles untergebracht, was das Krankenhaus benötigte, aber mittlerweile lag das Depot zu ungünstig. Eine neue Einbahnstraßenregelung war daran schuld, dass man eine lange und beschwerliche Fahrt quer durch Dublin auf sich nehmen musste, um von einem Ort zum anderen zu gelangen.
In diesem Teil von Dublin gab es immer noch die alten Arbeiterhäuser und Fabrikgebäude, die in moderne Wohnblocks umgestaltet worden waren. Dieser Teil der Stadt »boomte« und war enorm »in«, wie die Immobilienleute es beschrieben; bald würden Spekulanten auch ein Auge auf die Lagerhallen werfen und dem Krankenhaus St. Brigid ein Angebot von der Art unterbreiten, das man nicht ablehnen konnte.
Genau das war es, was Frank Ennis sich wünschte. Er hielt sich selbst für das Superhirn der Finanzverwaltung von St. Brigid, und eine riesige Finanzspritze, ein schöner Batzen Geld in seiner Amtszeit als Verwaltungschef, war genau das, was dem Krankenhaus fehlte.
Frank Ennis konnte das alles bereits Realität werden sehen.
Natürlich gab es jedes Jahr, wenn das Planungskomitee sich bei der Hauptversammlung traf, das eine oder andere Problem, das Frank davon abhielt, diese lästige Immobilie zu verkaufen und das Geld in das Krankenhaus zu stecken. In dem einen Jahr waren es die Rheumalobbyisten, die sich eine Rheumaambulanz wünschten. Dann gab es die Abteilung für Lungenkrankheiten, die ein Zentrum für Patienten mit Beschwerden der Atemwegsorgane einrichten wollte. Ganz zu schweigen von der sich zusehends stärker zu Wort meldenden Herzfraktion. Ihre Befürworter behaupteten, dass genügend wissenschaftliche Gutachten vorlägen, die bewiesen, dass Patienten auch ambulant betreut werden könnten – und folglich weniger Krankenhausbetten nötig wären –, wenn sie nur eine entsprechende Anlaufstelle hätten. Die Kardiologen kamen Frank vor wie Hunde, die sich in einen Knochen verbissen hatten – sie wollten nicht mehr davon ablassen.
Frank seufzte, da ihnen ein weiterer Nachmittag in dem engen, muffigen Besprechungszimmer der Klinikleitung bevorstand, deren Mitglieder bereits um den Tisch versammelt waren. Frank betrachtete freudlos die übliche Ansammlung von Menschen, die jedem beliebigen Klinikdirektorium hätte angehören können. Da war die – wie er sie nannte – Nonne in Zivil. Früher war St. Brigid ausschließlich von Nonnen geleitet worden; jetzt waren gerade mal vier Ordensschwestern übrig geblieben. Daneben saßen die offiziellen Vertreter der Gesundheitsbehörde, alles ältere Herrschaften, die bereits auf anderen Gebieten ihre Verdienste erworben hatten. Und da war der gutmütige amerikanische Philanthrop Chester Kovac, der etliche Meilen entfernt auf dem Land ein privates Gesundheitszentrum errichtet hatte.
Die Ordensschwester in Zivil würde wie immer alle Fenster aufreißen, so dass die Papiere über den Tisch geweht wurden, woraufhin irgendjemand die Fenster wieder schließen musste. Frank hatte dies viele Male miterlebt. Doch bei der heutigen Gelegenheit witterte er Morgenluft, und der Sieg schien ihm nahe, denn er hatte ein schriftliches Angebot über eine enorme Summe von einem Bauträger vorliegen, der ihnen sofort das umstrittene und für sie völlig nutzlose Grundstück um das Depot abkaufen würde – eine Summe, die jeden von ihnen aufhorchen lassen würde.
Unweigerlich würde daraufhin die Frage im Raum stehen, wofür das Geld am besten auszugeben sei. Würde es in den Topf für die ultramodernen Computertomographen wandern? Oder doch eher dazu verwendet werden, die Fassade des Krankenhauses radikal umzugestalten? Wie bei vielen Gebäuden aus dieser Zeit, dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, führte eine unpraktische Steintreppe hinauf zum Haupteingang. Eine Rampe oder Ähnliches wäre wesentlich geeigneter, um schwachen und gebrechlichen Patienten leichter Zugang zu gewähren.
Außerdem herrschte stets Bettenmangel in der chirurgischen Gynäkologie, und es wurden mehr Isolierzimmer benötigt. Auch die Überwachungsstation hatte in der letzten Zeit großen Druck gemacht, da man zu einer Intensivstation aufgewertet werden wollte, und das kostete Geld.
Wie auch immer. Auf jeden Fall würden sie heute dem Bauträger eine Antwort geben, sein Angebot akzeptieren und endlich damit aufhören können, Zeit für die diversen Einzelinteressen zu verschwenden, da doch alle nur ihren Machtbereich ausdehnen wollten.
Man servierte Kaffee und Kekse, die Tagesordnung wurde verteilt, und die Besprechung begann. Doch Frank wusste von Anfang an, dass etwas nicht stimmte.
Dummerweise standen die Mitglieder der Klinikleitung unter dem unheilvollen Einfluss einer erst kürzlich veröffentlichten Statistik. Diese schien zu belegen, dass die Iren überdurchschnittlich von Herzinfarkten bedroht waren, was wahrscheinlich mit ihrem Lebensstil und ihrer Ernährung zusammenhing, wobei Alkohol und Zigaretten zweifellos eine große Rolle spielten. Alle am Tisch diskutierten mit größtem Eifer Methoden, wie man betroffenen Patienten wieder neuen Lebensmut vermitteln könnte. Wie großartig wäre es, an vorderster Front im Kampf gegen Herzkrankheiten zu stehen, mit einer Tagesklinik als Anlaufstelle für diese Patienten. Frank Ennis hätte die Organisation verfluchen können, die nur Tage vor seinem Direktoriumstreffen diese Zahlen veröffentlicht hatte. Seinem Empfinden nach hätte durchaus Absicht dahinterstecken können – die Kardiologen in St. Brigid waren wirklich ziemlich arrogante Schnösel und hielten sich für allmächtig.
Hilfesuchend wanderte sein Blick zu Chester Kovac, in solchen Situationen normalerweise ein Mann mit gesundem Menschenverstand, auf den man sich verlassen konnte. Doch dieses Mal hatte Frank sich getäuscht. Chester war nämlich der Ansicht, dass dies eine Idee von visionärer Kraft sei und dass er sich freuen würde, wenn St. Brigid bei dieser Bewegung in vorderster Reihe mitmarschieren würde. Schließlich ginge es nur um Geld.
Frank schäumte vor Wut. Chester konnte leicht sagen, dass es nur um Geld ginge; er hatte schließlich jede Menge davon. Sicher war er sehr großzügig, aber was wusste er schon? Er war Amerikaner polnischer Abstammung mit einem irischen Großvater – ein leichtes Opfer für jeden, der es auf ihn abgesehen hatte.
Frank wurde immer wütender.
»Es ist nicht nur Geld, Chester. Hier steht eine riesige Summe auf dem Spiel, mit der man St. Brigid enorm aufwerten könnte.«
»Vergangenes Jahr wollten Sie dieses Stück Land schon mal verkaufen, um einen Parkplatz daraus zu machen«, sagte Chester.
»Aber das Angebot hier ist weitaus besser.« Frank war rot im Gesicht, so sehr regte ihn die ganze Sache auf.
»Nun, wir wären dumm gewesen, hätten wir vergangenes Jahr Ihren Vorschlag angenommen, Frank, wenn man sieht, wie sich die Dinge entwickelt haben«, entgegnete Chester freundlich, aber mit Nachdruck.
»Aber ich habe Wochen gebraucht, um das Angebot in die Höhe zu treiben …«
»Und letztes Jahr waren wir uns alle einig, dass wir keinen Parkplatz wollten.«
»Aber das hier ist kein Parkplatz. Hier geht es um Luxuswohnungen – mit gehobener Ausstattung …«, ereiferte sich Frank.
»Nicht unbedingt Sinn und Zweck eines Krankenhauses«, konterte Chester Kovac.
»Wenn wir schon auf einem so teuren Grundstück sitzen, dann sollten wir das auch nützen«, meldete sich einer der ehemaligen Industriemagnaten zu Wort.
»Wir werden es auch nützen. Wir werden ein kleines Vermögen dafür bekommen und es in das Krankenhaus investieren!« Frank hatte das Gefühl, es mit Leuten zu tun zu haben, die wirklich sehr schwer von Begriff waren.
Die Nonne in Zivil meldete sich zu Wort. »Wir würden ein Projekt bevorzugen, das etwas mehr dem Geist des ursprünglichen Ordens entspricht, der einst dieses Krankenhaus geleitet hat.«
»Wohnungen werden wohl kaum dem Geist des Ordens widersprechen, oder?«, fragte Frank.
»Luxuswohnungen mit gehobener Ausstattung mögen vielleicht nicht ganz im Sinn der wohltätigen Schwestern sein«, wandte Chester ein.
»Die wohltätigen Schwestern sind doch schon längst alle weg und ausgestorben!« Frank explodierte.
Chesters Blick fiel auf das Gesicht der Nonne in Zivil, die von dieser Bemerkung sehr verletzt zu sein schien. Er musste wohl wieder mal vermitteln.
»Mr.Ennis möchte damit ausdrücken, dass das Werk der Schwester vollendet und ihre Arbeit getan ist. Aber sie haben uns ihr Vermächtnis hinterlassen. Die hiesige Gemeinde benötigt dringend mehr medizinische Versorgung und weniger Luxuswohnungen mit Garagen für zwei Autos, die wiederum die Straßen noch weiter verstopfen werden. Sie benötigt mehr Einrichtungen im Gesundheitswesen. Den Menschen muss dabei geholfen werden, nach dem Schock bei einem Herzinfarkt wieder auf die Füße zu kommen und etwas aus ihrem Leben zu machen. Und um ganz offen zu sein – wenn es zur Abstimmung kommt, wäre mir dies das liebste Ergebnis, und dafür werde ich auch meine Stimme abgeben.«
Sein Monolog hatte etwas sehr Würdevolles an sich.
Frank Ennis war bitter enttäuscht. Sie würden das Grundstück wieder nicht loswerden, wie er an diesem Morgen noch so zuversichtlich gehofft hatte. Die Kardiologen hatten gewonnen. Es würden Monate vergehen, ehe man sich über die Kosten einig war, und weitere Monate, bis das Gebäude endlich stand und eingerichtet war. Man würde einen neuen Direktor berufen und neues Personal einstellen müssen. Frank stieß einen tiefen Seufzer aus. Warum besaßen diese Menschen nicht einen Funken Verstand? Sie hätten sich so viele Wünsche auf ihrer Liste erfüllen können, würden sie nur begreifen, wie diese Welt funktionierte. Stattdessen machten sie alles nur noch komplizierter.
Irgendwie stand er den Rest der Besprechung durch und hakte dabei automatisch einen Tagesordnungspunkt nach dem nächsten ab. Dann kam es zur Abstimmung über die Nutzungsänderung des zu St. Brigid gehörenden Geländes, besser bekannt als das sogenannte frühere Depot. Wie zu erwarten, war man einstimmig der Ansicht, dass dort eine Tagesklinik für koronare Herzerkrankungen errichtet werden sollte.
Frank schlug eine Machbarkeitsstudie vor, wurde aber prompt überstimmt. Keiner wollte etwas davon hören – sonst würde sie die Sache weitere sechs Jahre diskutieren. Beschlossen war beschlossen. Und machbar war es auch.
Trotzdem würde eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden müssen, sobald man sich über die Kosten geeinigt, Ausschreibungen diverser Bauunternehmen erhalten und mit der kardiologischen Abteilung die nötige Anzahl an neuen Mitarbeitern ausgehandelt hatte.
Alle blätterten in ihren Terminkalendern, und man einigte sich auf ein Datum.
Frank hatte einen Termin in sechs Monaten vorgeschlagen. Chester Kovac war jedoch der Meinung, dass ein paar Wochen genügen müssten, um die Angebote einzuholen. Die Baufirmen müssten doch wild auf Aufträge sein. Der Vertreter der Kardiologen bedankte sich im Namen seiner Kollegen von St. Brigid und kündigte an, dass sie ihre Forderungen rasch formulieren würden.
»Forderungen!«, schnaubte Frank Ennis.
»Und selbstverständlich muss der Posten des Direktors ausgeschrieben werden«, sagte die Nonne in Zivil.
»O ja, in der Tat. Ich wage zu vermuten, dass hinter den Kulissen bereits einer darauf wartet, hier bald eine ruhige Kugel schieben zu dürfen«, murmelte Frank, noch immer verbittert wegen seiner Niederlage.
»Einer oder eine«, fügte die Nonne mit fester Stimme hinzu.
»Gott – an die Frauenquote habe ich natürlich nicht gedacht«, sagte Frank leise. Er war ein Mann, in dessen Leben Frauen nur eine untergeordnete Rolle spielten. Im Golfclub reagierte er jedes Mal empört, wenn er wegen des Damentags warten musste. Zu heiraten hatte er ebenfalls vollkommen vergessen, was für alle Beteiligten jedoch wahrscheinlich das Beste gewesen war. »Er oder sie, selbstverständlich«, sagte er laut. »Tut mir leid, aber ich bin noch vom alten Schlag, Schwester.«
»Das ist aber schlecht für Sie, Mr.Ennis«, erwiderte die Nonne in Zivil, während sie schwungvoll das Fenster öffnete, um ein weiteres Mal frische Luft ins Zimmer zu lassen.
KAPITEL EINS
Es sei nur ein kleines Budget vorhanden, um ihr neues Büro einrichten zu können, hatte man Clara Casey erklärt. Ein anstrengender Verwalter mit lauter Stimme, wirr abstehenden Haaren und irritierender Körpersprache hatte dabei auf den langweiligen, ungemütlichen Raum mit den grauen Wänden und den plumpen Aktenschränken aus Stahl gedeutet. Nicht unbedingt die Art von Büroraum, die eine Fachärztin nach Studium und dreißig Jahren Erfahrung im Gesundheitsbetrieb als Aufstieg empfinden würde. Aber es war nie klug, bereits am Anfang zu kritisch zu sein.
Wie hieß der Mann noch gleich? »Tja, in der Tat … äh … Frank«, sagte sie. »Aber hieraus lässt sich sicher etwas machen.«
Mit dieser Antwort hatte Frank nicht gerechnet. Die gutaussehende Brünette in dem schicken lila Strickkostüm, die auf die fünfzig zugehen mochte, lief in dem Zimmer auf und ab wie eine Löwin im Käfig.
»Doch leider nur in einem gewissen Rahmen, Dr.Casey, vom Finanziellen her, fürchte ich. Aber hier ein neuer Anstrich und dort ein nettes Möbelstück, ein femininer Touch sozusagen – das wird Wunder bewirken.« Er lächelte nachsichtig.
Clara musste sich zusammenreißen, um nicht ausfallend zu werden.
»Natürlich, ja, genau dieselben Maßnahmen würde ich ergreifen, um meine eigene Wohnung zu verschönern. Doch hier liegt die Sache vollkommen anders, denn ich kann nicht von einem Zimmer aus arbeiten, das nur über einen endlos langen Korridor zu erreichen ist. Wenn ich diese ambulante Klinik leiten soll, muss ich näher am Zentrum des Geschehens sitzen.«
»Aber alle werden wissen, wo Sie zu finden sind. Ihr Name wird an der Tür stehen«, stammelte Frank.
»Ich habe definitiv nicht die Absicht, mich hier in diese Ecke zu verkriechen«, erwiderte Clara.
»Dr.Casey, Sie wissen, unsere Mittel sind begrenzt, Sie waren sich im Klaren über die Natur dieser Einrichtung, als Sie die Stelle annahmen.«
»Wo mein Schreibtisch stehen sollte, war zu dem Zeitpunkt kein Thema, das wurde mit keinem Wort erwähnt. Die Raumfrage sollte später geklärt werden. Und heute ist später.«
Frank gefiel ihr Tonfall ganz und gar nicht. Sie hörte sich an wie eine Lehrerin.
»Und das ist der fragliche Raum«, sagte er.
Sie war kurz versucht, ihn zu bitten, sie Clara zu nennen, doch ihr fiel gerade noch rechtzeitig ein, dass dieser Mann, wollte sie hier etwas bewirken, ihre Autorität würde anerkennen müssen. Sie kannte diesen Typus.
»Ich denke nicht, Frank«, entgegnete sie.
»Können Sie mir vielleicht zeigen, wo man Sie sonst unterbringen könnte? Das Zimmer der Diätassistentin ist noch kleiner als das hier, die Sekretärin hat gerade Platz für sich und die Akten. Der Physiotherapeut muss sich das Zimmer mit einer Unmenge an Gerätschaften teilen, die Krankenschwestern brauchen ihre Station für sich selbst, und das Wartezimmer gehört nun mal vorn an den Eingang. Könnten Sie mir also freundlicherweise verraten, woher wir ein anderes Büro für Sie nehmen sollen, wenn Ihnen dieser absolut passende Raum nicht zusagt?«
»Ich werde in der Halle sitzen«, erklärte Clara.
»Die Halle? Welche Halle?«
»Der große Raum, wenn Sie durch die Glastüren kommen.«
»Aber, Dr.Casey, das geht doch nicht.«
»Und warum nicht, Frank?«
»Sie säßen da wie auf einem Präsentierteller«, stammelte er.
»Ja und?«
»Sie hätten keinerlei Privatsphäre, es sähe aus … es wäre einfach nicht richtig. Außerdem wäre da nur Platz für einen Schreibtisch.«
»Mehr als einen Schreibtisch brauche ich auch nicht.«
»Nein, Dr.Casey, bei allem Respekt, aber Sie brauchen mehr als einen Schreibtisch. Viel mehr. Zum Beispiel einen Aktenschrank«, beendete Frank lahm seinen Satz.
»Ich kann doch einen im Zimmer der Sekretärin für mich reservieren.«
»Und wohin mit den Krankenblättern Ihrer Patienten?«
»In die Schwesternstation.«
»Sie werden ab und zu einen ruhigen Ort benötigen, um mit den Patienten zu reden.«
»Wir können ja diesen Raum hier, der Ihnen so am Herzen liegt, zum Beratungszimmer erklären, und das können wir dann alle benutzen, wenn wir es brauchen. Man könnte das Zimmer in ruhigen, warmen Tönen streichen und neue Vorhänge besorgen; ich suche sie auch aus, wenn Sie wollen. Dazu ein paar Stühle, ein runder Tisch. Okay?«
Frank wusste, dass die Schlacht verloren war, aber er wagte einen letzten Vorstoß.
»So etwas hat es hier noch nie gegeben, Dr.Casey, noch nie.«
»Eine ambulante Herzklinik hat es hier auch noch nie gegeben, Frank, also hat es wenig Sinn, Dinge miteinander zu vergleichen, die es so noch nie gegeben hat. Wir richten diese Tagesklinik von Grund auf neu ein, und wenn ich sie leiten soll, dann werde ich das so machen, wie ich es für richtig halte.«
Clara spürte, dass er ihr von der Tür aus noch immer missbilligend nachsah, als sie zu ihrem Wagen ging. Sie hielt den Kopf hoch und fror das aufgesetzte Lächeln auf ihrem Gesicht ein.
Sie öffnete die Tür des Autos und setzte sich hinter das Steuer.
Irgendjemand würde Frank nach der Arbeit heute sicher fragen, wie sie denn so sei. Sie wusste, was er antworten würde. »Eine beschissene Emanze.«
Auf Nachfrage würde er sie als machthungrig bezeichnen, als eine Frau, die es nicht erwarten könne, es sich auf ihrem Chefsessel bequem zu machen und die Muskeln spielen zu lassen. Wenn er wüsste. Niemand durfte es je erfahren. Niemand würde je wissen, wie wenig Clara Casey diesen neuen Job haben wollte. Doch sie hatte zugestimmt, ihn für ein Jahr zu übernehmen. Und daran würde sie sich auch halten.
Als Clara sich in den Nachmittagsverkehr einfädelte, fühlte sie sich sicher genug, das aufgesetzte Lächeln wie eine Maske vom Gesicht zu nehmen. Sie hatte vor, unterwegs in den Supermarkt zu fahren und eine Auswahl an Pastasaucen zu kaufen. Sie konnte nach Hause bringen, was sie wollte, eines der Mädchen hatte immer etwas daran auszusetzen. Der Käse war zu würzig, die Tomaten zu geschmacklos, die Pestosauce zu trendig. Aber bei drei Auswahlmöglichkeiten würden sie vielleicht etwas Passendes finden. Clara schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die beiden jungen Damen heute Abend guter Laune wären.
Gerade heute könnte sie es nicht ertragen, wenn Adi und ihr Freund Gerry wieder einmal einen ihrer häufigen ideologischen Dispute zum Thema Umwelt, Walfang oder Käfighaltung von Hühnern hätten. Oder wenn Linda sich zum wiederholten Mal auf ein Abenteuer mit einem Nichtsnutz eingelassen hatte, der sie nach der ersten Nacht wieder nicht angerufen hatte.
Clara seufzte.
Man hatte ihr erzählt, dass Mädchen im Teenageralter schrecklich seien, doch mit zwanzig Jahren würde sich die Lage langsam wieder bessern. Wie üblich war es bei Clara genau umgekehrt. Ihre beiden Töchter, die eine dreiundzwanzig, die andere einundzwanzig Jahre alt, waren unerträglich. Als Teenager waren sie bei weitem nicht so schlimm gewesen. Aber natürlich hatte damals auch noch ihr Vater, dieser Mistkerl von Alan, im Haus gewohnt, was einiges erleichtert hatte. In gewisser Weise zumindest.
Adi Casey sperrte die Tür auf und trat in das Haus, das sie mit ihrer Schwester und ihrer Mutter bewohnte. Haus der fliegenden Hitzen, wie ihre Schwester Linda ihr Heim sarkastisch zu nennen pflegte. Sehr witzig.
Ihre Mutter war noch nicht zu Hause. Umso besser, dachte Adi, so hätte sie wenigstens Gelegenheit, genüsslich und lange zu baden und dabei das neue Badeöl auszuprobieren, das sie auf dem Nachhausweg auf dem Markt gekauft hatte. Sie hatte außerdem ein wenig Bio-Gemüse mitgenommen. Wer konnte schon wissen, welche chemisch vergifteten, gentechnisch veränderten Lebensmittel aus dem Supermarkt ihre Mutter wieder anschleppen würde.
Zu ihrem großen Missfallen hörte Adi jedoch Musik aus dem Badezimmer dringen. Linda war ihr offenbar zuvorgekommen. Mutter hatte immer wieder von einem zweiten Bad gesprochen, wenigstens von einer Dusche, aber in der letzten Zeit war das kein Thema mehr gewesen. Und da ihre Mutter die ersehnte tolle Stelle nicht bekommen hatte, war momentan die Zeit denkbar ungünstig, darauf zu bestehen. Adi lieferte zu Hause einen kleinen Teil ihres Gehalts ab, aber als Lehrerin verdiente sie nun mal nicht viel. Linda hingegen steuerte gar nichts bei. Sie studierte zwar noch, wäre aber nie auf die Idee gekommen, sich einen Job zu suchen. Ihre Mutter finanzierte alles aus eigener Kraft und hatte folglich auch das Sagen.
Ehe Adi in ihr Zimmer gehen konnte, klingelte das Telefon. Es war ihr Vater.
»Wie geht es meiner schönen Tochter?«, fragte er.
»Ich glaube, sie badet gerade, Dad. Soll ich sie holen?«
»Ich habe dich gemeint, Adi.«
»Du meinst immer den, mit dem du gerade sprichst, Dad. Das kennen wir doch.«
»Adi, bitte. Ich versuche doch nur, nett zu sein. Jetzt geh nicht gleich wieder an die Decke.«
»Okay, Dad, sorry. Was gibt’s?«
»Kann ich nicht einfach mal anrufen, um meinen …«
»Das ist nicht deine Art. Du rufst nur dann an, wenn du was willst.« Adis Tonfall war unüberhörbar scharf.
»Wird deine Mutter heute Abend zu Hause sein?«
»Ja.«
»Um wie viel Uhr?«
»Wir sind eine Familie, Dad, kein Hotel, in dem sich die Gäste schriftlich anmelden.«
»Ich will mit ihr reden.«
»Dann ruf sie später an.«
»Sie ruft nie zurück.«
»Dann komm vorbei.«
»Das mag sie nicht, das weißt du. Ihr Haus und so weiter.«
»Ich bin zu alt für diese Spielchen zwischen euch. Das geht jetzt schon zu lange. Bring das endlich mal auf die Reihe, Dad. Bitte.«
»Könntet ihr zwei mir einen Gefallen tun und heute Abend nicht zu Hause sein? Linda und du, meine ich. Ich will mit eurer Mutter etwas besprechen.«
»Nein, wir werden nicht außer Haus sein.«
»Ich spendiere euch ein Abendessen.«
»Du willst uns dafür bezahlen, dass wir unser eigenes Haus verlassen?«
»Versuch doch mal, mir zu helfen.«
»Warum sollte ich? Du hast die ganze Zeit über nie versucht, irgendjemandem bei irgendetwas zu helfen.«
»Warum willst du mir nicht einmal diesen kleinen Gefallen tun?«
»Weil Mam angekündigt hat, uns zu bekochen, um ihren neuen Job zu feiern. Weil es schon lange geplant ist und ich das jetzt nicht absagen werde. Tut mir leid, Dad.«
»Ich komme trotzdem vorbei.« Und damit legte er auf.
Linda kam tropfend und in ein Handtuch gewickelt aus dem Badezimmer. Missmutig betrachtete Adi ihre Schwester. Linda, die sich von Junkfood ernährte, rauchte und trank, sah einfach umwerfend schön aus, selbst das lange, nasse Haar sah an ihr besser aus als ein neuer, schicker Haarschnitt an einer anderen Frau. Das Leben war einfach ungerecht.
»Wer war das am Telefon?«, fragte Linda.
»Dad. Er hat sich nicht abwimmeln lassen.«
»Was wollte er?«
»Mit Mam reden. Er hat gesagt, er gibt uns Geld, wenn wir heute Abend nicht zu Hause sind.«
Linda lächelte. »Tatsächlich? Wie viel?«
»Ich habe nein gesagt. Kommt nicht in Frage.«
»Das war sehr selbstherrlich von dir.«
»Ruf ihn doch an und verhandle du mit ihm, wenn du unbedingt willst. Ich werde mich jedenfalls nicht vertreiben lassen.«
»Ich vermute mal, es geht um die Scheidung«, sagte Linda.
»Warum sollten sie sich die Mühe machen und sich jetzt noch scheiden lassen? Sie hat ihn damals, als sie es hätte tun sollen, nicht aus dem Haus geworfen. Es läuft doch auch so bestens, oder? Für ihn mit seiner Tussi und für Mam mit uns.« Adi sah keinen Grund, daran etwas zu ändern.
Linda zuckte die Schultern. »Ich wette, sie ist schwanger, die Tussi. Ich wette mit dir, dass er ihr das sagen will.«
»Gott«, meinte Adi, »jetzt wünschte ich mir, ich hätte sein Bestechungsgeld doch angenommen, wenn das der Grund ist. Ich glaube, ich rufe ihn noch mal an.«
Letzten Endes schickten sie ihm eine SMS: »Haus tochterfrei ab 19:30 Uhr. Sind bei Quentins. Schicken dir die Rechnung. Gruß, Adi.«
»Alan? Alan, es rauscht so komisch im Telefon. Kannst du mich hören? Ich bin’s, Cinta.«
»Ich weiß, dass du es bist, Schatz.«
»Hast du es ihr gesagt?«
»Ich bin gerade auf dem Weg zu ihr, Schatz.«
»Du wirst doch nicht wieder kneifen wie letzte Woche?«
»So würde ich das nicht nennen …«
»Dann lass es nicht wieder so weit kommen, bitte, Alan.«
»Nein, Schatz, du kannst dich auf mich verlasen.«
»Das muss ich auch, Alan, dieses Mal muss ich mich auf dich verlassen können.«
Clara betrat das Haus, das verdächtig ruhig war. Sie hatte erwartet, dass beide Mädchen zu Hause wären. Auf dem Boden im Badezimmer lagen nasse Handtücher. Linda hatte wohl gebadet. Auf dem Küchentisch lagen Flugblätter über die Möglichkeit, Plastik zu recyceln, also war auch Adi hier gewesen. Doch weit und breit war nichts von den beiden zu sehen. Dann entdeckte Clara den Zettel am Kühlschrank.
Dad kommt gegen acht Uhr, um mit Dir zu reden. Er hat mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, dass er unter vier Augen mit Dir sprechen will. Ohne uns. Genauer gesagt ist er sehr deutlich geworden. Er hat sogar angeboten, uns ein Abendessen zu spendieren, und deswegen gehen wir ins Quentins. Grüße von uns beiden, Adi.
Was mochte Alan ausgerechnet heute Abend von ihr wollen? Am Ende eines langen, ermüdenden, enttäuschenden Tages, an dem sie als krönenden Abschluss diesen seelenlosen Ort zu sehen bekommen hatte, der für das ganze nächste Jahr im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen würde?
Nach langen Stunden, in denen sie einem nervenden, bürokratischen Krankenhausvertreter Theater vorgespielt und mit markigen Sprüchen ihr Revier markiert hatte. Nachdem sie in drei verschiedenen Feinkostabteilungen nach Pastasaucen für ihre heiklen Töchter gesucht hatte. Und jetzt saßen die beiden in einem schicken Restaurant, und sie – Clara – musste sich mit Alan und seinen idiotischen Ideen auseinandersetzen, die er sich wahrscheinlich wieder einmal ausgedacht hatte, um ihre finanzielle Abmachung zu ihren Ungunsten zu korrigieren.
Clara verstaute die Lebensmittel. Kam nicht in Frage, dass Alan mitessen würde. Nicht mehr. Diese Zeiten waren vorbei. Clara nahm zwei Flaschen Mineralwasser aus dem Kühlschrank und versteckte die beiden Flaschen australischen Sauvignon Blanc hinter den Joghurtbechern und den fettreduzierten Brotaufstrichen. Dort würde Alan sie niemals finden. Und vielleicht würde sie den Wein ja dringend brauchen, wenn er gegangen war.
Adi und Linda machten es sich bei Quentins bequem.
»Mit dem, was die da drüben an dem Tisch bezahlen, könnte man leicht ein kleines Land eine ganze Woche lang ernähren«, sagte Adi missbilligend.
»Ja, aber es würde nicht halb so viel Spaß machen«, erwiderte Linda.
»Manchmal frage ich mich, ob wir tatsächlich Schwestern sind«, meinte Adi.
»Das hast du dich doch immer schon gefragt.« Linda trank einen Schluck von ihrem Tequila Sunrise.
»Wann wird er wohl wieder gehen, was denkst du?«, fragte Adi.
»Wer, der Typ drüben an dem Tisch?«
»Nein, Dad, du Dummerchen.«
»Sobald er bekommen hat, was er will. Warum sollte er anders sein als andere Männer?« Linda versuchte, den Kellner auf sich aufmerksam zu machen. Noch ein Tequila Sunrise, und sie wäre so weit, zu bestellen.
Eigentlich hatte Clara in ein paar bequemere Kleidungsstücke schlüpfen wollen, aber das Telefon stand einfach nicht still, und so blieb keine Zeit mehr. Ihre Mutter wollte unbedingt wissen, wie ihr neues Büro aussah.
»Hast du einen Teppichboden?« Ihre Mutter kam immer gleich zur Sache.
»Im ganzen Gebäude ist ein sehr moderner Bodenbelag verlegt.«
»Also nicht.« Clara sah deutlich vor sich, wie der Mund ihrer Mutter wie eine Mausefalle zuschnappte. So hatte sie reagiert, als sie sich mit Alan verlobt, als sie ihn geheiratet und als sie sich von ihm getrennt hatte. Die Mausefalle war bereits viele Male zugeschnappt.
Dann hatte ihre Freundin Dervla angerufen und wissen wollen, welche Schwingungen ihr neues Büro ausstrahlte.
»Die von Champignons und Magnolien«, hatte Clara ihr geantwortet.
»Gott, was soll das denn heißen?«
»Das sind die Farben, in denen es im Moment gestrichen ist.«
»Aber das kannst du doch ändern.«
»O ja, selbstverständlich.«
»Dann sind es nicht nur die Farben, die dich stören.«
»Was stört mich denn?«
»Keine Ahnung. Hast du schon jemanden von deinen Kollegen und Mitarbeitern kennengelernt?«
»Nein, es war so lebendig wie auf einem Friedhof.«
»Könnte man vielleicht sagen, dass dir dort rein gar nichts so richtig zugesagt hat? Habe ich recht?«
»Du hast recht wie immer, Dervla«, erwiderte Clara seufzend.
»Hör mal, Philip ist bei einem Meeting und braucht ausnahmsweise nichts zu essen. Würde es dir helfen, wenn ich mit einer Flasche Wein und einem halben Kilo Würstchen vorbeikäme? Früher hat das was genützt.«
»Nicht heute Abend, Dervla. Alan, der Mistkerl, hat die Mädchen bestochen, damit sie zu Quentins gehen, weil er mir etwas zu sagen hat und mich etwas fragen will. Was kann er jetzt noch von mir wollen, möchte ich wissen.«
»Gestern war ich bei einer Besprechung, und einer der Punkte auf der Tagesordnung hieß ADM. Ich habe doch tatsächlich gedacht, das heißt, Alan, der Mistkerl, weil du ihn nie anders nennst.«
Clara lachte. »Was hieß es denn?«
»Keine Ahnung. Außendienstmitarbeiter, so was in die Richtung.« Dervla war sich nicht sicher.
»Kein Mensch käme je auf die Idee, dass du so clever bist, Dervla. Du tust immer so, als könntest du nicht bis drei zählen.«
»Aber das hat auch seine Vorteile.«
»Wäre ich doch nur so gerissen wie du. Ich habe zwar keine Ahnung, was er von mir will, aber was immer es auch ist, ich will es ihm auf keinen Fall geben.«
»Wenn dir nichts daran liegt, dann gib es ihm doch. Natürlich musst du ein großes Theater darum machen, aber wenn es dir egal ist, gib ihm, was er haben will, und vergiss die Sache.«
»Aber was kann das sein? Das Haus bekommt er nicht. Die Mädchen will er nicht. Sie sind außerdem alt genug, um ihre eigenen Wege zu gehen, und sie werden wohl kaum zu ihm wollen.«
»Vielleicht hat er einen grippalen Infekt und will sich von dir untersuchen lassen.«
»Nein, ich habe ihn nie behandelt. Ich habe von Anfang an darauf bestanden, dass er zu Sean Murray gehen soll.«
»Vielleicht will er seine junge Freundin heiraten und braucht die Scheidung.«
»Aber er käme doch nie auf den Gedanken, sie zu heiraten.«
»Woher willst du das wissen?«
»Die Mädchen haben mir das erzählt, und sogar er versucht, mir das unterzujubeln, wenn er glaubt, dass ich ihm zuhöre.«
»Und, wirst du ihm zuhören?«
»Nur bedingt. Ich weiß, ihr denkt alle, dass ich diese Geschichte schon vor Urzeiten hätte endgültig beenden sollen. Wer weiß? Vielleicht mache ich es dieses Mal. Vielleicht auch nicht.«
»Viel Glück, Clara.«
»Würstchen und Wein wären mir allerdings lieber.«
»Ein andermal, Clara.«
Dann war da noch eine E-Mail aus dem Malergeschäft, mit der Bitte, doch am nächsten Vormittag im Laden vorbeizukommen, um eine Farbmusterkarte abzuholen; außerdem eine Anfrage von ihrer Cousine aus Nordirland, die mit ihrem Damenclub nach Dublin kommen wollte. Clara sollte ihr bitte ein lohnendes Ausflugsziel vorschlagen, wo der Bus parken und sie zu einem annehmbaren Preis zu Mittag essen, Souvenirs kaufen und ein wenig frische Landluft schnuppern könnten. Schließlich kam noch eine Nachbarin vorbei, mit der Bitte um Claras Unterstützung beim Protest gegen ein Rockkonzert, das ihnen in drei Monaten mit ohrenbetäubendem Lärm drohte. Und dann war es schon acht Uhr, und Alan stand vor der Tür.
Er sah gut aus. Unerträglich gut. Viel jünger als seine achtundvierzig Jahre. Unter einem dunklen Jackett trug er ein zitronengelbes Hemd mit offenem Kragen. Pflegeleicht, wie Clara bemerkte. Kein mühseliges Bügeln von Hemdkrägen und Manschetten für die Tussi. Alan hatte eine Flasche Wein in der Hand.
»Das ist etwas zivilisierter, dachte ich mir«, sagte er.
»Zivilisierter als was genau?«, fragte Clara.
»Als sich gegenüberzusitzen und sich böse anzustarren. Gott, du siehst gut aus, das ist eine wirklich schöne Farbe. Ist das erikafarben oder mauve?«
»Ich weiß nicht genau.«
»O doch, das weißt du, du kennst dich gut aus mit Farben. Vielleicht ist es eher violett oder lila oder …?«
»Vielleicht, Alan. Komm doch rein.«
»Sind die Mädchen nicht da?«
»Nein, du hast ihnen doch Geld gegeben, damit sie zu Quentins gehen können, schon vergessen?«
»Ich habe gesagt, ich würde ihnen ein Abendessen spendieren. Ich habe aber nicht gewusst, dass sie gleich so zuschlagen würden. Na ja, so ist die Jugend heutzutage.«
»Tja, nun, darüber weißt du ja bestens Bescheid, Alan. Komm rein und setz dich, wenn du schon mal da bist.«
»Danke. Soll ich den Korkenzieher holen?«
»Das ist mein Haus. Ich werde meinen Korkenzieher und meine Gläser holen, wenn ich es für richtig halte.«
»Hey, hey, Clara, ich habe dir eine Friedenspfeife mitgebracht, sozusagen einen Friedenswein. Wieso bist du so giftig?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung. Kann es vielleicht etwas damit zu tun haben, dass du mich jahrelang betrogen und belogen und mir versprochen hast, dass alles vorbei ist, obwohl nichts vorbei war, dass du mich verlassen und mir alle Anwälte im Land auf den Hals gehetzt hast?«
»Du hast das Haus bekommen.« Für Alan war die Sache einfach.
»Ja, ich habe das Haus bekommen, das ich bezahlt habe. Sonst habe ich nichts bekommen.«
»Das haben wir doch längst alles hinter uns, Clara. Menschen verändern sich.«
»Ich nicht.«
»Doch, auch du, Clara. Wir alle haben uns verändert. Du willst das nur nicht sehen.«
Plötzlich fühlte sie sich sehr müde. »Was willst du, Alan? Was willst du von mir?«
»Die Scheidung.«
»Die was?«
»Die Scheidung.«
»Aber wir sind geschiedene Leute, wir leben seit vier Jahren getrennt, in Gottes Namen.«
»Aber nicht legal.«
»Aber du hast gesagt, du willst nicht wieder heiraten. Du und Cinta, ihr bräuchtet keinen schriftlichen Vertrag.«
»Brauchen wir auch nicht. Aber weißt du, jetzt ist sie schwanger, und du verstehst schon, was ich meine, oder?«
»Ich verstehe es nicht.«
»Doch, du verstehst es, Clara, du willst es nur nicht zugeben. Es ist vorbei. Es ist schon lange vorbei. Wieso ziehen wir nicht endlich einen Schlussstrich?«
»Geh, Alan.«
»Was?«
»Geh, Alan, und nimm deinen Friedenswein mit. Mach ihn zu Hause auf. Du hast dir heute den falschen Abend ausgesucht.«
»Aber es wird so oder so zur Scheidung kommen. Warum kannst du dich nicht anständig und freundlich verhalten?«
»Ja, Alan, das frage ich mich auch«, sagte Clara, stand auf und schob ihm die ungeöffnete Flasche Wein über den Tisch hinweg zu.
Wie gern hätte sie das Gefühl gehabt, die Sache sei vorbei. Es war so unbefriedigend, alles in der Schwebe zu lassen, aber Clara würde nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel machen und sich nach seinem Zeitplan richten. War es möglich, dass sie insgeheim doch noch Hoffnungen für ihre Beziehung hegte?
Auch wenn die Sache noch nicht endgültig ausgestanden war – genau so wollte sie es im Moment haben. Clara blieb so lange stehen, bis Alan begriff, dass er tatsächlich gehen sollte, und irgendwann ging er dann.
»Cinta? Schatz?«
»Bist du’s, Alan?«
»Wie viele andere Männer nennen dich Cinta und Schatz?« Sein Lachen war dünn.
»Was hat sie gesagt?«
»Nichts.«
»Sie muss doch etwas gesagt haben.«
»Nein, hat sie nicht.«
»Du warst nicht bei ihr.«
»Doch, ich war bei ihr.« Die Ungerechtigkeit ihrer Unterstellung beleidigte ihn.
»Sie kann doch nicht nichts gesagt haben.«
»›Geh‹, hat sie gesagt.«
»Und du bist gegangen?«
»Liebling, das ändert doch nichts an der Sache.«
»Für mich schon«, sagte Cinta.
Clara war stets eine große Anhängerin der These gewesen, dass man seine Sorgen einfach verdrängen sollte. Vor vielen Jahren hatte sie bei einem wunderbaren Professor der Allgemeinmedizin studiert, der es fertiggebracht hatte, alle für sein Fach zu begeistern – Dr.Morrissey, der Vater ihrer Freundin Dervla.
»Unterschätzen Sie nie, wie heilsam es sein kann, bis über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt zu sein«, hatte er seinen Studenten mit auf den Weg gegeben. Die meisten ihrer Patienten würden davon profitieren, eher mehr als zu wenig zu tun zu haben. Dr.Morrissey hatte sich seinen schon fast legendären Ruf dadurch erworben, dass er als Mittel der Wahl gegen Schlaflosigkeit seinen Patienten einzig und allein den Rat gab, mitten in der Nacht aufzustehen und die Platten- oder CD-Sammlung zu ordnen oder die Stoffservietten zu bügeln. Was hätte er ihr wohl jetzt geraten, der freundliche Dr.Morrissey, der für Clara mehr Vater gewesen war, als ihr eigener distanzierter, verschlossener Erzeuger es je hatte sein können?
Bestimmt hätte Dr.Morrissey gesagt: »Such dir eine Beschäftigung, bei der du alles um dich herum vergisst, etwas, das diesen Mistkerl Alan, die Scheidung und seine infantile Freundin vollkommen ausblendet.«
Clara goss sich ein Glas Wein ein und ging nach oben. Sie würde jeden Winkel ihres Bewusstseins mit Gedanken an dieses verdammte Herzzentrum füllen, das zu leiten sie sich verpflichtet hatte.
Im Quentins bedachte Adi ihre Schwester mit einem tadelnden Blick. Linda wickelte gerade eine Strähne ihres langen blonden Haares um ihren Finger und lächelte quer durch den Raum einem Mann zu.
»Lass das, Linda«, zischte Adi.
»Was soll ich lassen?« Linda schaute sie aus großen, blauen, unschuldigen Augen an.
»Hör auf damit, den Typen anzumachen.«
»Er hat gelächelt. Ich habe zurückgelächelt. Ist das vielleicht eine strafbare Handlung?«
»Es könnte mit Komplikationen enden. Würdest du bitte aufhören zu lächeln, Linda!«
»Na gut, Miss Sauertopf. Aber ein bisschen freundlicher könntest du schon sein«, meinte Linda schmollend.
In dem Moment kam ein Ober, dem man die Missbilligung deutlich ansah, an ihren Tisch geeilt. »Der Herr dort drüben – Mr.Young – würde die jungen Damen gern auf einen Digestif einladen.«
»Können Sie Mr.Young bitte ausrichten, dass wir sein Angebot dankend ablehnen«, sagte Adi.
»Bitte richten Sie Mr.Young aus, dass ich gern einen Irish Coffee hätte«, fiel Linda ihr ins Wort.
Hilflos schaute der Ober von einer zur anderen. Mr.Young hatte von der anderen Seite des Restaurants aus die Situation mitverfolgt und tauchte unvermittelt an ihrem Tisch auf. Der große, schlanke Mann Ende vierzig trug einen gut geschnittenen Anzug und wirkte, als wäre er fast jeder Situation im Leben gewachsen.
»Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie kurz das Leben doch ist, und auch traurig, wenn man es mit geschäftlichen Besprechungen mit Herren in grauen Anzügen verbringen muss«, sagte er, ein routiniertes Lächeln auf dem sonnengebräunten Gesicht.
»Oh, da kann ich Ihnen nur zustimmen«, flötete Linda.
»Ich auch«, sagte Adi. »Aber wir sind die Falschen, um den Rest Ihres Lebens an uns zu verschwenden, Mr.Young. Meine Schwester hier ist einundzwanzig Jahre alt und Studentin, ich bin dreiundzwanzig und Lehrerin, und wir sind wahrscheinlich nicht viel älter als Ihre eigenen Kinder. Unser Vater hat uns mit einem teuren Abendessen in diesem Restaurant bestochen, während er im Moment unserer Mutter wahrscheinlich gerade mitteilt, dass er sich von ihr scheiden lassen will. Sie sehen also, der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt. Und wahrscheinlich würden Sie mit den Herren in grauen Anzügen auch mehr Spaß haben.«
»So viel Leidenschaft und Power in einer so jungen und schönen Frau.« Bewundernd betrachtete Mr.Young die ältere der beiden Schwestern.
Linda gefiel das ganz und gar nicht.
»Adi hat recht, wir müssen nach Hause«, sagte sie rasch, und der Ober ließ entspannt die Schultern sinken. Probleme dieser Art lösten sich nicht immer so leicht von allein.
»Und du bist tatsächlich gegangen, weil sie ›Geh!‹ gesagt hat?« Cinta konnte es nicht glauben.
»Gott, Cinta, was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Ihr an die Kehle springen?«
»Du hast gesagt, du würdest sie um die Scheidung bitten.«
»Und das habe ich getan … ich habe sie gebeten. Früher oder später werden wir geschieden. So will es das Gesetz.«
»Aber nicht, bevor das Baby auf der Welt ist.«
»Ist es denn so wichtig, wann ich geschieden werde? Wir werden schließlich beide für das Baby da sein. Ist das denn nicht viel wichtiger?«
»Also keine Hochzeit?«
»Nicht sofort jedenfalls. Später kannst du die größte und prächtigste Hochzeit auf der Welt haben.«
»Okay, dann später.«
»Was?«
»Ich habe gesagt, es ist in Ordnung. Es ist hart für dich. Ich werde nicht an dir herumnörgeln. Warum kommst du nicht mit dem Wein vorbei, den du ihr mitbringen wolltest, und wir trinken ihn zusammen?«
»Ich habe ihn dort gelassen.«
»Du hast ihr den Wein gegeben und bist ohne Scheidung wieder abgezogen? Was bist du nur für ein Feigling, Alan?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Alan Casey wahrheitsgemäß.
Clara hatte Alan in ihrem ersten Jahr als Medizinstudentin kennengelernt, und er hatte gerade das erste Jahr in einer Bank hinter sich.
Wahrscheinlich gab es nur wenige Menschen auf der Welt, die für eine Bank arbeiteten und es in der Zeit nicht zu Geld brachten, wie Claras Mutter immer zu sagen pflegte. Doch Alan Casey war einer von ihnen. Blauäugig, wie er war, ließ er sich nur zu gern auf spekulative und riskante Geldanlagen ein, weshalb das junge Paar materiell nie gutgestellt war. Alan hatte regelmäßig das Nachsehen, wenn es ums große Geschäft ging. Clara hingegen legte konsequent jeden Monat einen Teil ihres Gehalts auf die Seite und verschloss ansonsten die Ohren vor den ungebetenen Ratschlägen ihrer Mutter und ihrer Freunde. Das war ihr Leben, und ihre Entscheidungen gingen niemanden etwas an.
Trotzdem war Alan stets derjenige mit den größeren Ambitionen gewesen: Genug war ihm nie genug, und es musste immer mehr sein. Das bezog sich auch auf Frauen. Eine Zeitlang tat Clara so, als sei sie blind und taub, doch irgendwann wurde das immer schwieriger, und so stellte sie sich der Situation.
Nachdem Clara und Alan sich offiziell getrennt hatten, legte Clara großen Wert darauf, dass bei ihr zu Hause in jedem Zimmer ein Schreibtisch und Bücherregale standen. So konnten sie und ihre Töchter in ihrem eigenen Reich arbeiten, ohne die anderen zu stören. Das Erdgeschoss hingegen gehörte allen. Claras Zimmer war kühl und elegant eingerichtet. Auf der einen Seite standen ihr Bett, ein Frisiertisch und ein großer Kleiderschrank, während die andere Hälfte als Arbeitszimmer diente, mit hochwertigen Möbeln ausgestattet war und sehr edel wirkte. Ein bequemer Schreibtischstuhl aus Leder und Designerlampen vervollständigten diesen Eindruck. Clara öffnete eine Schublade und holte einen dicken Ordner mit der Aufschrift »Zentrum« heraus. Drei Wochen lang hatte sie es vermieden, auch nur einen Blick darauf zu werfen, denn damit war zu sehr die Erkenntnis all dessen verbunden, was sie verloren und welchen winzigen Trost sie im Gegenzug dafür erhalten hatte. Doch heute Abend würde sie die Sache in Angriff nehmen – aber vielleicht erst nach den Neun-Uhr-Nachrichten.
Als das große Kaufhaus damals Fernsehapparate im Sonderangebot gehabt hatte, hatte Clara gleich drei davon gekauft. Sie würde sich wie eine exzentrische Millionärin benehmen, hatten die Mädchen ihr vorgeworfen, doch in Claras Augen hatte sich die Investition mehr als gelohnt. So konnte Adi ihre Sendungen über den apokalyptischen Niedergang des Planeten, Linda ihre Pop-Shows und sie in aller Ruhe einen Kostümfilm anschauen.
Clara griff nach der Fernbedienung, aber dann fiel ihr wieder ein, was Dr.Morrissey darüber gesagt hatte, dass wir nie um Ausreden verlegen wären, wenn es darum ging, uns von unseren Sorgen abzulenken. Es war fast so, als wollten wir nicht auf den Luxus verzichten, uns zu ärgern. Also öffnete Clara stattdessen die große Box und begutachtete ihr akkurates Ablagesystem. Hier hatte sie alles, was im Zusammenhang mit der ambulanten Herzklinik stand, dokumentiert und gesammelt: deren Zielsetzung, Finanzierung und wie ihre eigene Rolle als leitende Direktorin definiert war. Hier befanden sich auch die Berichte über ihre Studienreisen, die sie zu vier Herzzentren in Irland, zu drei in Großbritannien und zu einem in Deutschland geführt hatte. Diese Reisen waren allesamt sehr anstrengend gewesen; lange, ermüdende Stunden hatte sie damit verbracht, sich Einrichtungen anzusehen, die für ihr eigenes Projekt weder wichtig noch maßgeblich waren. Und dabei hatte sie sich unzählige Notizen gemacht, aufmunternd genickt, hier murmelnd Zustimmung signalisiert, dort Fragen gestellt.
Mal wurde gespart, dann wieder das Geld zum Fenster hinausgeworfen. Einerseits wurde zu wenig, andererseits zu viel geplant, oder man begnügte sich einfach mit den Strukturen, die bereits vorhanden waren. Nichts davon hatte Clara jedoch besonders überzeugt. Ganz zu schweigen von so idiotischen Einfällen wie der Entscheidung, ein Herzzentrum in den dritten Stock zu verlegen, noch dazu ohne Aufzüge, oder der Tatsache, dass sich das Pflegepersonal nur gelegentlich und unregelmäßig blicken ließ. Auch die Aktenberge waren auf das Doppelte angewachsen. Andererseits hatte Clara aber auch erlebt, wie viel Hoffnung und Vertrauen die Patienten hatten, wenn sie das Gefühl bekamen, tatsächlich mit ihrer Krankheit umgehen zu lernen. Doch sicher konnte man so etwas auch in jeder guten Allgemeinpraxis oder als ambulanter Patient erreichen.
Mit zwei verschiedenfarbigen Stiften hatte Clara notiert, was ihr bei ihren Besuchen gefallen und was sie für schlecht befunden hatte. So würde sie ihre Erfahrungen leichter zusammenfassen können. Ihr Blick fiel auf eine Akte, die mit »Personal« überschrieben war, eine Auswahl der Mitarbeiter, die sie zu ihrer Unterstützung einstellen konnte. Am dringendsten würde sie eine Diätassistentin und einen Physiotherapeuten brauchen, dazu wenigstens zwei ausgebildete kardiologische Schwestern und eine Fachkraft für die Blutabnahmen, außerdem zur allgemeinen Unterstützung einen Assistenzarzt oder eine Assistenzärztin, die ihr halbes Jahr Praktikum in der Kardiologie absolvierten; auch kämen sie nicht ohne ein gut funktionierendes Überweisungssystem von Fachärzten und dem Mutterkrankenhaus aus. Sie würden Interviews in der nationalen Presse und im Radio lancieren und generell verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben müssen.
Das alles war nichts Neues für sie, das hatte Clara bereits früher organisiert, damals, als sie noch eine Spitzenposition gehabt hatte und auf dem Weg nach oben gewesen war. Oder zumindest gedacht hatte, es zu sein. Trotzdem, die Arbeit musste getan werden, und sie würde ihr Bestes geben. Was hätte es sonst für einen Sinn?
Seufzend machte Clara sich daran, die Akten durchzuarbeiten.
Lavender. Was für ein Name für eine Diätassistentin. Aber ihr Lebenslauf machte einen guten Eindruck, und sie wollte sich auf gesunde Ernährung für Herzpatienten spezialisieren. Die Frau schien jung, aufgeschlossen und begeisterungsfähig zu sein. Clara machte einen Haken neben ihren Namen und griff zum Telefon. Wenn, dann konnte sie ebenso gut gleich heute Abend damit anfangen. Es war zwar schon nach neun Uhr, aber es war eine Handynummer, und das Mobiltelefon war sicher in Griffweite.
»Lavender? Hier Clara Casey. Ich hoffe, ich rufe nicht zu spät an …«
»Nein, natürlich nicht, Dr.Casey. Es freut mich, von Ihnen zu hören.«
»Vielleicht könnten Sie morgen mal auf einen Sprung bei mir im Zentrum vorbeischauen, und wir könnten uns ein wenig unterhalten. Es gibt dort einen kleinen Besprechungsraum. Wann würde es Ihnen denn am besten passen?«
»Morgen arbeite ich von zu Hause aus, also ist mir jede Zeit recht.«
Sie einigten sich auf zehn Uhr vormittags.
Jetzt musste Clara sich noch für einen Physiotherapeuten entscheiden, aber sie wusste nicht genau, für wie viele Stunden in der Woche sie dessen Dienste benötigen würde. Clara blätterte die Bewerbungen durch, um zu sehen, wer für eine Teilzeitstelle überhaupt in Frage kam. Dabei fiel ihr ein großes, grobschlächtiges Gesicht auf – ein richtiger Quadratschädel, bodenständig, verlässlich, wenn auch nicht gerade attraktiv. Der Mann sah aus wie ein ehemaliger Boxer, aber irgendetwas an seiner Lebensgeschichte erregte Claras Neugier. Der Mann arbeitete vorwiegend in Sozialzentren und Clubs in der Innenstadt und hatte erst spät seine Ausbildung begonnen und abgeschlossen. Sein schiefes Grinsen gefiel Clara. Großartig, dachte sie, jetzt suche ich mir die Leute schon nach ihrem Aussehen aus.
Er meldete sich beim ersten Klingeln seines Handys. »Hier Johnny«, sagte er.
Clara Casey erklärte ihr Anliegen. Aber klar doch, bis elf Uhr würde er es leicht schaffen. Kein Problem.
Das ließ sich ja gar nicht so schlecht an. Zwei Krankenschwestern standen zur engeren Auswahl, und Name und Telefonnummer eines Wachmanns befanden sich auch noch in der Akte. Er hieß Tim. Auch ihn rief Clara auf seinem Handy an. Mit leicht amerikanischem Akzent erklärte ihr eine Stimme, dass er umgehend zurückrufen würde. Wenn sie morgen anfing, die gesamte Klinik auf den Kopf zu stellen, würde sie jemanden brauchen, der für die Sicherheit des Gebäudes sorgte.
Zu ihrer Überraschung hörte Clara einen Schlüssel in der Tür und die Schritte ihrer beiden Töchter, die nach Hause zurückkamen. Ohne anzuklopfen, stürmten sie missgelaunt in ihr Zimmer. Ebenfalls eine Angewohnheit, die ihr in der letzten Zeit unangenehm auffiel.
»Was hat er gewollt?«, fragte Linda.
»Wer?«
»Dad.«
»Die Scheidung, er will wieder heiraten.«
Die Mädchen sahen einander an. »Und?«
»Ich habe ihn aus dem Haus geworfen.« Clara schien unbeeindruckt.
»Und, ist er gegangen?«
»Na ja, offensichtlich. Hattet ihr einen netten Abend? Nein? Er hat euch eine Flasche Wein dagelassen. Die könnt ihr euch gern teilen.«
Linda und Adi sahen einander verwirrt an. In dem Moment klingelte das Telefon ihrer Mutter.
»Oh, Tim, danke, dass Sie gleich zurückrufen. Nein, natürlich ist es nicht zu spät. Könnten Sie morgen vorbeikommen? Es geht um einen kleineren Sicherheitsjob. Ich werde einige Wände einreißen lassen, und ein paar Tage lang wird alles offen stehen, so dass rund um die Uhr jemand im Haus sein muss. Danach wird sich die Arbeit auf die üblichen Patrouillengänge beschränken. Schön. Sehr schön. Dann bis morgen.« Clara lächelte ihren Töchtern vage zu.
Adi und Linda wussten nicht, was sie davon halten sollten. Das Essen bei Quentins war nicht unbedingt ein Erfolg gewesen, ihr Vater würde ein Mädchen heiraten, das so alt war wie sie, und jetzt hatte es auch noch den Anschein, als hätte ihre Mutter den Verstand verloren.
Der nächste Vormittag verging wie im Flug. Die Vorstellungsgespräche verliefen bemerkenswert gut. Lavender, eine gepflegte Erscheinung Mitte vierzig, entpuppte sich als echter Profi mit realistischen Vorstellungen davon, wie häufig ihre Ernährungsberatung benötigt werden würde. Sie schlug deshalb vor, ein Mal in der Woche einen Kochkurs zu veranstalten. Während ihrer Arbeit in einer Londoner Klinik habe sie beste Erfahrungen damit gemacht, erzählte sie. Viele der Patienten wüssten nämlich nicht einmal, wie man Gemüse richtig kocht oder eine Suppe zubereitet, und waren immer wieder erstaunt, wie gut man sich gesund ernähren konnte. Nur auf eines legte die pragmatische Singlefrau Lavender Wert: Jedes Jahr im Januar und Februar nahm sie sich zwei Monate Auszeit und reiste nach Australien. Für eine Vertretung würde sie selbst sorgen. In zwei Wochen könne sie anfangen zu arbeiten, und sie würde Clara helfen, die Küche einzurichten.
Clara fand diesen Auftakt sehr ermutigend.
Johnny, der Physiotherapeut, war in der Tat groß und grobschlächtig, schien aber ein Herz aus Gold und ein unerschöpfliches Reservoir an Geduld zu haben. Er war der Ansicht, dass Herzpatienten einfach zu viele Filme gesehen hatten, in denen sich die Leute an die Brust fassten und in Sekunden tot zu Boden sanken. Deshalb hätten sie fürchterliche Angst, sich beim Sport zu überanstrengen, einen Herzinfarkt zu bekommen und daran zu sterben. Lieber nahmen sie es in Kauf, dass ihre Muskeln schlaff und schlaffer wurden. Ob Clara die Möglichkeit habe, die Patienten per EKG überwachen zu lassen, um ihre Fortschritte aufzuzeigen, wollte er wissen.
»Ich bezweifle, dass man mir diese Apparaturen bewilligen wird«, erwiderte Clara.
»Wir könnten uns doch dafür starkmachen«, sagte Johnny. Und damit war er eingestellt.
Tim, der Wachmann, hatte drei oder vier Jahre in New York gelebt. Er hatte drüben viel in Krankenhäusern gearbeitet und wusste deshalb bestens, worauf es bei dem Job ankam. In den kommenden Wochen könne er sich voll und ganz auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentrieren, da er hoffe, sich bald selbständig zu machen, und dafür brauche er ein paar zufriedene Kunden größeren Kalibers. Doch er wolle niemandem auf den Schlips treten, fügte er hastig hinzu.
»Warum greifen Sie eigentlich nicht auf die bereits bestehenden Sicherheitseinrichtungen des Krankenhauses zurück?«, fragte er unverblümt.
»Weil ich unabhängig bleiben will«, antwortete Clara ebenso direkt.
»Und werden Sie die Mittel dafür bekommen?«
»Ja, das heißt, falls Sie uns ein Angebot machen, das die Herren in der Verwaltung als angemessen betrachten. Sie haben gern das Gefühl, Geld zu sparen. Das ist das Einzige, was ihnen wichtig ist.«
»Es ist wirklich überall dasselbe«, erwiderte Tim pragmatisch.
»Warum sind Sie eigentlich aus Amerika wieder zurückgekommen?«
»Na ja, jeder, den ich dort kannte, hat vierzehn Stunden am Tag gearbeitet. Alle Leute, die ich hier kannte, trugen Designeranzüge und kauften sich Häuser in Spanien. Da dachte ich mir, ich komme lieber zurück und sehe zu, dass ich auch ein Stück vom Kuchen abbekomme. Was das angeht, bin ich auch nicht viel besser als die Herren in der Chefetage.«
»Sind Sie froh, dass Sie wieder hier sind?«
»Ich bin nicht ganz sicher«, gab er zu.
»Sie haben ja noch Zeit.« Clara fühlte sich irgendwie wohl in Gesellschaft dieses wortkargen Mannes.
Barbara, die erste der beiden Krankenschwestern, mit der Clara sprach, war genau der Typ, den auch sie in die engere Auswahl genommen hätte. Sie war aufgeschlossen, direkt und sehr gut informiert. Mühelos beantwortete sie Claras Routinefragen über spezielle Medikamente bei Herzerkrankungen und über das Schlaganfallrisiko bei Bluthochdruck.
Die zweite Frau war um einiges älter, jedoch kein bisschen weiser. Sie hieß Jacqui und buchstabierte ihren Namen sicherheitshalber zwei Mal, damit es kein Missverständnis gab. Fast im selben Atemzug fügte sie hinzu, dass sie sich nur deshalb um die Stelle bewarb, weil sie hier weder abends noch im Schichtdienst arbeiten müsse. Des Weiteren müssten bestehende Urlaubsregelungen übernommen werden, und mittags bräuchte sie eine Pause von eineinhalb Stunden, um ihren Hund spazieren zu führen. Dieser würde nämlich nur dann friedlich schlafend in ihrem Wagen auf sie warten, wenn er wusste, dass er auf seine ausgedehnten Spaziergänge nicht verzichten müsse. Pikiert fügte Jacqui hinzu, dass sie sich in ihrem gegenwärtigen Job manchmal wie in der Dritten Welt vorkäme, da sie den größten Teil ihrer Zeit damit verbrachte, sich irgendwelchen Ausländern gegenüber verständlich zu machen. Clara wusste vom ersten Moment an, dass diese Frau nicht in ihr Team passte.
»Bis wann werde ich von Ihnen hören?«, fragte Jacqui hochnäsig.
»Es stehen noch viele Bewerber auf meiner Liste. Ich gebe Ihnen in einer Woche Bescheid.« Clara verschwendete nicht viele Worte.
Wenig begeistert sah Jacqui sich um. »Sie haben hier ja noch einiges zu tun«, meinte sie.
»Richtig, aber liegt nicht gerade darin eine gewisse Herausforderung?« Clara spürte, wie das Lächeln auf ihrem Gesicht gefror.
Was sie jedoch wirklich dringend brauchte, war – wie Clara am nächsten Morgen feststellte – ein zusätzliches Paar Beine, gewissermaßen ein Mädchen für alles, das für sie die Laufarbeiten erledigte, hier ein leeres Formular abholte, dort ein ausgefülltes abgab und bei Bedarf die Bauarbeiter und Elektriker zusammentrommelte. Doch bisher hatte sich dieses Paar Beine noch nicht gefunden. Clara würde sich wohl oder übel selbst auf die Suche danach machen müssen. Der Zufall wollte es, dass sie auf dem Parkplatz fündig wurde, wo eine magere junge Frau mit langem, strähnigem Haar und einem Fensterleder in der Hand ihr anbot, ihre Windschutzscheibe zu putzen.
»Nein danke.« Clara lehnte freundlich, aber bestimmt ab. »Das ist ein schlechter Ort, um Geschäfte zu machen. Hier verkehren hauptsächlich Schwestern und Pfleger, denen es egal ist, wie ihr Auto aussieht, oder Patienten, die andere Sorgen haben, als auf so etwas zu achten.«
Die junge Frau schien sie nicht richtig zu verstehen. Sie strengte sich sichtlich an, um die Bedeutung von Claras Worten zu erfassen.
»Woher kommen Sie?«
»Ich Polski«, erwiderte das Mädchen.
»Ah, aus Polen sind Sie. Gefällt es Ihnen hier?«
»Ich glaube, ja.«
»Haben Sie Arbeit?«
»Nein. Keine feste Arbeit. Ich mache mal dies, mal das.« Dabei deutete sie auf das Fensterleder.
»Was sonst? Was machen Sie sonst noch?«
»Ich gehe zu den Leuten, spüle Geschirr und putze die Böden. Ich sammle die Blätter von den Bäumen in große Säcke. Dann sehe ich kleine Jungen, die Autofenster putzen, und ich denke mir, vielleicht …« Das Gesicht der jungen Frau war blass und schmal.
»Haben Sie denn wenigstens genug zu essen?«, fragte Clara.
»Ja, ich wohne über einem Restaurant und bekomme dort eine Mahlzeit am Tag.«
»Haben Sie Freunde hier?«
»Ein paar, ja.«
»Könnten Sie denn Arbeit gebrauchen?«
»Ja, Madam, ich brauche Arbeit.«
»Wie heißen Sie?«
»Ania.«
»Na, dann kommen Sie mal mit, Ania«, sagte Clara.
Die Diskussionen mit den Bauarbeitern waren ermüdend und langwierig, und zu allem Überfluss erklärte der Polier Clara auch noch, dass sie ihre beabsichtigten Umbauten niemals von der Verwaltung genehmigt bekäme. Die Herren dort würden jede Veränderung hassen und fürchteten sich vor zu viel Licht und Luft. Sie bevorzugten kleine, verwinkelte Räume, wo man ungestört war. Also besorgte Clara Stoff für die Vorhänge zur Unterteilung der Kabinen, dazu Jalousien für die Fenster, ehe sie Kataloge mit Büromöbeln wälzte und die gewünschten Schreibtische und Aktenschränke markierte. Die Zeit verging wie im Flug.
Während sie sich mit der Bürokratie herumschlug, war die junge Polin unermüdlich unterwegs. Clara hatte ihr ein Schreiben mitgegeben, in dem sie bestätigte, dass Ania Prasky in ihrem Auftrag handele, und in dem sie alle ihre Qualifikationen und Befugnisse aufführte. Dieser geballten Ladung an Kompetenz würde sich sicher niemand in den Weg stellen.
Es war bereits vier Uhr nachmittags, und der Gedanke an eine Pause war ihr bisher noch nicht in den Sinn gekommen. Ania hatte gewiss auch noch nichts gegessen. Auf Claras Bitte hin kam sie sofort angerannt.
»So, jetzt gibt es erst mal was zu essen«, erklärte Clara munter, doch über Anias Gesicht huschte ein Schatten der Besorgnis.
»Nein, Madam, danke, aber ich arbeite weiter«, antwortete sie.
»Etwas Leckeres zum Essen und ein starker Kaffee – danach arbeiten wir doppelt so gut.«
Langsam wich der besorgte Ausdruck von Anias Gesicht. Clara würde für das Essen bezahlen, so dass sie ihren Tageslohn nicht opfern musste. Ania strahlte glücklich wie ein Kind.
Als Claras Töchter Adi und Linda mit achtzehn, zwanzig Jahren durch die Welt gereist waren, hatten freundliche Menschen den Mädchen oft einen Platz zum Schlafen oder eine warme Mahlzeit angeboten, wenn sie nicht gewusst hatten, wohin. Man musste so etwas als eine Art Tauschgeschäft betrachten: Man war freundlich zu den Kindern anderer Eltern, die wiederum den eigenen Kindern halfen.
»Komm, Ania, das gibt Haare auf der Brust.«
»Tatsächlich?« Ania wirkte fassungslos.
»Nein, keine echten Haare natürlich. Das sagt man bei uns nur so. Wissen Sie, was das bedeutet?«
»Nein, eigentlich nicht, Madam.«
»Na, dann werde ich versuchen, es Ihnen beim Essen zu erklären«, meinte Clara und griff nach ihrer Jacke.
Frank konnte es nicht glauben, dass diese Frau bereits so schnell so viel in Angriff genommen hatte. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Formulare mit allen möglichen Anträgen, und er würde einen ganzen Tag brauchen, um seine Ablage zu erledigen. Und jetzt hatte er noch ein zusätzliches Problem. Frank hatte nämlich erfahren, dass eine junge polnische Frau mit großen, ängstlichen Augen dabei gesehen worden war, wie sie mindestens ein halbes Dutzend Mal irgendwelche Unterlagen in sein Büro geschleppt hatte. Diese Clara Casey schien in ihrem neuen Reich keinen Stein auf dem anderen lassen zu wollen. Auf ihrem Briefpapier – das sie anscheinend über Nacht hatte drucken lassen – stand neben jeder Anfrage oder Erklärung eine persönliche Notiz, in der sie sich entweder auf »unser Gespräch« oder »unsere Übereinkunft« bezog. Diese Frau machte ihn äußerst effektiv zum Erfüllungsgehilfen ihrer Expansionspläne. Entweder zog er auf der Stelle die Notbremse, bevor er mit ihr in den Abgrund gerissen wurde, oder er ließ sie gewähren. Frank konnte Frauen wie sie zwar nicht ausstehen – sie war eine richtige Emanze –, aber in ihr eine Verbündete im Krankenhaus zu haben, der ebenfalls daran lag, dass etwas vorwärtsging, war nicht zu verachten.
Frank beschloss daher, ihr noch ein paar Tage Zeit zu geben, bevor er einschritt. In den nächsten achtundvierzig Stunden würde sie gewiss so spektakulär über ihr Ziel hinausschießen, dass es einem Selbstmord gleichkäme. In der Zwischenzeit würde Frank ihr zu seiner eigenen Rückversicherung einen vagen, nichtssagenden Brief schreiben, in dem er zum Ausdruck brachte, dass alle ihre Bestellungen selbstverständlich erst noch von der Klinikleitung bewilligt werden müssten.
Barbara biss herzhaft in den großen Hamburger. Seit sechs Wochen war sie nun auf Diät und hatte nur sechs Pfund abgenommen. Für den Fall, dass sie die neue Stelle in der Herzklinik bekommen würde, hatte sie sich daher eine Belohnung versprochen. Sie hatte dabei zwar eher an ein Paar neue Schuhe oder eine große, teure Handtasche gedacht, aber es war ein langer Tag gewesen, und sie hatte keine Kraft mehr, in den Geschäften herumzulaufen. Um ihren neuen Job zu feiern, war Barbara mit ihrer Freundin Fiona verabredet.
Fiona beneidete sie glühend. Genau so eine Stelle hätte sie auch gern gehabt.
»Aber du hast dich ja nicht einmal darum beworben.« Barbara war verärgert über Fiona. »Du hättest die Stelle bestimmt bekommen, und wir könnten zusammenarbeiten. Aber nein, du wolltest ja keine Formulare ausfüllen.«
»Ich wusste doch nicht, dass diese Ärztin so nett ist und dass man so viel Eigenverantwortung haben würde. Ich dachte eher, dass das wieder einmal so ein Handlangerjob ist.«
»Also, jetzt ist es zu spät. Wahrscheinlich hat diese Dr.Casey bereits eine böse alte Schachtel eingestellt, mit der ich mich herumschlagen muss, nur weil du partout keinen Schreibkram magst.«
»Wie ist sie denn so?«, fragte Fiona.
»Dunkelhaarig, gepflegt, auf eine altmodische Weise hübsch. Sieht ein bisschen aus wie die Frau da drüben am Tisch. Hey, warte mal eine Minute, das ist sie.« Barbaras Hand mit dem Hamburger verharrte in der Luft.
»Sie geht hierher zum Essen?« Fiona blieb vor Staunen der Mund offen stehen.
»Ja, und neben ihr sitzt diese junge Frau aus dem Zentrum, eine Ausländerin namens Ania. Merkwürdig!« Barbara schüttelte ungläubig den Kopf.
»Na ja, irgendwo muss sie ja essen …« Doch Fiona war bereits auf dem Weg zu Claras Tisch.