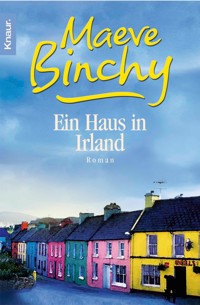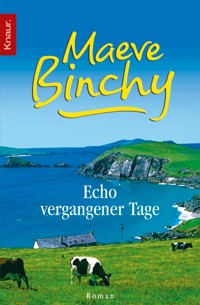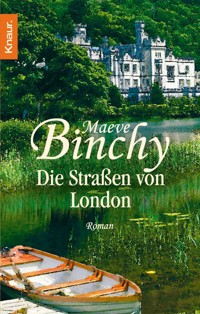6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Eltern der kleinen Frankie sind nicht wie die Eltern anderer Kinder: Zwar ist Noel ihr leiblicher Vater, der ihrer Mutter auf dem Sterbebett versprach, für die Tochter zu sorgen, Lisa aber ist eine Gestrandete, die sich mit Noel lediglich die Wohnung in Dublin teilt. Doch alle beide lieben das Kind von ganzem Herzen – bis Moira auftaucht, eine übereifrige Sozialarbeiterin, die nicht glauben kann, dass Noel und Lisa Frankie ein echtes Heim bieten können. Heimlich hat sie sogar schon nach Adoptiveltern für die Kleine gesucht. Als Noel dies erfährt, droht er zu verzweifeln, doch dann stellt das Leben die Weichen noch einmal ganz neu – auch für Moira …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maeve Binchy
Herzenskind
Roman
Aus dem Englischen von Gabriela Schönberger
Über dieses Buch
Die Eltern der kleinen Frankie sind nicht wie die Eltern anderer Kinder: Zwar ist Noel ihr leiblicher Vater, der ihrer Mutter auf dem Sterbebett versprach, für die Tochter zu sorgen, Lisa aber ist eine Gestrandete, die sich mit Noel lediglich die Wohnung teilt. Doch alle beide lieben das Kind von ganzem Herzen – bis Moira auftaucht, eine übereifrige Sozialarbeiterin, die nicht glauben kann, dass Noel und Lisa Frankie ein echtes Heim bieten können. Heimlich hat sie sogar schon nach Adoptiveltern für die Kleine gesucht. Als Noel dies erfährt, droht er zu verzweifeln, doch dann stellt das Leben die Weichen noch einmal ganz neu – auch für Moira …
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Danksagung
LESETIPP: »Die Achse meiner Welt«
Vorbemerkung
1. Kapitel
Für Gordon, der mir mit seiner Großherzigkeit jeden Tag aufs Neue verschönert.
Kapitel 1
Für Katie Finglas neigte sich ein anstrengender Arbeitstag dem Ende zu. Alles, was schiefgehen konnte, war schiefgegangen. Eine Kundin hatte ihnen nichts von ihrer Allergie gegen Färbemittel erzählt und war mit verfilztem Haar und roten Pusteln auf der Stirn aus dem Salon gestürmt. Eine Brautmutter hatte einen Tobsuchtsanfall bekommen und sie beschimpft, dass sie mit der neuen Frisur wie eine Witzfigur aussehe. Ein junger Mann, der sich blonde Strähnen gewünscht hatte, war vollkommen ausgerastet, als er sich nach der Hälfte der Einwirkzeit erkundigte, was die Behandlung kostete. Und Katies Mann hatte einer sechzigjährigen Kundin arglos beide Hände auf die Schultern gelegt, um postwendend von ihr erklärt zu bekommen, dass sie ihn wegen sexueller Belästigung anzuzeigen gedenke.
Katie betrachtete den Mann, der vor ihr stand – ein beleibter Geistlicher mit blondem, von grauen Strähnen durchzogenem Haar.
»Sie müssen Katie Finglas sein, und Ihnen gehört wohl dieses Etablissement hier«, sagte der Priester und sah sich nervös in dem harmlosen Frisiersalon um, als befände er sich in einem Edelbordell.
»Ganz recht, Father«, erwiderte Katie seufzend. Was gab es nun schon wieder?
»Äh, also, ich habe unten im Zentrum am Kai mit ein paar der Mädchen gesprochen, die hier bei Ihnen arbeiten, und sie haben mir erzählt …«
Katie war unendlich müde. Sie beschäftigte in ihrem Salon tatsächlich mehrere Schulabgängerinnen, die sie anständig bezahlte und ausbildete. Worüber konnten sie sich bei einem Pfarrer beklagt haben?
»Ja, Father, und wo liegt das Problem?«, fragte sie.
Verlegen trat er von einem Bein auf das andere. »Tja, es gibt in der Tat ein kleines Problem, und deshalb dachte ich mir, ich wende mich direkt an Sie.«
»Sehr richtig, Father«, erwiderte Katie. »Dann verraten Sie mir doch mal, worum es geht.«
»Es geht um diese Frau, Stella Dixon. Sie liegt im Krankenhaus …«
»Im Krankenhaus?«
Katie erschrak. Was hatte das zu bedeuten? Hatte die Frau vielleicht zu viel Wasserstoffsuperoxid inhaliert?
»Das tut mir leid.« Sie versuchte, sich ihre Anspannung nicht anmerken zu lassen.
»Ja, und diese Frau wünscht sich, dass jemand zu ihr kommt und ihr die Haare schneidet.«
»Sie meinen, sie hat trotz allem noch Vertrauen zu uns?«
Schon seltsam, wie das Leben manchmal spielte.
»Äh, ich denke nicht, dass sie schon einmal hier war …« Der Pfarrer schien verwirrt.
»Und was haben Sie mit alledem zu tun, Father?«
»Also, mein Name ist Brian Flynn, und ich vertrete zurzeit den Krankenhausseelsorger im St.-Brigid-Hospital, der auf Pilgerreise in Rom ist. Das ist das erste Mal, dass sich jemand mit einem wirklich ernsthaften Anliegen an mich wendet. Bisher wollten die Patienten immer nur, dass ich ihnen Zigaretten und Alkohol ins Krankenhaus schmuggle.«
»Sie wollen also, dass ich ins Krankenhaus fahre und dieser Frau die Haare schneide?«
»Sie ist schwer krank. Sie liegt im Sterben, und ich könnte mir vorstellen, dass sie jemanden zum Reden braucht, der schon ein wenig älter ist. Nein, nein, nicht dass Sie alt aussehen würden. Sie sind ja fast noch ein junges Mädchen«, wiegelte der Priester ab.
»Guter Gott, da haben die irischen Frauen aber einen herben Verlust erlitten, als Sie sich für das Priesteramt entschieden«, meinte Katie lachend. »Sagen Sie mir, um wen es sich handelt, und ich werde meine Trickkiste einpacken und diese Frau besuchen.«
»Vielen Dank, Ms. Finglas. Ich habe alles hier aufgeschrieben.«
Father Flynn reichte ihr einen Zettel.
In dem Moment näherte sich eine Frau mittleren Alters dem Verkaufstresen. Die Brille war ihr auf die Nasenspitze gerutscht, und sie wirkte ein wenig unsicher.
»Aha, Sie bringen den Leuten also Tricks bei, was sie mit ihren Haaren machen sollen«, sagte sie.
»Ja, auch, aber wir bezeichnen das, was wir tun, lieber als Kunst«, antwortete Katie.
»Meine Nichte aus Amerika ist für ein paar Wochen zu Besuch bei uns. Sie hat mir erzählt, dass es in Amerika Läden gibt, wo man sich für fast umsonst die Haare schneiden lassen kann, wenn man als Modell den Kopf hinhält.«
»Nun, wir haben ein spezielles Angebot für Schüler und Studenten am Dienstagabend nach Ladenschluss. Die Kunden bringen ihre eigenen Handtücher mit, und wir schneiden ihnen die Haare. Normalerweise spenden sie fünf Euro für einen guten Zweck.«
»Heute ist Dienstag!«, sagte die Frau triumphierend.
Katie seufzte innerlich. »So ist es.«
»Also, könnte ich einen Termin bekommen? Mein Name ist Josie Lynch.«
»Sehr gern, Mrs. Lynch. Dann bis sieben Uhr«, sagte Katie und notierte sich den Namen.
Als sie aufschaute, traf sich Katies Blick mit dem des Priesters, der sie voller Mitgefühl und Verständnis ansah.
Einen eigenen Frisiersalon zu leiten war kein Honigschlecken.
Josie und Charles Lynch hatten seit ihrer Hochzeit vor zweiunddreißig Jahren im St. Jarlath’s Crescent Nummer dreiundzwanzig gewohnt und in dieser Zeit viele Veränderungen im Viertel miterlebt. Der Tante-Emma-Laden um die Ecke hatte sich in einen Mini-Supermarkt verwandelt, und die alte Wäscherei, in die man früher die Bettwäsche zum Bügeln und Zusammenlegen gebracht hatte, war nun ein moderner Waschsalon, in dem die Leute unförmige Tüten voller Schmutzwäsche ablieferten. Wo früher der alte Dr. Gillespie praktizierte – er hatte fast alle Geburten und Todesfälle im Viertel betreut –, hatte jetzt eine Gemeinschaftspraxis mit vier Ärzten eröffnet.
Zu Zeiten des wirtschaftlichen Booms hatten die Immobilien im St. Jarlath’s Crescent für schwindelerregende Summen die Besitzer gewechselt. Kleinere Häuser mit Gärten in Citynähe waren sehr gefragt gewesen. Jetzt natürlich nicht mehr – die Rezession hatte sich als großer Gleichmacher erwiesen, auch wenn das Stadtviertel noch immer bedeutend besser dastand als vor dreißig Jahren.
Man brauchte sich nur Molly und Paddy Carroll mit ihrem Sohn Declan ansehen. Der war jetzt Arzt, ein richtiger, echter Doktor! Und dann Muttie und Lizzy Scarlets Tochter Cathy. Sie betrieb eine Catering-Firma, die Top-Events ausrichtete.
Doch vieles hatte sich auch zum Schlechteren gewendet. Heutzutage gab es keinen Gemeinschaftssinn und keine kirchlichen Prozessionen mehr, wie sie noch vor drei Jahrzehnten an Fronleichnam den Crescent auf und ab gezogen waren. Wenn Josie und Charles Lynch sich abends hinknieten und den Rosenkranz beteten, hatten sie das Gefühl, die Einzigen auf dieser Welt zu sein, die das taten – und ganz gewiss im St. Jarlath’s Crescent.
So war das immer schon gewesen.
Bei ihrer Hochzeit hatten sie sich vorgestellt, ein Leben nach dem Grundsatz zu führen, dass eine Familie, die gemeinsam betet, auch stets zusammenhält. Sie hatten mit mindestens acht oder neun Kindern gerechnet, da Gott nie ein Wesen in die Welt setzt, das er nicht ernähren kann. Doch es kam alles anders. Nach Noels Geburt hatte man Josie eröffnet, dass sie keine weiteren Kinder mehr bekommen könne. Das war nur schwer zu akzeptieren gewesen. Sie und Charles entstammten beide großen Familien, und ihre Geschwister hatten alle viele Kinder in die Welt gesetzt. Doch vielleicht sollte es so sein.
Josie und Charles hatten immer gehofft, dass ihr Sohn Noel eines Tages Priester werden würde. Noch vor seinem dritten Geburtstag hatten sie begonnen, einen Teil von Josies Lohn in der Keksfabrik abzuzweigen und für das Priesterseminar auf die Seite zu legen. Jede Woche sammelte sich ein wenig mehr auf dem Konto bei der Post an, und sobald Charles am Freitag seine Lohntüte von dem Hotel bekam, in dem er als Portier arbeitete, wurde davon ebenfalls eine bestimmte Summe bei dem Postamt eingezahlt. Wenn die Zeit gekommen war, sollte Noel die beste Ausbildung erhalten.
Deshalb war es eine große Überraschung und eine herbe Enttäuschung für die Eltern, als sie erfuhren, dass ihr schweigsamer Sohn keinerlei Interesse an einem Leben in Gott zeigte. Die Patres an seiner Schule erklärten ihnen, keinerlei Anzeichen für eine Berufung an ihm feststellen zu können. Auf ihren entsprechenden Vorschlag hin habe Noel geantwortet, dass ein Priesteramt auf keinen Fall für ihn in Frage käme, und sei dies der letzte Job auf Erden. Da war er gerade mal vierzehn Jahre alt gewesen.
Deutlicher hatte er sich wohl nicht ausdrücken können.
Weniger deutlich war Noel jedoch in Bezug auf das, was er tatsächlich machen wollte. Er blieb vage und meinte lediglich, dass es ihm gefallen könne, ein Büro zu leiten. Nicht in einem zu arbeiten, wohlgemerkt, es zu leiten. Dabei zeigte er nicht das geringste Interesse, Büromanagement, Buchführung, Rechnungswesen oder sonst etwas zu studieren, was die Berufsberatung beim Arbeitsamt ihm schmackhaft zu machen versuchte. Er mochte Kunst, aber Maler wollte er auch nicht werden, und erst auf mehrmalige Nachfrage erklärte er, dass er sich gern Gemälde anschaue und darüber nachdenke. Er war ein recht begabter Zeichner und führte stets einen Block und einen Bleistift bei sich; oft konnte man ihn dabei beobachten, wie er sich in eine ruhige Ecke zurückzog und ein Gesicht oder ein Tier skizzierte. Selbstverständlich mündete auch diese Vorliebe nicht in einer beruflichen Laufbahn, doch dies war auch nie Noels Intention gewesen. Seine Hausaufgaben erledigte er nebenbei am Küchentisch, hin und wieder laut seufzend, aber selten besonders engagiert oder begeistert. Beim Elternsprechtag hatten Josie und Charles dieses Thema einmal angesprochen und wissen wollen, ob es denn wenigstens in der Schule etwas gebe, für das der Junge sich begeisterte.
Doch sogar die Lehrer wussten sich nicht mehr zu helfen. Die meisten Jungen im Alter von vierzehn, fünfzehn Jahren stellten ihre Umwelt vor ein Rätsel, aber irgendwann waren alle ihre Schüler wieder zu Sinnen gekommen und hatten begonnen, etwas Vernünftiges zu tun. Oder auch nicht. Noel Lynch war nur noch schweigsamer und introvertierter als bisher schon, wie sie den Eltern erklärten.
Josie und Charles quälten sich mit Zweifeln.
Gewiss, Noel war ein ruhiger Junge, und im Grunde waren sie erleichtert gewesen, dass er nie Horden lauter junger Burschen ins Haus geschleppt hatte, die sich gegenseitig verprügelten. Aber sie hatten dies als Ausdruck seines spirituellen Lebens angesehen, sozusagen als Vorbereitung auf eine Zukunft als Priester. Nun schienen sie einsehen zu müssen, dass dies definitiv nicht der Fall war.
Vielleicht war es die Ordensausrichtung der Brüder, die Noel nicht lag. Vielleicht fühlte er eine andere Berufung in sich und wollte lieber Jesuit oder Missionar werden, wie Josie in ihrer Verzweiflung mutmaßte.
Offenbar jedoch nicht.
Als Noel fünfzehn Jahre alt war, verkündete er, dass er auf keinen Fall weiterhin mit der Familie den Rosenkranz beten wolle; dies sei lediglich ein sinnentleertes, in endloser Wiederholung vor sich hin geplappertes Ritual. Er habe nichts dagegen, Gutes zu tun und zu versuchen, Menschen zu helfen, die weniger Glück im Leben hatten, aber gewiss würde kein Gott verlangen, fünfzehn Minuten lang belanglose Silben herunterzuleiern.
Als ihr Sohn sechzehn Jahre alt wurde, mussten Josie und Charles feststellen, dass er sonntags nicht länger den Gottesdienst besuchte. Er war unten am Kanal gesehen worden, als er eigentlich in der Frühmesse in der Kirche um die Ecke hätte sein sollen. Und schließlich erklärte Noel den Eltern, dass er keinen Sinn mehr darin sehe, weiterhin zur Schule zu gehen, da er dort nichts mehr lernen könne. Bei Hall’s stelle man gerade Personal ein, und man würde ihn dort zum Bürokaufmann ausbilden. Statt noch länger Zeit mit der Schule zu verlieren, könne er ebenso gut gleich zu arbeiten anfangen.
Die Patres und Lehrer an Noels Schule bedauerten es sehr, wieder einen Schüler ohne qualifizierten Abschluss zu verlieren, aber noch immer wollte es ihnen nicht gelingen, den Jungen für irgendetwas zu begeistern, wie sie den Eltern erklärten. Er schien nur sehnsüchtig darauf zu warten, dass der Schultag zu Ende ging. Vielleicht war es sogar zu seinem Besten, wenn er die Schule verließ und bei Hall’s, dem großen Baustoffhändler, eine Stellung annahm und jede Woche regelmäßig sein Geld bekam. Dann würde man schon sehen, wo seine Interessen lagen.
Traurig dachten Josie und Charles an das kleine Vermögen, das sich im Lauf der Jahre auf dem Sparkonto bei der Post angesammelt hatte. Nie würde dieses Geld ausgegeben werden, um Noel Lynch zum Priester auszubilden. Ein mitfühlender Pater schlug vor, dass sie sich damit einen Urlaub gönnen sollten, aber Charles und Josie wiegelten schockiert ab. Sie hatten dieses Geld gespart, um Gottes Werk zu unterstützen, und dafür würden sie es auch ausgeben.
Noel bekam den Ausbildungsplatz bei Hall’s, doch auch dort gestaltete sich sein Kontakt zu seinen Arbeitskollegen eher zurückhaltend. Noel befreundete sich mit niemandem. Er legte es aber auch nicht darauf an, ständig allein zu sein. Allerdings war es so oft einfacher.
In den folgenden Jahren hatte Noel sich mit seiner Mutter darauf geeinigt, an den gemeinsamen Familienmahlzeiten nicht mehr teilzunehmen. Mittags aß er in der Firma, und abends nahm er nur noch einen kleinen Imbiss zu sich, den er sich selbst zubereitete. So ging er nicht nur dem Rosenkranzbeten aus dem Weg, sondern auch frommen Nachbarn und neugierigen Nachfragen darüber, womit er seinen Tag verbracht habe – dem üblichen Gesprächsthema am Essenstisch der Familie Lynch.
Noel gewöhnte es sich an, jeden Tag später nach Hause zu kommen, und war bald Stammgast in Casey’s Pub, wo er auf dem Heimweg immer einkehrte. In dem großen Lokal konnte er in der anonymen Menge untertauchen und fühlte sich dennoch geborgen. Hier war er kein Fremder, da ihn alle beim Namen kannten.
»Hey, Noel, altes Haus«, schallte ihm schon an der Tür die Begrüßung durch den Sohn des Hauses entgegen.
Der alte Casey, der wenig sprach, aber alles sah, linste über seine Brillengläser zu ihm hinüber, während er mit einem sauberen Leinentuch die Biergläser polierte.
»’n Abend, Noel.« Unter der routinierten Höflichkeit des Wirts klang die Missbilligung durch, die er für Noel empfand. Schließlich kannte er Noels Vater gut. Einerseits schien der Wirt in ihm das Geld nicht zu verachten, das Noel für sein Bier – oder mehrere Biere – bei Casey’s ließ, andererseits schien er enttäuscht, dass der junge Mann nicht vernünftiger mit seinem Lohn wirtschaftete. Aber Noel gefiel es hier. Es war ein altmodisches Pub mit moderaten Preisen und ohne Grüppchen kichernder Mädchen, die einen Mann beim Biertrinken störten. Hier hatte man seine Ruhe.
Und das war viel wert.
Als Noel an diesem Abend nach Haus kam, fiel ihm sofort auf, dass seine Mutter irgendwie anders aussah. Er vermochte jedoch nicht gleich zu sagen, woran es lag. Sie hatte das rote Strickkostüm an, das sie nur zu besonderen Gelegenheiten aus dem Schrank holte. In der Keksfabrik musste sie eine Uniform tragen, was ihr ganz recht war, da sie so ihre guten Sachen schonen konnte. Noels Mutter war nicht geschminkt, also lag es daran auch nicht.
Schließlich bemerkte Noel, dass ihr Haar anders aussah. Seine Mutter war beim Friseur gewesen.
»Du hast ja einen neuen Haarschnitt, Mam!«, sagte er.
Zufrieden nickte Josie Lynch. »Das haben sie dieses Mal gut hingekriegt, nicht wahr?« Sie hörte sich an, als ginge sie regelmäßig zum Friseur.
»Sieht hübsch aus, Mam«, erwiderte er.
»Willst du Tee? Ich mache rasch Wasser heiß«, erbot sie sich.
»Nein, Mam, ist schon in Ordnung.«
Noel konnte es kaum erwarten, die Küche zu verlassen und sich in die Sicherheit seines Zimmers zu flüchten. Und dann fiel ihm ein, dass für den nächsten Tag der Besuch seiner Cousine Emily aus Amerika angekündigt war. Seine Mutter bereitete sich also auf ihre Ankunft vor. Diese Emily wollte offenbar einige Wochen bleiben. Bisher war noch nicht entschieden, wie lange …
Noel hatte sich nicht sehr mit diesem Besuch auseinandergesetzt, sondern lediglich getan, was unumgänglich war. Er hatte seinem Vater geholfen, Emilys Zimmer zu streichen und die Abstellkammer im Erdgeschoss auszuräumen, in der sie die Wände gefliest und eine Dusche eingebaut hatten. Noel wusste nicht viel über seine Cousine; sie war schon ein wenig älter, in den Fünfzigern vielleicht, und die einzige Tochter des ältesten Bruders seines Vaters, Martin. Sie hatte als Kunsterzieherin gearbeitet, aber unerwartet ihre Anstellung verloren und wollte nun mit ihrem Ersparten die Welt bereisen. Ihre erste Etappe war Dublin. Von hier aus war ihr Vater vor vielen Jahren aufgebrochen, um in Amerika sein Glück zu machen.
Viel Glück war ihm nicht beschieden gewesen, vor allem nicht in materieller Hinsicht, wie Charles zu erzählen wusste. Der älteste Sohn der Familie hatte zuletzt in einer Bar gearbeitet, wo er selbst sein bester Kunde war, und sich nie mehr bei seiner Familie gemeldet. Jedes Jahr zu Weihnachten hatte Emily die Karten geschrieben, und sie war es auch, die sie vor Jahren über den Tod ihres Vaters und schließlich über den ihrer Mutter informiert hatte. In nüchternem Tonfall ließ sie nun ihre Verwandten wissen, dass sie selbstverständlich gedenke, sich während ihres Aufenthalts in Dublin an den Haushaltsausgaben zu beteiligen. Dies sei ihr auch ohne weiteres möglich, da sie beabsichtige, ihr kleines New Yorker Apartment in der Zeit ihrer Abwesenheit zu vermieten. Außerdem sei sie als rücksichtsvoll und zurückhaltend bekannt, wie sie Josie und Charles versicherte, und würde ihnen bestimmt nicht auf die Nerven gehen oder gar von ihnen unterhalten werden wollen. Sie wisse sich schon zu beschäftigen.
Noel seufzte.
Wie immer würden seine Mutter und sein Vater dieses banale Ereignis in höchsten Tönen dramatisieren. Die Frau hätte noch nicht den Fuß über die Türschwelle gesetzt, wüsste sie bereits alles über seine großartige Karriere bei Hall’s, über die Tätigkeit seiner Mutter in der Keksfabrik und über die gewichtige Rolle, die sein Vater als dienstältester Portier in dem großen Hotel spielte, in dem er arbeitete. Man würde sie umgehend über den Verfall der moralischen Werte in Irland, die mangelnde Beteiligung an der Sonntagsmesse und über das exzessive Komasaufen aufklären, das jedes Wochenende die Ambulanzen der Krankenhäuser mit Alkoholleichen überschwemmte. Und ganz sicher würden sie Emily auffordern, gemeinsam mit ihnen den Rosenkranz zu beten.
Noels Mutter hatte bereits lange Zeit unschlüssig hin und her überlegt, ob sie ein Bild des Heiligsten Herzens Jesu oder doch lieber das von Unserer lieben Mutter von der Immerwährenden Hilfe in das frisch gestrichene Zimmer hängen sollte. Immerhin hatte Noel es mit seinem Vorschlag, bis zu Emilys Ankunft zu warten, geschafft, jede weitere Diskussion dieses schrecklichen Themas zu unterbinden.
»Sie hat Kunst unterrichtet an der Schule, Mam. Vielleicht bringt sie ja ihre eigenen Bilder mit«, hatte er gesagt, und zu seinem Erstaunen hatte sich seine Mutter sofort umstimmen lassen.
»Du hast recht, Noel. Ich weiß, ich neige dazu, immer alles regeln zu wollen. Aber ich freue mich schon darauf, wenn eine Frau im Haus ist, mit der ich auch mal solche Dinge besprechen kann.«
Noel konnte nur hoffen, dass seine Mutter recht hatte und dass diese Frau nicht ihr häusliches Leben durcheinanderwirbeln würde. Es standen ohnehin einige Veränderungen bevor. In ein, zwei Jahren würde sein Vater in Rente gehen. Seine Mutter hatte in der Keksfabrik zwar noch ein paar Jahre vor sich, aber auch sie überlegte bereits, baldmöglichst aufzuhören und Charles dabei zu unterstützen, gute Werke zu tun. Noel hoffte, dass Emily ihr Leben vereinfachen und nicht verkomplizieren würde.
Aber meistens dachte er kaum an den bevorstehenden Besuch.
Dies war generell Noels Art der Lebensbewältigung: sich nur nicht allzu viele Gedanken machen – nicht über seinen Job bei Hall’s, der ihm keinerlei Aufstiegschancen bot; nicht über die vielen Stunden, die er in Old Man Casey’s Pub verbrachte, und das viele Geld, das er dort versoff; nicht über den religiösen Wahn seiner Eltern, die im Rosenkranzgebet die Antwort auf alle Probleme dieser Welt sahen. Ebenso blendete Noel einfach aus, dass er keine feste Freundin hatte. Er hatte bisher eben noch nicht die Richtige kennengelernt, das war alles. Auch der Mangel an Freunden generell bereitete ihm kein Kopfzerbrechen. Es gab Orte, an denen man leicht Freundschaften schließen konnte; Hall’s Baustoffhandlung zählte gewiss nicht dazu. Die beste Art, mit unbefriedigenden Lebensumständen umzugehen, bestand darin, sie einfach zu ignorieren. Und bisher hatte Noel mit seiner Einstellung Erfolg gehabt.
Warum etwas reparieren wollen, das nicht kaputt war?
Charles Lynch war den ganzen Abend über sehr still gewesen. Weder hatte er den neuen Haarschnitt seiner Frau bemerkt, noch war ihm aufgefallen, dass sein Sohn auf dem Nachhauseweg vier Bier im Pub getrunken hatte. Und dass am nächsten Tag Emily, die Tochter seines Bruders Martin, vor der Tür stehen würde, interessierte ihn nicht im mindesten. Martin hatte zu Lebzeiten klar zu verstehen gegeben, dass er keinerlei Interesse an der Familie in der alten Heimat habe.
Emily hatte im Lauf der Jahre stets sehr nette Briefe geschrieben und sogar angeboten, während ihres Aufenthalts für Bett und Logis zu zahlen. Das Geld würden sie in nächster Zeit noch dringend benötigen. Man hatte Charles Lynch an diesem Morgen nämlich mitgeteilt, dass man seine Dienste als Hotelportier nicht länger benötige. Er und ein anderer »älterer« Portier würden zum Ende des Monats gehen müssen. Seit er nach Hause gekommen war, versuchte Charles nun, die richtigen Worte zu finden, um Josie die Hiobsbotschaft mitzuteilen, aber ihm wollte nichts einfallen.
Er könnte wiederholen, was der junge Mann im Anzug zu ihm gesagt hatte: eine Abfolge gestelzt klingender Sätze, dass dies nichts mit ihm persönlich oder seiner Loyalität dem Hotel gegenüber zu tun habe. In seiner schmucken Portiersuniform hatte Charles vor dem jungen Mann gestanden – das Sinnbild einer längst versunkenen Epoche. Doch genau darum ging es den neuen Eigentümern. Sie wollten ein neues Image für ihr Hotel, und wer wollte sich schon dem Fortschritt in den Weg stellen?
Charles hatte geglaubt, in seinem Beruf alt werden zu können. Er hatte erwartet, eines Tages eine Jubiläumsfeier erleben zu dürfen, bei der Josie ein langes Kleid tragen und er eine vergoldete Uhr überreicht bekommen würde. Doch nun würde nichts daraus werden.
In zweieinhalb Wochen wäre er arbeitslos.
Für einen Mann jenseits der sechzig, der von dem Hotel entlassen worden war, in dem er seit seinem sechzehnten Lebensjahr gearbeitet hatte, gab es kaum nennenswerte Stellen. Wie gern hätte Charles mit seinem Sohn über sein Problem gesprochen, aber er und Noel hatten seit Jahren kein richtiges Gespräch mehr geführt. Der Junge hatte es stets eilig, in sein Zimmer zu kommen und Fragen oder Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ihn jetzt mit seinen Angelegenheiten zu belasten wäre nicht fair.
Nirgendwo war jemand in Sicht, bei dem Charles auf Verständnis oder auf einen Rat hätte hoffen können. Erzähl es Josie und bringe es hinter dich, dachte er. Aber sie war so sehr mit dieser Frau beschäftigt, die aus Amerika kommen sollte, dass er überlegte, lieber noch ein paar Tage damit zu warten. Charles seufzte. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig.
Von: Betsy
An: Emily
Hättest du dich bloß nicht entschlossen, nach Irland zu gehen! Du wirst mir schrecklich fehlen.
Und warum darf ich nicht wenigstens mitkommen und dich verabschieden …? Aber du warst ja immer schon spontan in deinen Entscheidungen. Warum sollte das jetzt anders sein?
Ich weiß, ich sollte dir wünschen, dass sich in Dublin alle deine Träume verwirklichen, aber ich weigere mich. Ich will schon, dass es dir dort gefällt, aber spätestens nach sechs Wochen sollst du wieder nach Hause kommen wollen.
Ohne dich wird es hier öde und leer sein. Heute Abend wird gleich in der Nähe eine Ausstellung eröffnet, aber ich kann mich nicht überwinden, allein hinzugehen. Und ich werde nicht annähernd so viele Theatermatineen besuchen wie mit dir.
Aber ich werde brav jeden Freitag die Miete von der Studentin eintreiben, an die du deine Wohnung vermietet hast, und ein Auge darauf haben, dass sie keine bewusstseinserweiternden Drogen in deinen Blumenkästen anpflanzt.
Also, versprich mir, dass du mir regelmäßig schreiben und mir haarklein alles berichten wirst. Und lass ja nichts aus. Zum Glück hast du deinen Laptop dabei. Du hast also keine Entschuldigung, dich nicht zu melden. Ich werde dir weiterhin den neuesten Klatsch über Eric aus dem Kofferladen schreiben. Er ist wirklich sehr an dir interessiert, Emily, ob du das glaubst oder nicht!
Ich hoffe, dass du deinen Laptop bald irgendwo anschließen und mir alles über deine Ankunft auf der Grünen Insel erzählen kannst.
Alles Liebe von deiner einsamen Freundin,
Betsy
An: Betsy
Von: Emily
Wie kommst du nur auf die Idee, dass ich bis Irland warten muss, um deine Mail zu lesen? Ich bin noch am J. F. K.-Flughafen, und mein Laptop läuft auch ohne Netz.
Blödsinn! Ich werde dir nicht fehlen – du und deine übersteigerte Fantasie! Immer bildest du dir alles Mögliche ein. Außerdem ist Eric nicht in mich verliebt, nicht die Bohne. Er ist kein Mann vieler Worte, und wenn er etwas sagt, dann hat das was zu bedeuten. Er redete deswegen mit dir über mich, weil er zu schüchtern ist, dich anzusprechen. Aber das weißt du doch, oder?
Du wirst mir auch fehlen, Bets, aber ich muss das hier durchziehen.
Ich verspreche dir, dass ich mich regelmäßig bei dir melden werde. Wahrscheinlich bekommst du täglich eine ellenlange Mail von mir und wirst mich deswegen bald verfluchen!
Alles Liebe,
deine Emily
»Hätten wir sie nicht doch vom Flughafen abholen sollen?«, fragte Josie Lynch an diesem Morgen schon zum fünften Mal.
»Sie hat gesagt, sie würde lieber allein kommen«, erwiderte Charles wie auch schon die vier Mal zuvor.
Noel trank seinen Tee und sagte nichts.
»In ihrem Brief hat sie geschrieben, dass das Flugzeug vielleicht eher landen wird, wenn sie Rückenwind haben.« Josie hörte sich an, als sei sie regelmäßige Vielfliegerin.
Charles seufzte. »Dann dürfte sie ja jeden Moment hier sein …«
Da er wusste, dass seine Tage dort gezählt waren, ging er an diesem Morgen höchst ungern ins Hotel. Er konnte es Josie immer noch beichten, sobald sich diese Frau hier häuslich eingerichtet hatte. Martins Tochter! Hoffentlich hatte sie nicht den großen Durst ihres Vaters geerbt.
Es klingelte an der Tür, und Josie blickte alarmiert auf. Rasch riss sie Noel die Teetasse aus der Hand und nahm Charles den leeren Eierbecher und den Teller weg, ehe sie den Sitz ihrer Frisur überprüfte und mit hoher, unnatürlicher Stimme säuselte: »Geh doch bitte an die Tür, Noel, und heiße deine Cousine Emily willkommen.«
Als Noel die Tür öffnete, stand eine kleine Frau um die vierzig mit krausem Haar und beigefarbenem Regenmantel vor ihm. An jeder Hand einen roten Trolley, sah sie aus, als hätte sie die Situation völlig im Griff: Ihr erster Besuch in diesem Land, und sie hatte sogar mühelos in den St. Jarlath’s Crescent gefunden.
»Du musst Noel sein. Ich hoffe, ich komme nicht zu früh.«
»Nein, wir sind alle schon auf den Beinen. Wir müssen auch gleich los zur Arbeit, aber schön, dass du da bist.«
»Danke. Also, darf ich reinkommen und auch deinen Eltern ›Hallo‹ und ›Auf Wiedersehen‹ sagen?«
Noel schluckte. Hätte sie nichts gesagt, hätte er seine Cousine womöglich noch länger dort stehen lassen, aber schließlich war er noch nicht ganz wach. Der Tag begann erst dann für ihn, wenn er gegen elf Uhr seinen ersten Wodka mit Cola intus hatte. Noel war überzeugt davon, dass bei Hall’s niemand von dem morgendlichen Muntermacher und seinem nachmittäglichen Aufputschdrink wusste. Er achtete stets darauf, eine Flasche Diätcola bei sich zu haben, die er mit Wodka auffüllte, sobald er allein war.
Noel führte die kleine Amerikanerin in die Küche, wo seine Mutter und sein Vater sie zur Begrüßung auf die Wange küssten und beteuerten, was für ein Freudentag es doch sei, dass Martin Lynchs Tochter den Weg zurück in das Land ihrer Vorfahren gefunden habe.
»Dann bis heute Abend, Noel«, rief Emily ihm nach.
»Ja, natürlich. Es kann vielleicht ein bisschen später werden. Ich muss einiges nacharbeiten. Aber fühle dich wie zu Hause …«
»Das werde ich, und danke, dass ich bei euch wohnen darf.«
Noel überließ die drei ihrem Schicksal. Als er die Tür hinter sich schloss, hörte er noch, wie seine Mutter Emily stolz das neu eingerichtete Schlafzimmer im Erdgeschoss zeigte, ebenso die begeisterte Antwort seiner Cousine Emily.
Noel war aufgefallen, dass sein Vater den ganzen Morgen und bereits den gestrigen Abend über sehr still gewesen war, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein. Was sollte Charles schon bedrücken? Für ihn war alles in Ordnung, solange sie ihm im Hotel die gebührende Beachtung schenkten, er jeden Abend den Rosenkranz beten und ein Mal im Jahr nach Lourdes pilgern und davon träumen konnte, noch weiter zu verreisen, nach Rom vielleicht oder gar ins Heilige Land. Charles Lynch besaß die glückliche Gabe, mit seinem Leben zufrieden zu sein, so, wie es war. Er musste sich nicht stundenlang bei Old Man Casey’s betrinken, um die Leere und Sinnlosigkeit seiner Tage und Nächte ertragen zu können.
Noel ging bis zum Ende der Straße, wo er den Bus nehmen wollte. Wie jeden Morgen nickte er den Leuten zu, die ihm entgegenkamen, ohne jedoch irgendwelche Details seiner Umgebung wahrzunehmen. Er fragte sich, wie diese so geschäftig wirkende Amerikanerin wohl hier zurechtkäme.
Wahrscheinlich würde sie gerade einmal eine Woche durchhalten, bevor sie verzweifelt aufgab und wieder abreiste.
In der Keksfabrik hatte Josie nichts Eiligeres zu tun, als den Kolleginnen umgehend von der Ankunft ihrer Nichte Emily zu erzählen, die so problemlos den Weg in den St. Jarlath’s Crescent gefunden hatte, als ob sie hier geboren und aufgewachsen wäre. Was war sie doch für eine nette Person. Sie hatte sich tatsächlich erboten, an dem Abend für alle zu kochen, und sie gebeten, ihr den Weg zum Markt zu zeigen und ihr zu sagen, was sie gern aßen und was nicht. Sie musste sich auch nicht erst hinlegen und ausruhen, da sie im Flugzeug geschlafen hatte. Nachdem sie im Haus alles gebührend bewundert hatte, hatte sie Josie erzählt, dass sie Hobbygärtnerin sei und gern ein paar neue Pflanzen für sie besorgen wolle, wenn sie ohnehin beim Einkaufen war. Das heißt, wenn sie nichts dagegen hätten.
Die anderen Frauen beglückwünschten Josie. Sie könne wirklich von Glück reden, dass diese Amerikanerin so unkompliziert war; es hätte auch anders kommen können.
Im Hotel ließ Charles sich nichts anmerken und war nach außen hin so freundlich und zuvorkommend wie immer. Er schleppte Koffer aus den Taxis ins Foyer, zeigte Touristen den Weg zu den Sehenswürdigkeiten von Dublin, schlug die Anfangszeiten von Theateraufführungen nach und schaute immer wieder mal nach dem traurig dreinblickenden kleinen King-Charles-Spaniel draußen vor dem Hotel. Charles kannte den Hund. Cäsar kam oft in Begleitung von Mrs. Monty, einer exzentrischen alten Dame, die stets einen breitkrempigen Hut, eine dreireihige Perlenkette, einen Pelzmantel, aber nichts darunter trug. Ärgerte jemand sie, schlug sie ihren Mantel auf und erntete sprachloses Staunen.
Dass sie den Hund vor dem Hotel angebunden hatte, konnte nur bedeuten, dass sie wieder einmal in die psychiatrische Klinik eingeliefert worden war. Sollte es sich abspielen wie immer, würde sie nach drei Tagen aus der Klinik entlassen werden und vorbeikommen, um Cäsar in ihr unberechenbares Dasein zurückzuholen.
Charles seufzte.
Das letzte Mal hatte er den Hund im Hotel verstecken können, bis Mrs. Monty ihn wieder abgeholt hatte, doch jetzt lagen die Dinge anders. Er wollte den Hund mittags mit nach Hause nehmen, was Josie allerdings nicht sehr gefallen würde. Aber der heilige Franz von Assisi war schließlich oberster Tierschützer. Falls es zum Streit kommen sollte, könnte Josie nur schwerlich gegen den Heiligen argumentieren. Hoffentlich reagierte die Tochter seines Bruders nicht allergisch auf Hunde oder fürchtete sich gar vor ihnen. Doch dafür wirkte sie viel zu vernünftig.
Emily hatte den Vormittag mit Einkaufen verbracht und stand in der Küche, umgeben von Lebensmitteln, als Charles nach Hause kam. Sie brühte ihm sofort einen Becher Tee auf und machte ihm ein Käsesandwich.
Charles war ihr dankbar, da er befürchtet hatte, nichts zum Mittagessen zu bekommen. Er präsentierte ihr den Hund Cäsar und erklärte ihr den Grund für seinen Besuch im St. Jarlath’s Crescent.
Für Emily Lynch schien dies die natürlichste Sache der Welt zu sein.
»Hätte ich gewusst, dass er mitkommt, hätte ich einen Knochen für ihn besorgt«, sagte sie. »Ich habe übrigens euren netten Nachbarn kennengelernt, diesen Mr. Carroll. Er ist Metzger. Vielleicht kann er mir einen geben.«
Sie war noch keine fünf Minuten im Land und kannte bereits ihre Nachbarn!
Bewundernd sah Charles sie an. »Du bist ja ein richtiges Energiebündel«, meinte er. »Für jemanden, der so fit ist wie du, gehst du aber früh in Rente.«
»O nein, ich habe mir das nicht ausgesucht«, widersprach Emily, während sie den Teigrand um die Pastete legte und festdrückte. »Im Gegenteil, ich habe meine Arbeit geliebt. Aber man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich gehen sollte.«
»Warum? Warum hat man das getan?« Charles war empört.
»Ich war der Schulleitung zu alt und zu konservativ. Man warf mir vor, nicht modern genug zu sein. Ich bin oft vormittags mit den Kindern in Ausstellungen und Galerien gegangen, habe ihnen ein Blatt Papier mit zwanzig Fragen in die Hand gedrückt, und dann sollten sie sich die Antworten dazu überlegen. So hatten sie meiner Meinung nach eine solide Grundlage, um Gemälde oder Skulpturen beurteilen zu können. Doch dann haben wir einen neuen Rektor bekommen, selbst noch ein halbes Kind, der der Ansicht war, dass es bei der Kunst einzig und allein um den freien Ausdruck geht. Deshalb wollte er junge Leute von den Universitäten in die Schulen holen, die dort gelernt hatten, wie man dies den Schülern vermittelt. Ich wusste es nicht, also musste ich gehen.«
»Aber man kann doch niemanden entlassen, nur weil derjenige ein gewisses Alter erreicht hat?«
Charles konnte sich gut in Emilys Lage versetzen, auch wenn sein eigener Fall anders lag. Er war schließlich das öffentliche Gesicht des Hotels, wie man ihm gesagt hatte, und heutzutage musste dieses Gesicht jung sein. Logisch, aber grausam. Doch Emily war nicht alt. Sie war noch keine fünfzig. Gegen diese Art der Diskriminierung musste es Gesetze geben.
»Nein, entlassen haben sie mich nicht, aber ich durfte nicht mehr unterrichten. Sie haben mich in die Verwaltung gesteckt, wo ich keinen Kontakt mehr zu den Kindern hatte. Ich bin schließlich selbst gegangen, weil die Situation für mich unerträglich wurde. Aber im Grunde haben sie mich dazu gezwungen.«
»Hast du dich sehr geärgert?«, fragte Charles mitleidig.
»O ja, am Anfang war ich sehr wütend. Ich hatte das Gefühl, als wäre meine jahrelange Arbeit dort völlig umsonst gewesen. Wie oft sind mir früher in Galerien ehemalige Schüler begegnet, die zu mir sagten: ›Miss Lynch, ohne Sie würde ich mich heute nicht für Kunst interessieren.‹ Aber als man mich dann aufs Abstellgleis geschoben hatte, kam es mir so vor, als zählte das alles nichts mehr. Als wollte man mir zu verstehen geben, dass ich mit meinem Engagement nichts bewirkt hatte.«
Charles spürte, wie seine Augen feucht wurden. Sie beschrieb exakt seine eigenen Jahre als Portier im Hotel. Auf das Abstellgleis geschoben – genauso kam auch er sich vor.
Emily hatte sich inzwischen wieder gefangen. Sie legte eine dünne Teigplatte auf die Pastete und machte rasch die Küche sauber.
»Aber meine Freundin Betsy hat mich aufgemuntert und gemeint, ich solle doch nicht so dumm sein und mich in den Schmollwinkel zurückziehen. Ich sollte sofort kündigen und endlich anfangen, das zu tun, was ich immer schon machen wollte. Dies sozusagen als Beginn eines neuen Lebens für mich ansehen, wie sie es nannte.«
»Und – hast du das getan?«, fragte Charles.
War Amerika nicht ein wunderbares Land? Hier wäre ihm das niemals möglich – nicht in einer Million Jahre.
»Ja, das habe ich. Ich habe mich sofort hingesetzt und aufgeschrieben, was ich machen wollte. Betsy hatte recht. Hätte ich mich in einer anderen Schule um eine Stelle beworben, wäre vielleicht wieder das Gleiche passiert. Da ich einiges auf der hohen Kante hatte, konnte ich es mir leisten, eine Weile ohne bezahlte Arbeit zu leben. Das Problem war nur, dass ich nicht so genau wusste, was ich eigentlich wollte, und so habe ich erst mal verschiedene Dinge ausprobiert.
Zuerst habe ich einen Kochkurs besucht. Tja, das ist der Grund, warum ich heute so fix eine Hühnerpastete auf den Tisch zaubern kann. Anschließend habe ich mich für einen Intensivkurs angemeldet und alles über Computer und das Internet gelernt, so dass ich jederzeit einen Job in einem Büro bekommen könnte, wenn ich das wollte. Und schließlich habe ich in einer Gärtnerei ein Praktikum gemacht und mir dort alles abgeschaut, was man über Pflanzen und Balkonblumen wissen muss. Im Besitz all dieser neuen Fähigkeiten habe ich dann beschlossen, mir die Welt anzusehen.«
»Und Betsy? Hat sie das alles mitgemacht?«
»Nein. Mit dem Internet kannte sie sich bereits aus, und kochen will sie nicht, weil sie immer auf Diät ist, aber sie ist eine ebenso begeisterte Hobbygärtnerin wie ich.«
»Einmal angenommen, sie bieten dir deine alte Stelle wieder an? Würdest du zurückgehen?«
»Nein, das geht jetzt nicht mehr, selbst wenn sie mich darum bitten würden. Ich habe viel zu viel zu tun«, erwiderte Emily.
Charles nickte. »Ich verstehe.«
Er schien noch etwas sagen zu wollen, schwieg aber. Stattdessen goss er sich umständlich Milch in seinen Tee.
Emily wusste, dass er noch etwas auf dem Herzen hatte; sie kannte die Menschen. Doch irgendwann würde er schon damit herausrücken.
»Tja …«, sagte er schließlich gedehnt. Jedes Wort schien ihm große Mühe zu bereiten. »Es heißt doch immer, neue Besen kehren gut, aber außer Spinnweben und Dreck fegen sie auch Dinge fort, die wertvoll und wichtig sind …«
Emily begriff. Dieses Problem musste behutsam angegangen werden. Voller Mitgefühl sah sie ihn an.
»Komm, trink noch einen Tee, Onkel Charles.«
»Nein, ich muss wieder zurück«, wehrte er ab.
»Tatsächlich? Überleg doch mal, Onkel Charles. Musst du wirklich? Was können sie dir denn noch antun? Ich meine, was sie nicht bereits getan haben …«
Er warf ihr einen langen Blick zu.
Diese Frau, die er erst heute Morgen kennengelernt hatte, hatte ohne viele Worte begriffen, was Charles Lynch zugestoßen war. Weder seine Frau noch sein Sohn waren dazu in der Lage gewesen.
Die Hühnerpastete, die es an diesem Abend gab, war ein voller Erfolg. Emily hatte auch noch einen Salat gemacht. Die drei unterhielten sich angeregt, und dann kam Emily auf das Thema ihres Ruhestandes zu sprechen.
»Ist schon erstaunlich. Das, wovor man sich am meisten fürchtet, kann sich manchmal als der größte Segen herausstellen! Erst als es vorbei war, ist mir nämlich klargeworden, wie viele Stunden meines Lebens ich in Zügen und Bussen zugebracht hatte. Kein Wunder, dass ich keine Zeit mehr hatte, mich mit dem Internet oder mit dem Gärtnern zu beschäftigen.«
Bewundernd sah Charles sie an. Unauffällig ebnete sie ihm den Weg für sein Geständnis. Er würde es Josie morgen erzählen, vielleicht aber auch gleich jetzt, noch in dieser Minute.
Es war leichter, als er es für möglich gehalten hätte. Stockend begann er zu erzählen, dass er bereits längere Zeit darüber nachdenke, das Hotel zu verlassen. Nun sei kürzlich genau dieses Thema angesprochen worden, und zu seiner großen Verwunderung habe es sich herausgestellt, dass seine Überlegungen auch dem Hotel gelegen kamen, so dass man beschlossen habe, sich in gegenseitigem Einvernehmen zu trennen. Jetzt müsse er nur noch darauf achten, dass er auch eine anständige Abfindung bekam.
Und er fügte noch hinzu, dass ihm den ganzen Nachmittag über nur so der Kopf geschwirrt habe vor Ideen, was er denn jetzt alles machen könne.
Josie staunte nicht schlecht, und sie musterte Charles besorgt. Vielleicht machte er ihr lediglich etwas vor und tat nach außen hin ruhig, während er innerlich vor Aufregung völlig zerrissen war. Doch soweit sie es beurteilen konnte, schien er es ehrlich zu meinen.
»Wenn unser Herr dies für dich vorgesehen hat«, erwiderte sie gottergeben.
»Ja, und ich werde die Gelegenheit mit beiden Händen ergreifen.«
Charles Lynch sprach tatsächlich die Wahrheit. Seit langer Zeit hatte er sich nicht mehr so frei gefühlt. Seit dem Gespräch mit Emily am Mittag schien es ihm, als hielte das Schicksal tatsächlich auch für ihn ein neues Leben bereit.
Emily räumte den Tisch ab und brachte das Dessert herein. Ab und zu mischte sie sich in die Unterhaltung ein. Als ihr Onkel ankündigte, dass er sich um Mrs. Montys Hund kümmern wolle, bis diese wieder aus der Klinik – aus welcher auch immer – entlassen würde, machte sie Charles den Vorschlag, auch noch andere Hunde spazieren zu führen.
»Dieser Paddy Carroll, der Metzger, er hat einen riesigen Hund namens Dimples, und der müsste mindestens zehn Pfund abnehmen. Der Hund, meine ich, nicht sein Herrchen«, sagte sie eifrig.
»Ich kann von Paddy doch kein Geld verlangen«, protestierte Charles.
Josie stimmte ihm zu. »Weißt du, Emily, Paddy und Molly Carroll sind gute Nachbarn. Es käme mir unrecht vor, von ihnen Geld dafür zu verlangen, dass Charles ihren vertrottelten Hund Gassi führt. Das wäre ziemlich unverschämt.«
»Ich verstehe, dass ihr nicht geldgierig erscheinen wollt, aber vielleicht könnte er sich ja hin und wieder mit ein paar Steaks oder einem Pfund Hackfleisch bei euch revanchieren.«
Emily war eine überzeugte Anhängerin von Tauschgeschäften, und Charles schien dem auch nicht abgeneigt.
»Aber sag mal ehrlich, Emily, glaubst du wirklich, dass Charles wieder eine richtige Arbeit finden wird? Du weißt schon, einen Beruf wie im Hotel, wo er ein wichtiger Mann war?«
»Nur vom Spazierenführen von Hunden kann ich bestimmt nicht leben, aber vielleicht finde ich ja Arbeit im Tierheim. Das würde mir gefallen«, meinte Charles.
»Gibt es denn irgendetwas, was ihr beide immer schon mal gemeinsam tun wolltet?«, fragte Emily sanft. »Mir hat es zum Beispiel großen Spaß gemacht, den Stammbaum meiner Familie zu erforschen. Nicht dass ich euch das vorschlagen will.«
»Also, weißt du, was wir immer schon mal machen wollten …«, begann Josie zögernd.
»Was denn?« Emilys Interesse kam von Herzen, und deswegen konnte man auch so gut mit ihr reden.
»Wir fanden es schon immer schade, dass der heilige Jarlath hier im Viertel nie angemessen gefeiert wurde«, fuhr Josie fort. »Unsere Straße ist zwar nach ihm benannt, aber keiner weiß so recht, wer er eigentlich war. Charles und ich haben deswegen überlegt, Geld zu sammeln, um eine Statue zu seinen Ehren errichten zu lassen.«
»Eine Statue für St. Jarlath! Na, so was!« Mit so etwas hatte Emily nicht gerechnet. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, die beiden zu ermutigen, ihre Fantasie spielen zu lassen. »Es ist doch bestimmt schon sehr lange her, dass er gelebt hat, oder?« Sie wollte Josie nicht von vornherein entmutigen, vor allem, als sie sah, dass auch Charles’ Gesicht vor Begeisterung aufleuchtete.
Josie tat Emilys Einwand mit einer Handbewegung ab. »Oh, das ist kein Problem. Bei einem Heiligen spielt es keine Rolle, ob er erst vor ein paar Jahren oder bereits im sechsten Jahrhundert gestorben ist«, entgegnete Josie.
»Im sechsten Jahrhundert?« Das war ja noch schlimmer, als Emily befürchtet hatte.
»Ja, er ist so um das Jahr 520 nach Christus gestorben, glaube ich, und sein Gedenktag ist der sechste Juni.«
»Das wäre vom Wetter her eine gute Zeit, um eine kleine Prozession zu seinem Gedenkschrein zu veranstalten.« Charles war offenbar bereits eifrig am Planen.
»Stammt er denn aus der Gegend hier?«, erkundigte sich Emily.
Anscheinend nicht. Jarlath hatte im Westen des Landes, an der Atlantikküste, gelebt, an der Stelle des heutigen Städtchens Tuam ein Kloster gegründet und es zu seinem Bischofssitz gemacht. Bis auf den heutigen Tag war Tuam eine Erzdiözese. St. Jarlath schien ein großer Lehrmeister gewesen zu sein, und bei ihm waren andere spätere Heilige wie St. Brendan of Clonfert und St. Colman of Coyne in die Schule gegangen.
»Nein, aber man hat ihn hier immer sehr verehrt«, erklärte Charles.
»Warum hätte man sonst eine Straße nach ihm benannt?«, meinte Josie.
Emily fragte sich, was aus ihrem Vater geworden wäre, wäre er in diesem Land geblieben. Hätte Martin Lynch hier wohl ein ebenso bescheidenes und anspruchsloses Dasein geführt wie Charles und Josie, statt als unzufriedener Säufer zu enden wie in New York? Aber diese Geschichte mit dem Heiligen, der vor Hunderten von Jahren an der Westküste Irlands gestorben war – die sollte man doch nicht allzu ernst nehmen, oder?
»Das Problem dürfte sein, genügend Mittel für die Statue zu sammeln und gleichzeitig Geld für den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen«, wandte Emily ein.
Das schien offenbar kein Problem zu sein. In der Hoffnung, Noel eines Tages eine Ausbildung zum Priester finanzieren zu können, hatten die beiden jahrelang jeden Penny auf die Seite gelegt. Aber der Wunsch, ihren Sohn Gott zu weihen, hatte sich nicht erfüllt. Josie und Charles hatten ihre Ersparnisse immer der Kirche zukommen lassen wollen, und dies war die perfekte Gelegenheit.
Emily Lynch ermahnte sich, nicht ständig versuchen zu wollen, die Welt zu verändern. Dies war nicht der geeignete Zeitpunkt, sich zu überlegen, für welche anderen guten Zwecke man das Geld verwenden könnte, selbstverständlich auch für katholische Einrichtungen. Schöner hätte Emily es jedoch gefunden, wenn Josie und Charles das Geld für sich ausgegeben und sich nach einem harten, arbeitsreichen Leben eine kleine Belohnung gegönnt hätten. Schließlich hatten sie einen in ihren Augen tragischen Schicksalsschlag erdulden müssen, als es mit der Berufung ihres Sohnes nichts geworden war.
Aber es gab Kräfte, denen man weder mit Logik noch mit Sachlichkeit beikommen konnte. Emily Lynch wusste das nur zu gut.
Noel hatte einen schlechten Tag hinter sich. Zwei Mal hatte sich Mr. Hall, einen drohenden Unterton in der Stimme, nach seinem Befinden erkundigt. Auf die dritte Nachfrage erwiderte Noel höflich, warum er das wissen wolle.
»Wir haben eine leere Flasche gefunden, in der zuvor Wodka gewesen zu sein scheint«, hatte Mr. Hall erklärt.
»Und was hat das mit mir und der Frage zu tun, ob es mir gutgeht?«, hatte Noel gefragt, wieder voller Zuversicht und neuem Mut.
Unter buschigen Augenbrauen warf Mr. Hall ihm einen langen, strengen Blick zu.
»Das ist die Frage, Noel. Viele Männer, die in ferne Länder auswandern müssen, würden sich glücklich schätzen, wenn sie hier die Arbeit machen dürften, für die du eingestellt wurdest.«
Dann war er weitergegangen, und Noel hatte bemerkt, dass die anderen Arbeiter betreten den Blick senkten.
So hatte er Mr. Hall noch nie erlebt. Meistens richtete dieser im Vorübergehen eine freundliche Bemerkung an Noel, verbunden mit der Aufmunterung, weiterhin fleißig Lieferscheine mit Kassenbons abzugleichen, Hauptbuch und Rechnungen zu überprüfen und generell seinen eintönigen Pflichten als Bürokaufmann nachzukommen.
In der Anfangszeit schien Mr. Hall noch der Ansicht gewesen zu sein, dass Noel Potenzial habe, und hatte ihm immer wieder Vorschläge gemacht. Damals hatte es noch Hoffnung gegeben, doch jetzt nicht mehr. Dies hier war mehr als eine Ermahnung, dies war eine Warnung. Noel war zutiefst erschüttert, und auf dem Nachhauseweg lenkte er seine Schritte automatisch in Richtung von Casey’s großem, behaglichem Pub. Vage erinnerte er sich daran, das letzte Mal wohl ein Bier zu viel getrunken zu haben, aber er zögerte nur einen Moment, ehe er eintrat.
Mossy, der Sohn des alten Casey, wirkte nervös. »Ah, Noel höchstpersönlich.«
»Kann ich bitte eine Halbe haben, Mossy?«
»Äh, das ist keine gute Idee, Noel. Du weißt, du kriegst hier nichts mehr zu trinken. Mein Vater hat gesagt …«
»Dein Vater redet viel in der Hitze des Gefechts. Das Verbot ist doch längst aufgehoben.«
»Nein, ist es nicht, Noel. Tut mir leid, aber so ist es nun mal.«
Noel spürte, wie die Ader an seiner Schläfe zu pochen begann. Jetzt musste er vorsichtig sein.
»Nun, das ist eure Entscheidung. Aber zufälligerweise trinke ich keinen Alkohol mehr und wollte dich eigentlich um eine Halbe Limonade bitten.«
Mossy starrte ihn mit offenem Mund an. Noel Lynch trocken? Er konnte es kaum erwarten, seinem Vater davon zu erzählen.
Noel machte Anstalten zu gehen.
»Wann hast du denn den Sprit aufgegeben?«, fragte Mossy.
»Ach, Mossy, das braucht dich nicht zu interessieren. Mach zu, die Leute warten auf ihre Getränke. Halte ich dich etwa vom Ausschenken ab? Ganz bestimmt nicht.«
»Warte mal, Noel«, rief Mossy ihm nach.
Es tue ihm leid, aber er müsse nun gehen, erwiderte Noel. Und dann stolzierte er hoch erhobenen Hauptes aus dem Lokal, in dem er bisher den größten Teil seiner Freizeit verbracht hatte.
Ein kalter Wind wehte über die Straße, als Noel sich an eine Mauer lehnte und sich klarmachte, was er gerade gesagt hatte. Eigentlich hatte er Mossy, dieses dümmliche Sprachrohr seines Vaters, nur ärgern wollen, doch jetzt musste er zu seinen Worten stehen. Bei Casey’s würde er kein Bier mehr bestellen können, sondern er müsste von nun an in das Pub gehen, in dem Declan Carrolls Vater mit seinem riesigen Hund Stammgast war. Hier traf man sich nicht mit »Freunden« oder »Kumpeln«, hier gab es nur Wettbegeisterte wie Muttie Scarlet, der ständig damit beschäftigt war, mit seinen »Kollegen« den Ausgang eines Pferderennens oder eines Fußballspiels zu diskutieren. Dies war jedoch kein Lokal, in dem Noel sich bisher besonders wohl gefühlt hatte.
Wäre es da nicht bedeutend einfacher, tatsächlich mit dem Trinken aufzuhören? Dann könnte Mr. Hall so viele Flaschen finden, wie er wollte, und Mr. Casey würde sich in Grund und Boden schämen und sich entschuldigen. Was für eine Genugtuung! Und er hätte abends Zeit, endlich das zu tun, was ihn wirklich interessierte. Er könnte sich weiterbilden und einen Abschluss machen, um die Qualifikation für eine Beförderung zu erlangen. Vielleicht könnte er sogar aus dem St. Jarlath’s Crescent ausziehen.
Noel brach zu einem langen Spaziergang durch Dublin auf: den Grand Canal hinauf und über die Georgianischen Plätze wieder zurück. Als er dabei an Restaurants vorbeikam, in denen junge Männer seines Alters mit ihren Freundinnen saßen, kamen ihm so manche Gedanken. Noel war kein gesellschaftlicher Außenseiter, er lebte nur in seiner eigenen Welt, in der diese Art von Frauen für ihn nicht erreichbar waren. Und warum war das so? Weil er nichts Besseres zu tun hatte, als ständig am Tresen herumzuhängen.
Doch das würde sich jetzt ändern. Er würde sich ein Geschenk machen, besser gesagt zwei, nämlich Nüchternheit und Zeit, viel Zeit. Nach einem kurzen Blick auf die Uhr steckte Noel den Schlüssel zum St. Jarlath’s Crescent Nummer dreiundzwanzig ins Schloss. Sie lagen bestimmt alle schon in ihren Betten und schliefen. Zum Glück. Seine Entscheidung war von so weitreichender Bedeutung, dass er sie nicht gleich wieder zerreden wollte.
Doch Noel täuschte sich. Sie waren alle hellwach und saßen lebhaft diskutierend am Küchentisch. Offensichtlich beabsichtigte sein Vater, das Hotel zu verlassen, in dem er sein ganzes Leben gearbeitet hatte. Zudem schienen sie einen kleinen King-Charles-Spaniel namens Cäsar adoptiert zu haben, der ihm aus großen Augen einen seelenvollen Blick zuwarf. Und seine Mutter plante, in der Keksfabrik kürzerzutreten. Seine Cousine Emily hatte offenbar bereits alle Leute aus der Nachbarschaft kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet. Doch am meisten beunruhigte Noel, dass seine Eltern vorhatten, eine Kampagne zur Errichtung einer Statue für einen Heiligen ins Leben zu rufen, der – falls er überhaupt je existiert hatte – bereits vor über fünfzehnhundert Jahren gestorben war.
Als er an diesem Morgen das Haus verlassen hatte, waren sie alle noch vollkommen normal gewesen. Was war in der Zwischenzeit geschehen?
Zu seinem größten Leidwesen konnte Noel sich nicht ohne weiteres in sein Zimmer verdrücken und dort wie üblich die Schachtel mit der Aufschrift »Malutensilien« hervorholen, in der er unbenutzte Malpinsel und seinen Vorrat an Wodka oder Wein aufbewahrte.
Aber er hatte das Trinken ja aufgegeben. Das hatte er schon wieder vergessen.
Während er am Tisch saß und versuchte, die merkwürdigen Veränderungen zu Hause zu begreifen, verfiel er plötzlich in tiefste Depression. Heute Abend bliebe es ihm verwehrt, Trost im Vergessen zu finden. Stattdessen stand ihm eine Nacht bevor, in der er den Versuchungen der Flaschen würde widerstehen oder gar deren flüssigen Inhalt in das Handwaschbecken in seinem Zimmer kippen müssen.
Noel bemühte sich zu verstehen, worüber sein Vater gerade sprach. Es ging darum, Hunde spazieren zu führen, sich um Haustiere zu kümmern, Geld zu sammeln und St. Jarlath den ihm gebührenden Platz zukommen zu lassen. In all den Jahren, in denen er trank, hatte Noel nicht eine Szene erlebt, die so surreal gewesen wäre. Und das an einem Abend, an dem er vollkommen nüchtern war.
Unmerklich verlagerte Noel sein Gewicht und versuchte, die Aufmerksamkeit seiner Cousine Emily zu erregen.
Bestimmt war sie für diesen plötzlichen Stimmungsumschwung verantwortlich, für diese Schnapsidee, dass mit dem heutigen Tag für jeden hier ein neues Leben begönne. Was für ein verrücktes, gefährliches Gedankengut in einem Haus, in dem es seit Jahrzehnten keine Veränderungen mehr gegeben hatte.
Mitten in der Nacht wurde Noel wach und sagte sich, dass ein Entschluss wie der, auf den Alkohol zu verzichten, nicht leichtfertig getroffen werden dürfe. Nächste Woche, wenn sich die Welt um ihn herum wieder beruhigt hatte, könnte er immer noch damit beginnen. Doch als er nach der Flasche in der Schachtel griff, wurde ihm mit einer Klarheit, die er noch nicht oft erlebt hatte, bewusst, dass diese nächste Woche niemals kommen würde. Also schüttete er den Inhalt zweier Wodkaflaschen in das Waschbecken und kippte noch zwei Flaschen Rotwein hinterher.
Dann ging er wieder zu Bett und warf sich unruhig hin und her, bis ihn am nächsten Morgen der Wecker aus dem Schlaf riss.
Emily war in ihrem Zimmer und setzte sich an ihren Laptop, um eine E-Mail an Betsy zu schreiben:
Es kommt mir vor, als würde ich schon seit vielen Jahren hier leben, und dabei habe ich noch nicht einmal die erste Nacht in diesem Land verbracht!
Offenbar bin ich zu einer Zeit gekommen, in der sich erstaunliche Veränderungen anbahnen. Jeder in diesem Haus ist zu einer Art Reise aufgebrochen. Mein Onkel hat seinen Job als Hotelportier verloren und will sich jetzt als Hundesitter selbständig machen, während meine Tante hofft, weniger arbeiten zu können, damit sie Zeit hat, Geld zu sammeln, um einem Heiligen, der schon seit – warte mal – seit über tausendfünfhundert Jahren tot ist, eine Statue zu errichten!
Und der Sohn des Hauses, ein verschlossener Eigenbrötler, hat sich ausgerechnet diesen Tag ausgesucht, um seine Liebesaffäre mit dem Alkohol zu beenden. Ich kann gerade hören, wie er das Zeug flaschenweise in das Waschbecken in seinem Zimmer kippt.
Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, hier könnte es friedlich und still zugehen, Betsy? Habe ich denn bisher nichts dazugelernt, oder bin ich dazu verdammt, auf immer und ewig dumm zu bleiben?
Du musst mir nicht antworten. Das ist weniger eine Frage als eine Feststellung.
Du fehlst mir.
Alles Liebe,
Emily
Kapitel 2
In seiner kleinen Wohnung im Herzen Dublins fand Father Brian Flynn keinen Schlaf. Erst heute hatte er erfahren, dass ihm nur noch drei Wochen Zeit blieben, um sich eine neue Unterkunft zu suchen. Der Umzug wäre nicht das Problem, da er nicht viel besaß, aber leider hatte er auch nicht nennenswert viel Geld. Eine teure Wohnung konnte er sich einfach nicht leisten.
Hinzu kam, dass er nur ungern dieses praktische kleine Apartment verließ, das sein Freund Johnny vor Jahren für ihn gefunden hatte. Von hier aus konnte er in ein paar Gehminuten seinen Arbeitsplatz im Gemeindezentrum für Einwanderer erreichen, und eines der besten Pubs in ganz Irland lag direkt um die Ecke. Außerdem kannte er jeden im Viertel. Der bevorstehende Umzug machte Brian große Sorgen.
»Kann dir der Erzbischof nicht eine neue Wohnung besorgen?«
Viel Mitleid hatte Johnny nicht mit seinem alten Freund. Er selbst war gerade im Begriff, zu seiner Freundin zu ziehen. Dies war natürlich keine Option für einen katholischen Priester mittleren Alters. Johnny hatte die nervtötende Angewohnheit, jedem, der es hören wollte, zu erzählen, dass heutzutage ein Mann schon ein amtlich beglaubigter Irrer sein müsse, um in diesen Zeiten noch Geistlicher zu werden. Das Mindeste, was der Erzbischof von Dublin deshalb für diese armen Schlucker tun könne, sei es, ihnen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Schließlich hätten sie alles aufgegeben, was wichtig war im Leben, und täten Tag und Nacht Gutes.
»Das ist nun wirklich nicht Aufgabe des Erzbischofs. Er hat Wichtigeres zu tun«, protestierte Brian Flynn. »Aber es dürfte kein Problem sein, eine neue Wohnung zu finden.«
Die Suche erwies sich als mühseliger, als er für möglich gehalten hatte. Und jetzt blieben ihm nur noch zwanzig Tage.
Brian Flynn konnte nicht glauben, wie viel Miete die Leute verlangten. Wer sollte das bezahlen? Noch dazu mitten in der Krise!
Und es gab noch andere Dinge, die ihm den Schlaf raubten. Der Priester auf Pilgerreise in Rom war die Spanische Treppe hinuntergefallen und hatte sich das Bein gebrochen. Er lag im Krankenhaus und ließ sich die italienischen Weintrauben schmecken, während Father Flynn ihn noch immer als Krankenhausseelsorger am St.-Brigid-Hospital zu vertreten hatte, was sein Leben zusätzlich verkomplizierte.
Auch aus seiner alten Pfarrgemeinde in Rossmore trafen beunruhigende Nachrichten ein. Seine Mutter, die bereits ziemlich verwirrt war und in einem Heim für Senioren lebte, sollte angeblich eine Erscheinung gehabt haben. Doch wie es sich herausstellte, hatte sie damit das Fernsehen gemeint, und alle im Heim waren bitter enttäuscht gewesen.
Da er im Krankenhaus so oft mit dem Ende des Lebens konfrontiert war, stellte Father Flynn fest, dass er immer öfter über den Sinn dieses Lebens nachdachte. Da war zum Beispiel diese arme Stella. Sie schien ihn schon deshalb sehr zu mögen, weil er arrangiert hatte, dass eine Friseurin zu ihr ins Krankenhaus gekommen war. Die junge Frau erwartete ein Kind und war todkrank. Sie hatte bisher nicht viel gehabt von ihrem kurzen Leben, aber anderen Menschen erginge es oft noch viel schlechter, wie sie einmal zu Brian sagte. Stella hatte nicht das geringste Interesse daran, sich auf die Begegnung mit ihrem Schöpfer vorzubereiten, doch in dem Punkt war der Geistliche konsequent. Solange die Patienten das Thema nicht von sich aus zur Sprache brachten, erwähnte er es auch nicht. Schließlich wussten sie, wofür er da war. Wünschten sie Vermittlung mit der himmlischen Instanz, Gebete oder die Vergebung ihrer Sünden, so war er für sie da, ansonsten hielt er sich diskret zurück.
Mit Stella hatte er bei einem Glas Single-Malt-Whiskey so manches gute Gespräch geführt – ob es dabei nun um die Viertelfinalspiele der Fußballweltmeisterschaft oder um die ungleiche Verteilung des Reichtums in dieser Welt ging. Dabei vertraute Stella ihm eines Tages an, dass sie noch eine letzte Sache zu erledigen habe, ehe sie sich in die andere Welt – was immer diese ihr auch bringen mochte – verabschieden müsse. Eine einzige Sache. Doch sie hegte die Hoffnung, dass sich alles zum Positiven fügen würde. Und dabei hatte sie Father Flynn gefragt, ob er die nette Friseurin bald wieder zu ihr schicken könne, denn sie müsse unbedingt hübsch aussehen, wenn sie alles für diese letzte Sache in die Wege leitete.
Father Flynn lief in seiner kleinen Wohnung auf und ab, deren Wände mit Fußballpostern bedeckt waren, um die feuchten Stellen zu kaschieren. Vielleicht würde er Stella fragen, ob sie nicht eine Unterkunft für ihn wusste. Vielleicht war das taktlos, da er weiterleben würde und sie nicht, aber es wäre immer noch besser, als in ihr verwüstetes Gesicht und in ihre gequälten Augen zu schauen und ihrem Leid einen Sinn zu geben versuchen.
Im St. Jarlath’s Crescent lagen Josie und Charles Lynch noch lange wach und flüsterten leise miteinander. Gestern Abend um diese Zeit hatten sie Emily noch nicht einmal gekannt, und heute hatte sie bereits ihr gesamtes Leben umgekrempelt. Jetzt hatten sie einen Hund und eine Untermieterin, und zum ersten Mal seit Monaten hatte Noel sich zu ihnen gesetzt und mit ihnen gesprochen. Und sie waren dabei, eine Kampagne ins Leben zu rufen, um den heiligen Jarlath gebührend zu würdigen.
Das Leben hatte sich an allen Fronten verbessert.
Und erstaunlicherweise blieb dies auch noch eine Weile so.
Die psychiatrische Klinik teilte dem Hotel mit, dass sie Cäsars Besitzerin, eine adelige, wenn auch ziemlich exzentrische Lady, wohl noch länger dabehalten müsste, und fügte hinzu, dass sich doch bitte jemand um den kleinen Hund kümmern möge. Der Hotelmanager begriff im ersten Moment nicht, worum es ging, war indes erleichtert, als er erfuhr, dass die Angelegenheit bereits geregelt war, und auch ein wenig beschämt, als man ihm sagte, dass er die Lösung des Problems dem alten Portier zu verdanken hatte, den er eben erst wegrationalisiert hatte. Charles Lynch schien ihm nichts nachzutragen, sondern wies nur dezent darauf hin, dass er sich über eine Art Verabschiedung in den Ruhestand sehr freuen würde. Der Manager machte sich eine Notiz, damit er nicht vergaß, etwas zu organisieren oder einen anderen damit zu beauftragen.