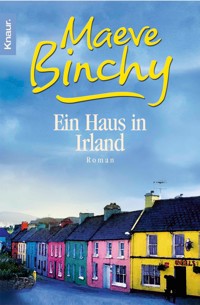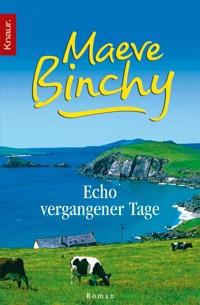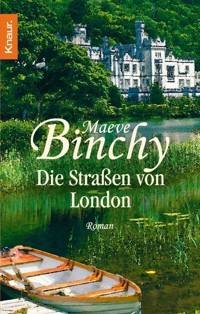6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Grüne Insel-Reihe
- Sprache: Deutsch
Erzählungen aus Irland zum Mitfühlen und Träumen Der zweite Band der atmosphärischen Kurzgeschichtensammlung der irischen Bestseller-Autorin Maeve Binchy über Frauen-Freundschaften und Familien-Beziehungen. Bisher unveröffentlichte, kleine irische Perlen über Frauen, die ihren Weg im Leben suchen, von ihren Ängsten, Wünschen und Sehnsüchte berichten. Es sind warmherzige Liebesgeschichten und Beziehungsgeschichten aus Irland mit der gewissen Portion Humor über Liebe, Freundschaft und Hoffnung. Da ist zum Beispiel Annie, die sich nach der Hochzeit ihrer besten Freundin einsam fühlt und sich überwindet, alleine in den Urlaub zu fahren. Die eitle Sandra ist gezwungen, sich auf ihrer Europa-Reise die nicht ganz so schicken Kleidungsstücke der anderen Reisemitglieder zu leihen, da ihr Koffer verloren gegangen ist. Bella kann nicht akzeptieren, dass sich Jim von ihr scheiden lassen möchte, und will abnehmen, um ihm wieder zu gefallen. Und die Katze Audrey schaut sich in der Nachbarschaft nach einem neuen Zuhause um, nachdem ihre Besitzerin verstorben ist. Nach dem ersten berührenden Kurzgeschichten-Band "Irische Sehnsucht" nun der zweite Teil der Anthologie der bisher unveröffentlichten Erzählungen der berühmten irischen Bestseller-Autorin Maeve Binchy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Maeve Binchy
Irische Hoffnung
Erzählungen von der Grünen Insel
Aus dem Englischen von Gabriela Schönberger
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der zweite Band der atmosphärischen Kurzgeschichtensammlung der Bestseller-Autorin Maeve Binchy. Bisher unveröffentlichte, kleine irische Perlen über Frauen, die ihren Weg im Leben suchen, von ihren Ängsten, Wünschen und Sehnsüchte berichten. Es sind warmherzige Liebesgeschichten und Beziehungsgeschichten aus Irland mit der gewissen Portion Humor über Liebe, Freundschaft und Hoffnung.
Da ist zum Beispiel Annie, die sich nach der Hochzeit ihrer besten Freundin einsam fühlt und sich überwindet, alleine in den Urlaub zu fahren.
Die eitle Sandra ist gezwungen, sich auf ihrer Europa-Reise die nicht ganz so schicken Kleidungsstücke der anderen Reisemitglieder zu leihen, da ihr Koffer verloren gegangen ist.
Bella kann nicht akzeptieren, dass sich Jim von ihr scheiden lassen möchte, und will abnehmen, um ihm wieder zu gefallen.
Und die Katze Audrey schaut sich in der Nachbarschaft nach einem neuen Zuhause um, nachdem ihre Besitzerin verstorben ist.
Inhaltsübersicht
Die Schlechtwetterfreundin
Audrey
Keine Tränen im Tivoli
Ein Unterschied wie Tag und Nacht
Valentinstag auf den Kanaren
Kontinentales Frühstück inklusive
Der Traumurlaub
In Auflösung
Unter Frauen
Sandras Koffer
Bella und der Eheberater
Schwere Entscheidung in Brüssel
Mit Maß und Ziel
Ein Wintermärchen
Ein Haufen Scherben
Das Liebesmahl
Dustys Winter
Komisches kleines Ding
Die Abmachung
Jetzt erst recht
Die Silvesterparty
Die Schlechtwetterfreundin
Wenn ich beim Heimkommen sehe, dass der Anrufbeantworter blinkt, muss ich immer an meine Freundin denken. Das Gerät habe ich mir damals wegen einer Freundin angeschafft. Eine gute Freundin, aber eben eine Schlechtwetterfreundin.
An dem Tag, als ich sie das erste Mal getroffen habe, stand sie an der Bushaltestelle, so dünn und zerbrechlich, dass ich befürchtete, ein starker Windstoß, der um die Ecke fegte, könnte sie erfassen und gegen das Bushäuschen schleudern. Ihr Kopf kam mir riesig vor, mit einer Unmenge an braunem, gekraustem Haar, kein Afrolook, eher sah es so aus, als hätte jemand mit der Schere hineingeschnitten so wie wir damals in der Schule bei den Quasten aus Wolle. Ich betrachtete lange ihr Haar, ohne zu bemerken, dass ich sie anstarrte.
Wahrscheinlich stehen viele Leute an dieser Bushaltestelle und bekommen nicht mit, dass sie jemanden anstarren. Die Haltestelle liegt direkt gegenüber der Klinik. Und auch ich wollte an alles denken, nur nicht an das Gesicht meiner Freundin Maria, die mich nicht sehen würde in dem Zimmer, in dem sie dort drinnen saß –Zelle nannten sie so etwas nicht – und immer wieder diese Karten mischte. Keine normalen Spielkarten, sondern Tarotkarten mit Schwertern und Kelchen und Sternen. Stunde um Stunde sitzt sie so da, legt die Karten in Kreuzform aus und murmelt dabei vor sich hin.
John wusste nicht, dass ich bei ihr gewesen war. Er hatte mich angefleht, nicht hinzugehen. »Wir haben sie schließlich zu dem gemacht«, hatte er oft gesagt. »Das ist unsere Strafe.« Ich hatte versucht, diese Bemerkung ins Lächerliche zu ziehen. Ich bin die irische Katholikin, erklärte ich ihm; falls es einen Sinn für Sünde gibt, dann sollte ich den haben.
Er war in einem Haus aufgewachsen, in dem keiner im Plauderton über die Hölle redete so wie wir. Und doch war er derjenige mit dem Berg aus Schuldgefühlen, der unsere Liebe letztendlich unter sich begrub. Wir hatten Maria betrogen, er als ihr Ehemann, ich als ihre beste Freundin.
Ich stand da und starrte auf den großen, lockigen Kopf dieser blassen Frau, die mit beiden Armen ihre dünne Taille umfasste, als versuchte sie, ungeschickt die obere Hälfte ihres Rumpfs an den restlichen Körper zu pressen.
Sie lächelte nicht, als sie mich ansprach.
»Ich heiße Fenella«, sagte sie.
»Diesen Namen kenne ich bisher nur aus Schulgeschichten.« Es stimmte; in diesen Büchern war Fenella immer die Mutige, der Wildfang. Zu Hause kannte ich niemanden, der Fenella hieß.
»Sie sind sehr aufgewühlt, nicht wahr?«, fragte sie.
In ihrer Stimme lag so viel Mitgefühl, dass ich fast die Hand ausgestreckt, sie berührt und ihr geholfen hätte, diesen dünnen Körper zusammenzuhalten, aus Angst, er könnte auseinanderbrechen und eine Hälfte weggeweht werden. Sie hatte nicht die für Haltestellen übliche Bemerkung gemacht, von wegen, dass der Bus nie kam, wenn man ihn brauchte. Sie hatte auch nicht gesagt, dass man nach einem Krankenhausbesuch dankbar sein müsse für die eigene Gesundheit. Sie schaute mich nur an und sah meinen Schmerz und mein Unglück so deutlich, dass sie diesen Umstand einfach angesprochen hatte.
Ich dachte zwar, es sei der scharfe, kalte Wind, der mir in die Augen stach, als er um die hohen Mauern der Klinik pfiff, aber es war ihr Mitgefühl, das mir die Tränen in die Augen trieb. Nie zuvor hatte ein fremder Mensch so zu mir gesprochen. Nicht einmal bei mir zu Hause, wo sie oft zu direkt waren und sich zu weit in dein Leben drängten. Aber ausgerechnet in England, in den gepflegten grünen Seitenstraßen im Umland von London, hatte eine komplett fremde Frau vor den spitzenbewehrten Mauern einer privaten Nervenklinik zu mir gesagt, sie könne sehen, wie erschüttert ich sei. Ich kam mir vor wie eine Närrin, während die Tränen über mein Gesicht liefen. Die Frau streckte den Arm aus, ich dachte, sie würde mich umarmen, und wich ein wenig zurück. Aber nein, es kam nur der Bus.
»Das ist eine Bedarfshaltestelle«, sagte sie sanft. »Sie müssen artig darum bitten, dass er hält, sonst fährt er weiter.«
Ich glaube, sie versuchte, mir ein Lächeln zu entlocken, damit ich nicht ganz so aussah wie jemand, der aus diesen hohen Mauern geflohen war.
Sie löste meine Busfahrkarte und trat in mein Leben.
Sie kannte ein kleines Café in der Stadt, wo es selbst gemachte Suppen und wunderbare Vollkornbrötchen gab. Essen für die Seele. Und die Tische standen weit genug auseinander, so hörte niemand außer Fenella meine Geschichte von John und Maria. Dass sie an allem schuld gewesen war, dass sie ein vollkommen glückliches Leben geführt hatte, bis sie es sich in den Kopf setzte, Carlos zu erobern, dass sie das völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Ich erzählte Fenella von den einsamen Tagen und Nächten, in denen John und ich uns gegenseitig getröstet hatten, wie nur gute Freunde es konnten, durch Liebe und Zuwendung. Von meiner Hoffnung, dass Maria ihr Glück bei Carlos und ihrer aberwitzigen Suche finden würde. Doch John wollte, dass alles seine Ordnung hatte; er mochte es nicht, wenn Fragen offenblieben. Und jetzt hatte alles seine Ordnung. John kannte nur noch seine Arbeit, Maria hatte den Verstand verloren und befand sich an einem Ort, den sie nie mehr verlassen würde, und was mich betraf … Es ist seltsam, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals einem Menschen so viel erzählt zu haben wie Fenella, nicht nur an diesem Nachmittag in der warmen Suppenküche mit dem prasselnden Kaminfeuer, den knusprigen Brötchen und den wärmenden, belebenden, dampfenden Schüsseln voller Köstlichkeiten.
Später, als es Abend wurde, kam sie mit in meine Wohnung, nachdem sie mir im Zug zurück nach London erklärt hatte, dass es ihr nicht klug erschiene, mich allein zu lassen. Sie setzte sich auf einen Stuhl, und das Haar stand wie ein Strahlenkranz um ihren Kopf. Für mich war sie in der Tat eine Heilige, die bereit war, mir ohne ein Wort des Vorwurfs zuzuhören.
Und das Schönste daran war, dass sie nicht ein einziges Mal versuchte, mich aufzuheitern. Nicht ein Mal sagte sie, ich würde über ihn hinwegkommen und einen anderen finden. Nicht ein Mal warnte sie mich, dass jeder Mann auf seine Art ein Dreckskerl sei und dass man sich die Zeit sparen könne, sich ihretwegen die Augen auszuweinen. Sie machte mir keinerlei Hoffnung, dass Maria sterben und dass John je zur Vernunft kommen und mich anflehen würde, an seine Seite zurückzukehren. Sie akzeptierte die Tatsache, dass alles ganz entsetzlich war, und teilte die Last mit mir.
Bald verspürte ich eine unendliche Müdigkeit und hieß sie willkommen, wie man den Regen willkommen heißt nach einem drückenden Tag. Es war so lange her, dass meine Schultern und Augen sich müde anfühlten. Normalerweise verbrachte ich den größten Teil der Nacht hellwach und angespannt, eine Zigarette in der Hand. Im Lehrerzimmer in der Schule war den anderen bestimmt schon aufgefallen, wie launisch und reizbar ich geworden war. Unmut stieg in mir hoch. Das waren meine Kollegen und Freunde seit fast einem Jahrzehnt. Wie kam es, dass keiner von ihnen meinen Kummer bemerkt hatte und in der Lage gewesen war, mir zuzuhören, Verständnis zu zeigen, ein Freund zu sein? Schläfrig lächelte ich Fenella zu. Sie müsse nun gehen, sagte sie und lehnte mein Angebot ab, im Gästezimmer zu übernachten. Sie würde mich morgen anrufen. Es war Samstag, ein bekanntermaßen schwieriger Tag für unglückliche Menschen.
Während ich in den ersten richtigen Schlaf seit Monaten hinüberglitt, fiel mir ein, dass sie keine Telefonnummer von mir hatte. Vielleicht könnte ich ja ihre herausfinden, dachte ich. So häufig kam der Name Fenella bestimmt nicht vor. Ich konnte mich nicht erinnern, wie sie mit Familiennamen hieß, was sie arbeitete oder wo sie wohnte. Sie hatte es mir sicher gesagt. Oder? Wir konnten doch nicht die ganze Zeit nur über mich geredet haben. Doch der Schlaf war stärker als die Verwirrung. Ich knipste nicht einmal das Licht aus.
Ich war gerade bei meiner zweiten Tasse Kaffee angelangt, als sie anrief. Sie hätte sich die Nummer notiert, sagte sie. Ich war zu unglücklich, um mir wegen irgendwelcher Nebensächlichkeiten Gedanken zu machen. Ob wir in den Park wollten? Es sei so ein schöner Tag, wir könnten spazieren gehen und dabei reden, ohne dass uns jemand störte. Ich verspürte einen Anflug von Scham, da ich bereits genug geredet hatte, aber ihre Anteilnahme schien so groß, dass es mir wie eine Zurückweisung ihrer Freundschaft vorgekommen wäre, wenn ich abgelehnt hätte.
Und so durchwanderten Fenella und ich an diesem sonnigen Tag der Länge und der Breite nach einen der großen Londoner Parks, während ringsum Liebende Händchen hielten, Mütter sich mit anderen Müttern austauschten und zwischendurch ihre Kleinkinder zurechtwiesen, alte Männer in der Zeitung blätterten und einander von Ereignissen erzählten, die Jahre zurücklagen.
Hin und wieder setzten wir uns auf eine Bank. Fenella hatte kleine Sandwiches und eine Thermoskanne mit Kaffee mitgebracht, sodass wir die Grünanlage nicht verlassen mussten, bis meine Beine müde wurden und meine Augen schmerzten von den vielen Tränen, die sie geweint hatten. Ich erzählte ihr von meiner ersten Nacht mit John, davon, dass er mich schon immer geliebt hatte, schon bevor Maria zu der Wahrsagerin gegangen war, die ihr den Floh ins Ohr gesetzt hatte, sich auf die Suche nach unpassender Liebe und unerfüllbaren Träumen zu machen. Ich erzählte ihr auch Banales wie die Tatsache, dass John und ich im Bett immer Animal Snap spielten, uns kleine, rote Hüte aufsetzten und Tommy Cooper und seine Zaubertricks imitierten.
Fenella merkte sich alles. Jedes einzelne Wort.
»Es muss hart für euch beide gewesen sein, als Maria selbst mit dieser Wahrsagerei anfing«, sagte sie.
Ich hatte ganz vergessen, dass ich ihr von Maria und den Tarotkarten erzählt hatte. Am Sonntag fühlte ich mich stark genug, John gegenüberzutreten, ohne ihm eine Szene zu machen; immerhin hatte ich zwei Nächte durchgeschlafen. Ich hatte mir meinen ganzen Kummer von der Seele geredet. Es würde keine Emotionen, kein Drama, keine schlimmen Vorwürfe geben.
Auf dem Weg zurück von Johns Haus fragte ich mich, welchem Grad an Selbstversunkenheit ich es zu verdanken hatte, dass ich Fenella erneut gehen ließ, ohne sie nach ihrer Adresse oder Telefonnummer gefragt zu haben. Aber als ich zu meiner Wohnung kam, saß sie dort im Hof und wartete auf einer der rustikalen Bänke unter dem alten Kirschbaum auf mich. Es war ein warmer Abend.
»Ich dachte, du brauchst mich vielleicht«, sagte sie.
»Du musst mich ja für sehr schwach halten«, erwiderte ich schluchzend. Ich hockte auf meinem Bett und schlürfte die Mischung aus Honig, Zitrone und heißem Wasser, die sie mir zur Beruhigung zubereitet hatte. Fenella hatte sich im Sessel niedergelassen.
»Hast du dir hier in dem Bett einen Fez aufgesetzt und Animal Snap gespielt?«, fragte sie, und vor lauter Rührung, dass sie sich das gemerkt hatte, brach ich gleich wieder in Tränen aus.
Sie war so gut zu mir, Fenella; sie nahm sich alle Zeit der Welt für mich. Natürlich notierte ich mir schließlich ihre Adresse und Telefonnummer und erfuhr nebenbei, dass sie in einer Agentur arbeitete, die mit Buchrechten handelte. Das klang spannend, aber Fenella erzählte nicht viel – sie wolle mich nicht mit Formalitäten ihres Jobs langweilen, meinte sie. Ihre Agentur fungierte als Zwischenhändler für Literaturagenten im Königreich und auf dem Kontinent. Sie schlugen Bücher für Übersetzungen ins Griechische oder Italienische oder sonstige Sprachen vor und bekamen dafür eine Provision. Ob sie viele interessante Menschen kennenlerne?, fragte ich sie. Nicht viele, sie verhandelten nicht direkt mit den Autoren, erwiderte sie zurückhaltend. Ich hatte verstanden und stellte keine weiteren Fragen zu Fenellas Job. Außerdem redete ich viel über meinen eigenen Beruf.
Ich erzählte ihr, was für Trauerklöße sie bei mir an der Schule seien; keiner versuche je, den Kindern etwas Neues zu bieten. Wie gern hätte ich Autoren eingeladen, damit sie den Schülern erklärten, was es mit dem Schreiben wirklich auf sich hatte. Damit sie einmal lebende Schriftsteller kennenlernten, statt zu glauben, jeder, der schrieb, sei bereits lange tot und begraben. Ich hatte mir Hoffnungen auf die Autorin von Open Windows gemacht. Nicht unbedingt ein Kinderbuch, aber es war schon überraschend, wie viele aus der sechsten Klasse es gelesen und sich mit dem Zorn gegen die Mütter identifiziert hatten, der daraus sprach. Aber ich hatte leider nicht herausfinden können, wo die Autorin lebte, und war sicher, dass der Verlag einen Brief an sie niemals weiterleiten würde, vor allem dann nicht, wenn es sich dabei um eine Anfrage für einen Vortrag handelte.
»Ich kann dir ihre Adresse geben«, sagte Fenella zu meiner Überraschung. Es stellte sich heraus, dass ihre Agentur die Übersetzungsrechte und den Vertrieb für Europa ausgehandelt hatte.
»Ist sie nett?« Ich konnte es nicht glauben, dass tatsächlich jemand diese Autorin kannte.
»Früher standen wir uns einmal sehr nahe, als ihre Mutter eine schlimme Verletzung an der Hüfte hatte. Damals haben wir viel miteinander geredet. Aber jetzt hat sie dafür keine Zeit mehr.« Fenellas Stimme klang kalt.
Doch um an die Schule zu kommen, dafür hatte sie Zeit. Und die Schüler waren hingerissen von ihr. Sie behandelte sie nicht von oben herab, sondern erzählte ziemlich offen, dass sie selbst eine schreckliche Mutter habe. Aber das hätten die meisten Leute, einschließlich ihrer eigenen Kinder. Das gefiel den Schülern; das brachte sie zum Nachdenken. Mich übrigens auch. Ich fing an, über meine eigene, längst verstorbene Mutter zu Hause in Irland nachzudenken. Ich hatte nie ihr Grab besucht. Machte mich das zu einer schrecklichen Tochter? Sie war in vielerlei Hinsicht eine schreckliche Mutter gewesen und hatte von mir verlangt, dass ich zu Hause bleiben, auf dem Land leben und einen Pubbesitzer heiraten solle. Herumzureisen, wie ich das tat, sei für eine Frau viel zu frivol, sagte sie, kein Mann würde mich mehr haben wollen. Vielleicht hatte sie recht gehabt. Stundenlang diskutierte ich das mit Fenella.
Die Schüler wünschten sich auch Louise Mitchell, die Autorin dieser sogenannten Historienromane. Zum ersten Mal waren der Schulleiter und ich einer Meinung, dass es sich dabei im Grunde um Pornografie handelte. Ich fragte mich, ob ich allmählich konservativ wurde oder ob der Direktor sich stärker den Realitäten dieser Welt öffnete. Danach hatten wir Maxwell Lawrie an der Schule, den Schöpfer von Vladimir Klein. Er konnte wunderbar mit Kindern umgehen und erklärte ihnen, wie man Spionagebücher und Thriller schrieb, indem man mit der letzten Seite anfing und von dort aus die Handlung entwickelte. Die Ausarbeitung ähnele einer mathematischen Aufgabe, sagte er. Diejenigen, die es nicht getan haben konnten, mussten eliminiert werden, und dann musste man ein unwahrscheinliches Motiv für denjenigen finden, der der Täter sein könnte, und alles von vorn aufrollen.
Lawrie kam noch mit auf einen Kaffee ins Lehrerzimmer, und mir schien, dass er mir tatsächlich schöne Augen machte. Mindestens zehn Kinder hätte er gern, sagte er zu mir. Ich nicht auch? Ich sagte, ja, ich sei völlig seiner Ansicht, auch mir sei eine ganze Fußballmannschaft am liebsten: Es wäre wesentlich lustiger, und die Geschwister könnten einander Gesellschaft leisten. Doch wenn wir wirklich vorhätten, das in die Tat umzusetzen, sollten wir uns besser beeilen. Woraufhin er noch denselben Abend vorschlug. Ich denke, zu neunzig Prozent war das nicht ernst gemeint. Fenella sagte, der Mann sei krank, und es wäre wahnsinnig von mir, mich auf so etwas einzulassen, bevor meine Wunden verheilt waren. Seltsam, in dem Moment wurde mir klar, dass meine Wunden verheilt waren. Ich dachte kaum mehr an John, und dieser Maxwell Lawrie – das war nicht sein richtiger Name, eigentlich hieß er Cyril Biggs – kam mir doch recht interessant vor. Ich fand seinen Annäherungsversuch nicht krank, eher witzig. So etwas sagt man schon mal. Ich meine, ich bin achtundzwanzig Jahre alt, und er ist um einiges älter. In unserem Alter heißt es nicht mehr: »Würden Sie vielleicht mit mir ausgehen?« Oder? Man macht Witze darüber, dass man bald anfangen muss, wenn man plant, zehn Kinder oder mehr in die Welt zu setzen. Fenella spitzte die Lippen. Ich beließ es dabei. Ich wollte sie nicht aufregen.
Cyril hatte mir geraten, Mavis Ormitage für einen Vortrag an die Schule zu holen. Sie sei eine beeindruckende Frau, sagte er, groß und wuchtig, immer in Weiß gekleidet, um sich noch größer zu machen. Die Leute nannten sie Moby Dick. Sie verfasste Kurzgeschichten, die aus dem Leben gegriffen schienen, Hunderte von realistischen Storys; Cyril kannte sie, weil sie sich jeden Sommer in einem Kurs für Kreatives Schreiben trafen. Sie besaß das große Talent, über das Leben zu schreiben und es dabei leicht und unkompliziert erscheinen zu lassen. Und das alles mit einem humorvollen Unterton. Ich hatte Bedenken, dass der Schulleiter nicht einverstanden wäre mit der Königin des Realismus, wie sie genannt wurde. Cyril sagte, er würde mit ihm reden; es sei leicht, eine oberflächliche Entscheidung zu treffen, ohne die betreffende Person zu kennen. Mavis täte diesen Kindern gut, die kurz davor standen, ins Leben aufzubrechen – ihr war nichts Menschliches fremd, und sie moralisierte nicht. Das war der Grund für ihren großen Erfolg. Mit einem Land Rover fuhr sie im ganzen Land umher, immer mit einem weißen Regenmantel und einem weißen Südwester auf dem Kopf, wenn es regnete. Ihre Bücher lagen in Plastiktüten verpackt auf dem Sitz neben ihr, denn sie liebte Cabriolets und das Gefühl von Regen auf ihrem Gesicht. So etwas konnte für Kinder doch nur nützlich sein, sagte Cyril.
Fenella kannte Mavis Ormitage. Ich konnte es nicht glauben. In einer Stadt mit zwölf Millionen Einwohnern hatte sie zwei Menschen getroffen, die mir ebenfalls über den Weg gelaufen waren. Und dabei war Mavis nicht einmal eine Klientin von ihr. Ihre Art zu schreiben sei unübersetzbar, sagte Fenella. Es sei das reinste Wunder, dass sie sich hier im Land überhaupt verkaufe.
Nein, wie sollte es anders sein, Fenella hatte Mavis Ormitage im richtigen Leben kennengelernt, vor ungefähr fünf Jahren. Mavis hatte eine Tochter, die behindert war, und sie hatte ihr Leben diesem Mädchen geopfert. Inzwischen war sie natürlich kein Mädchen mehr, sondern eine Frau. Die Tochter musste so um die vierzig gewesen sein, als Mavis sich gezwungen sah, sie in eine Klinik zu bringen. Fenella hatte damals eine Freundin, Ruth, die dort arbeitete.
Von Ruth hatte ich bisher noch nichts gehört.
»Wo ist sie jetzt? Diese Ruth, meine ich.«
Fenella hatte keine Ahnung. Ruth war damals schrecklich deprimiert gewesen, was an ihrer echt schrecklichen Mutter lag. So ähnlich wie diejenige in Open Windows! Die ihre kleidete sich wie ein Teenager und gab sich der Lächerlichkeit preis, indem sie durch die Straßen lief und fremde Männer anmachte. Die arme Ruth war vollkommen am Boden zerstört gewesen, aber um wieder auf die Beine zu kommen, hatte sie angefangen, ehrenamtlich in besagter Klinik auszuhelfen. Und zufälligerweise hatte sie davor an einem Schreibkurs teilgenommen, den Mavis Ormitage geleitet hatte. Vermutlich sogar derselbe wie der von Cyril.
Ich hatte das Gefühl, dass Fenella nicht viel von Cyril hielt. Und von Mavis auch nicht. Und in gewisser Weise auch nicht von ihrer Freundin Ruth.
Nun, viele Worte verlor sie nicht darüber. Fenella ging nie sehr ins Detail, was sie selbst betraf. Aber Mavis erkannte Ruth wieder, die im Krankenhaus Wägelchen mit Büchern und Zeitschriften durch die Korridore schob. Sie kamen ins Gespräch und unterhielten sich oft auf dem Gang, in der Kantine und in dem hübschen, großen Klinikgarten. Ich sah alles deutlich vor mir. Sah, wie Fenella sie zu den von überhängenden Ästen beschatteten Parkbänken dirigierte. Hörte, wie Mavis über ihre sterbende Tochter und Ruth über ihre verrückte, mannstolle Mutter sprach. Spürte, wie beide Frauen beeindruckt waren von Fenellas Interesse und ihrem phänomenalen Gedächtnis für die Einzelheiten ihrer Geschichten.
»Gute Zeiten waren das damals«, sagte Fenella. »Mit guten Gesprächen unter einem Baum im Krankenhauspark.« Sie wirkte abwesend, während sie an die guten Zeiten dachte, damals, als sie von den Geschmacklosigkeiten einer verrückten alten Frau und dem langsamen Sterben einer aufgedunsenen, behinderten jungen Frau erfuhr. Mich überkam ein Schauer, und ich wünschte mir, ich wäre an diesem Abend mit Cyril Biggs ausgegangen.
Es ging mir nicht darum, zehn oder überhaupt irgendwelche Kinder in die Welt zu setzen. Cyril war ein witziger, selbstironischer Mann, der sich oder andere nicht allzu wichtig nahm. Hätte ich ihm von John und Maria erzählt, was höchst unwahrscheinlich war, wäre er nur kurz darauf eingegangen. Er hätte nicht wissen wollen, was Maria sagte, als sie das von John erfuhr, und wie wir sie betrogen hatten.
Mavis Ormitage war zweifellos diejenige Besucherin an unserer Schule, die am meisten für Gesprächsstoff sorgte. Die Schüler liebten sie vom ersten Moment an, als sie mit ihrem offenen Land Rover die Auffahrt hinaufbrauste und, umhüllt von wallender, weißer Seide, die Aula betrat. Hinterher stellte sie noch zahllose Fragen und konnte erst zum Aufbruch bewegt werden, als die Sicherheitsleute darauf hinwiesen, dass es an der Zeit sei, das Tor zu schließen.
Mavis Ormitage hatte einen kleinen Flachmann mit Brandy mitgebracht und kippte im Lehrerzimmer jedem von uns einen Schuss in den Kaffee. Sogar der Direktor schien erfreut zu sein über die spontane Party. Und so etwas war noch nie vorgekommen. Ich zwang mich, irgendwann die Sprache auf Fenella zu bringen, auch wenn mir das nicht leichtfiel. Aus zwei Gründen nicht. Zum einen war es schwierig, Mavis allein zu fassen zu bekommen, und außerdem hatte ich Angst, illoyal zu erscheinen. Es war, als würde man an einem wehen Zahn herumdoktern: Mit einer Frage nach Fenella handle ich mir bestimmt schlechte Nachrichten ein, dachte ich. Warum will ich etwas Schlechtes über eine Frau hören, die so freundlich zu mir war? Suche ich nach einer Ausrede, sie nicht mehr sehen zu müssen?
Mavis musterte mich aus kleinen Knopfaugen inmitten all der Falten in ihrem fröhlichen Gesicht.
»Fenella? Eine der gütigsten Personen, denen ich je begegnet bin«, erwiderte Mavis. »Zu der Zeit zumindest. Es gibt eine Zeit für Menschen wie Fenella, wie es schon in den alten Psalmen heißt. Eine Zeit, geboren zu werden, eine Zeit, zu sterben, und eben eine Zeit für die Fenellas dieser Welt.«
»Und wenn diese Zeit vorbei ist?«, fragte ich.
»Dann werden Sie es wissen, aber Fenella wird nie dazu in der Lage sein. Sie gleicht einem Geisterschiff, ständig auf Kollisionskurs mit anderen, dem Untergang geweihten Schiffen, denen sie hilft, um später von ihnen verlassen zu werden.«
Ein wenig blumig war ihre Sprache schon, und sie weckte Schuldgefühle in mir.
Mir ging es inzwischen nämlich viel besser. Ich wollte nicht mehr über John und Maria reden, über schlaflose Nächte oder gefühllose Kollegen oder über das Versäumnis, das Grab meiner Mutter nicht besucht zu haben. Ich richtete meinen Blick nach vorn. Nur Fenella richtete den ihren nach hinten.
»Was wurde aus Ruth?«, wollte ich wissen.
»Das ist eine unglaubliche Geschichte«, erwiderte Mavis und bebte vor Vergnügen. »Ihre Mutter lernte drei attraktive junge jüdische Lebensmittelhändler kennen. Keiner weiß, wer von denen – oder ob einer überhaupt – ihr Liebhaber ist. Sie hat sich total beruhigt und zu einer hervorragenden Geschäftsfrau entwickelt. Ruth hat dann diesen wunderbaren Mann kennengelernt, der im Museum arbeitet. Momentan läuft dort diese große Dinosaurier-Ausstellung, für die überall Reklame gemacht wird. Sie wissen doch, oder?«
»Aber die beiden werden heiraten! Ich habe es in der Zeitung gelesen«, rief ich aufgeregt. »Die Trauung wird in der prähistorischen Abteilung stattfinden.«
»Sie hat Fenella eingeladen, aber Ruth weiß, dass sie keine Antwort bekommen wird.«
Es folgte ein kurzes Schweigen. Ich musste rasch weitersprechen, sonst hätte mir noch jemand die wunderbare Mavis Ormitage entführt.
»War es in dem Moment, in dem Sie sich wieder besser und nicht mehr wie ein zum Untergang verdammtes Schiff fühlten, als Ihnen das alles ein bisschen zu viel …«
»Sie war wunderbar in ihrer Zeit«, wiederholte Mavis.
»Soll ich ihr Grüße von Ihnen ausrichten und sagen, dass Sie sich nach ihr erkundigt haben?« Ich wusste, das war mehr als halbherzig.
»Nein, nein, besser nicht. Aber wie gesagt, der Ozean ist voller zum Scheitern verdammter Schiffe, Sie werden schon noch dahinterkommen … Ich meine, vor mir gab es da diese tolle Frau, die Open Windows verfasste und eine ebenfalls schreckliche Mutter hatte, und dann waren da eben Ruth und ich und zwischen mir und Ihnen noch ganz viele andere.«
Ein paar Wochen später klingelte das Telefon, und ich hoffte, dass es Cyril war. Doch mir wurde schwer ums Herz, als ich Fenellas Stimme hörte.
»Muss heute ein schlimmer Tag für dich sein, hat dich wahrscheinlich ganz schön runtergezogen«, sprach sie auf Band. Ich löschte umgehend die Aufnahme.
Mir fiel nämlich wieder ein, was Mavis zu dem Direktor in Bezug auf ihren Anrufbeantworter gesagt hatte. »Keine Bandaufnahme kann je eine so verheerende Wirkung haben wie eine lebende Stimme. Eine Stimme, deren Zeit vorüber ist.«
Verwirrt hatte der Schulleiter genickt; er war den Schuss Brandy in seinem Kaffee nicht gewohnt. Aber ich wusste jetzt, was Mavis gemeint hatte. Und außerdem war Cyril ein Mensch, der gern Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterließ. Das gab ihm das Gefühl, einfallsreich, kreativ und sogar – wenn die Stimmung danach war – liebevoll zu sein.
Audrey
Als die alte Miss Harris starb, wusste Audrey, ihre schwarz-weiße Katze, nicht, wohin.
Audrey war klar, dass nicht wenige wohlmeinende Menschen der Ansicht waren, es wäre am besten, sie einzuschläfern, aber Audrey war noch nicht bereit für den Katzenhimmel, und so ahnte sie, dass sie rasch handeln musste. Sie musste sich ein neues Zuhause suchen und sich als Teil des Haushalts unentbehrlich machen. Das Problem war nur, dass sie niemanden aus der Nachbarschaft besonders gut kannte. Das Leben bei Miss Harris war einfach und angenehm gewesen: Audrey hatte nie die Notwendigkeit verspürt, sich anderweitig umzusehen. Doch jetzt musste sie eine Entscheidung treffen.
Bei den Wilsons nebenan wollte sie auf keinen Fall wohnen. Die Frau hatte eine sehr scharfe Stimme, und der Ehemann war bekannt dafür, dass er Audrey gern mal einen Tritt verpasste, wenn niemand hinsah. Außerdem hatten sich die Wilsons als schlechte Nachbarn erwiesen, als die arme Miss Harris älter und schwächer wurde. Es hätte sie nicht umgebracht, wenn sie ihr morgens eine Tasse Tee vorbeigebracht hätten. Audrey hätte den Tee ja gern selbst gemacht, aber Katzen waren dazu leider nicht in der Lage, und so musste sie schweren Herzens mitansehen, wie Miss Harris ihre schmerzenden Gliedmaßen aus dem Bett quälte, bis sie langsam und mühselig in die Gänge kam.
Audrey überlegte kurz, zu Eric zu ziehen, ein angenehmer Zeitgenosse, der Audrey einmal ein ganzes Filetsteak überlassen hatte. Aber nur weil er betrunken war, wie sich herausstellte, und aus Versehen; er hatte das Steak für sich selbst zubereitet, und dann war es irgendwie auf dem Boden gelandet. Selbstverständlich hatte Audrey es verzehrt – voller Dankbarkeit, versteht sich –, konnte jedoch nicht begreifen, weshalb er es danach wie eine Stecknadel im ganzen Haus suchte.
Aber auch wenn Eric ein Herz aus Gold besaß und sich Miss Harris gegenüber freundlich benommen hatte, letztendlich könnte er sich als schlechte Wahl erweisen, weil er oft betrunken und folglich unzuverlässig war. Er könnte Audrey leicht ins Haus sperren und anschließend für sechs Monate verschwinden, und wenn er wiederkam, wäre sie nur noch ein Katzenskelett.
Da Audrey die meisten der anderen Haushalte nicht kannte, begab sie sich auf eine Besichtigungstour.
Keinesfalls infrage kam die Familie, die sie bereits wegscheuchte, bevor sie ihre vier Pfoten über die Schwelle gesetzt hatte. Ebenso wenig das pensionierte Paar, das einander zuraunte, Audrey könne schließlich F-L-Ö-H-E haben. Man stelle sich vor! Abgesehen davon, dass Audrey nie Flöhe hatte, wie kamen diese Leute auf die Idee, sie könnte, falls sie das Wort überhaupt verstand, auch noch wissen, wie man es buchstabierte?
Und auch nicht die drei Mädchen, die sie unter keinen Umständen ermutigen wollten, weil sie eine Katze im Unterhalt für zu teuer hielten. Auch nicht der Drummer, der aus heiterem Himmel die beunruhigendsten Geräusche mit seinen Trommeln erzeugte und sogar eine ausgeglichene Katze wie Audrey verunsichern würde. Und generell nicht Familien mit Kleinkindern, die dazu neigten, Audrey am Hals zu packen und ihr die Luft abzuschnüren.
Audrey wünschte sich, Miss Harris wäre noch am Leben und hätte sie nicht allein gelassen. Sie war so eine nette Dame gewesen, hatte oft in ihrem Garten gebuddelt und dabei mit sich selbst gesprochen. Zu Audrey sagte sie immer: »Du bist die Einzige, die mich wirklich vermissen wird, wenn ich einmal nicht mehr lebe. Aber dir kann ich meinen Schatz leider nicht hinterlassen, sonst würde mich Henry noch für geisteskrank erklären.«
Miss Harris hasste ihren Neffen Henry aus tiefstem Herzen. Er besuchte sie ein Mal im Jahr und zeigte sich, wie es schien, wenig erfreut darüber, dass sie noch immer am Leben war. Neugierig sah er sich in Miss Harris’ Haus um und klimperte mit dem Wechselgeld in seinen Taschen, als plante er bereits einschneidende Veränderungen für die Zeit nach ihr. Nach Henrys letztem Besuch war Miss Harris sehr aufgebracht gewesen und mit einer Schaufel hinaus in den Garten gegangen.
Audrey war ihr gefolgt, um ihr Gesellschaft zu leisten. Es war ausgesprochen schade, aber Miss Harris wusste nicht, dass Audrey jede ihrer Äußerungen verstehen konnte und versuchte, ihr jedes Mal eine Antwort zu geben. Doch alles, was Miss Harris und alle anderen verstanden, war nur ein Wort: Miau.
Das war äußerst ärgerlich.
Miss Harris hatte an dem Tag gegraben und gegraben. Niemand würde das je finden, hatte sie dabei vor sich hin gemurmelt, nicht einmal Henry und eine Horde von Detektiven. Audrey sah interessiert zu, wie die guten silbernen Kerzenhalter und dicke Plastikumschläge mit Bargeld neben dem Rittersporn in der Erde verschwanden. Danach kehrte Miss Harris ins Haus zurück und ruhte sich erst mal aus.
In der nächsten Zeit ruhte sie sich immer öfter aus, mit Audrey auf ihrem Schoss, bis zu dem Tag, an dem sie ganz zu atmen aufhörte.
Audrey streifte noch lange genug durch Haus und Garten, um genau mitzubekommen, dass Henry vor Wut schäumte.
»Meine Tante muss mehr an Vermögen besessen haben als das, was sie in ihrer Handtasche herumtrug«, ereiferte er sich. In ihrem Testament hatte Miss Harris verfügt, dass das Haus verkauft und der Erlös an einen Tierschutzverein gehen sollte. Den Rest der Erbmasse sollte ihr Neffe Henry aus Dankbarkeit für seinen jährlichen Besuch erhalten.
Der Rest der Erbmasse stellte sich jedoch als äußerst unbedeutend heraus. Kaum der Rede wert. Doch alles war juristisch in Ordnung. Miss Harris hatte ihr Testament bei klarem Verstand verfasst und regelmäßig Bargeld von ihrem Sparkonto abgehoben. Das war ihr gutes Recht. Und von diesem Bargeld war nichts gefunden worden.
Audrey trug schwer an ihrem Geheimnis, während sie die Landstraße entlangtrottete und sich große Sorgen um ihre Zukunft machte. Als sie in ihre Straße einbog, sah sie vor Hausnummer achtundzwanzig einen Umzugswagen seine Fracht abladen. Der wenige Hausrat von Miss Harris war bereits verkauft und das Haus geräumt worden.
Von ihrem Posten unter der Hecke aus sah Audrey gebannt zu, wie die Möbel ausgeladen wurden. Keine Hundehütte – das war gut, die Neuen hatten offenbar keinen großen, kläffenden Köter. Kein Vogelkäfig, auch gut; Leute, die Kanarienvögel oder Wellensittiche in Käfigen hielten, hatten Angst vor Katzen. Und Kleinkinder, die Audrey zu ungestüm umarmen könnten, hatten sie offenbar auch nicht.
Die Neuankömmlinge waren allem Anschein nach ein junges Paar, das sein erstes gemeinsames Heim bezog. Sie waren erschöpft von den Strapazen des Umzugs, gespannt, was die Zukunft bringen würde, und in Sorge, ob sie die monatlichen Raten aufbringen konnten. Angenommen, einer von ihnen wurde krank? Angenommen, es gab eine Wirtschaftskrise und keine zusätzliche Arbeit?
Doch sie sprachen einander Mut zu, wanderten mit dicken Teetassen in der Hand durch Miss Harris’ Haus, streichelten die Wände und versuchten, die Energie aufzubringen, die Kartons auszupacken. Die beiden hießen Ken und Lilly, und je länger Audrey sie durch das Fenster beobachtete, desto mehr mochte sie sie.
Aber sie durfte nicht vorschnell handeln. Die zwei waren müde und verängstigt. Die Vorstellung von zusätzlichen vier Pfoten im Haus, einem weiteren Maul zum Füttern wäre ihnen bestimmt zu viel. Sie würde sich langsam an sie herantasten. Bis dahin konnte sie im Gartenschuppen von Miss Harris unterschlüpfen.
Am nächsten Tag fing Audrey einen kleinen Spatz zum Mittagessen und tags darauf eine Feldmaus, aber sie sehnte sich nach den leckeren Mahlzeiten, die Miss Harris ihr immer hingestellt hatte: Schalen voller Katzenfutter zum Aufbau der Knochen und für ein seidiges Fell.
Am dritten Tag hielt sie die Zeit für gekommen, sich dem jungen Paar zu präsentieren. Sorgfältig bereitete sie sich auf den Besuch vor und putzte sich von Kopf bis Schwanz. Sie wusste, dass sie die beiden nicht erschrecken durfte. Reden durfte sie auch nicht, denn sie würden sie ohnehin nicht verstehen und in ihr nur eine jämmerlich miauende Katze sehen, die entweder hungrig war oder sich verlaufen hatte, obwohl sie ihnen doch nur Fragen stellte, um herauszufinden, ob sie bei ihnen gut aufgehoben wäre.
Gäbe es doch nur eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, um dieser Lilly und diesem Ken mitzuteilen, dass sie ihnen keinen Ärger bereiten würde. Im Gegenteil. Schließlich hatte sie bereits drei Jahre in diesem Haus gelebt und könnte sie mit der Nachbarschaft vertraut machen. Aber diese Sprache existierte nicht. Das Paar würde sie für eine hilflose Streunerin halten, anstatt in ihr ein neues, nützliches Mitglied ihres Haushalts zu sehen. Plötzlich fiel Audrey das Halsband ein, das Miss Harris ihr einst gegeben hatte. Auf dem stand »Audrey« und eine Adresse und Telefonnummer.
Als Miss Harris gestorben war, hatte Audrey zwei vorbeikommende Katzen gebeten, ihr zu helfen, dieses Halsband loszuwerden. Es hätte wenig Sinn, wenn freundliche Passanten sie immer wieder zu einem leeren Haus zurückbrächten, wenn sie gerade dabei war, sich ein neues Heim zu suchen. Doch jetzt sah es so aus, als könnte ihr altes auch wieder ihr neues Zuhause werden, wenn sie ihre Karten geschickt ausspielte. Audrey entdeckte das Halsband ganz hinten im Schuppen und nahm es mit, als sie zu Lillys und Kens Haus aufbrach.
Die beiden staunten nicht schlecht, als sie eine schwarz-weiße Katze sahen, die geduldig vor ihrer Tür wartete, ein durchgebissenes Katzenhalsband im Maul. Noch mehr erstaunte sie die Adresse.
»Audrey?«, fragten sie unsicher, und Audrey schmiegte sich an ihre Beine, schnurrte wie ein Motor und streckte ihnen die Pfote hin, wie die Menschen es gern mochten.
»Wir sollten herausfinden, wo sie zu Hause ist«, sagte Ken.
»Na, laut diesem Halsband hier«, meinte Lilly. Lilly war die gutmütigere von beiden, das begriff Audrey sofort.
Ken war abweisender. »Wir werden Katzenfutter für sie besorgen müssen, und dabei haben wir kaum Geld, um uns selbst was zu essen zu kaufen.« Ken war derjenige, den Audrey überzeugen musste. Sie versuchte, sich ganz klein zu machen, ein Häufchen Fell, das kaum etwas zu fressen brauchte. Dafür schnurrte sie umso lauter. Ken war nervös und gestresst, aber das Geräusch schien ihn zu beruhigen.
»Na gut, probieren wir es eine Woche lang mit ihr aus«, stimmte er schließlich zu. Audrey war in Sicherheit. Kein Mensch gibt nach einer Woche ein Katze weg.
Die beiden waren ein nettes, wenn auch sehr ängstliches junges Paar, ständig in Panik wegen der monatlichen Ratenzahlungen. Jeden Abend gingen sie durch Miss Harris’ Haus, streichelten die Wände und bestätigten einander, wie schön es hier war und dass sie sich vom ersten Moment an zu Hause gefühlt hatten. Dann fielen die Überstunden weg, die Ken in seiner Firma bisher immer gemacht hatte, und Lilly bot an, Bügelarbeiten zu übernehmen. Sie hatte bereits Handzettel entworfen, scheute sich aber davor, sie bei den Nachbarn zu verteilen. So nahm Audrey, der ewigen Sorgen leid, die Sache selbst in die Hand und deponierte die Zettel vor den Türen der Nachbarn oder neben den Pflanzentöpfen, und bald nahm das Bügelgeschäft Fahrt auf.
Lilly wunderte sich, dass so viele Leute von ihr gehört hatten – unglaublich, diese Mundpropaganda. Nur Audrey wusste, dass es das Werk geschickter Katzenpfoten war, doch es schien sinnlos, dies irgendjemandem klarmachen zu wollen. Und nach einer Woche war nicht mehr die Rede davon gewesen, dass Audrey wieder gehen sollte. Die beiden hatten sie in ihr Herz geschlossen, und wie zu Miss Harris’ Zeiten schlief sie auf ihrem Bett und tröstete sie des Nachts mit ihrem Schnurren.
Und dann erzählte Lilly Ken, dass sie ein Junges erwarte. Ein Menschenjunges natürlich. Und Ken regte sich fürchterlich auf, schrie, dass sie sich das nicht leisten könnten, und lief Türen knallend aus dem Haus. Lilly weinte bitterlich, wandte sich in ihrer Not an Audrey und klagte, dass sie nie ein Junges haben würden. Sie würden nie über genügend Geld verfügen. Es sei dumm von ihnen gewesen, dieses wunderhübsche Haus zu kaufen.
Audrey verstand das nicht; entweder bekam man ein Junges oder nicht. Audrey selbst konnte keine Kätzchen mehr bekommen, weil jemand etwas mit ihr gemacht hatte: Sie hätte so gern ein oder zwei Würfe gehabt, aber sie dachte, entweder bekam man seine Jungen oder nicht, ihr war nicht bekannt, dass man auf halbem Weg wieder umkehren konnte. Doch dieser Zustand machte Ken und Lilly sehr traurig, und Audrey wusste, dass sie ziemlich bald etwas dagegen unternehmen musste.
Und so lockte sie die beiden unter lautem Maunzen und aufgeregtem Miauen hinaus in den Garten und fing an, dort zu scharren, wo sie Miss Harris ihren Schatz hatte vergraben sehen. Immer wieder drückte sie ihre kleinen Pfoten in die Erde.
»Sie kommt mir vor wie ein Hund, der nach einem Knochen sucht«, sagte Lilly.
»Gott weiß, was wir da ausgraben werden«, erwiderte Ken. »Vielleicht den verrotteten Kadaver eines mausetoten Vogels.«
»Nein, ich bin sicher, es ist etwas Wichtiges«, widersprach Lilly, und so grub Ken tiefer und stieß schließlich auf die Schatulle und die Bündel mit Geld. Ein Vermögen war das, mit dem sie auf Nummer achtundzwanzig wohnen bleiben könnten.
Sogar ein eigenes Junges könnten sie sich leisten. Und richtiges Katzenfutter für Audrey. Flehend schaute sie sie an, doch bitte das Richtige zu tun.
Zusammen kehrten sie in die Küche zurück und bestaunten das Geld. Das musste der alten Dame gehört haben, sagten sie. Die Arme – sie war wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf, als sie das Geld da draußen vergrub. Doch dann fiel ihnen Henry, der schreckliche Neffe der alten Dame, wieder ein.
Unter diesen Umständen würden sie das Geld selbstverständlich behalten. Das konnte man ihm doch auf keinen Fall überlassen.
Audrey entspannte sich ein wenig.