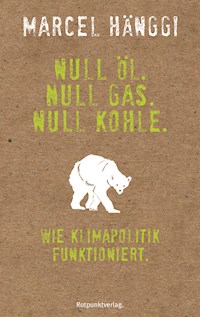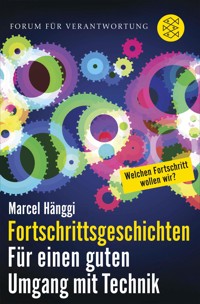Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Marcel Hänggi, Journalist, Buchautor und Initiator der Gletscher-Initiative, zeigt in Weil es Recht ist, wie die Schweizer Bundesverfassung unter ökologischen Gesichtspunkten zu revidieren wäre. Die »Erhaltung der Lebensgrundlagen« ist in der geltenden schweizerischen Bundesverfassung nicht irgendeine Bestimmung: Sie ist ein Zweck der Eidgenossenschaft. Aber der politische Alltag, das ist kein Geheimnis, bringt ständig Beschlüsse hervor, die unsere Lebensgrundlagen weiter zerstören. Was läuft falsch, wenn eine Demokratie immer wieder gegen ein von ihr selbst gesetztes, konsensuelles Ziel handelt? Und selbst wenn dieses Ziel eingehalten würde: Im Zeitalter multipler Umweltkrisen genügt es nicht mehr, die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch uns Menschen zu schützen. Statt die Lebensgrundlagen für alle Lebewesen bloß zu erhalten, müssen wir längst schon regenerieren, was wir beschädigt haben. Und es gilt, Menschen und unsere sozialen Institutionen vor den Katastrophen zu schützen, die eine Folge des menschlichen Eingreifens in natürliche Systeme sind. Marcel Hänggi analysiert die geltende Bundesverfassung. Er findet darin vieles, was richtig, aber unerfüllt ist, und er findet blinde Flecken. Er blickt in die Kantone und ins Ausland. Er diskutiert Vorschläge, wie man die rechtliche Grundlage unserer Demokratie neu denken kann, um sie für Gegenwart und Zukunft tauglich zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Hänggi
Weil es Recht ist
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2025 unterstützt.
© 2024 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Korrektorat: Jürg Fischer
eISBN 978-3-03973-048-3
1. Auflage 2024
Inhalt
Einleitung
Teil I Was wir haben
1 Die Bundesverfassung vom 18. April 1999
2 Nachhaltigkeit
3 Vorsorge- und Verursacherprinzip
4 Schutzobjekte und Schutzmotive
5 Grundrechte und Grundpflichten
6 Eigentum und Wirtschaftsfreiheit
7 Suffizienz und eingebaute Wachstumsspirale
8 Finanzordnung
9 Kantonale Verfassungen
Intermezzo Eine Anregung von aussen
10 Pachamama und Rechte der Natur
Teil II Was wir brauchen
11 System, Systemstabilität und Kipppunkte
12 Verfassungszweck der Mitigation: Grenzen
13 Verfassungszweck der Anpassung: Resilienz
14 Verfahren der Information
15 Verfahren der Entscheidungsfindung
16 Instanzen des Entscheidungsvollzugs
Anhang
Überblick über die Vorschläge
Die wichtigsten Eigenheiten und Begriffe des schweizerischen Politsystems
Zitierte Rechtstexte
Literatur
Nachwort
Dank/Autor
Einleitung
Am 9. April 2024 gab die Vorsitzende der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, Síofra O’Leary, das Urteil im Fall »Verein Klimaseniorinnen gegen die Schweiz« bekannt. In 727 Erwägungen auf 260 Seiten befand der EGMR mit sechzehn gegen eine Stimme, dass die Schweiz die Menschenrechte der klagenden alten Frauen verletzt habe, weil sie sie zu wenig vor der Klimakrise schützt.1
Das Urteil löste in der Schweiz Empörung aus. Der Stände- und der Nationalrat verabschiedeten eine »Erklärung«, wonach »die Schweiz keinen Anlass sieht, dem Urteil [...] weitere Folge zu geben, da durch die bisherigen und laufenden klimapolitischen Bestrebungen der Schweiz die menschenrechtlichen Anforderungen des Urteils erfüllt sind«. Das höchste Menschenrechtsgericht betreibe »gerichtlichen Aktivismus«.1
Viele Medien schrieben von einem Konflikt zwischen Rechtsstaat, der die Einhaltung von Regeln erfordere, und Demokratie, die anders entscheide. Aber diesen Konflikt gibt es nicht, denn das Gericht fordert nur ein, worauf die Schweiz sich bereits demokratisch festgelegt hat. Die Unverschämtheit des EGMR bestand nicht darin, der Schweiz etwas befohlen, sondern darin, sie an die eigenen Werte und Regeln erinnert zu haben, die sie missachtet. Es gibt keinen Konflikt zwischen Demokratie und Rechtsstaat, sondern einen zwischen konsensualen Werten und Zielen einerseits und einem Handeln, das diesen Werten und Zielen widerspricht, andererseits. In der Sprache der Psychologie ausgedrückt: Die Reaktionen auf das Urteil machten eine kognitive Dissonanz sichtbar.
Die Welt steckt in mehreren schweren Umweltkrisen, und wir erleben gerade erst den Anfang ihrer Auswirkungen. Um die Krisen zu begrenzen, bedarf es »systemischen Wandels in nie dagewesenem Umfang« – das ist wissenschaftlicher Konsens.2 Weitermachen wie bisher und mehr erneuerbare Energie erzeugen, mehr rezyklieren und die Umwelt weniger belasten, das reicht nicht mehr. Stände- und Nationalrat irren, wenn sie meinen, dass »die bisherigen und laufenden klimapolitischen Bestrebungen der Schweiz« genügten.
Wir brauchen systemischen Wandel in nie dagewesenem Umfang und müssen uns demokratisch darauf verständigen. Zeit dafür haben wir keine mehr. Diese Ausgangslage ist bedrückend. Was können wir tun, um nicht zu resignieren? Vielleicht sollten wir endlich umsetzen, worauf wir uns demokratisch verständigt haben und was wir in unsere Gesetze geschrieben und zur Basis unserer Demokratie – der Bundesverfassung – gemacht haben.
Wir sollten tun, was Recht ist.
Die Basis ist da
Den Anstoß zu diesem Buch gab ein Studienauftrag von Greenpeace Schweiz, der wiederum von einer angedachten Volksinitiative für eine Totalrevision der Bundesverfassung (vgl. »Nachwort«) angeregt war.2 Die Frage des Studienauftrags lautete: Taugt die schweizerische Bundesverfassung für das Zeitalter der multiplen Umweltkrisen, des Anthropozäns,3 oder wie müsste sie allenfalls revidiert werden?
Ich nahm den Auftrag als juristischer Laie an. Meine Arbeitsmethode ist eine wissenschaftsjournalistische. Der Blick durch die ausgeliehene juristische Brille auf ein Thema, mit dem ich mich seit Jahrzehnten befasse, hat mir neue Einsichten ermöglicht. Vielleicht kann ich mit meinem Blick von außen etwas zur verfassungsrechtlichen Debatte beitragen.
So viel vorweg: Meine Antwort auf die Frage, was die Bundesverfassung im Anthropozän taugt, wird ambivalent ausfallen. Das schweizerische Rechtssystem stellt taugliche Lösungen für Umweltprobleme bereit. Als Antwort auf die systemischen Krisen des Anthropozän aber genügt der klassische Umweltschutz, wie ihn die Schweiz kennt, nicht mehr. Das hat auch der Bundesrat festgestellt.3
Doch die rechtliche Basis, um vorbereitet zu sein, ist vorhanden. Die Bundesverfassung, nähme man sie denn ernst, böte nicht nur Hand für die nötige Transformation. Sie erforderte geradezu eine radikale Umgestaltung unserer Wirtschafts- und Lebensweise hin zu Nachhaltigkeit – in einem strikten Sinne und nicht als Marketingleerformel. Nicht nur haben sich Volk und Kantone die Verfassung »in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung« und »im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen« gegeben (Präambel); nicht nur sind die »nachhaltige Entwicklung« und die »Erhaltung der Lebensgrundlagen« Zwecke der Eidgenossenschaft (Art. 2 Abs. 2 und 4). Die Bundesverfassung gibt darüber hinaus auch Handlungsrichtlinien vor, die so richtig wie unerfüllt sind. Rücksicht auf künftige Generationen, das Vorsorgeprinzip, der Vorrang des Ökologischen vor dem Ökonomischen, die politisch so unbeliebte Suffizienz, Grenzen – die Bundesverfassung enthält das alles.
Dieser Befund macht Hoffnung. Zwar müssen wir die Politik der Normalität überwinden, um Antworten für postnormale Krisen zu finden. Das ist bislang nicht gelungen, ja, eigentlich nicht versucht worden. Doch wir können uns dabei auf bestehendes Recht stützen. »Die meisten Konzepte einer bewussten Transformation betonen die Bedeutung gemeinsamer Ziele und Grundsätze«, stellt der Weltklimarat IPCC fest.4 In der Bundesverfassung haben wir diese gemeinsamen Ziele und Grundsätze.
Man kann den Befund aber auch pessimistisch lesen, und zwar als Beleg für die große Fähigkeit unserer Gesellschaft, die Werte, über die eigentlich Einigkeit herrscht, auszublenden, wenn sie mit den Alltagsgewohnheiten kollidieren.
Ich will sie mit diesem Buch einblenden.
Zwiespätige Demokratieerfahrung
2017 habe ich zusammen mit Heribert Rausch, dem emeritierten Professor für öffentliches Recht und insbesondere Umweltrecht der Universität Zürich, einen Klimaartikel für die Bundesverfassung verfasst. Es war der Initiativtext zur Gletscher-Initiative5, aus der als indirekter Gegenvorschlag das Klimaschutzgesetz6 hervorging, das am 18. Juni 2023 an der Urne angenommen wurde.
Ein Anstoß für mich, die Gletscher-Initiative zu lancieren, war eine Begegnung mit der damaligen Bundesrätin und Umweltministerin Doris Leuthard an der Uno-Klimakonferenz in Paris, an der ich als Journalist teilnahm.7 Dort hatte sich in der zweiten Konferenzwoche eine neue Verhandlungsgruppe gebildet, die »Koalition der Hochambitionierten«, die die Konferenz schließlich zum Erfolg und zur Verabschiedung des Pariser Klima-Übereinkommens führte.
Als Bundesrätin Leuthard in Paris verkündete, dass auch die Schweiz dieser Verhandlungsgruppe beigetreten sei,8 fragte ich sie, ob sie nun bereit sei, auch zu Hause eine »hochambitionierte« Klimapolitik zu verfolgen. »Ach«, sagte sie, »wir wären ja schon froh, für 2 Grad auf Kurs zu sein. Und Sie kennen ja unser Parlament. Und glauben Sie denn, die Amerikaner meinten es ernst?«
Das Übereinkommen kam zustande.9 Es wurde im Konsens beschlossen und von fast allen Staaten der Welt ratifiziert. Kaum ein Land der Welt ist aber bis heute auf Kurs, es zu erfüllen.
Mit der Gletscher-Initiative wollte ich den Bundesrat zwingen, ernstzunehmen, was er in Paris versprochen hatte. Ein politischer Sieg krönte mein Engagement: Am 18. Juni 2023 sagten 59 Prozent der Abstimmenden Ja zum Klimaschutzgesetz. Die Schweiz beschloss als erstes Land der Welt das Netto-Null-Emissionsziel in einer Volksabstimmung. Doch die demokratische Auseinandersetzung, die zu diesem Sieg geführt hatte, war für mich eine zwiespältige Erfahrung.10 (Vgl. Kap. 15 S. »Erfahrung Gletscher-Initiative«)
Die Gletscher-Initiative hätte vorgesehen, fossile Energien ab 2050 zu verbieten. Ein Verbot würde garantieren, dass aus der Energienutzung kein CO2 mehr in die Atmosphäre gelangt: Kohlenstoff, der gar nicht auf den Markt kommt, kann ihn auch nicht als CO2 verlassen. Im Klimaschutzgesetz fehlt dieses Verbot, und ob das Gesetz seine Ziele erreicht, ist ungewiss.
Dass das Initiativkomitee, auch auf meine Empfehlung, die Gletscher-Initiative dennoch zugunsten des Klimaschutzgesetzes zurückzog, hatte seinen Grund letztlich in einer ernüchternden Erkenntnis. Selbst ein glasklar formuliertes Verbot in der Verfassung garantiert dessen Einhaltung nicht.4 Wir zogen die Gletscher-Initiative nicht zuletzt aus der Einsicht zurück, dass ein Verfassungsartikel von begrenztem Wert ist, wenn Bundesrat und Parlament ihn nicht umsetzen wollen.
Grundlegende, für eine Demokratie zentrale Fragen ließen sich im Abstimmungskampf nicht diskutieren, beispielsweise wie viel Energie wir verbrauchen wollen und wie viel wir dafür zu opfern bereit sind? Wäre eine Gesellschaft, die weniger Energie verbraucht, vielleicht sogar eine bessere?11 Die Diskussionen des Abstimmungskampfs verloren sich oft im Kleinklein wissenschaftlicher Studien, die sich in Details widersprachen, während von der Dimension der Bedrohung durch die Klimaerhitzung kaum die Rede war.
Die Bundesverfassung als Ganze auf ihre Anthropozäntauglichkeit in den Blick zu nehmen, war mir nun eine willkommene Gelegenheit, groß zu denken.
Demokratie hält einiges aus
Groß denken müssen wir, und zwar in zwei Richtungen. Wir müssen die Umwelt vor den Folgen unserer Tätigkeiten schützen, und wir müssen uns und unsere Institutionen vor der Umwelt schützen, wenn diese aus den Fugen gerät. Die Umweltkrisen der Gegenwart und der Zukunft zerstören nicht nur Ökosysteme, lassen Arten aussterben und töten Menschen. Sie gefährden auch die Demokratie.12 Die modernen Demokratien sind Kinder der letzten zwei Jahrhunderte: des Zeitalters der zunehmenden Nutzung fossiler Energiequellen. Wir müssen heute das, was dieses Zeitalter an Gutem hervorgebracht hat5, vor dem Schlechten schützen, das es ebenfalls hervorgebracht hat und noch hervorbringen wird.
Die Demokratiehistorikerin Hedwig Richter und der Journalist Bernd Ulrich weisen darauf hin, dass die Demokratie als eine Staatsform gelte, die erstens langsam sei und zweitens den Bürgerinnen und Bürgern nichts zumuten könne, was diesen nicht gefalle. Sie zeigen, dass die Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur etwas zumuten darf und kann, sondern dass Demokratie gar nicht möglich wäre ohne Zumutungen, ohne Selbstbeschränkungen und Disziplin. Namentlich könne Demokratie den Menschen zumuten, etwas nicht nur deshalb zu akzeptieren, weil es ihnen nützt (»Die Energiewende zahlt sich wirtschaftlich aus«), sondern weil es moralisch richtig ist,13 – weil es Recht ist.
Es ist nicht lange her, dass eine Krise die Welt plötzlich und unerwartet traf, deren Bewältigung schnelles Handeln verlangte und den Menschen, wenn auch nur für kurze Zeit, einiges zumutete: die Covid-19-Pandemie. Sie dient Richter und Ulrich als Beispiel, dass Demokratie mit Krisen umgehen kann – bei allen Fehlern, die passiert sind. Denn Demokratie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie keine Fehler macht, sondern dass sie Fehler korrigiert. (Vgl. Kap. 14 »Das Wissen in die Politik bringen«) Man sollte also nicht von vornherein in den Wind schlagen, was einer Mehrheit zu missfallen scheint, und man sollte dies umso weniger tun, wenn konkreten, vielleicht unbeliebten Maßnahmen allgemein anerkannte Grundsätze und eine allgemein anerkannte Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit zugrunde liegen.
Ich will in diesem Buch Lösungen vorschlagen, die nicht unbedingt mehrheitsfähig sind, die aber doch auf mehrheitsfähigen Grundprinzipien aufbauen können. Ich werde also beispielsweise nicht vorschlagen, den Kapitalismus abzuschaffen; aber selbstverständlich muss eine Verfassung Raum für nichtkapitalistische Organisationsformen wirtschaftlicher Tätigkeit bieten, zumal große Teile namentlich der Haus- und Pflegearbeit, der Wissensproduktion oder der Landwirtschaft nichtkapitalistisch verfasst sind. Wenn möglich, schlage ich Änderungen vor, die nicht »originell« sind, sondern bereits irgendwo existieren, etwa in kantonalem oder ausländischem Recht, oder schon einmal vorgeschlagen wurden.
Fertige Antworten gebe ich keine, weil es sie nicht gibt. Wir müssen unsere demokratischen Systeme resilient, also krisenfest machen. »Ein resilientes System kann mit dem Unvorhergesehenen umgehen«, schreiben die »Kollapsologen« Agnès Sinaï, Raphaël Stevens, Hugo Carton und Pablo Servigne.14 Dazu braucht es nicht Endgültigkeit, sondern Flexibilität.
Zwei Verfassungszwecke und drei Voraussetzungen
Eine anthropozäntaugliche Verfassung hat zwei Zwecke zu erfüllen. Sie muss erstens »Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen«, wie es Artikel 74 der Bundeserfassung formuliert. In der Fachsprache heißt dieser Zweck »Mitigation«. Ergänzen müsste man, dass bereits beschädigte Systeme zu regenerieren sind.
Und sie muss zweitens die menschlichen Systeme so gestalten, dass sie in den zu erwartenden Krisen bestehen können. Es ist der Zweck der Anpassung.
Mit dem Begriff ist vorsichtig umzugehen. Meist versteht man darunter in erster Linie technische Maßnahmen wie Hochwasserverbauungen oder eine Umstellung der Landwirtschaft auf Sorten, die zu einem wärmeren Klima passen. Und klimapolitische Bremserinnen und Bremser verlangen, man solle sich veränderten klimatischen Bedingungen anpassen statt zu versuchen, die Klimaerhitzung zu begrenzen. Beides, die Beschränkung auf technische Maßnahmen und die Forderung eines Anstelle-Von, verkennt die Dimensionen der Umweltkrisen. Je weniger es gelingt, die Klimaerhitzung oder den Biodiversitätsschwund zu begrenzen, je mehr also Mitigation und Regeneration versagen, desto schwieriger wird die Anpassung – bis sie nicht mehr möglich ist.15 Und technische Anpassungen werden nicht genügen.
Anpassung, wie ich sie hier verstehe, heißt: Die demokratische Gesellschaft und ihre Institutionen sollen gegenüber den Krisen resilient, also widerstandsfähig16 sein. Eine Staatsverfassung muss auf einem starken Fundament stehen, auf Werten und Zielen, die von den meisten Menschen geteilt werden und idealerweise keiner weiteren Begründung bedürfen.
Die schweizerische Bundesverfassung steht auf einem solchen Fundament. Die Nachhaltigkeit ist in ihr gut verankert; der deutsche Verfassungsrechtler Wolfgang Kahl nennt die Schweiz neben Frankreich17 diesbezüglich sogar als Vorbild für Deutschland.18 Man kann davon ausgehen, dass der Grundsatz, die Lebensgrundlagen seien zu erhalten, unbestritten ist. Der Umweltschutzartikel der Bundesverfassung, der heutige Artikel 74, wurde am 6. Juni 1971 von 92,7 Prozent der Stimmenden angenommen, was fast ein Rekord war. Es war die erste eidgenössische Volksabstimmung, an der Frauen teilnehmen durften.
Aber umgesetzt ist dieser Volksentscheid nur schlecht. Heribert Rausch hat aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des Umweltschutzartikels gezeigt, wie der Artikel in den Gesetzen unzureichend und erst zwölf Jahre nach seiner Annahme an der Urne umgesetzt wurde6, wie die Verordnungen wiederum die Gesetze unzureichend umsetzen und wie schließlich die Bestimmungen der Verordnungen unzureichend durchgesetzt werden.19 Der Rechtswissenschaftlerin Dunia Brunner zufolge wäre eine im strengen Sinne nachhaltige Wirtschaftsweise nicht nur mit der Bundesverfassung kompatibel, sie würde dieser sogar besser gerecht als der heutige Zustand.20
Die Bundesverfassung bietet zumindest, was den Zweck der Mitigation angeht, also schon fast alles, was wir brauchen.21 Dass aber die Umwälzungen, derer es bedürfte, um die Umweltkrisen zu begrenzen und wie sie Brunner zufolge die Bundesverfassung eigentlich fordert, politische Mehrheiten finden könnten, erscheint heute unwahrscheinlich. Es ist ein Grundparadoxon der Umweltpolitik: Niemand will die Lebensgrundlagen zerstören, und doch fällen Gesellschaften demokratisch Entscheidungen, die genau das tun.
Offensichtlich geht auf dem Weg vom Konsens im Grundsatz über die Ausarbeitung konkreter Rechtsbestimmungen bis zu deren Anwendung viel verloren. Die Erklärung, »die Menschen« seien einfach zu bequem, um sich zu verändern, ist jedoch zu einfach. Menschen sind bereit, sich zu ändern, wenn sie es als notwendig erkennen.
Wenn eine Gesellschaft frei und demokratisch Entscheidungen trifft, die einem geteilten Ziel widersprechen, so läuft etwas falsch. Ich sehe Fehler auf drei Ebenen: Die Entscheidungen fallen unzureichend informiert, die Verfahren der Entscheidungsfindung sind unzureichend, die Entscheidungen werden unzureichend vollzogen.
Aufbau dieses Buchs
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Teil I, »Was wir haben«, nimmt die geltende Bundesverfassung unter die Lupe. Teil II, »Was wir brauchen«, fragt danach, was fehlt, um die genannten Zwecke und Voraussetzungen zu erfüllen. Teil I analysiert, was besteht; er ist präziser. Teil II ist notwendigerweise unbestimmter, denn hier geht es um die Zukunft.
Zwischen den beiden Teilen blicke ich als Intermezzo nach Ecuador und auf ein Element seiner Verfassung, das von der indigenen Kultur der Anden geprägt ist und von dem wir uns, wie ich argumentieren werde, inspirieren lassen sollten.
Ich schlage konkrete Änderungen vor. Die meisten Vorschläge zielen auf die Bundesverfassung, ein paar betreffen die Gesetzesebene. Im Anhang findet sich ein Überblick über die Vorschläge in der Abfolge der Verfassungsbestimmungen (vgl. »Überblick über die Vorschläge«). Wenn ich von »Vorschlägen« spreche, ist das kein Bescheidenheitsgestus. Käme jemand und sagte: »Wunderbar, lasst uns das genau so übernehmen!«, so wäre das nicht in meinem Sinne: Eine gute Verfassung entsteht partizipativ und demokratisch, und eine krisentaugliche Verfassung ist nie fertig, sondern muss stets angepasst werden.
1Konkret hat die Schweiz Art. 6, Recht auf ein faires Verfahren, und Art. 8, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt. Die Verletzung von Art. 6 EMRK stellte der Gerichtshof sogar einstimmig fest. Affaire Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (Requête no 53600/20), Urteil, 9. April 2024.
2Der Weltklimarat Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der periodisch den Konsens der Wissenschaften zur Klimakrise zusammenfasst, schrieb 2018 (IPCC 2018, »Summary for Policy Makers«, Erw. C.2): »Pfade zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C [...] würden rasche und weitreichende Umstellungen in den Bereichen Energie, Land, Stadt und Infrastruktur [...] sowie in den industriellen Systemen erfordern (hohes Vertrauen). Diese Systemübergänge sind beispiellos in Bezug auf ihr Ausmaß, aber nicht unbedingt in Bezug auf ihre Geschwindigkeit«. Der Biodiversitätsrat (IPBES) schrieb ein Jahr später (IPBES 2019, Erw. C., S. 14): »Die Ziele für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Natur und die Verwirklichung der Nachhaltigkeit [...] können nur durch transformative Veränderungen wirtschaftlicher, sozialer, politischer und technologischer Faktoren erreicht werden.« Transformative Veränderungen definiert der Bericht als »eine grundlegende, systemweite Neuordnung der technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren, einschließlich der Paradigmen, Ziele und Werte«.
3»Anthropozän« ist ein vom Chemiker Paul Crutzen im Jahr 2000 vorgeschlagener Begriff für ein neues Erdzeitalter, das das Holozän, das vor 11700 Jahren begann, ablöst. Das Definieren der Erdzeitalter ist Aufgabe der International Union of Geological Sciences (IUGS). Sie hat eine jahrelange Debatte darüber geführt, ob man das neue Zeitalter verkünden und wann man es beginnen lassen solle. Im März 2024 hat es die zuständige Subkommission der IUGS schließlich abgelehnt, ein neues Erdzeitalter namens Anthropozän zu definieren. Ein solches, im 20. Jahrhundert beginnendes Zeitalter, so lautete die Begründung, würde den menschlichen Einfluss zu eng fassen, prägten die Menschen ihre Umwelt doch seit Jahrtausenden (Witze 2024). Eine Minderheit argumentierte dagegen, dass diese Prägung in jüngster Zeit eine neue Qualität erreicht habe: »Das System Erde – d. h. die wirklich grundlegenden Dinge wie die Zusammensetzung der Atmosphäre, das Klima und alle Ökosysteme – sind in letzter Zeit stark von der Stabilität abgewichen, die sie während des Holozäns über Tausende von Jahren gezeigt hatten; eine Stabilität, die es der menschlichen Zivilisation ermöglichte, zu wachsen und zu gedeihen.« (Turner et al. 2024). Während es nun also offiziell kein Erdzeitalter namens »Anthropozän« gibt, hat der Begriff sich in den Geistes- und Sozialwissenschaften längst etabliert, und auch ich verwende ihn. Alternativ zum »Anthropozän« wurden auch Begriffe wie »Kapitalozän« oder Chthuluzän« (Haraway 2018) vorgeschlagen.
4Wie selbst glasklare Verfassungsbestimmungen nicht umgesetzt werden, zeigt Art. 84 BV »Alpenquerender Transitverkehr«, der auf die 1994 angenommene Alpeninitiative zurückgeht. Er postuliert: »Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene.« Das Bundesgesetz über die Verlagerung des alpenquerenden Güterschwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene (GVVG) vom 19. Dezember 2008, das den Artikel umsetzen sollte, setzt indes ein Ziel von »höchstens 650000 Fahrten pro Jahr«.
5Oft heißt es, die fossile Energie habe, bei all ihren Schattenseiten, doch auch für präzedenzlosen Wohlstand, eine markante Verbesserung der Lebensumstände, die Senkung der Kindersterblichkeit und so weiter gesorgt und letztlich zu Freiheit und Demokratie geführt. Charkrabarty (2021) weist darauf hin, wie eurozentrisch diese Sichtweise ist. Für die meisten Menschen weltweit, im globalen Süden und in den Unterschichten des globalen Nordens, bedeuteten die fossilen Energietechniken zunächst einmal vor allem, dass sie effizienter ausgebeutet werden konnten. Das Argument von den segensreichen Errungenschaften des Fossilenergiezeitalters übersieht auch, dass Freiheit und Demokratie keineswegs westliche Erfindungen sind. Und natürlich wissen wir nicht, wie die Welt aussähe, hätte es den Energieüberfluss dieses Zeitalters nicht gegeben.
6Das Parlament verabschiedete das Umweltschutzgesetz (USG) 1983; am 1. Januar 1985 trat es in Kraft. Hauptgrund für die lange Dauer war der Widerstand der Wirtschaftsverbände Vorort und Schweizerischer Handels- und Industrieverein, die Vorgängerorganisationen der heutigen Economiesuisse.
Teil IWas wir haben
1 Die Bundesverfassung vom 18. April 1999
Die geltende Bundesverfassung wurde am 18. April 1999 von Volk und Ständen angenommen.1 Sie ist die dritte Verfassung der Schweiz seit der Gründung des Bundesstaats 1848. Die Bundesverfassung von 1848 wurde bereits 1874 durch eine neue abgelöst, die dann 125 Jahre Bestand hatte. Die »weltweit fortschrittlichste Verfassung«22 von 1874 führte mit dem Referendumsrecht ein direktdemokratisches Werkzeug ein, das Initiativrecht folgte 1891,2 ebenso als Weltneuheit die Verfassungsgerichtsbarkeit, wenn auch nur für kantonale Erlasse (vgl. Kap. 16), und stellte nichtchristliche, also insbesondere jüdische Bürgerinnen und Bürger den christlichen gleich. In den 125 Jahren erfuhr diese Verfassung zahlreiche Änderungen – und widerstand manchem sehr lang, am auffälligsten dem Frauenstimmrecht, das die Schweiz als zweitletztes Land Europas 1971 einführte.
Schon 1965 regten politische Vorstöße im Nationalrat an, die Verfassung zu revidieren.3 1977 legte eine 46-köpfige Expertenkommission unter dem Vorsitz von Bundesrat Kurt Furgler einen Verfassungsentwurf vor23, der zunächst enthusiastisch aufgenommen wurde24, dann aber in den Schubladen verschwand. Teile des Entwurfs wie die vom Schriftsteller Adolf Muschg verfasste Präambel schafften es 22 Jahre später in die heute geltende Bundesverfassung.
Der Verfassungsentwurf von 1977 entstand in einer Zeit des aufkeimenden Umweltbewusstseins. 1972 fand der Bericht Die Grenzen des Wachstums an den Club of Rome25 großen Widerhall, und die Vereinten Nationen luden zur ersten Umweltkonferenz nach Stockholm; 1973 löste die OPEC die erste Ölpreiskrise aus, die bewirkte, dass der seit dem Zweiten Weltkrieg rasant angestiegene Energiekonsum kritisch hinterfragt wurde.
Die politischen Schriften der siebziger Jahre zeugen von einem größeren politischen Mut, als es heute üblich ist. So sah der Verfassungsentwurf von 1977 Schranken für Kapitalismus und Wirtschaftswachstum vor. Die prägende Figur für wirtschaftspolitische Fragen in der Expertenkommission war der St. Galler Wirtschaftsprofessor Hans Christoph Binswanger, ein ökologisch bewusster Kritiker des Wachstumszwangs der kapitalistischen Wirtschaft26 mit freisinnigem Parteibuch. Diese Kombination ist heute schwer vorstellbar – und auch damals hatten Wirtschaftsverbände und rechtsbürgerliche Kreise wenig Freude an den eigentums- und wirtschaftspolitischen Vorschlägen des freisinnigen Ökonomen. Sie opponierten gegen den Entwurf und vermochten die Verfassungsrevision vorerst zu stoppen.
Frustriert, weil der Revisionsprozess nicht vorankam, publizierten die Professoren für Verfassungsrecht Alfred Kölz und Jörg Paul Müller 1984 einen eigenen Entwurf. Er nahm denjenigen der Expertenkommission von 1977 auf – Müller hatte der Kommission angehört –, korrigierte aber einige seiner strittigsten Punkte und legte noch konsequenter den Akzent auf ökologische Aspekte.27 Dieser Entwurf wurde lebhaft diskutiert, doch war auch er der bürgerlichen Mehrheit im Parlament zu progressiv.428
Die Verfassung, die Volk und Kantone 1999 endlich verabschiedeten, war weniger visionär als die Entwürfe der Expertenkommission und von Kölz und Müller. Manches von dem, was es nicht aus den Entwürfen in die geltende Bundesverfassung geschafft hat, ist es wert, heute wieder erwogen zu werden. Manches hat die Bundesverfassung aber auch aus den Entwürfen übernommen. Dazu gehört insbesondere die breite Verankerung der Nachhaltigkeit.29
1Bei der bescheidenen Stimmbeteiligung von 36 Prozent nahmen 59 Prozent der Stimmenden die neue Bundesverfassung an; die Ja-Anteile lagen in den Kantonen zwischen 30 (Glarus) und 86 Prozent (Genf).
2Eine Form der Volksinitiative kannte bereits die Verfassung von 1848: die Volksinitiative für eine Totalrevision der Bundesverfassung.
3Außerdem war 1935 eine Volksinitiative für eine Totalrevision der Bundesverfassung aus rechtsextremen Kreisen zur Abstimmung gekommen (»Fronteninitiative«, BBl 1934 III 593); sie scheiterte mit 28 Prozent Ja an der Urne. Immerhin drei Kantone stimmten Ja: Freiburg, das Wallis und, mit einer einzigen Stimme Vorsprung, Appenzell-Innerrhoden.
4Isabelle Häner war damals Kölz’ Assistentin und brachte die Jungliberalen, deren Mitglied sie war, dazu, sich für den Verfassungsentwurf einzusetzen – auch das wäre heute kaum mehr vorstellbar.
2 Nachhaltigkeit
In Werbe- und Alltagssprache ist »Nachhaltigkeit« durch inflationären Gebrauch zur Floskel verkommen. Der Begriff hat aber eine klare und weit reichende Bedeutung.
Staatszweck und »Super-Prinzip«
Laut der Präambel geben sich »das Schweizervolk und die Kantone« die Bundesverfassung unter anderem »in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung«, »im Bestreben, [...] Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken«, »im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme [...] zu leben«, »im Bewusstsein [...] der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen« und »gewiss, [...] dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen«.
Zweck der Eidgenossenschaft sind neben anderem die »gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung« und die »langfristige Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen« (Art. 2 Abs. 2 und 4 BV). Artikel 73 der Bundesverfassung »Nachhaltigkeit« postuliert: »Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.«
Der Nachhaltigkeitsartikel eröffnet Abschnitt »Umwelt und Raumplanung«der Bundesverfassung (Art. 73–80), der die umweltrechtlichen Bestimmungen im engeren Sinne umfasst. (Vgl. Kap. 4) Nachhaltigkeitsbestimmungen finden sich darüber hinaus in den Artikeln 54, »Auswärtige Angelegenheiten«,89, »Energiepolitik«, 104, »Landwirtschaft«, 104a, »Ernährungssicherheit«, und 120, »Gentechnologie im Ausserhumanbereich«. Manche Autor:innen zählen auch den Schuldenbremseartikel 126, »Haushaltführung«, zu den Nachhaltigkeitsbestimmungen. (Vgl. Kap. 9 »Schuldenbremse«)
All das verleiht der Nachhaltigkeit eine übergeordnete Bedeutung über die gesamte Verfassung. Sie ist, mit einem Wort der Lausanner Rechtsprofessorin Anne-Christine Favre, ein »Super-Prinzip«30.
Allerdings kontrastiert dieser hohe Stellenwert »auffällig mit seiner geringen Durchschlagskraft in der politischen Praxis«, schreibt der Staatsrechtler Alain Griffel. »Oftmals zum Schlagwort degradiert, wird ›Nachhaltigkeit‹ meist dann ins Argumentarium aufgenommen, wenn dies gerade dienlich scheint. Eine konsistente, am Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit oder am Konzept der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtete Strategie des Gesetzgebers [...] ist – ungeachtet der umfangreichen bundesrätlichen Strategiepapiere – nicht auszumachen.«31
Was aber bedeutet Nachhaltigkeit?
Brundtland-Definition und ihre Fehlinterpretationen
Im rechtlichen Sprachgebrauch hat sich, in der Schweiz wie international, die Definition etabliert, die die Kommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 1987 vorstellte. Die Brundtland-Kommission, wie sie nach ihrer Vorsitzenden, der norwegischen Politikerin Gro Harlem Brundtland, meist genannt wird, definierte Nachhaltigkeit als Generationengerechtigkeit: »Nachhaltig ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.« So wird die Definition meist zitiert; die Kantone Schaffhausen und Basel-Stadt haben den Satz sinngemäß in ihre Kantonsverfassungen übernommen.
Aber das ist nur die halbe Definition. Fast nie, auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur nicht, wird die zweite Hälfte der Definition zitiert: »Sie [die Nachhaltigkeit] enthält zwei Schlüsselkonzepte: das Konzept der ›Bedürfnisse‹, insbesondere der grundlegenden Bedürfnisse der Armen der Welt, denen oberste Priorität eingeräumt werden sollte, und die Vorstellung von Grenzen, die der Stand der Technik und der sozialen Organisation der Fähigkeit der Umwelt auferlegt, gegenwärtige und künftige Bedürfnisse zu erfüllen.«32 Die »Bedürfnisse«, um die es hier geht, sind also nicht einfach alles, was man auch noch gern hätte, sondern es geht um die Grundbedürfnisse. Und Nachhaltigkeit setzt Grenzen.
Darüber hinaus popularisierte der Brundtland-Bericht den Ausdruck der »nachhaltigen Entwicklung«, der in der französisch- und italienischsprachigen Verfassung auch den Titel von Artikel 73 abgibt33. Und er spricht von drei »Problembereichen« der Nachhaltigkeit, dem ökologischen, dem ökonomischen und dem sozialen.34 Beide Formulierungen haben zu weit verbreiteten Fehllektüren geführt:
Zum Einen wird »nachhaltige Entwicklung« oft umstandslos als »nachhaltiges Wirtschaftswachstum« verstanden. Viele nahmen den Brundtland-Bericht bei seinem Erscheinen, fünfzehn Jahre nach dem Club-of-Rome-Bericht Die Grenzen des Wachstums, erleichtert als die Botschaft auf, die Wirtschaft könne nachhaltig wachsen. Tatsächlich widerspricht der Brundtland-Bericht einer solchen Aussage zwar nicht grundsätzlich; er setzt »Entwicklung« aber keineswegs mit »Wirtschaftswachstum« gleich: »Nachhaltige Entwicklung erfordert eindeutig Wirtschaftswachstum an Orten, an denen diese [menschlichen Grund-]Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Andernorts kann sie mit Wirtschaftswachstum vereinbar sein, vorausgesetzt, der Inhalt des Wachstums spiegelt die allgemeinen Grundsätze der Nachhaltigkeit und der Nichtausbeutung anderer wider. Aber Wachstum allein ist nicht genug.«35
Zum Zweiten ist häufig ist von drei »Säulen« der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft, die Rede, auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur36; das »Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit« verfügt sogar über einen Wikipedia-Eintrag. Die Metapher der »Säule« kommt allerdings im Brundtland-Bericht nicht vor. Sie suggeriert, die drei Bereiche stünden gleichberechtigt und unverbunden nebeneinander – und genau so wird die Rede von den drei Säulen oft verwendet. Ökologische Forderungen werden dann mit dem Hinweis abgewendet, »ökonomische Nachhaltigkeit« sei genauso wichtig, wobei unter dieser häufig und nochmals verkürzt Profitabilität verstanden wird.
Eine solche Sichtweise ist unsinnig. Während natürliche Ressourcen essenzielle Grundlage der Wirtschaft sind, ist das umgekehrt nicht der Fall.5 Oder anders gesagt: Das Ziel der Nachhaltigkeit wird immer wieder mit ökonomischen Partikularinteressen und mit kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Erwägungen in Konflikt geraten. Mit ökonomischer Nachhaltigkeit, die immer langfristig und gesamtwirtschaftlich zu denken ist, kann die ökologische Nachhaltigkeit hingegen nicht kollidieren, denn diese ist eine Voraussetzung für jene und es kann keine ökonomische Nachhaltigkeit geben, wenn die ökologische Nachhaltigkeit nicht erfüllt ist. Ökonomische Nachhaltigkeit ist wichtig, aber nachgeordnet und darf nicht gegen die anderen Bereiche ausgespielt werden. Und sie darf nicht auf Profitabilität oder Wirtschaftswachstum reduziert werden. Wirtschaftlich so handeln, dass die ökonomischen Chancen künftiger Generationen intakt bleiben, ist oft gerade nicht das, was (kurzfristig) profitabel ist und auf dem Markt Erfolg hat. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit muss heißen, die Krisenfestigkeit (Resilienz) der Wirtschaft zu stärken. (Vgl. Kap. 13)
Dass es essenziell ist, Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft zusammenzudenken, hat einen ganz anderen Grund, als es die Säulen-Metapher suggeriert. Es geht nicht darum, dreierlei Interessen gegeneinander abzuwägen, sondern darum, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften und zusammenleben, für die ökologischen Krisen entscheidend ist. Die drei Bereiche der Nachhaltigkeit stehen eben gerade nicht wie Säulen nebeneinander, sondern sind untrennbar und asymmetrisch miteinander verflochten.
Zum Dritten ist mit dem »Drei-Säulen-Konzept« das Konzept der »schwachen Nachhaltigkeit« eng verbunden. Es sieht Umweltressourcen als eine Kapitalform unter anderen, und als nachhaltig gilt ein Handeln, das das Gesamtkapital erhöht. Natürliche Ressourcen dürfen zerstört werden, wenn dadurch mindestens gleich viel ökonomisches Kapital neu entsteht. Dieses Konzept setzt voraus, dass alles miteinander verrechnet werden kann. Der Ökonom Herman E. Daly hat einmal gespottet, »schwache Nachhaltigkeit« sei wie der Glaube, man könne dasselbe Holzhaus auch mit halb so viel Holz bauen, wenn man nur doppelt so viele Sägen und Zimmerleute einsetze.37
Das kann man natürlich nicht, und deshalb brauchen verschiedene ökologische Einheiten je eigene Nachhaltigkeitsziele. Ein solches Nachhaltigkeitskonzept nennt man »starke Nachhaltigkeit«.6
Die Nachhaltigkeitsdefinition der Bundesverfassung
Der Artikel 73 der Bundesverfassung definiert Nachhaltigkeit als ein »auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits«. Diese Formulierung ist aus dem ersten, gescheiterten Entwurf für ein Umweltschutzgesetz von 1973 übernommen und mithin älter als der Brundtland-Bericht. Als sie entstand, war sie »[ihrer] Zeit weit voraus«.738
Auf den ersten Blick bietet diese Definition gewissermaßen eine Zweisäulennachhaltigkeit mit einer ökologischen, der Natur und ihre Erneuerungsfähigkeit, und einer ökonomischen Säule, der Beanspruchung der Natur durch den Menschen, zwischen denen ein »ausgewogenes Verhältnis« zu schaffen sei. Sie kann den Eindruck erwecken, es gehe darum, ein Gleichgewicht zwischen zwei gleichwertigen Anliegen zu schaffen.
Bei genauerer Betrachtung besteht aber keine Symmetrie. Die Erneuerungsfähigkeit der Natur ist gegeben. Was der Artikel regelt, ist einzig ihre Beanspruchung durch den Menschen. Sie ist so zu begrenzen, dass die ökologischen Grenzen nicht überschritten werden. Artikel 73 widerspricht also der Säulenmetapher und gibt – wie auch Artikel 2 Absatz 4 – der ökologischen Dimension einen Vorrang.39
Die Nachhaltigkeit der Bundesverfassung ist also stärker, als eine Dreisäulennachhaltigkeit es sein kann. Ist sie aber schon eine starke? Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sind der Meinung, sie sei als stark zu verstehen.40 Der Bundesrat spricht davon, dass er eine »schwache Nachhaltigkeit plus« anstrebe, und erkennt an, dass die »Kapitalstöcke« Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft nur begrenzt substituierbar seien und dass »insgesamt die Belastbarkeit der Biosphäre respektiert« werden müsse.41 Ich würde dieses Verständnis eher »starke Nachhaltigkeit minus« nennen.
Die Nachhaltigkeitsdefinition der Bundesverfassung ist also gut, weil sie den Vorrang der Ökologie betont. Doch sie suggeriert einen Gegensatz zwischen »Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit« einerseits und »Beanspruchung durch den Menschen« anderseits, bekräftigt also eine Dichotomie, die gerade mitverantwortlich ist für die Umweltkrisen der Gegenwart. Dabei müsste es darum gehen, die »Natur« und den »Menschen« nicht als Gegensätze zu sehen, sondern menschliches Handeln als integralen Bestandteil der ökosozialen Lebensgrundlagen zu verstehen.
Dass schließlich die soziale Dimension in der Nachhaltigkeitsdefinition von Artikel 73 fehlt, wird in der Literatur als unproblematisch bezeichnet, da die Bundesverfassung das Soziale in anderen Bestimmungen regle. Doch das ist wieder ein Denken in Säulen, hier Umwelt, da Gesellschaft. Im Anthropozän muss die Art und Weise, wie eine Gesellschaft zusammenlebt, produziert und konsumiert, mit den Ursachen der Umweltkrise zusammengedacht werden.42
Vorschlag 2.1: Nachhaltigkeit ist als das Superprinzip ernstzunehmen, das es ist, und muss als Grundprinzip der Leitfaden für jegliches Handeln sein, das die Bundesverfassung regelt.
Vorschlag 2.2: Nachhaltigkeit ist, angelehnt an die (vollständige) Definition des Brundtland-Berichts, präziser zu definieren:
Artikel 73 Nachhaltigkeit
(1) Bund und Kantone stellen die Befriedigung der Grundbedürfnisse der heutigen Generation auf eine Weise sicher, welche die Chancen künftiger Generationen nicht schmälert, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
(2) Jegliches Handeln respektiert die Belastungsgrenzen ökologischer [und ökosozialer] Systeme. Das Gesetz legt die nicht zu überschreitenden Grenzen auf wissenschaftlicher Grundlage fest.
(3) Sind Belastungsgrenzen überschritten, sorgen Bund und Kantone für die Reduktion der Belastung. Beschädigte Ökosysteme werden so weit regeneriert, bis ihre Fähigkeit zur Selbstregulierung wiederhergestellt ist.