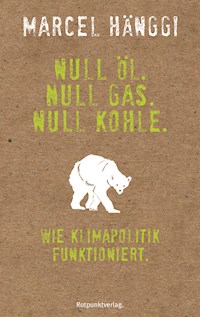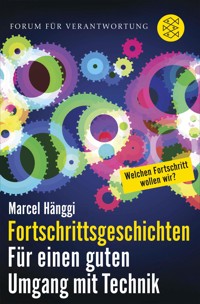
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Welchen Fortschritt wollen wir? Eine neue, ebenso realistische wie kritische Wahrnehmung von Technik ist dringend gefragt: Denn die drohende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, die wir mit unserer Technik zum großen Teil selbst zu verantworten haben, zwingt uns dazu, nach einem zukunftsverträglichen Umgang mit Technik zu suchen. Der Schweizer Technikexperte Marcel Hänggi untersucht in zwölf Fortschrittsgeschichten, wie technischer Wandel zustande kommt, wie wir ihn wahrnehmen und was er der Gesellschaft bringt. Abschließend münden seine Überlegungen in der Vision einer Welt in 30 Jahren, die verantwortungsvoll mit Technik umgeht. Aus der Reihe »Entwürfe für eine Welt mit Zukunft«, herausgegeben von Harald Welzer und Klaus Wiegandt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Marcel Hänggi
Fortschrittsgeschichten
Für einen guten Umgang mit Technik
Über dieses Buch
Eine neue, ebenso realistische wie kritische Wahrnehmung von Technik ist dringend gefragt.
Der Schweizer Wissenschaftsjournalist Marcel Hänggi untersucht in zwölf Fortschrittsgeschichten, wie technischer Wandel zustande kommt, wie wir ihn wahrnehmen und was er der Gesellschaft bringt. Abschließend münden seine Überlegungen in der Vision einer Welt in 30 Jahren, die verantwortungsvoll mit Technik umgeht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Entwürfe für eine Welt mit Zukunft
Herausgegeben von Harald Welzer und Klaus Wiegandt
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403289-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Entwürfe für eine Welt mit Zukunft
Vorwort von Harald Welzer
Fortschritt? Eine Einleitung
Teil I: Dinge
1 Buch
2 Dampf
3 Klee
4 Rad
5 Schwefeläther
6 Überschall
7 Wäsche
Teil II: Treiber
8 Alternativen
9 Erfahrung
10 Spiel
11 Tempo
12 Versprechen
Umwelthandwerker werden. Ein utopischer Epilog
Literaturverzeichnis
Dank
Für Sarah
Entwürfe für eine Welt mit Zukunft
Das 19. und 20. Jahrhundert waren die Epoche der expansiven Moderne. Immer weitere Teile der Welt folgten dem wachstumswirtschaftlichen Pfad, ihre Bewohnerinnen und Bewohner erlebten materiellen und vor allem auch immateriellen Fortschritt: die Gesellschaften demokratisierten sich, wurden freiheitliche Rechtsstaaten, Arbeitsschutzrechte, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialversorgung wurden erkämpft. Im 21. Jahrhundert, da die Globalisierung fast den ganzen Planeten in den wachstumswirtschaftlichen Sog gezogen, aber dabei keineswegs überall Freiheit, Demokratie und Recht etabliert hat, stehen wir vor der Herausforderung, den erreichten zivilisatorischen Standard zu sichern, denn dieser gerät immer mehr unter den Druck von Umweltzerstörung, Ressourcenkonkurrenz, Klimaerwärmung – um nur einige der gravierendsten Probleme zu nennen. Wie sieht eine moderne Gesellschaft aus, die nicht mehr dem Prinzip der immerwährenden Expansion folgt, sondern gutes Leben mit nur einem Fünftel des heutigen Verbrauchs an Material und Energie sichert? Das weiß im Augenblick niemand; einen Masterplan für eine solche Moderne gibt es nicht. Wir brauchen daher Zukunftsbilder, die die Lebensqualität in einer nachhaltigen Moderne vorstellbar machen und mit den Entwürfen einer anderen Mobilität, einer anderen Ernährungskultur, eines anderen Bauens und Wohnens die Veränderung der gegenwärtigen Praxis attraktiv und nicht abschreckend erscheinen lassen.
Deshalb haben wir für die Buchreihe »Entwürfe für eine Welt mit Zukunft« Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebeten, konkrete Utopien künftiger Wirtschafts- und Lebenspraktiken zu skizzieren. Konkrete Utopien, das heißt: Szenarien künftiger Wirklichkeiten, die auf der Basis heute vorliegender technischer und sozialer Möglichkeiten herstellbar sind. Erst vor dem Hintergrund solcher Zukunftsbilder lässt sich abwägen, welche Entwicklungsschritte heute sinnvoll sind, um sich in Richtung einer wünschenswerten Zukunft aufzumachen. Anders gesagt: Ohne Zukunftsbilder lässt sich weder eine gestaltende Politik denken noch die Rolle, die die Zivilgesellschaft für eine solche Politik spielt. Wenn Politik und Zivilgesellschaft wie Kaninchen vor der Schlange ausschließlich auf die Bewahrung eines fragiler werdenden status quo fixiert sind, verlieren sie die Fähigkeit, sich auf ein anderes Ziel zuzubewegen. Sie verbleiben in der schieren Gegenwart, was in einer sich verändernden Welt eine tödliche Haltung ist.
Nach 18 Bänden der ebenfalls im Fischer-Taschenbuch erschienenen Vorgängerreihe, die unter großer öffentlicher Resonanz eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme des naturalen status quo der Erde in den einzelnen Dimensionen von den Ozeanen bis zur Bevölkerungsentwicklung vorgelegt hat, wenden wir nun also den Blick von der Gegenwart in die Zukunft – in der Hoffnung, konkrete Perspektiven für die Gestaltungsmöglichkeiten einer nachhaltigen modernen Gesellschaft aufzuzeigen, Perspektiven, die der Politik wie den Bürgerinnen und Bürgern Mut machen, ihre Handlungsspielräume zu nutzen und Wege zum guten Leben einzuschlagen.
Harald Welzer & Klaus Wiegandt
Vorwort von Harald Welzer
Wenn man dieses Buch gelesen hat, ist man erheblich klüger, als man vor seiner Lektüre war. Gut, mit einer solchen Erwartung macht man sich ans Lesen eines jeglichen Sachbuchs, aber nur selten wird sie so eindrucksvoll erfüllt wie hier. Das liegt weniger an der Fülle »neuester Forschungsergebnisse«, die hier ausgebreitet würden, noch liegt es an mundgerecht aufbereiteten Diagrammen und Bildchen, die scheinbar komplizierte Sachverhalte auch »dem interessierten Laien« verständlich machen. Nein, es liegt daran, dass Marcel Hänggi den Blick auf etwas verändert, was man gut zu kennen meint: nämlich den Fortschritt. Hänggis Fallgeschichten sind weder fortschritts- noch kulturkritisch in einem trivialen Sinn, sie richten sich vielmehr auf das Jagen der Mythen, die mit dem Fortschritt verbunden sind. Die Dampfmaschine stand am Beginn der industriellen Revolution? Gutenbergs Bibel am Anfang der massenweisen Verbreitung von Schrifttum? Das Rad wurde einmal erfunden und dann war es da? Man kann in Hänggis Fallgeschichten aus der Technikgeschichte eine Menge darüber lernen, wie sich bestimmte Techniken ausgebreitet haben und andere vergessen worden sind, und dabei lernt man zugleich, dass Einsatz und Durchsetzung von Techniken weniger mit ihnen, den Techniken selbst, zu tun haben, sondern viel mehr mit der kulturellen Situation, in der sie zum Einsatz kommen oder eben auch nicht. Alle hier versammelten Fallgeschichten sollten Pflichtlektüre für jene Apologeten des »technischen Fortschritts« sein, die die Lösung von Gegenwartsproblemen vom Klimawandel bis zum Artensterben, von wachsender sozialer Ungleichheit bis zur überdrehenden Beschleunigung moderner Lebensverhältnisse davon erwarten, dass »die Ingenieure« schon etwas dagegen erfinden werden. Das Gegenteil ist richtig: viele dieser Probleme gibt es nicht trotz, sondern wegen des Technikeinsatzes, und zwar eines solchen, der sich über die kulturellen Bedingungen und Folgen des Einsatzes keine Rechenschaft abgelegt hat.
»Die neuen Energien des 19. Jahrhunderts – Erdöl, Erdgas und elektrischer Strom aus Wasserkraft – haben die alten Energien nicht abgelöst, sondern die Menschheit verbraucht mehr Brennholz und mehr Kohle denn je, und nie zuvor wurden weltweit so viele kohlegetriebene Dampfmaschinen respektive Dampfturbinen gebaut wie heute. Die Moderne verbraucht mehr Stein als die Steinzeit, mehr Eisen als die Eisenzeit, mehr Kohle als das ›Kohlezeitalter‹. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, die aktuelle Förderung erneuerbarer Energie würde den Verbrauch der nicht erneuerbaren Energien verdrängen, solange diese nicht aktiv zurückgebunden werden.« Warum? Weil alle diese Erfindungen in einer expansiven Kultur eingesetzt werden, und die hat es an sich, dass sie alles, aus dem sich »mehr« machen lässt, auch benutzt. In einer solchen Kultur wird nicht ersetzt, sondern addiert, das Ergebnis können wir an den jährlichen Steigerungsraten von Material- und Energieeinsatz, von Emissionen und Müll ablesen.
Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt ins Spiel, der Hänggis Buch so erhellend macht: Der Begriff des Fortschritts ist eigentlich nur zu gebrauchen, wenn er sich auf einen gesellschaftlichen Wert bezieht – also etwa die Einführung erneuerbarer Energieträger nicht mit »höherer Effizienz« oder »geringeren Emissionen« begründet, sondern damit, dass man in einer Gesellschaft leben möchte, die in ihre Vorstellung vom guten Leben einschließt, dass es nicht auf Kosten von anderen geführt wird. Ein solcher Fortschrittsbegriff hängt also an einer ganz und gar untechnischen Kategorie: nämlich am »guten Leben«, was den demokratischen Streit darüber, was das sein kann, natürlich nicht ausschließt. Er hängt aber eben nicht an der Technik selbst, die ist bloß ein Mittel und niemals Zweck.
Hänggi zeigt aber auch, wie der Fortschrittsbegriff zunehmend abgelöst worden ist durch den Begriff »Innovation«, dem schon genügt, wenn etwas neu ist, gleichgültig, ob es auch »gut« in einem kulturellen Sinn ist. Sein Buch setzt den Fortschrittsbegriff kritisch wieder ins Recht und verteidigt ihn gegen leerlaufende Innovationen und Technikeinsätze, deren Sinn sich eben nicht aus sich selbst heraus begründet. Deshalb schreibt er nach seinen Fallgeschichten die Geschichte des Fortschritts in die Zukunft hinein fort und zeigt eindrucksvoll, dass eine Welt mit Zukunft ohne utopischen Vorgriff weder gedacht noch gemacht werden kann. Anders gesagt: Eine künftige, nachhaltige, reduktive Gesellschaft braucht eine Vorstellung davon, welchen Fortschritt sie braucht. Der Pfadwechsel von der fortschreitenden Naturzerstörung durch marktgesteuerten Technikeinsatz zu einem Stoffwechsel zwischen Menschen und Naturbedingungen, in dem der Einsatz von ökonomischen und technischen Mitteln kulturell bestimmt wird, wird ohne einen Schritt fort vom immer Mehr zum immer Weniger nicht gelingen.
Fortschritt? Eine Einleitung
Der Ruf nach Innovation ist, paradoxerweise, ein beliebter Weg, Veränderungen abzuwehren, wenn sie nicht erwünscht sind. Das Argument, die Wissenschaft und die Technik der Zukunft würden mit dem Klimawandel schon fertig, ist ein Beispiel dafür. (…) Technik war nicht generell eine revolutionäre Kraft; sie war ebenso sehr dafür verantwortlich, dass die Dinge blieben, wie sie waren, wie dafür, sie zu verändern.
David Edgerton[1]
Dieses Buch erzählt Geschichten vom technischen Wandel. »Fortschrittsgeschichten« nenne ich sie, nicht um zu behaupten, jede stelle einen Mosaikstein dar im Bild des großen Fortschreitens der Menschheit. Es sind Geschichten von Fortschritten und Rückschritten, und inwieweit sich diese in der Gesamtbilanz zu »Fortschritt« addieren – oder allenfalls zu »Rückschritt« –, das ist auf den zweiten Blick meist weniger eindeutig, als es auf den ersten scheint. Die Geschichten sind Anlass, darüber nachzudenken, was »Fortschritt« ist oder sein könnte.
Bevor ich aber mit Erzählen beginne, will ich mich Fortschrittsgeschichten zuwenden, die jemand anderes erzählt hat und die mir beim Schreiben dieses Buchs über den Weg gelaufen sind.
Im November 2013 publizierte die US-amerikanische Monatszeitschrift The Atlantic eine Rangliste der »fünfzig wichtigsten Durchbrüche seit dem Rad«.[2] Die Liste beruhte auf einer Umfrage unter vier Expertinnen und acht Experten in den USA – Technik- und Wirtschaftshistoriker, Ökonominnen, Unternehmerinnen, Ingenieure. Jeder »Durchbruch« war mit einer Zeitangabe versehen. Es lohnt sich, etwas bei der Atlantic-Liste zu verweilen.
Die Menschheit sieht sich heute von Problemen herausgefordert, die in ihren Dimensionen neu sind. Zu einem Gutteil hat der Mensch – mit seiner Technik – die Probleme selbst zu verantworten. Die Selbstzerstörung der menschlichen Zivilisation ist technisch möglich. Welche Rolle man der Technik bei der Lösung der Probleme zuschreibt, hängt davon ab, wie man Technik wahrnimmt: welche Geschichten man sich über Technik und technischen »Fortschritt« erzählt. Auf der Suche nach einem guten Umgang mit Technik weisen falsche Vorstellungen davon, wie Technik sich wandelt und was sie dabei bewirkt, in falsche Richtungen.
Mehreren Techniken, die der Atlantic auf seine Liste gesetzt hat, widme auch ich in diesem Buch ein Kapitel. Das hat weniger damit zu tun, dass ich die Wichtigkeit dieser Techniken gleich einschätzen würde wie die Jury des Atlantic. Die Liste enthält einige offensichtliche Absurditäten – jede Liste würde solche enthalten –, so etwa die zufälligen Nachbarschaften: Das Telefon belegt Platz 24, darauf folgt die Schrift; die Anästhesie auf Platz 46 wird gefolgt vom Nagel – als könnte man die Wichtigkeit des Nagels mit der der Anästhesie, die der Schrift mit der des Telefons vergleichen!
»Die fünfzig größten Durchbrüche seit dem Rad« laut The Atlantic vom November 2013.
Die Druckerpresse (1430er Jahre)
Die Elektrizität (19. Jahrhundert)
Das Penicillin (1928)
Die Halbleiter-Elektronik (Mitte 20. Jahrhundert)
Optische Linsen (13. Jahrhundert)
Das Papier (2. Jahrhundert)
Der Verbrennungsmotor (spätes 19. Jahrhundert)
Die Impfung (1796)
Das Internet (1960er Jahre)
Die Dampfmaschine (1712)
Die Stickstofffixierung (Haber-Bosch-Verfahren) (1918)
Die Abwasserkanalisation (Mitte 19. Jahrhundert)
Die Kühltechnik (1850er Jahre)
Das Schießpulver (10. Jahrhundert)
Das Flugzeug (1903)
Der Personal Computer (1970er Jahre)
Der Kompass (12. Jahrhundert)
Das Auto (spätes 19. Jahrhundert)
Die industrielle Stahlproduktion (1850er Jahre)
Die Anti-Baby-Pille (1960)
Die Atomspaltung (1939)
Die »Grüne Revolution« (Mitte 20. Jahrhundert)
Der Sextant (1757)
Das Telefon (1876)
Die Schrift (1. Jahrtausend v. Chr.)
Der Telegraf (1837)
Die mechanische Uhr (15. Jahrhundert)
Der Funk (1906)
Die Fotografie (frühes 19. Jahrhundert)
Der Wendepflug (18. Jahrhundert)
Die archimedische Schraube (3. Jahrhundert v. Chr.)
Die Egreniermaschine (Cotton Gin) (1793)
Die Pasteurisierung (1863)
Der gregorianische Kalender (1582)
Die Ölraffinierung (Mitte 19. Jahrhundert)
Die Dampfturbine (1884)
Der Zement (1. Jahrtausend v. Chr.)
Die wissenschaftliche Pflanzenzucht (1920er Jahre)
Die Ölbohrung (1859)
Das Segelschiff (4. Jahrtausend v. Chr.)
Die Rakete (1926)
Das Papiergeld (11. Jahrhundert)
Der Abakus (3. Jahrtausend v. Chr.)
Die Klimaanlage (1902)
Das Fernsehen (frühes 20. Jahrhundert)
Die Anästhesie (1846)
Der Nagel (2. Jahrtausend v. Chr.)
Der Hebel (3. Jahrtausend v. Chr.)
Das Fließband (1913)
Der Mähdrescher (1930er Jahre)
Die Parallelen zwischen den »Durchbrüchen« auf der Liste und den Techniken, deren Geschichten ich in diesem Buch zu zeichnen versuche, haben damit zu tun, dass ich mich hier für die Wahrnehmung von Technik interessiere. So wenig eine Rangliste dafür taugt, der »tatsächlichen« Bedeutung von Einzeltechniken gerecht zu werden, gibt die Liste des Atlantic doch ein recht gutes Bild davon, wie ein typisches nordamerikanisches oder europäisches Publikum Technik wahrnimmt. Man hätte mit einer anderen Jury aus demselben Kulturkreis wohl ein ähnliches Resultat erhalten.
Die Liste impliziert eine Reihe von Aussagen über Technik:
Technik (sagt die Liste) entwickelt sich in einer Abfolge von »Durchbrüchen«, die sich datieren lassen.
Wichtige Technik ist häufiger komplex und spektakulär (Dampfmaschine, Flugzeug, Internet) als simpel und unscheinbar, und wenn simple Techniken wichtig sind (Papier, Nagel, Hebel), sind sie alt. Das Auto (Platz 18) steht weit oben. Das gleich alte, aber unscheinbarere Fahrrad hingegen fehlt, obwohl es heute weltweit von weit mehr Menschen benutzt wird und in der Verkehrsgeschichte lange Zeit die Vorreiterrolle spielte, also in gewissem Sinne »wichtiger« ist als das Auto. Dass eine Technik wie das Wellblech auf der Liste fehlt, überrascht nicht – aber ist es nicht weit »wichtiger« als etwa die Rakete (Platz 41)? Denn das Wellblech ist ein Paradebeispiel einer »wahrhaft globalen Technik« des 20. Jahrhunderts, wie der Technikhistoriker David Edgerton festgestellt hat – gerade weil es so billig und vielseitig verwendbar ist.[3] Ohne es hätte nicht ein Ort wie Ibadan in Nigeria innerhalb eines Jahrhunderts vom Marktflecken zur Multimillionen-Agglomeration anwachsen können.
Technik, sagt die Liste weiter, ist häufig (und in jüngerer Zeit fast ausschließlich) das Werk von Männern, Ingenieuren und Wissenschaftlern. Die von Ingenieuren erfundene Konservierungstechnik des Kühlschranks findet sich auf der Liste (Platz 13), nicht aber die Konservierungstechniken des Pökelns, Räucherns, Dörrens oder Vergärens von Lebensmitteln. Die von Louis Pasteur erfundene Pasteurisierung, die Milch für einige Tage haltbar macht, steht auf der Liste (Platz 33), nicht aber die traditionellerweise weiblichen Techniken des Buttermachens oder Käsens, deren ökonomische Bedeutung lange Zeit enorm war und die die Inhaltsstoffe der Milch für Wochen bis Jahre haltbar machen.[4] Das vor allem für die Düngerproduktion genutzte Verfahren der Stickstofffixierung, das der Chemiker Fritz Haber und der Ingenieur Carl Bosch erfunden haben, steht auf der Liste (Platz 11), nicht aber die Techniken der Stickstofffixierung durch Fruchtfolgen mit geeigneten Pflanzen, deren Erfinder und Erfinderinnen niemand kennt.
Technik ist westlich: Als Zeitangabe zur Druckerpresse (Platz 1) nennt The Atlantic die 1430er Jahre. Aber in China kannte man sie seit dem 8. Jahrhundert. Die landwirtschaftlichen Techniken auf der Liste sind das Haber-Bosch-Verfahren, die »Grüne Revolution« (Platz 22), der Wendepflug (Platz 30), die wissenschaftliche Pflanzenzucht (Platz 38) und der Mähdrescher (Platz 50): Lauter »westliche« Techniken. Mit der »Grünen Revolution« wird zwar eine Bewegung zur Modernisierung der Landwirtschaft außerhalb der westlich-industrialisierten Welt im 20. Jahrhundert bezeichnet, aber diese »Modernisierung« hatte die Nachahmung »westlicher« Landwirtschaft zum Inhalt. Nähme man eine globale Perspektive ein, verlören die aufgelisteten Techniken viel von ihrer Bedeutung: Die intensivsten Agrarkulturen der Welt befinden sich in Südostasien und Japan, wo Wendepflug und Mähdrescher nutzlos sind, und auf den tropischen, erosionsanfälligen Böden Afrikas hat der Pflug mehr Verheerungen angerichtet als Nutzen gestiftet.[5] (Selbst für Europa könnte man argumentieren, der simple Spaten sei historisch wichtiger gewesen als der so oft ins Zentrum der Agrargeschichte gerückte Pflug: Im vormodernen Europa ernteten Bauern, die ihre Felder umstachen, auf gleicher Fläche mehr als Bauern, die pflügten.[6])
Technik, suggeriert die Liste, ist zielgerichtet und alternativlos: Die Begründung, weshalb der Wendepflug wichtig sei, lautet, dass es ohne ihn »die Landwirtschaft nicht gäbe, wie wir sie in Nordeuropa oder im amerikanischen Mittleren Westen kennen«. In der Tat: Ohne Wendepflug gäbe es dort eine andere Landwirtschaft. Aber diese andere Landwirtschaft (oder diese anderen Landwirtschaften) würde dann vermutlich als genauso wichtig betrachtet. Das Argument sagt nichts anderes, als dass die Welt so ist, wie sie ist, weil sie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
Schließlich: Technik verändert Gesellschaft und Kultur. Das ist gewiss richtig, aber in der Logik der Rangliste verläuft die Wirkung immer in diese Richtung und nie umgekehrt. Die Anti-Baby-Pille habe »eine soziale Revolution ausgelöst«, begründet The Atlantic deren Platz (20) auf der Liste – als hätten die Menschen zuvor nicht gewusst, wie sich Schwangerschaften verhüten lassen. Die Einführung der Anti-Baby-Pille ging tatsächlich mit einem anderen Umgang mit Sex einher, was zu sozialen Umwälzungen beitrug – aber neu war vor allem, dass die Pille die Verhütung zur Sache der Medizin machte und sie so vom Schmuddel-Image befreite, das dem Präservativ anhaftete. Das war ein in erster Linie kultureller und kein technischer Wandel, und wäre die Pille nicht in eine Zeit sozialen Aufbruchs gefallen, stünde sie heute wohl nicht auf der Liste.
Die populäre Wahrnehmung von Technik, wie die Atlantic-Rangliste sie widerspiegelt, ist die Geschichte vom Fortschritt. Sie lässt sich in großen Linien erzählen: vom Höhlenbewohner, der das Feuer beherrschen und Geräte herstellen lernt, über den Bauern, der Pflanzen und Tiere domestiziert, später die Metallbearbeitung erlernt, um Ackergeräte und Waffen herzustellen, mit denen er Land urbar macht und Reiche aufbaut, weiter zum modernen Menschen, der die Wissenschaft entdeckt und das mythische Denken überwindet, die Welt verstehen und dadurch noch besser beherrschen lernt.
Diese Fortschrittsgeschichte hält einer kritischen Betrachtung nicht stand, und davon handelt dieses Buch.
Aber was ist das: Fortschritt?
Die Idee, die Menschheit schreite fort in eine bessere Zukunft, kommt in Europa im 16. Jahrhundert auf und wird zunächst vor allem wissenschaftlich-technisch verstanden. Der Begriff »progrès« entsteht im Frankreich des 18. Jahrhunderts, woraus in Deutschland ab etwa 1800 der »Fortschritt« wird. Er ist verbunden mit dem Liberalismus (und mit dem später aus dem Liberalismus entstehenden Sozialismus), der die Ordnung der Welt nicht wie der Konservatismus für gott- oder naturgegeben, sondern für veränderbar hält. Aber schon im frühen 19. Jahrhundert wird »Fortschritt« zu einem Schlagwort, ideologisch vereinnahmt von verschiedensten Seiten.[7]
Der Begriff taugt nicht mehr viel. Und kann man noch von »Fortschritt« sprechen, nachdem seit der Terrorherrschaft der Jakobiner 1793/94 so viele Verbrechen in seinem Namen verübt wurden? Ist die Menschheitsgeschichte überhaupt eine Fortschrittsgeschichte, das heißt: Geht es den Menschen von heute besser als einst?
Ohne Zweifel gab es Fortschritte. Wenn für eine bis dahin unheilbare Krankheit eine Therapie gefunden wird, ist das ein medizinischer Fortschritt. Wenn man sich das Ziel setzt, seine Feinde effizient extralegal hinrichten zu können, ist auch die Drohne ein Fortschritt. In den letzten 200 Jahren hat der materielle Wohlstand immens zugenommen, die Lebenserwartung ist gestiegen, und das waren Fortschritte, auch wenn der Wohlstand äußerst ungleich verteilt ist, auch wenn nicht so einfach klar ist, dass ein längeres Leben auch ein besseres ist. Aber summieren sich diese Fortschritte zum »Fortschritt« im Singular? Wie sähe eine Bilanz aus, berücksichtigte man auch die Kosten der vielen Fortschritte? Um die Frage zu beantworten, müsste man allzu vieles miteinander verrechnen, was sich nicht verrechnen lässt. Aber es könnte sein, dass sich die Frage nach dem Fortschritt in Zukunft negativ entscheidet: Wenn die menschliche Zivilisation ihre eigenen Grundlagen zerstört. Bei allen Vorbehalten gegenüber dem Fortschrittsbegriff: Wir kommen gar nicht umhin, Fortschritt anzustreben im Sinne einer Entwicklung, die das verhindert.
Die Selbstzerstörung der menschlichen Zivilisation ist von einer bloß denkbaren zu einer wahrscheinlichen Option geworden. Das gab den Ansporn zu diesem Buch. Eine solche Selbstzerstörung wäre technisch insofern, als Techniken den Menschen befähigt haben, die Zusammensetzung der Atmosphäre zu verändern, Meere zu übersäuern, Böden zu zerstören. Mit Technik hat der Mensch das Anthropozän hervorgebracht.[8] Aber das kann nicht Anlass sein, Technik abzulehnen: Denn die durch Technik bedrohte Zivilisation ist selber eine in jeder Hinsicht technische. Der Mensch ist Mensch, seit und indem er Werkzeuge benutzt. Es gibt keine Kultur ohne Technik.
Die drohende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen muss Anlass sein, nach einem zukunftsverträglichen Umgang mit Technik und Techniken zu suchen. Ein solcher Umgang wird nicht aus einem Set von Techniken bestehen, die, einmal für gut befunden, für immer die richtigen sind. Er wird aus Regeln und Prozessen bestehen, wie Gesellschaften, die sich verändern, die Frage nach der richtigen Technik immer wieder neu stellen können, und die Regeln und Prozesse selber werden sich verändern. Dafür braucht es eine realistische und kritische Wahrnehmung von Technik jenseits von Technikeuphorie und Technikfeindschaft. Dieses Buch will dazu beitragen.
So prekär der Begriff des »Fortschritts« ist, so unbeschwert ist im Allgemeinen in der medialen Öffentlichkeit, in Technikmagazinen und – vor allem – in Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften von ihm und verwandten Begriffen die Rede. Wobei der zurzeit beliebteste Begriff aus dem Umfeld des »Fortschritts« nicht dieser selbst ist, sondern die »Innovation«. Ministerien für Forschung und Technik sind in Ministerien für Forschung und Innovation umbenannt worden.[9] Nichts, was die Werbung nicht als »innovativ« priese – vom Küchengerät bis zur Partnervermittlung. Alles soll »innovativer« werden – vom Arbeitslosen bis zur Kunst. »Innovation« ist ein Fetisch geworden. Dabei gab es das Wort im Deutschen bis um 1960 gar nicht. Es ist eine Übernahme aus dem Englischen, das das Wort schon lange kennt, wo die »innovation« seit ungefähr 1960 aber ebenfalls einen steilen Aufstieg erlebt. Seit etwa 1970 verdrängt die »Innovation« den »Fortschritt« allmählich.[10]
Die bemerkenswerte Karriere der »Innovation« liegt in Entwicklungen der ökonomischen Theorie begründet – sowie in Konkurrenzängsten, die mit diesen Entwicklungen einhergingen. Innovation war treibender Faktor wirtschaftlicher Entwicklung im Werk Joseph Schumpeters (1883 bis 1950), vor allem in seinem 1939 (deutsch: 1963) erschienenen Buch über die Konjunkturzyklen.[11] Als Außenseiter der Wirtschaftswissenschaften war Schumpeter aber nicht allzu einflussreich.
Abb. 1 Häufigkeit der Wörter »innovativ« und »fortschrittlich« in den deutschsprachigen Beständen von Google Books, 1950 bis 2008.
Umso einflussreicher war dafür ein Aufsatz, mit dem der US-amerikanische Ökonom Robert Solow 1956 die sogenannte neoklassische Wachstumstheorie begründete, wofür er 1987 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt.[12] Solow erklärt Innovation – respektive »technical change«, wie er sie nannte[13] – zum Motor des Wirtschaftswachstums. Hatte Schumpeter noch von »wirtschaftlicher Entwicklung« gesprochen und vor allem qualitative Veränderungen im Auge gehabt, geht es in der neoklassischen Wachstumstheorie nur mehr um eine – quantitative – Zunahme des Wirtschaftsprodukts.
Solow publizierte seine Theorie, die eigentlich eher eine Hypothese ist, zum richtigen Zeitpunkt. Ein Jahr später schickte die Sowjetunion den Satelliten Sputnik ins Weltall und versetzte die kapitalistische Welt in Schock: War die sozialistische Sowjetunion dem kapitalistischen Westen am Ende überlegen? »Innovation« lautete die Antwort auf den »Sputnikschock«: Wollte der Westen im Wettbewerb der Systeme nicht unterliegen, musste er innovativer werden. Vor allem die Organisation für ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) griff den Gedanken auf und trug viel zu seiner Popularisierung bei;[14] dazu kamen als weiterer Verstärker die neuen Managementlehren.[15]
Die neoklassische Wachstumstheorie schloss eine Erklärungslücke. Die Neoklassik als dominierende Schule der Wirtschaftswissenschaften beschreibt die Wirtschaft nämlich als Gleichgewichtszustand. Sie hat Mühe, theoretisch zu fassen, warum die Wirtschaft wächst: Eine Wirtschaft im Gleichgewicht dürfte eigentlich nicht wachsen respektive nur so schnell, wie die Bevölkerung zunimmt. Solow sagte nun: Es gibt einen Motor des Wachstums, und der heißt technischer Wandel.[16]
So wirkungsmächtig die Erklärung war, steht sie doch auf tönernen Füßen: Solow fügte der statischen neoklassischen Produktionsfunktion (der mathematischen Formel, die wirtschaftliche Produktion abhängig von den Inputfaktoren beschreibt)[17] einfach eine zeitabhängige Variable hinzu, von der er selber sagte, sie sei lediglich »ein Kürzel für irgendeine Art von Veränderung in der Produktionsfunktion«.[18] Philip Mirowski, ein Historiker der Wirtschaftswissenschaften, schreibt lakonisch, man »könnte versucht sein, diese Variable ›Schummelfaktor‹ zu nennen, aber Solow entschied sich, sie ›technischen Wandel‹ zu nennen.«[19] Für den Ökonomen und Theoriehistoriker Hans Christoph Binswanger hat Solow das Wachstum »in Wirklichkeit gar nicht erklärt, sondern nur postuliert«.[20] Der empirische Beleg für die Behauptung, Innovation lasse die Wirtschaft wachsen, steht bis heute aus.
Wenn eine so schwache Erklärung so viel Anklang findet, muss sie einem Bedürfnis entsprochen haben. Solows These erklärt, wie unbegrenztes Wachstum in einer begrenzten Welt möglich sein kann – etwas, was die Klassiker der Ökonomie im 18. und 19. Jahrhundert für unmöglich hielten. Ist nämlich die »Innovation« Motor des Wirtschaftswachstums (und nicht etwa die Ausbeutung von Boden, Rohstoffen und Energie), so kann die Wirtschaft immer weiter wachsen. Denn während natürliche Ressourcen endlich sind, hört die menschliche Erfindungsgabe, die der Innovation zugrunde liegt, nie auf. Im Zusammenhang mit den sich verschärfenden Umweltproblemen ist Solows These besonders attraktiv, denn die menschliche Erfindungskraft braucht sich nicht nur nicht auf: Sie stinkt auch nicht, strahlt nicht, ist nicht giftig und trägt nicht zum Treibhauseffekt bei. Die Probleme lösen, indem man innovativ ist: So lautet die tröstende Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart, und es stellt sich eigentlich nur die Frage, ob der technische Fortschritt schnell genug sei, um mit den wachsenden Problemen der Menschheit mitzuhalten. Wenn die Neoklassik denn recht hat.
Wer meint, sie habe recht, argumentiert gerne mit der Dampfmaschine: Dieses Produkt menschlicher Erfindungskraft habe den ungeheuren Wirtschaftsaufschwung seit der industriellen Revolution ermöglicht. Nun war die Dampfmaschine ohne Zweifel »innovativ«. Aber sie diente für lange Zeit einem einzigen Zweck, nämlich der Entwässerung von Kohlegruben, wodurch sie die Ausbeutung von Kohlevorkommen ermöglichte, die ohne sie nicht hätten ausgebeutet werden können. Wenn die Dampfmaschine eine enorm folgenreiche technische Neuerung war, so nicht, weil sie die Industrialisierung ausgelöst hätte, wie oft behauptet wird – das tat sie nicht –, sondern weil sie das Zeitalter der fossilen Energien einläutete (vgl. Kapitel Dampf). Die Innovation konnte ihre Bedeutung nur deshalb entfalten, weil eine natürliche Ressource, die Kohle, in großen Mengen vorhanden war.
Soweit technische Neuerungen die industrielle Revolution ermöglichten, war nicht die Dampfmaschine besonders wichtig, sondern es waren die weniger spektakulären (und häufiger von Frauen bedienten) Maschinen der Textilproduktion: die Spinning Jenny, der Jacqard-Webstuhl oder die Egreniermaschine (Cotton Gin), die Baumwollfasern von den Samen trennt. Aber auch diese Maschinen konnten nur Wirkung entfalten, wenn immer mehr Rohstoff, nämlich Baumwolle, verfügbar war. Deren Produktion war ausgesprochen lukrativ – aber innovativ war sie nicht. Sie beruhte auf der uralten Technik der Ausbeutung von Menschen – Sklavinnen und Sklaven – durch Menschen, und eine ihrer wichtigsten Techniken war die Peitsche.
Wer nur von Innovation spricht, übersieht Kohle wie Peitsche.
Wenn die »Innovation« den »Fortschritt« allmählich verdrängt, so könnte man das begrüßen als eine Versachlichung, denn während der »Fortschritt« das ganze Pathos der Gesellschaftsverbesserungansprüche der Aufklärung mitschleppt, bedeutet »Innovation« einfach »Erneuerung«. Doch wenn die »Innovation« zum Fetisch gemacht wird, ist diese Sinnreduktion ein Problem.
Der »Fortschritt« kennt im »Rückschritt« einen Gegenbegriff: Der Fortschrittsbegriff denkt mit, dass Wandel auch in die falsche Richtung zielen kann. Zur »Innovation« gibt es höchstens den Gegenbegriff der »Stagnation«, aber Stagnation ist nicht Wandel in eine falsche Richtung, sondern sein bloßes Fehlen. Allenfalls könnte man in der »Veraltung« einen Gegenbegriff der »Innovation« sehen. Doch genau besehen ist sie ihre Voraussetzung: Was gestern neu war, muss morgen veraltet sein, damit heute Innovation geschieht.[21]
»Innovation« interessiert sich nicht dafür, wie das Neue, einmal eingeführt, verwendet wird.[22] Neue Techniken müssen aber angenommen (oder abgelehnt) und der Umgang mit ihnen muss erlernt werden. Dieses Lernen – auf der gesellschaftlichen wie der individuellen Ebene – hat wenig mit Innovation und viel mit Übung, Routine und dem Erarbeiten und Aushandeln von Regeln zu tun. Innovation wird durch Wettbewerb motiviert: Man will besser sein als die Konkurrenz. Technik braucht aber, wie der Soziologe des Handwerks Richard Sennett betont, sowohl Wettbewerb wie Kooperation. Damit Kooperation klappt, braucht es Rituale der Kommunikation und verlässliche Abläufe. Moderne Managementtheorien und die gegenwärtige Arbeitsethik-Rhetorik zeichnen das Ideal des innovativen Mitarbeiters, aber wenn alle stets innovativ sein und alles neu erfinden wollten, wäre Kooperation unmöglich.[23]
»Innovation« ist ein ahistorisches Konzept: Vorher gab es die Sache nicht, seither schon. Da interessiert die Vergangenheit nur noch als die dunkle Folie, vor der sich die Gegenwart umso heller abhebt: Die Zeit vor dem Buchdruck erscheint dann als Zeit ohne intellektuellen Austausch, die vor dem Auto als eine ohne individuelle Mobilität, die vor der »Pille« als eine ohne sexuelle Selbstbestimmung. Oder die Vergangenheit wird teleologisch gelesen, also so, dass das Neue als die notwendige Antwort auf die Vergangenheit erscheint. Wenn aber technischer Wandel weder Geschichte noch Alternative kennt, entzieht er sich der Kritik.
»Innovation« kann man einfordern, ohne über Inhalte sprechen zu müssen. Wenn die EU jeweils die »innovativste« Nation Europas kürt, tut sie das anhand von Indikatoren wie der Zahl der Patente und der Hochschulabgänger oder der Höhe der Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Ob die Patente relevant sind oder die Forschung sinnvolle Resultate ergibt, spielt keine Rolle. Der Sinn solcher »Innovation« ist vor allem einer: Wirtschaftswachstum. »80 Milliarden für Forschung und Innovation, um Wachstum und Jobs zu fördern«: Mit diesem Slogan kündigte die Europäische Kommission ihr Forschungs-Rahmenprogramm 8 (2014 bis 2020) an.[24]
Von »Innovation« zu reden, scheint vom ideologischen Ballast des »Fortschritts« zu befreien und verlangt keine Anmaßung eines Urteils, ob das Neue nun gut oder schlecht sei. Aber für den Fetisch Innovation ist einfach alles, was neu ist, gut. »Innovation« ist inhaltsleer, aber nicht ideologiefrei, denn es gibt auch eine Ideologie der Inhaltsleere: den Neoliberalismus – eine extreme, aber mächtige Sekte der neoklassischen Schule der Ökonomie.
Ihr Übervater Friedrich August von Hayek stellte die Unvorhersagbarkeit gesellschaftlicher Entwicklungen ins Zentrum seines Denkens. Der Versuch, die Zukunft vorauszuwissen – und vorauszuplanen – war ihm eine »Anmaßung von Wissen«.[25] Hayeks Skepsis ist gut begründet. Aber wenn sie dazu führt, jede politische Debatte darüber, was wünschbar sei und was nicht, abzulehnen und einzig den Markt als Instanz der Entscheidungsfindung zu akzeptieren, dann verkehrt sich der Liberalismus in sein Gegenteil, dann landet man bei Margaret Thatchers »Es gibt keine Alternative«. Dann wird, während der Neoliberalismus (zu Recht) die Offenheit und Unvorhersagbarkeit der Zukunft betont, die Gegenwart zum zwangsläufigen Resultat der Vergangenheit. Dann wird der Ruf nach Innovation zum Mittel, gesellschaftliche Veränderung abzuwehren.
»Die Wissenschaft entdeckt, das Genie erfindet, die Industrie wendet an, und der Mensch passt sich den neuen Dingen an oder wird von ihnen geformt«, lautete das Motto der Chicagoer Weltausstellung »Century of Progress« von 1933/34. Der Satz gibt einem Modell Ausdruck, das älter ist als die neoklassische Wachstumstheorie, ihr aber zugrunde liegt: Fortschritt entsteht als Abfolge von wissenschaftlicher Erkenntnis, die Innovationen auslöst, welche schließlich die Gesellschaft weiterbringen. Reduziert man dann noch die Gesellschaft auf ihr Wirtschaftsprodukt, führt das Modell zu Solows Wachstumstheorie.[26]
Die Technikgeschichten, die ich in diesem Buch erzähle, widersprechen diesem linearen Fortschrittsmodell. Technische Anwendungen können der wissenschaftlichen Entwicklung vorausgehen und gesellschaftliche Entwicklungen der technischen Innovation. Innovation kann sich auf nichtwissenschaftliche Erkenntnisformen stützen. Die Abfolge von »Alt« und »Neu« kann sich zwischen verschiedenen Kulturen unterscheiden. Neue Techniken können eine Gesellschaft ärmer statt reicher machen. Das Alte existiert häufiger neben dem Neuen weiter, als dass es von diesem verdrängt würde, und nicht selten steigert sich mit dem Neuen der Bedarf nach dem Alten noch (weshalb ich den Glauben, man werde fossile Energieträger und Atomenergie los, wenn man nur genug Windräder und Solaranlagen aufstelle, nicht teilen kann). Und »Innovation« kann heißen, Vergessenes wieder zu aktivieren. Es wäre schwierig, Beispiele zu finden, die das lineare Modell bestätigten.
Die Chicagoer Formulierung des linearen Fortschrittsmodells ist merkwürdig paradox: Als »Genie« ist der Mensch aktiv und erfindet die »neuen Dinge«, als »Mensch« passt er sich ihnen passiv an oder wird »von ihnen geformt«. Diese Kombination der beiden Pole – »der Mensch beherrscht die Technik«, »die Technik beherrscht den Menschen« – findet man in techno-optimistischen Positionen häufig. Denn letztlich läuft beides auf eine Disqualifikation jeder Kritik an Technik hinaus. Wenn nämlich der Mensch die Technik beherrscht, gibt es keinen Grund, sich vor ihr zu fürchten: Wir haben alles im Griff! Und wenn die Technik den Menschen beherrscht, dann hat es keinen Sinn, gegen Technik zu sein: Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten! Technikkritik ist dann Donquichotterie.
Aber keine der beiden Positionen ist richtig, oder beide sind es halb. Menschen – Individuen wie Gesellschaften – können entscheiden, welche Techniken sie wie nutzen, und sie können auch Techniken wieder aufgeben, die sie als schädlich erkannt haben. Verschiedene Kulturen haben auf dieselben Herausforderungen unterschiedliche Antworten gefunden und gleiche Dinge unterschiedlich genutzt. Die Freiheit ist jedoch nicht unbegrenzt: Ein Hammer zwingt seinen Besitzer bis zu einem gewissen Grad, ein Problem als Nagel wahrzunehmen. Man könnte das Verhältnis zwischen Mensch und Technik als ein wechselseitiges beschreiben, aber man kann mit dem Technikphilosophen Bruno Latour auch feststellen, dass es zwischen »Mensch« und »Technik« keine scharfe Grenze gibt.[27] Der Mensch ist immer Mischwesen zwischen Natur und Kultur. Ein guter Tennisspieler verschmilzt mit seinem Schläger zu einer Einheit, der Schläger wird Teil seines Körpers – andernfalls könnte er gar nicht Tennis spielen. Wenn jemand ein Gewehr im Anschlag hält, in einem Auto sitzt, telefoniert: Immer verändert die Technik die Reichweite seines Handelns, sein Verhalten sowie seine Wahrnehmung der Umwelt und seiner selbst.
Keine Technik kannten Adam und Eva im Paradies oder die Menschen (Männer) im griechischen Mythos vor der Ankunft der Pandora. Sie brauchten keine: Die Feldfrüchte wuchsen ohne Landwirtschaft, Krankheiten gab es nicht. Erst als sie aus dem Paradies verstoßen wurden respektive als Zeus sie mit den Gaben der Pandora bestrafte, mussten sie zu arbeiten beginnen, und dazu brauchten sie Hilfsmittel. Denn anders als die Tiere waren sie für das Leben auf der Welt unzureichend gerüstet.
Der Mythos zeichnet ein ambivalentes Bild von der Technik. Erst als Technik notwendig wird, und mit ihrer Hilfe wird der Mensch zum Menschen und vom Tier unterschieden. Doch mit dieser Menschwerdung verbunden ist der Verlust des Paradieses. Die Schlange, die Eva in Versuchung brachte, und den Gott Prometheus, der den Menschen das göttliche Feuer schenkte, strafen die Götter gnadenlos: Die Schlange muss fortan im Staube kriechen, Prometheus wird an den Fels geschmiedet, und beide können gegen ihr Los nichts tun. Dagegen haben die Menschen die Technik, um Scham, Mühsal, Hunger, Krankheit und Schmerzen zu lindern, mit denen die Götter sie geschlagen haben. Insofern ist Technik gut – aber ideal war die Welt, als es keine Technik brauchte. Diese Ambivalenz hat die Technik auch in der realen Welt: Das Auto, das Telefon oder der Computer haben die Handlungsoptionen der Menschen erweitert – sie haben aber auch die Welt hervorgebracht, in der ein Leben ohne Auto, Telefon und Computer oft nur noch schwer möglich ist.
Die Technik ist im Mythos noch in einer zweiten Hinsicht ambivalent. »Ihr werdet sein wie Gott«, versprach die Schlange, »wissend, was gut und böse ist.« Wenn auch die Schlange zu viel versprochen hatte, wurden die Menschen mit der Fähigkeit zur Erkenntnis doch gottähnlich, und die Griechen erhielten mit der Fähigkeit, Feuer zu machen, eine göttliche Fähigkeit. Die Menschen sind gottähnlich geworden, und es lockt die Versuchung, sich gottgleich zu machen: Technik tendiert zur Hybris. Dass die Menschen ihre körperlichen Grenzen technisch überwinden, dulden die Götter – bis zu einem gewissen Grad. Dädalus darf mit seinem Sohn Ikarus fliegen, und die Babylonier dürfen einen Turm bauen, aber wenn sie zu hoch hinaus wollen, werden sie bestraft.
Die zentralen Attribute der Götter sind die Erschaffung von Leben und die Unsterblichkeit; höchste Hybris ist es, diese Attribute anzustreben. Es ist eine Versuchung, die sich durch die Kulturgeschichte der Menschheit zieht, aber immer kommt es schlecht heraus: Die von Menschen erschaffenen Homunculi werden Monster, und Ahasver, der nicht sterben kann, ist eine tragische Figur. Doch die Versuchung lockt, und es gibt heute Menschen, die ernsthaft an der Erschaffung künstlichen Lebens forschen, wie solche, die an der Abschaffung des Todes arbeiten.
Aber während der Tod seiner Abschaffung widersteht, ist eine noch größere Hybris machbar geworden. Ob es Menschen gibt oder nicht, lag einst allein in der Macht der Götter. Indem der Mensch seine Selbstvernichtung im 20. Jahrhundert technisch möglich gemacht hat, hat er sich gewissermaßen ganz emanzipiert. Es ist diese Emanzipation, die Max Frisch nach dem Atomwaffentest auf dem Bikini-Atoll am 30. Juni 1946 von der »grundsätzlichen Freude, die dieses Ereignis auslöst«, schreiben lässt:
Der Fortschritt, der nach Bikini führte, wird auch den letzten Schritt noch machen: die Sintflut wird herstellbar. Das ist das Großartige. Wir können, was wir wollen, und es fragt sich nur noch, was wir wollen; am Ende unseres Fortschrittes stehen wir da, wo Adam und Eva gestanden haben; es bleibt uns nur noch die sittliche Frage. Vielleicht dürfte man nicht von Freude reden; es tönt nach Zuversicht oder Hohn, und eigentlich ist es keines von beidem, was man beim Anblick dieser Bilder erlebt; es ist das erfrischende Wachsein eines Wandrers, der sich plötzlich an einer klaren und deutlichen Wegkreuzung sieht, das Bewußtsein, daß wir uns entscheiden müssen, das Gefühl, daß wir noch einmal die Wahl haben und vielleicht zum letztenmal; ein Gefühl von Würde; es liegt auch an uns, ob es eine Menschheit gibt oder nicht.[28]
Das lineare Technikmodell und der Fetisch »Innovation« vernichten Ambivalenz. Fürsprecher einer bestimmten Technik stilisieren sich in der Auseinandersetzung mit ihren Gegnern häufig zu Fürsprechern der Technik schlechthin – und ihre Gegner damit zu Technikfeinden. Aber zu streiten, ob Technik an sich gut oder schlecht sei, bringt nichts. Gegen Technik sein ist sinnlos, aber genauso unsinnig ist es, generell »für Technik« zu sein. Niemand ist das, und oft sind gerade die selbsternannten Technikfreunde besonders eifrige Gegner anderer Techniken, die sie als rückständig empfinden: Schulmedizinanhänger gegen alternative Heilmethoden, Anhänger der »Grünen Revolution« gegen den Biolandbau. Und auch wenn es nicht explizit geschieht, ist jeder Entscheid für eine bestimmte Technik immer auch ein Entscheid gegen Alternativen.
Eine Haltung scheint sich als Ausweg aus dem Entweder-Oder anzubieten: Technik ist weder gut noch schlecht und es kommt nur darauf an, was man aus ihr macht. Schließlich kann man ein Messer brauchen, um jemanden zu erstechen oder um eine Mahlzeit zuzubereiten. Doch der Rückzug auf diese Position bewirkt dasselbe wie die Innovationsideologie: Auch sie entzieht einzelne Techniken der Kritik. Die Waffenlobby in den USA argumentiert so, wenn sie sagt, es seien nicht Waffen, die töten, sondern Menschen; die Autolobby verwendete das analoge Argument zu Zeiten, da es noch nicht als Tribut an die Moderne akzeptiert war, dass Autos Menschen töten (vgl. Kapitel Tempo).
Aber Technik ist nicht neutral. Gewiss kann man mit Dingen Unterschiedliches anstellen, aber die Atombombe kann man nicht menschenfreundlich einsetzen und auch die Guillotine nicht, die doch dazu entwickelt wurde, Hinrichtungen zu humanisieren. Man kann mit einem Auto andere Menschen überfahren oder Verletzte ins Krankenhaus bringen, aber das System Auto mit allem, was dazu gehört – von der Erdölgewinnung über den Straßenbau und das Automobilmarketing bis zu den übermotorisierten Geräten selber –, wird nie menschenfreundlich sein. Technik ist nicht einfach gut. Technik ist nicht einfach schlecht. Technik ist aber auch nicht neutral. Sondern Technik besteht aus einer Vielzahl von Techniken. Manche schaffen, andere zerstören. Manche machen frei, andere schaffen Zwänge. Manche helfen, Verhältnisse zu verändern, manche sorgen dafür, dass sie bleiben, wie sie sind. Und viele tun beides zugleich.
Ich habe für dieses Buch Beispiele technischen Wandels ausgesucht, deren Geschichte ich in ihrem gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhang untersuchen will. Vier Kapitel haben Transporttechniken zum Inhalt (»Rad«, »Überschall«, »Alternativen« und »Tempo«), je zwei befassen sich mit Landwirtschaftstechniken (»Klee«, »Erfahrung«), Medizinaltechniken (»Schwefeläther«, »Versprechen«) respektive Informations- und Kommunikationstechniken (»Buch«, »Spiel«) und je eines mit Energie- (»Dampf«) respektive Haushaltstechniken (»Wäsche«). Die Kapitel von Teil I (»Dinge«) stellen jeweils eine Technik ins Zentrum; die Kapitel von Teil II (»Treiber«) gehen von Mechanismen und Motoren des technischen Wandels aus. Innerhalb der beiden Teile ordne ich die Kapitel nach ihrem Titel alphabetisch, um keine Systematik zu suggerieren, die es nicht gibt. Im Epilog schließlich wage ich einen utopischen Ausblick auf eine Gesellschaft, die verantwortungsvoll mit Technik umgeht.
Ich habe die Beispiele weder nach ihrer »Wichtigkeit« ausgesucht noch versucht, eine repräsentative Auswahl zu treffen. Wichtige Bereiche wie Berg-, Erd- und Wasserbau, Materialtechnik, Messtechnik, Nahrungsverarbeitung und -konservierung, Architektur, Kriegstechnik, Management, Verwaltungs- und Herrschaftstechnik oder Unterhaltung fehlen. Weil ich eher eine Art Technik wahrzunehmen als die Techniken selber kritisieren will, habe ich viele Beispiele ausgewählt, die als besonders wichtig gelten – auch wenn ich sie für überschätzt halte. Deshalb spiegelt die Auswahl ein Stück weit die Einseitigkeit der populären Technikwahrnehmung wider, wie die Atlantic-Rangliste sie zeigt. Dass außereuropäische Techniken zu kurz kommen, liegt aber vor allem an meinen begrenzten Kenntnissen.