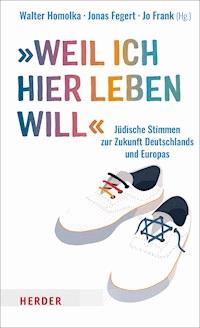
"Weil ich hier leben will ..." E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gibt es im 21. Jahrhundert so etwas wie ein "deutsches Judentum"? Wie sinnvoll ist das Reden von einer jüdischen Renaissance, wenn sich Jüdinnen und Juden heute ganz neu und in Abgrenzung zu alten Bildern und Vorstellungen definieren? Was bedeutet es für Deutschland, wenn sich Jüdinnen und Juden mit anderen religiösen, ethnischen und kulturellen Minderheiten solidarisieren und sich nicht gegen sie ausspielen lassen möchten? Und wie ist dem neu erwachenden Antisemitismus zu begegnen? Junge Jüdinnen und Juden in Deutschland schreiben an gegen altbewährte Klischees und Voreingenommenheiten. Und sie zeigen wie anders und lebendig jüdisches Leben heute ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Publikation wurde durch die Unterstützung der Leo Baeck Foundation ermöglicht.
Redaktionelle Mitarbeit: Annett Peschel
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
e-Book-Konvertierung: post scriptum, Vogtsburg-Burkheim
ISBN Print 978-3-451-38287-1
ISBN E-Book 978-3-451-81448-8
Inhalt
Vorwort
Rabbiner Prof. Walter Homolka, Jo Frank, Jonas Fegert
Hinführung: Zwischen Vielfalt und Vielfaltsverteidigung – Ein Gespräch zwischen Senator Dr. Klaus Lederer und Rabbiner Prof. Walter Homolka
Ukraine, Russland, USA, Israel – und was ist eigentlich Deutschland?
Wie ich in einen Bus stieg und Jüdin wurde
Olga Osadtschy
»Berliner Juden« – ein Zwiegespräch
Cecilia und Yair Haendler
Fernweh ist mein Lieblingswort im Deutschen
Meytal Rozental
Zwischen Assimilation und Desintegration
Keine Juden mehr für Deutsche?
Max Czollek
Jecke sein oder nicht sein?
Yan Wissmann
Einigkeit um jeden Preis? Ein Plädoyer für mehr Machloket
Hannah Peaceman
Neue Allianzen auf dem Weg in die Zukunft
Macht es euch nicht zu einfach! – Über die regulierende Macht sozialer Labels
Tobias Herzberg
War da was? – Altes Erinnern, neues Judentum
Erziehung über das Judentum oder zum Judentum? Perspektiven jüdischer Bildung
Sandra Anusiewicz-Baer
Von unserer Aufgabe, die Hand auszustrecken – Jüdische Bildungsarbeit heute
Greta Zelener
Zwischen Berghain und Club Odessa – Aktuelle Generationsfragen einer Gemeinschaft
Patchwork-Judentum
Igor Mitchnik
Modern-Orthodox, Masorti, Liberal, Reform, Säkular – Aufbruch zu gelebtem Pluralismus?
Neue religiöse jüdische Vielfalt
Benjamin Fischer
Combined into one frame – Ein Studienwerk als Bild einer Gemeinschaft
Prof. Dr. Frederek Musall
»Echte Juden« und die deutsche Bildungslandschaft
Carmen Reichert
Über die Autor*innen
Über die Herausgeber
Vorwort
Rabbiner Prof. Walter Homolka, Jo Frank, Jonas Fegert
»Weil ich hier leben will …« Jüdische Stimmen zur Zukunft Deutschlands und Europas erscheint in einer Phase der Umbrüche: Die politische Lage in der Bundesrepublik und vielen Teilen Europas ist noch komplexer und unübersichtlicher geworden. Im Zuge des Niedergangs der Sowjetunion, der Europäisierungs- und Migrationsprozesse hat sich seit Ende der 1980er-Jahre nicht nur die Bedeutung der Nationalstaaten, sondern auch das Selbstbild der Bundesrepublik gewandelt. Von diesen Entwicklungen ebenfalls berührt, durchlief die jüdische Gemeinschaft in Deutschland in den vergangenen dreißig Jahren einen grundlegenden Wandel: Zu einer kleinen Gruppe sogenannter »Alteingesessener« gesellten sich zwei »neue« Gruppen. Aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion kamen in den 1990er-Jahren über 212 000 Jüdinnen und Juden als sogenannte »Kontingentflüchtlinge« nach Deutschland. So wuchs die jüdische Gemeinschaft binnen kürzester Zeit in Deutschland auf ein Zehnfaches an. Nicht nur aufgrund der Quantität dieses Migrationsprozesses veränderte die postsowjetisch-jüdische Einwanderung die jüdische Gemeinschaft nachhaltig. Mit dieser Einwanderung kam ein breites Spektrum jüdischer Geschichten, die alle Ebenen des jüdischen Lebens tangieren sollten und die die Gemeinschaft bis heute prägen. Diese »neue« Gruppe von Jüdinnen und Juden, die heute die Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland bildet, brachte kulturell, politisch und religiös eine neue Vielfalt nach Deutschland. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist es zu einer weiteren Migrationsbewegung gekommen, zum Zuzug von Israelis nach Deutschland, vornehmlich nach Berlin. Galt Deutschland nach dem nationalsozialistischen Massenmord lange Zeit weltweit als ein »Unort« für jüdisches Leben, machten sich in den zurückliegenden dreißig Jahren erstmals nach der Schoah Jüdinnen und Juden bewusst auf den Weg, um in diesem Land Fuß zu fassen. Viele derer, die in dieser Zeit in die Bundesrepublik kamen, hatten in der ehemaligen Sowjetunion ihre jüdische Identität nicht ausleben können – wo die ethnische Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft im sowjetischen Pass mit dem Eintrag »Jewrej« markiert war und Juden unter Stigmatisierung und Verfolgung litten. Erst in Deutschland, welche Ironie der Geschichte, gab es für viele Jüdinnen und Juden die Möglichkeit, jüdische Identitäten kennenzulernen und zu leben. Der hiermit einhergehende positive Bezug zu Deutschland und den Möglichkeiten, die dieses Land den Einwanderer*innen versprach, steht im Kontrast zu dem Narrativ der Überlebenden, ihrer Kinder und Enkel. Während die postsowjetische Einwanderung vielen Jüdinnen und Juden das Leben in Deutschland ermöglichte, für die die Schoah kein wesentlicher biografischer Bezugspunkt war, war die Schoah für viele der »Alteingesessenen« nichts Abstraktes, sondern ein wesentlicher Teil ihrer Identität – sei es durch die Erinnerung an ermordete Verwandte oder die Alltagsfragen, was der Lehrer oder die Erzieherin, die Nachbarin oder der Bäcker im Nationalsozialismus getan hatten. Die Vernichtung des europäischen Judentums hatte viele Dimensionen, die in die Bunderepublik fortwirkten – auch durch die Identitätskonstruktionen der deutschen Nachkriegsgesellschaft, für die Jüdinnen und Juden in erster Linie durch das Prisma der Schoah betrachtet wurden.
In diesem Band schreiben Enkelinnen und Enkel von Überlebenden wie Opfern der Schoah sowie nach Deutschland in den 1990er-Jahren eingewanderte Jüdinnen und Juden. Sie kommen zusammen im Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, dem Begabtenförderwerk der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland.
Das 2008 gegründete und nach dem deutsch-jüdischen Religionsphilosophen Ernst Ludwig Ehrlich sel. A. (1921–2007) benannte Begabtenförderungswerk schuf – erstmalig in Europa nach der Schoah – einen Ort für eine neue jüdische Intellektualität; einen Ort jüdischen Lebens, der von Beginn an verschiedene jüdische religiöse und kulturelle Lebensentwürfe begleitet und fördert. In den ersten zehn Jahren seines Bestehens hat das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk über 650 Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen unterstützen können. Vergegenwärtigt man sich, was die persönliche Betreuung, der inhaltliche Austausch und die finanzielle Unterstützung für eine einzelne Person bedeuten kann, so sind 650 Stipendiat*innen eine eindrucksvolle Anzahl. Die Gruppe ist dabei nicht repräsentativ für das jüdische Gemeindeleben in Deutschland: Schon ihre Jugendlichkeit unterscheidet sie von den überalterten Gemeindestrukturen. Auch der akademische Anspruch und die religiöse Diversität sind Alleinstellungsmerkmale. Diese Exklusivität macht das Studienwerk zu einem Impulsgeber für ein modernes Judentum in Deutschland: Im Rahmen des Studienwerks können Positionen von ungeheurer Aktualität für die jüdische Gemeinschaft und die Gesamtgesellschaft entwickelt, diskutiert und veröffentlicht werden. Die Stipendiat*innen haben sich (Frei-)Räume erarbeitet, in denen sie – jenseits vorgefestigter Ansprüche und Vorstellungen – Themen setzen und neue Konzepte für deren Umsetzung entwickeln können. In Projekten wie DAGESH, der Künstler*innenförderung des Studienwerks, und unserem erfolgreichen Programm Dialogperspektiven. Religionen und Weltanschauungen im Gespräch können sie auf eine Infrastruktur zurückgreifen, die sie dabei unterstützt, ihre Positionen in die Gesellschaft zu tragen. Die Stipendiat*innen und Ehemaligen des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks bilden damit nicht nur als Autor*innen des vorliegenden Sammelbandes, sondern auch als aktiv Gestaltende des jüdischen Lebens in Gemeinden und Institutionen die Pluralität der jüdischen Gemeinschaft und der in ihr vertretenen Positionen und Lebensentwürfe ab.
Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk selbst steht auf seine Weise für die dynamische Veränderung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und ihrer Institutionen. In den letzten dreißig Jahren sind nämlich wesentliche Institutionen jüdischer Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik entstanden und gewachsen, die die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland und Europa widerspiegeln. Ob es die erste Ausbildungsstätte für Rabbinerinnen und Rabbiner seit der Schoah – das Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam –, das Kompetenzzentrum der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die Europäische Janusz Korczak Akademie oder eben das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk ist: die jüdische Zivilgesellschaft ist heute so vielfältig und so stark wie nie.
»Weil ich hier leben will …« Jüdische Stimmen zur Zukunft Deutschlands und Europas erscheint zum zehnjährigen Bestehen des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks und wird zum Jüdischen Zukunftskongress im November 2018 in Berlin vorgestellt. Bei dem Buch handelt es sich um weitaus mehr als eine spannende Momentaufnahme. Der Band bildet die Positionen ab, die sich in den vergangenen zehn Jahren durch die Arbeit und im Umfeld des Studienwerks entwickelt haben. Die Autor*innen schreiben gegen altbewährte Klischees und Voreingenommenheiten an. Dies hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung vieler Themen, die sowohl die jüdische Gemeinschaft als auch die deutsche Gesamtgesellschaft im Kern betreffen: Gibt es im 21. Jahrhundert so etwas wie ein »deutsches Judentum«? Kann das Reden von einer jüdischen Renaissance sinnvoll sein, wenn sich Jüdinnen und Juden heute ganz neu und in Abgrenzung zu alten Bildern und Vorstellungen definieren? Was bedeutet es für Deutschland, wenn sich Jüdinnen und Juden mit anderen religiösen, ethnischen und kulturellen Minderheiten solidarisieren? Wie begegnet diese neue jüdische Gemeinschaft dem Rechtsruck in Europa? Wie reflektiert sie Migration und Flucht aus jüdischer Perspektive? Und auf das Studienwerk bezogen: Was könnten zehn Jahre nach der Gründung Zukunftsperspektiven für sein Arbeiten sein?
Hierbei sind die Auslassungspunkte im Titel entscheidend, denn die Autor*innen haben eigene Vorstellungen und Wünsche, in welche Richtung sich jüdisches Leben und die Gesellschaft in Deutschland und Europa entwickeln soll. Die Autor*innen stellen auf ganz unterschiedliche Weise die Frage, ob und wie es sich in Deutschland und Europa in Anbetracht dramatischer demografischer, sozialer und politischer Verschiebungen als Jüdinnen und Juden leben lässt. Die Aushandlungsprozesse, die die heutigen jüdischen Gemeinschaften prägen, sind dabei nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes relevant: Sie werfen die Frage auf, wie mit der neuen Vielfalt umzugehen ist, und zeigen, wie unterschiedliche Narrative über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander stehen und anerkannt werden können. Dabei entscheidend ist der Gestaltungswille der Autor*innen: Sie wollen dieses Land, Europa und die jüdische Gemeinschaft gestalten.
Als Herausgeber sprechen wir mit dem Wegbereiter des Jüdischen Zukunftskongresses, Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin Klaus Lederer. Im Gespräch mit Rabbiner Walter Homolka, »Zwischen Vielfalt und Vielfaltsverteidigung«, erklärt Senator Klaus Lederer die Motive für seinen Einsatz für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und für ein Leben der Vielfalt in Berlin.
Im ersten Beitrag knüpft Olga Osadtschy durch eine persönliche Standortbestimmung an die geschilderte Ausgangslage an und führt zugleich in die Thematik ein. Dabei erörtert sie, wo sich neben »Ukraine, Russland, USA, Israel« das »Land der Gartenzwerge« einsortiert, und zeigt am eigenen Beispiel, wie sich eine jüdische Identität zwischen den verschiedenen nationalen Zuschreibungen herausbilden kann.
Carmen Reichert geht in ihrem Beitrag explizit auf ihre Erfahrungen im Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk ein. Sie beschreibt, wie sie als nichtjüdische Stipendiatin die Institution erlebte und weshalb sie begann, sich für das Studienwerk und die jüdische Gemeinschaft zu engagieren. Dabei thematisiert sie auch Vorurteile über Jüdinnen und Juden und unterschiedliche Formen des Antisemitismus, auch in Form von Philosemitismus.
Yair Haendler und Cecilia Haendler reflektieren ihr Leben in Deutschland im Kontext ihres Lebens zwischen Frankreich, Israel, Italien und Deutschland. Als modern-orthodoxes Ehepaar beschreiben sie ihren Lebensweg und fragen nach internationalen Perspektiven jüdischen Lebens in Deutschland und Europa.
Igor Mitchnik verweist in »Patchwork-Judentum« nicht nur auf Fragen, die Jüdinnen und Juden hierzulande betreffen, sondern diskutiert auch – politisch höchst aktuell –, inwiefern die Bundesrepublik Migrant*innen einen Platz in der Gesellschaft gewährt.
Auch Greta Zelener zeichnet in »Von unserer Aufgabe, die Hand auszustrecken« ihre eigene Migrationsgeschichte nach und geht auf Herausforderungen für das jüdische Leben in Deutschland ein. Sie legt dar, wie jüdische Bildungsorganisationen im Sinne eines neuen Miteinanders auf Antisemitismus reagieren können.
In »Modern Orthodox, Masorti, Liberal, Reform, Säkular – Aufbruch zu gelebtem Pluralismus« präzisiert Benjamin Fischer, was sich hinter der in den vergangenen Jahren entstandenen religiösen jüdischen Vielfalt in Deutschland verbirgt. Er stellt die Frage, was gelebter Pluralismus bedeuten und ob von einem »deutsch-jüdischen Pluralismus« überhaupt die Rede sein kann.
Sandra Anusiewicz-Baer knüpft mit ihrem Beitrag »Perspektiven der jüdischen Bildungsarbeit: Jüdische (Schul-)Bildung und Identitätskonstruktionen« an ihre mit dem Humboldt-Preis ausgezeichnete Forschung zum Thema an. Die von ihr aufgezeigten Perspektiven regen zum Nachdenken darüber an, wie jüdische Traditionen in der Bildungsarbeit bewahrt werden können.
Meytal Rozental schreibt in ihrem Beitrag vielleicht den kennzeichnenden Satz zu Erinnerung und Erinnerungskultur für das gegenwärtige Israel: »Meine Großeltern haben ungern über ihre Vergangenheit gesprochen, und meine Eltern haben nicht nachgefragt.« Mit dieser Feststellung beginnt Meytal Rozental, ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Familie nachzuzeichnen, bis sie bei sich und in der Gegenwart vieler Israelis in Deutschland ankommt. Zu dieser Gegenwart gehört die Frage der Repräsentanz unbedingt dazu: Sind alle Juden Repräsentant*innen Israels? Sind Israelis überhaupt Repräsentant*innen Israels? Meytal Rozental bezieht Stellung für ein anderes Bewusstsein und auch ein anderes Israel, von dem ihre Großetern träumten. Es ist ein wichtiger Beitrag für dieses Buch, der auch stellvertretend für die Spannung zwischen unbedingtem Bekenntnis zu Israel und dem unbedingten Gestaltungswillen Israels gelesen werden kann.
Tobias Herzberg problematisiert in »Macht es euch nicht zu einfach!« die Verwendung sozialer Kategorisierung. Er umreißt die politischen Herausforderungen unserer Zeit und macht sich als Antwort auf »Pegida, Donald Trump und AfD« für eine strategische Identitätspolitik stark, bei der sich Minderheiten miteinander solidarisieren und füreinander eintreten.
»Keine Juden mehr für Deutsche?«, fragt Max Czollek provokant. Dabei überprüft er das Begehren nichtjüdischer Deutscher nach Ritualen der Erinnerung und bestimmter »zahmer« Formen jüdischen Lebens. Zugleich zeigt er mit dem Konzept der »Desintegration« Jüdinnen und Juden einen alternativen Weg auf, mit diesen Erwartungen umzugehen.
So provokant sich Max Czolleks Beitrag in den Augen mancher lesen wird, so provokant ist sicherlich auch Yan Wissmans Beitrag: Anhand seiner Biografie macht er den Leser*innen nachvollziehbar, warum er sich für ein Leben in Deutschland entschied, was an Deutschland aus seiner Sicht besonders zu schätzen ist, und fordert Jüdinnen und Juden auf, sich stärker für die deutsche Gesellschaft zu engagieren – als deutsche Juden.
Auf den Streit zwischen zwei großen jüdischen Gelehrten, Hillel und Shammai, greift Hannah Peaceman in ihrem Plädoyer für mehr inner-jüdischen Dissens zurück. Dies wird besonders anschaulich, wenn die Praktik der jüdischen Auseinandersetzung, Machloket, auf die politische Kultur Deutschlands übertragen wird. Hier wird die Frage gestellt: Was kann die Gesamtgesellschaft von jüdischen Traditionen lernen?
Frederek Musall, Beiratsmitglied des ELES, reflektiert die Arbeit des Studienwerks, ordnet sie in einen Gesamtkontext ein und skizziert seine Visionen und Wünsche für die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft und von ELES. Dies geschieht in »Combined into One Frame. Ein Studienwerk als Bild einer Gemeinschaft« aus seiner Position des inhaltlichen Impulsgebers heraus.
Die Generation der Autorinnen und Autoren in dieser Sammlung steht heute für ein neues jüdisches Selbstbewusstsein und für neue Selbstbehauptung. Es wird deutlich, dass sich die Autor*innen einbringen möchten. Es wird gegen altbewährte Klischees und Voreingenommenheiten angeschrieben. Der Band fasst die Entwicklungen der letzten dreißig Jahre zusammen und weist hinaus auf die Zukunft einer Gemeinschaft, die sich in einem Prozess der Identitätsfindung neu definiert. Es entsteht das Bild eines lebendigen, vielfältigen jungen Judentums in Deutschland, das immer stärker Räume für sich innerhalb der Gesamtgesellschaft einfordert.
Pluralität ist eine der neuen Werte einer sich verändernden deutschen und europäischen Gesellschaft. Diese Pluralität ist dem Judentum seit jeher inhärent. Und in Anbetracht gesellschaftlicher Diskurse, in denen die Herausforderung der Pluralität immer an erster Stelle genannt wird, zeigt dieser Band für alle Leser*innen: Juden und Jüdinnen haben der Gesellschaft viel zu geben an Erfahrungen mit Pluralität. Dass zu dieser ein intensiver Streit gehört, das ist so selbstverständlich wie das Ziel, dass das Streiten zu einem Gelingen einer gemeinsamen Lebenswelt beitragen muss, soll der Streit fruchtbar und somit sinnvoll sein. Das Machloket, für das Hannah Peaceman in ihrem Beitrag plädiert, ist ein wesentliches Merkmal einer jüngeren Generation an Jüdinnen und Juden, die streiten, auch streitbar sein möchten. Aber alle Autor*innen dieses Bandes vereint der Wunsch, unsere gemeinsame deutsche und europäische Lebenswelt mitzugestalten, sie für alle lebenswerter zu machen.
Zehn Jahre nach der Gründung des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks bewahrheitet sich der Satz, der unser Arbeiten prägt: »Eine Geschichte mit Zukunft«. »Weil ich hier leben will …«, so könnte man diesen Satz nach dem Lesen der Beiträge vervollständigen, »gestalte ich die Zukunft mit«. Und von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen sich die Herausgeber, dass Sie bei der Gestaltung der Zukunft mitwirken – in der Gegenwart.
Zuletzt möchten die Herausgeber einen herzlichen Dank an den Herder-Verlag, zuvorderst vor allem an Dr. German Neundorfer, für die Zusammenarbeit richten, sowie an Annett Peschel für die redaktionelle Mitarbeit. Der Leo Baeck Foundation gebührt ein besonderer Dank für die Unterstützung dieser Publikation.
Berlin, im August 2018 Die Herausgeber
Hinführung: Zwischen Vielfalt und Vielfaltsverteidigung – Ein Gespräch zwischen Senator Dr. Klaus Lederer und Rabbiner Prof. Walter Homolka
Das Buch »Weil ich hier leben will …« Jüdische Stimmen zur Zukunft Europas vereint Beiträge einer Generation junger Jüdinnen und Juden im Alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren. Sie schildern ihre Vorstellungen für das jüdische Leben in Gegenwart und vor allem Zukunft. Worin unterscheidet sich diese Generation von anderen Generationen Jüdinnen und Juden in Deutschland?
Rabbiner Homolka: Unterscheidet sie sich? Das ist die Frage. Ich glaube, jede Generation hat eine besondere Herausforderung. Ich erinnere mich an das Buch von Peter Sichrovsky, Wir wissen nicht, was morgen wird, wir wissen wohl, was gestern war. Junge Juden in Deutschland und Österreich, das vor dem Fall der Mauer Aufsehen erregte. Die Fragen, die man sich damals stellte, waren: Warum bleibe ich in Deutschland, kann ich eine positive Perspektive für mein Leben hier gewinnen? Die Eltern und Großeltern der Jüdinnen und Juden, die im Band befragt wurden, waren teilweise in Deutschland »gestrandet«, hatten den Absprung verpasst, wollten auswandern, sind dann aber doch in Deutschland geblieben. Sie haben Familien gegründet, Karrieren verfolgt und ein »normales« Leben gelebt. Mit dem Fall der Mauer kamen alle möglichen Anreize zu denken, dass sich im »neuen Deutschland« etwas bewegt, und trotzdem gab es immer auch die Auseinandersetzung mit der Realität eines mehr oder weniger latenten Antisemitismus, der jüdisches Leben infrage stellte.
Was uns so bedrückt, ist, dass wir gedacht haben, es wäre eine grundlegend neue Sachlage eingetreten: dass Deutschland sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, dass es eine Erinnerungskultur entwickelt, dass ein Jüdisch-Sein in Deutschland fast normal erscheint. Ich kann mich noch entsinnen, wie es immer hieß: »Es ist jetzt endlich normalisiert«, und ehe man sich versieht, kommt dann doch wieder die Erinnerung: So normal ist das eben alles nicht. Insofern ist es spannend, jetzt wieder zu fragen, was diese jungen Menschen, diese jungen Jüdinnen und Juden, hier in Deutschland hält – und unter welchen Bedingungen sie eine Perspektive für sich sehen. Das ist ja immerhin eine Generation, der die Welt offensteht.
Die Autorinnen und Autoren nehmen in ihren Beiträgen auch eine Standortbestimmung vor und beschreiben, welche jüdischen Migrationsgruppen mit welchen unterschiedlichen Kulturen und religiösen Praxen in Deutschland aufeinandertreffen. Senator Lederer, ist die Vielfalt der Jüdinnen und Juden, die in Berlin leben, auch eine Herausforderung?
Senator Lederer: Für die Stadtgesellschaft ist sie ein riesengroßes Geschenk! Berlin ist die Stadt, in der der Holocaust geplant und ins Werk gesetzt worden ist. Wir haben durch die Tatsache, dass Antisemitismus als Staatsideologie zur Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung des jüdischen Lebens in dieser Stadt geführt hat, einen unfassbaren Schatz an kulturellen Wurzeln verloren. Ich hänge keiner Illusion an, dass man die Zeit oder die Uhr zurückdrehen kann, aber allein die Tatsache, dass angeknüpft wird an abgeschnittene Geschichtsfäden, an Traditionsfäden dieser Stadtgesellschaft, dass versucht wird, jüdisches Leben in Berlin in Vielfalt und Buntheit neu zu etablieren, ist ein großer Gewinn.
Als 1989/90 die Mauer von der Oppositionsbewegung der DDR und von der Bevölkerung eingerissen wurde, habe ich jüdisches Leben wahrgenommen als das, was sich in den 1980er-Jahren zwischen SED-Führung einerseits und den verbliebenen jüdischen DDR-Bürgern andererseits entwickelt hat: Dass beispielsweise die Synagoge in der Oranienburger Straße wiederaufgebaut werden konnte, dass das Centrum Judaicum etabliert wurde, hatte natürlich auch etwas mit dem Streben der DDR nach internationaler Anerkennung zu tun, und das war 1989/90 vorbei. Auch in Ost-Berlin existierte eine jüdische Community, die ich allerdings als sehr säkularisiert in Erinnerung habe, soweit ich als junger Mensch das wahrnehmen konnte. Viele von ihnen verstanden ihre Geschichte mindestens auch als eine genuin antifaschistische. In den 1980er-Jahren hatte eine jüngere Generation der Ostberliner Gemeinde in der Gruppe »Wir für uns – Juden für Juden« mit der Suche nach der eigenen Identität begonnen. Nach 1990 entwickelte sich der Jüdische Kulturverein dann auch zum Anlaufpunkt für Jüdinnen und Juden aus Osteuropa. Sehr etabliert in der wiedervereinigten Stadt war die »alteingesessene« Jüdische Gemeinde Westberlins mit einer Verankerung und Einbindung ins Leben der Stadt.
Dann aber passierte etwas Unfassbares: Diese Stadt, die bestimmt, zehn, fünfzehn Jahre überhaupt damit gehadert hatte, was sie eigentlich sei – Hauptstadt, Kulturstadt, Ost-West-Drehscheibe, Olympiastandort –, begann nach der Jahrtausendwende, ein pulsierendes Leben zu führen, das eine große Anziehungskraft ausübte. Berlin hatte nicht nur einen großen Teil der bundesweit nahezu Viertelmillion sogenannter Kontingentflüchtlinge, also Jüdinnen und Juden aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion, aufgenommen. Jetzt wurde es auch für viele Jüdinnen und Juden aus Israel ein Anziehungspunkt. Beide Gruppen haben Berlin ganz bewusst als den Ort gewählt, an dem sie leben wollen. Insofern ist die heutige Vielfalt jüdischen Lebens ein Glücksfall und belebt die Stadt auf eine Art und Weise, von der man eigentlich nur träumen konnte angesichts der Geschichte unserer Stadt und der Geschichte unseres Landes. Eine völlig andere Frage ist, vor welche erinnerungskulturellen Herausforderungen uns das stellt.
Homolka: Ich glaube, der Senator hat etwas herausgestellt, was wirklich zu der Herausforderung hinzukommt: Diese unheimlichen Erwartungen, die die zugewanderten Jüdinnen und Juden an Deutschland hatten. Für sie war die Ankunft hier sozusagen die Ankunft im Gelobten Land, in dem man sich etablieren wollte. Da trat auch für einen Moment die Geschichte Deutschlands und der Schoah in den Hintergrund. Auch, weil die deutsche Politik sagte: »Wir haben die Vergangenheit bearbeitet – jetzt kommen sogar jüdische Menschen zu uns, die hier ihre Zukunft verbringen wollen!« Schaut man auf die vielen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, muss festgestellt werden, dass an der Vergangenheit zwar gearbeitet wird, von bearbeitet kann aber nicht die Rede sein. Hinzu kommt, dass die Generationen vor 1989, die hier aufgewachsen sind und die auch teilweise Verfolgte des NS-Regimes waren, eine ganz und gar andere Perspektive auf das Leben in Deutschland und auf ihr Leben als Jüdinnen und Juden in Deutschland hatten. Das macht dieses Buch aber auch so unwahrscheinlich wichtig: Wir hören hier Stimmen aus einer großen Vielfalt der jüdischen Gemeinschaft: von postsowjetischen und postmigrantischen Stimmen, von israelischen, deutschen – und dies verbindet sie – jüdischen Stimmen der Gegenwart.
Die Arbeit des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks zeigt, wie stark junge Jüdinnen und Juden in den letzten Jahren mit Identitätsfragen beschäftigt waren. In den vorliegenden Beiträgen lässt sich der unbedingte Wille zur Mitgestaltung feststellen: Es werden Vorschläge unterbreitet, wie jüdische Positionen in die Gesellschaft wirken können. Senator Lederer, wo könnte das Land Erfahrungen und Kompetenzen jüdischer Menschen brauchen?
Lederer: Grundsätzlich unterscheide ich nicht zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen hierzulande, wenn es um Kompetenzen geht und um die Art und Weise, sich einzubringen. Vielmehr erhebe ich den Anspruch, dass alle gleichermaßen, gleich welcher Herkunft, welcher Ethnie, welchen Glaubens, die Chance haben, sich an unserer Gesellschaft zu beteiligen und sich in ihr zu entfalten. Die Vielfalt unserer Gesellschaft ist eben eine Chance, weil aus ihr etwas Neues erwächst. Eine Vielfalt, die natürlich voraussetzt, dass diejenigen, die sich einbringen wollen, dies aus einem Standpunkt heraus tun, den sie für sich selbst gefunden haben.
Wenn wir uns als Stadt Berlin heute unserer Weltoffenheit, unserer Freiheit rühmen, wird das oft als Stadtmarketing abgetan, ohne dabei zu beachten, dass Berlin – und nicht Gesamtdeutschland – in gewisser Weise auch deswegen ein Hotspot der Vielfalt ist, weil Menschen, die es woanders nicht aushalten, sich nach Berlin bewegen. Ich kann das aus der Perspektive von queeren Menschen sagen, die zum Teil vom Land regelrecht geflohen sind, um in der Stadt das Leben leben zu können, das sie leben möchten. Insofern ist die Frage, und das ist auch der Lackmustest: Wie stabil sind eigentlich diese Vielfalt und diese Freiheit, derer wir uns so rühmen? Es gab ein Momentum in der deutschen Geschichte, in dem schien der Umgang mit der Vergangenheit geklärt zu sein, da schien das Erinnerungsnarrativ eindeutig zu sein, da war die Frage des Bekenntnisses zum jüdischen Leben in Deutschland genauso wie das Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israels unangefochten. In den 1980er-Jahren hatte man einen relativ klaren Kanon erinnerungskultureller Bekenntnisse, und man hatte vermutlich – aber das vermögen andere besser einzuschätzen – auch ein weitgehend einheitliches Erinnerungsnarrativ der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Heute blicken wir auf eine Einwanderungs- und Migrationsgesellschaft, in der schon die Vielfalt der Narrative innerhalb der jüdischen Gemeinschaft viel größer und bunter geworden ist, weil jemand in dritter oder vierter Generation als jüdischer Mensch aus Osteuropa Geschichte vielleicht ganz anders vermittelt und erzählt bekommen hat als das Kind und Kindeskind der alteingesessenen Hiesigen oder derjenigen, die nach Palästina ausgewandert oder vor den Nazis geflüchtet sind. Und auch hierzulande hat man eben nicht mehr nur die homogene deutsche Mehrheitsgesellschaft mit einem Erinnerungskanon, sondern auch die zweite und dritte Generation der Eingewanderten aus der Türkei, aus osteuropäischen oder aus arabischen Ländern, die wiederum ganz andere Narrative mitbringen. In dieser Vielfalt bewegen wir uns, und sie stellt die Erinnerungskultur noch einmal vor ganz neue Herausforderungen, und genauso stellt sie die Vielfaltsverteidigung vor neue Herausforderungen.
Homolka: Wir haben als jüdische Gemeinschaft lange in einer Art geistig-intellektuellem Ghetto gewohnt. Der Drang, politisch, gesamtgesellschaftlich engagiert zu sein, war gar nicht so ausgeprägt. Da ging es vornehmlich um die Frage, ob man hierbleibt. Doch eigentlich waren die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge das Problem der Deutschen, nicht das Problem der jüdischen Gemeinschaft. Jetzt haben wir es geschafft, dass erstmals junge Jüdinnen und Juden sagen: Ja, das ist auch meine Gesellschaft und ich möchte sie gestalten! Ich möchte in Deutschland leben, aber dieses Deutschland möchte ich auch mitgestalten. Das ist ein Riesenschritt nach vorne, auch weil es ein gewisses Zutrauen in diese Gesellschaft dokumentiert, und wenn wir diese jungen Menschen jetzt enttäuschen, dann erleiden wir wirklich einen großen Verlust. Deswegen kämpfe ich dafür, dass wir möglichst viele bei der Stange halten und sagen, dass es sinnvoll ist, sich hier zu engagieren! Wir können etwas verändern, und nicht nur für uns als Jüdinnen und Juden!
Das Einzige, was wie eine schwarze Wolke über den jungen Leuten schwebt sind der Antisemitismus und die Ressentiments, die sich kaum verbinden lassen mit der Erfahrung dieses weltoffenen Berlins.
Die AfD erreichte bei der Bundestagswahl 2018 einen Stimmanteil von 12,6 Prozent und zwei Jahre zuvor bei den Berliner Abgeordnetenhauswahlen 14,6 Prozent. Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus scheinen salonfähig geworden zu sein. Braucht es neue Allianzen oder Solidaritäten, wie sie unter anderem Max Czollek und Prof. Frederek Musall in ihrem Beitrag fordern, um sich dieser Entwicklung entgegenzustellen?
Lederer:





























